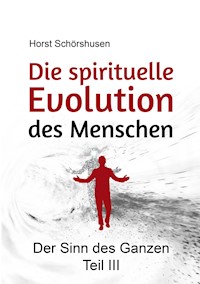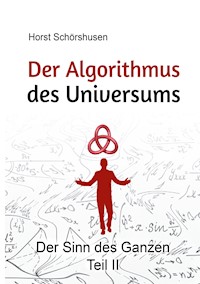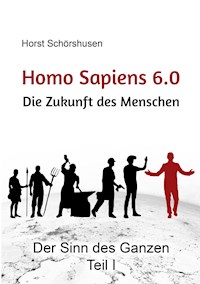
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Der Sinn des Ganzen
- Sprache: Deutsch
Der moderne Mensch erschien vor etwa 60.000 Jahren auf dieser Erde und hat eine erstaunliche kulturelle Evolution hinter sich gebracht. Heute befindet sich der Homo sapiens auf seiner fünften Stufe: Der Digitalisierung und Globalisierung. Die aufeinander aufbauenden Epochen der Jagdgemeinschaften, der Landwirtschaft, des Handwerks und der Industrie haben dies möglich gemacht. Wie wird die Zukunft des Menschen auf der 6.Stufe aussehen? Horst Schörshusen hat alle wichtigen Fakten für eine mögliche Antwort zusammengetragen und bewertet. Vor dem Hintergrund der neusten Erkenntnisse der Quantenphysik und der Psychologie sieht er die Zukunft des Menschen in der Wiederentdeckung seines spirituellen Wesens und der stärkeren Nutzung seiner Intuition. In diesem ersten Teil seiner Trilogie zum Sinn des Ganzen behandelt er die neuen Zukunftsängste und das Wesen des Homo sapiens. Dabei geht er detailliert auf die Fragen der Evolution, den freien Willen, dem Hang zur Grenzüberschreitung, den Unterschied zu den Tieren und dem Verhältnis von Verstand und Intuition ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor
Horst Schörshusen
Diplom-Politologe und Politiker, war lange Jahre in Leitungsfunktionen in der niedersächsischen Landesverwaltung tätig. Hat Politikwissenschaften, Soziologie und Volkswirtschaftslehre in Hamburg studiert. Wohnt in Hannover, ist verheiratet und hat drei Kinder.
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit wissenschaftlichen und spirituellen Themen. Hat bereits zwei Bücher zum Thema „Sinn des Ganzen“ geschrieben und eine eigene Philosophie dazu entwickelt. Jetzt hat er dazu seine Trilogie veröffentlicht.
Für
Marco, Rabea,
Lara und Christine
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Komplexität unserer Welt
Grundfragen des Lebens
Die neuen Zukunftsängste
Globalisierung und Digitalisierung
Versagen der Politik vor der Komplexität
Die Irrationalität des Menschen
Unsere begrenzte Wahrnehmung
Das Wesen des Menschen
Der unklare Ursprung der Menschheit
Lebensziele
Die Suche nach Glück
Der Wille zum Sinn
Lebensmotive
Zufall oder Schicksal?
Träume: Eigenartig wirkliche Unwirklichkeit
Außenreize und Innenimpulse
Selbstverwirklichung
Die Stabilität unserer Persönlichkeit
Der Freie Wille
Evolution und DNS-Code
Die Grenzen der Evolutionstheorie
Der genetische Code
Viren – Der Ursprung des Lebens
Das menschliche Gen-Programm
Die dunkle Seite der Gene
Die mysteriöse Epigenetik
Das Wesen des Homo Sapiens
Tiere und Pflanzen
Unterschiede zum Menschen
Kommunikation – typisch menschlich?
Besondere Tiere und Pflanzen
Die Schwarmintelligenz
Das Geheimnis der Intuition
Psychologisches Modell vom Unterbewusstsein
Wahrnehmung höhere Dimensionen
Die Zukunft des Menschen
Algorithmen mit zufälligen Abweichungen
Das Leben in einem Rollenspiel
Verwendete Literatur
Quellenverzeichnis
Einleitung
Die Komplexität unserer Welt
Als Homo sapiens gehören wir nach der Taxonomie des schwedischen Forschers Carl von Linné (1707-1778) zur Gattung Homo und der Familie der Menschenaffen. Übersetzt nennen wir uns den „Weisen“ und „Verstehenden“. Entsprechend den alten religiösen Überlieferungen nehmen wir eine Sonderstellung in der Natur ein, da wir einen Geist, eine Seele und einen freien Willen besitzen. Das Gefühl, dass wir etwas Besonderes sind, hat uns seit unserem plötzlichen Auftauchen vor erst 60.000 Jahren nicht verlassen.
Unsere soziokulturelle Evolution, die wir selbst vorangebracht haben, hat dazu geführt, dass wir unsere zunehmend komplexere Welt mit unserem Verstand immer weniger begreifen. Durch Übernutzung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten haben wir diesen an den Rand einer ökologischen Katastrophe manövriert. Auch unsere Gesellschaftssysteme sind aufgrund der komplexen Wechselbeziehungen faktisch unregierbar geworden. Die Zukunft des Menschen ist nicht nur ungewiss (das war sie schon immer), sondern stark gefährdet.
Vor diesem Hintergrund gibt es eine Gewissheit: Wir werden uns ändern und unser gegenwärtiges Weltbild und unser Handeln überprüfen müssen. Dabei müssen wir vorurteilsfrei Dogmen, Regeln und Werte analysieren, die uns bis heute begleitet haben. Wir werden auch unser Bild von uns Selbst auf den Prüfstand stellen, um zu erfahren, was in uns zu dieser existenziellen Krise geführt hat und welche ungenutzten Potenziale wir besitzen, die uns aus dieser Situation heraushelfen könnten.
Nach meiner Meinung stehen wir vor der 6. Stufe der Menschheitsentwicklung. Deshalb spreche ich vom Homo sapiens 6.0. Bisher haben wir in einem sich beschleunigenden Tempo 5 Stufen der kulturellen Evolution erobert. Entsprechend haben sich die Aktionsmöglichkeiten verändert, obwohl unsere Gene praktisch auf dem alten Stand geblieben sind.
Folgende fünf Epochen sollten wir unterscheiden:
Jäger und Sammler
Agrarische Gemeinschaften
Handwerk und Handel
Industrialisierung
Globalisierung und Digitalisierung
Was kommt wahrscheinlich danach? Was könnte den Homo sapiens 6.0 auszeichnen? Ich bin mir sicher, dass wir einige technologische Sprünge vor uns haben, die sich jetzt schon abzeichnen. Durch die Datenverarbeitung mit Hilfe Künstlicher Intelligenzen (KI) wird die Robotik, Sensorik und autonome Systeme viele menschliche Tätigkeiten ersetzen. Die Biotechnologie wird die Ernährung und die Medizin stark verändern. Nahrungsmittel werden dann möglicherweise häufiger in Bioreaktoren erzeugt und wir werden einige Krankheiten wie beispielsweise Krebs heilen können. Quantenphysik und Supraleiter führen vielleicht zu neuen Energietechniken und gravitativen Antriebssystemen. Wir werden dann auch Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems erkunden können. Unser ökonomisches System wird diese Entwicklung fast automatisch voranbringen, weil dahinter profitable Eigeninteressen wirken.
Wir Menschen könnten dann als Ganzes noch weiter abgehängt werden, wenn unsere politischen Systeme nicht den zukünftig wirksamen Rahmen setzen. Das betrifft zum Beispiel die auf Fairness aufzubauenden internationalen Handelsbeziehungen, damit wir keine Völkerwanderungen auslösen, die wir nicht bewältigen könnten. Wir brauchen auch global wirkende Regeln, wie Erneuerbare Energien durch Besteuerung fossiler Energien gefördert werden können. Wir müssen international durchsetzen, dass natürliche Lebensräume nicht weiter zerstört und natürliche Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden. Dazu gehört natürlich auch die Beendigung des Mülltourismus und die Abkehr von der Zerstörung der Ökosysteme durch Kunststoffpartikel. Diese Liste ließe sich noch beliebig verlängern. Probleme wie die Verringerung der Bodenfruchtbarkeit und der Verseuchung unserer Grundwasserreserven werden zukünftig genauso intensiv diskutiert wie das Absterben unserer Wälder. Wissenschaftlich erforscht sind die ökologischen Probleme, die wir seit vielen Jahren verursachen. Auch die Lösungen sind bekannt. Die Politik hat sich dieser Situation verbal und rhetorisch angepasst, passiert ist aber noch herzlich wenig. Ist der Homo sapiens möglicherweise unfähig, sich zu ändern?
Zu den ökologischen Problemen, die wir den nächsten Generationen überlassen wollen, gesellen sich noch die sozialen. Das betrifft zuallererst die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung. Dadurch steigen die Frustration und Gewaltbereitschaft der abgehängten Teile der Gesellschaft an. Dieses lässt sich nicht mehr allein durch „Brot und Spiele“ (heute: Sport, Konsum und Streaming) kompensieren. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt uns, dass wir die Arbeitszeit weiter verkürzen sollten und die Mindestlöhne anpassen müssen.
Wir brauchen nicht weniger staatliche Regulierungsmaßnahmen, sondern die richtigen. Das betrifft zum Beispiel den Börsenhandel. Aufgrund der niedrigen Zinsen treiben die Banken und Sparkassen ihre Kunden mit ihrem ersparten Vermögen (für schlechte Zeiten und zur Verbesserung der Rente) in die Fonds und Aktien. Dort gibt es allerdings keine Chancengleichheit mit den professionellen Spekulanten und den Hochfrequenzrechnern. Die Zeit ist gekommen, diejenigen Aktivitäten an der Börse gesetzlich auszuschließen, die einer modernen Wegelagerei entsprechen. Auch diese Liste der sozialen Defizite ließe sich weiter verlängern.
Eine Folge der politischen Entscheidungsdefizite als Ergebnis der vergangenen Deregulierungsmaßnahmen ist die starke Zunahme der Politikverdrossenheit. Besonders in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass die Organisationsfähigkeit unserer Verwaltungen und Gesundheitssysteme aufgrund des geringen Personalbestandes stark vermindert ist. Ohne eine Erstarkung staatlicher Organe werden wir die kommenden Krisen nicht bewältigen können. Am deutlichsten sieht man das heute in der Überforderung des Justiz-Apparates. Der Staat wird sich zukünftig mehr auf das Gemeinwohl ausrichten und privatwirtschaftliche Interessen dem Markt überlassen müssen.
Die gesellschaftlichen und ökologischen Probleme, die wir haben, sind meiner Meinung nach, Symptome eines desorientierten und kränkelnden Homo sapiens. Die psychischen Erkrankungen haben sicher nicht nur deshalb stark zugenommen, weil wir bessere Diagnosemöglichkeiten besitzen. Diese Entwicklung geht auch darauf zurück, dass viele Menschen eine Sinnlosigkeit ihres Lebens und ihrer Arbeit verspüren und zunehmend Angst vorm Sterben und vor Krankheiten haben.
Aufgrund der Aufklärung und der Bildungsanstrengungen wenden sich immer mehr Menschen von den traditionellen Religionsgemeinschaften ab. Diese haben den Menschen über Jahrhunderte hinweg Halt gegeben und Regeln aufgestellt, um sich auf das jenseitige Paradies oder das Jüngste Gericht vorzubereiten. Das reale Leben bekam dann einen besonderen Sinn. Wenn wir „Gott gefallen“, dann würden wir mit seiner Liebe im Jenseits belohnt (für Muslime kommen dann noch ein paar Jungfrauen dazu...). Für gottesfürchtige Menschen ist das Leben möglicherweise deshalb erträglicher als für nicht-religiöse. Das Religiöse entlarvt sich allerdings immer mehr als das, was es tatsächlich ist: Eine Manipulationsmaschine zur Absicherung besonderer (männlicher) Machtstrukturen. Mit einer spirituellen Botschaft und Sinnstiftung hat das schon seit langer Zeit nichts mehr zu tun.
Was bleibt da jetzt noch übrig? Ich gehe davon aus, dass die menschengemachten Krisen noch zunehmen. Dies beinhaltet auch Chancen und Herausforderungen. Wir haben jetzt die Chance, zu erkennen, dass wir nicht nur ein Teil des Universums sind, sondern auch in einer Welt leben, die mehr als 4 Dimensionen (Raumzeit) besitzt und unser Geist den körperlichen Tod überleben wird. Wir können erleben, dass die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse - insbesondere der Astro- und Quantenphysik - zur Wiederentdeckung der spirituellen Seite des Menschen beitragen und wir dadurch auch einen anderen Bezug zur Zeit bekommen können. Mit diesem Wissen könnten wir uns bewusst so ändern, dass nicht mehr der Wettbewerb, sondern die Kooperation im Vordergrund steht. Wir könnten die Komplexität der Welt durch eine ganzheitliche Sicht mit Hilfe einer verbesserten Intuition begreifen lernen und unseren Verstand primär für die praktische Organisation unseres Lebens einsetzen und uns nicht überfordern.
Diese andere Sicht auf die Welt und uns selbst kommt nicht von heute auf morgen. Wir müssen dazu bereit sein und unser Potenzial zur Veränderung selbst erkennen. Jeder Mensch auf seine Weise. Das wird nicht leicht sein, weil wir von Natur aus, die Ausübung von Macht über Andere schätzen und unsere Grenzen überschreiten wollen. Wir bemühen uns um Status und lieben unsere gesellschaftlichen Rollen, weil sie uns Sicherheit geben. Die mentale Evolution des Homo sapiens wird uns ohne Zweifel viel abverlangen. Wir werden etwas verlieren, aber auch ein neues zukunftsfähiges Selbstverständnis gewinnen. Meines Erachtens geht daran kein Weg vorbei.
Die neue Angst vorm Sterben
Die Gewissheit, dass wir irgendwann sterben, kommt spätestens dann, wenn jemand in unserem Umfeld gestorben ist. Natürlich erfahren wir jeden Tag in den Medien, wie Unfälle, Krankheiten, Morde und Kriege irgendwelche Menschen dahingerafft haben. Wenn man eine Zeitung aufschlägt, dann wird man von den vielen Todesgeschichten förmlich erschlagen.
Es gibt Menschen, die regelmäßig die Todesanzeigen in der Wochenendausgabe ihrer Regionalzeitung lesen. Dabei ist es selten, dass man jemanden kannte, der gerade gestorben ist. Die Faszination dieser Anzeigen lässt sich vielleicht damit erklären, dass man sich am Ende selbst sagen kann: „Ich lebe aber noch!“.
Wir wissen, dass in Deutschland jedes Jahr rund 1 Million Menschen von 83 Millionen sterben. Das Statistische Bundesamt gibt wöchentlich eine „Sonderauswertung“ über die Fallzahlen der letzten 5 Jahre heraus. Natürlich kann dort nachgelesen werden, dass die älteren Menschen am meisten sterben, je älter sie sind. Das müsste jeder Mensch intuitiv auch wissen.
Wir können dort auch erfahren, welche durchschnittliche Lebenserwartung man hat. Wahrscheinlichkeit ist eine statistische Größe, die leider nichts über meine eigentliche Wirklichkeit aussagt. Schon morgen könnte ich durch einen Unfall, Krebs oder Corona sterben. Es kann aber auch sein, dass ich 100 Jahre alt werde, wie der Gaia-Forscher James Lovelock.
Zum Glück kennen wir unsere eigene Zukunft nicht! Es hat aber etwas Beruhigendes, zu wissen, dass die statistische Lebenserwartung in Deutschland gestiegen ist. Ein heute neugeborener Knabe kann durchschnittlich 78,6 Jahre alt werden. Ein neugeborenes Mädchen hat eine Lebenserwartung von sogar 83,4 Jahren. Die Babys von 1991 hatten hingegen „nur“ eine Lebenserwartung von 72,5 bzw.
79 Jahren. Im Mittelalter wurden die Menschen im Durchschnitt nur halb so alt. Diese Statistik macht Hoffnung auf ein langes Leben.
Die Covid 19-Pandemie wird voraussichtlich nicht viel an der langfristig steigenden Lebenserwartung der Deutschen ändern. Das Virus schadet besonders den Alten. 89 % der Corona-Toten waren über 70 Jahre alt (Statistik von Februar 2021).
Die Wahrnehmungswelt der Menschen wird aber nicht durch die Statistik bestimmt, sondern durch die Medienberichterstattung, die Entscheidungen der Regierung und die Erfahrungen im persönlichen Umfeld. Bisher war das Thema Sterben selten ein dominierendes Thema der Medien und der Vor-Ort-Diskussionen.
Seit der Covid 19-Pandemie scheint nun alles anders zu sein. Die Sterbezahlen werden nicht nur täglich veröffentlicht, sondern auch dem eigenen Wohnort zugewiesen. Der Tod rückt plötzlich in das Bewusstsein aller Menschen, die sich diesen Meldungen eigentlich nur dann entziehen könnten, wenn sie alle Medien konsequent abschalten würden. Das Robert Koch-Institut bereitete alle Daten täglich auf seinem „Dashboard“ mediengerecht auf.
Zahlen müssen immer in Relation zu einem Bezugssystem bewertet werden. Damit hatte ich auch mal in einem Grundkurs Statistik in meinem Studium der Politischen Wissenschaften zu tun. Da sich niemand gerne alle Grunddaten anschaut, werden diese Daten grundsätzlich zu einem anschaulichen Wert verrechnet. Wie das Ergebnis dann aussieht, hängt von der „Erkenntnis leitenden Fragestellung“ ab. Es ist aber selten so, dass diese Fragestellung in den Vordergrund gerückt wird. Zahlen erscheinen als objektive Fakten schlechthin, da sie durch neutrale mathematische Formeln entstehen.
Eigentlich sind Zahlen etwas Emotionsloses. Durch eine geschickte Darstellung kann ich aber auch Optimismus oder Pessimismus verursachen. Mit Zahlen wird Politik gemacht.
In der „Apothekerzeitung“ vom 4.10.2019 konnte man lesen, dass wir 2017/18 mit 25.100 Todesfällen „die schlimmste Grippesaison seit 30 Jahren“ hatten. Das kann man auch in dem RKI-Bericht zur „Epidemiologie der Influenza“ erfahren. 9 Mio. Menschen haben damals einen Arzt aufgesucht. Das wurde in den Medien ohne große Aufregung kommuniziert. Irgendwann war die „Herdenimmunität“ erreicht.
Man wusste, dass sich das nächste Virus irgendwo auf der Welt schon auf den Weg gemacht hat. Wir haben gelernt, dies als normales Lebensrisiko in einer globalisierten Welt zu akzeptieren. Eigentlich gibt es seit etwa 6 Jahren eine weltweite Pandemie unterschiedlichen Ausmaßes. Im Zeitalter der Globalisierung und des internationalen Tourismus ist das statistisch leicht zu erklären. Viruserkrankungen könnten heute deshalb zu den allgemeinen Lebensrisiken wie Krebs und Herzerkrankungen gezählt werden.
Das ist aber nicht alles. Am 15.11.2019 berichtete z.B. die Berliner Zeitung, dass das Robert Koch-Institut mit bis zu 20.000 Toten pro Jahr durch multiresistente Klinikkeime in Deutschland rechnet. Seit 25 Jahren versucht der Hygiene-Facharzt Klaus-Dieter Zastrow (*1950), der auch mal Direktor des Robert-Koch-Instituts war, dies nach dem Vorbild der Niederlande zu verhindern. Dort wurden schon sehr früh Quarantänestationen eingerichtet und Mikrobiologen eingestellt. Hier zeigt sich, dass das Klinikkeim-Problem lösbar ist. Nur aus ökonomischen Gründen hat Deutschland die Problemlösung hinausgeschoben. Im Unterschied zu den Grippewellen, ist das allerdings ein hausgemachtes Problem, das leicht zu lösen wäre.
Bei Corona ist alles anders. Es wurden keine Kosten gescheut, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit die Intensivstationen nicht überfordert werden und die neuen Impfstoffe eingesetzt werden können. Es wird noch dauern, bis der finanzielle und mentale Schaden, der durch die Lockdowns verursacht worden ist, bilanziert werden kann.
Viele Menschen stellen sich die Frage: Ist es wirklich so, dass eine Gesellschaft alles dafür tun muss, damit möglichst wenig Menschen an dem Virus sterben? Verhindert die Ethik jeden Abwägungsprozess zwischen Schaden und Nutzen? Die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen lässt sich leider nicht berechnen. Das nachvollziehbare Argument ist, die Ausbreitung so lange abzubremsen, bis wirksame Impfstoffe in ausreichender Menge geliefert werden können. Danach werden wir wissen, ob diese Strategie funktioniert hat und wie sich das auf die Übersterblichkeit ausgewirkt hat. Fakt ist, dass das Corona-Virus die gesamte Gesellschaft und die verschiedenen Generationen polarisiert hat. Das Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit der Regierungen hat stark abgenommen.
Die weltweite Entwicklung und die staatlichen Maßnahmen zur Covid 19-Pandemie werden die mentale Einstellung der Menschen zu den Lebensrisiken nachhaltig verändern. Das Virus hat unsere Werte und unser Selbstverständnis vom Leben und Sterben durcheinandergewirbelt. Der Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen und ausgewertet. Ob diese Krise die Gattung Homo sapiens in seinem Überlebenswillen eher schwächt oder sogar stärkt, kann erst die Zukunft zeigen. Ob dadurch ein neues globales Gemeinschaftsgefühl oder im Gegenteil ein Zurück in alte nationale Egoismen erzeugt wird, kann ebenfalls noch nicht beurteilt werden.
Grundfragen des Lebens
Wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich jemanden, der mir weiterhelfen kann oder ich recherchiere im Internet. Ich frage, weil ich Antworten suche. Habe ich ein Problem, dann suche ich eine Lösung. Am Anfang steht immer eine Frage. Ohne Fragen bekomme ich keine Antworten. Mit Fragen kann etwas in Bewegung gebracht werden, wenn ich wirklich an einer Antwort interessiert bin.
Mit Fragen drücken wir unser Interesse an einer Antwort aus. Antworten, die gegeben werden, ohne dass Fragen gestellt worden sind, schweben unnütz im Raum und sind eigentlich überflüssig. Antworten können etwas beenden. Nach sinnvollen Fragen kann etwas Neues begonnen werden. Fragen ohne Antworten können depressiv machen. Vielleicht sollte man sich deshalb nur mit Fragen beschäftigen, die auch leicht zu beantworten sind? Vielleicht nur Fragen, die schon jemand vor uns beantwortet hat? Das Leben kann doch so leicht sein...
Es gibt Fragen, die sich alle Menschen voraussichtlich irgendwann mal stellen. Die internationale Organisation „Dropping Knowledge“ mit Sitz in Berlin sammelte deshalb Anfang 2006 über ihre Website Fragen zu allen Themenbereichen und versuchte auch auf dieser Basis Antworten zuzuordnen. Am 9. September 2006 hatten sich 112 „Freie Denker“ mit der Beantwortung von 100 ausgewählten wichtigen Fragen in Berlin öffentlich an einem großen runden Tisch getroffen. Die Fragen waren von sehr unterschiedlicher Qualität. Einige Beispiele: Werden wir jemals zufrieden sein? Was ist Glück? Warum existieren wir? Was ist der Sinn des Lebens? Welches sind die drei wichtigsten Werte? Was ist Wirklichkeit? Wie objektiv ist die Wissenschaft? Haben Tiere eine Seele? Können wir die Welt vor der Erwärmung retten? Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Das Konzept dieser Veranstaltung war aber eine Überforderung. Jeder dieser 112 Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen musste alle 100 Fragen in jeweils durchschnittlich 3 Minuten beantworten, so dass wir zu jeder Frage prinzipiell dann 112 unterschiedliche Antworten bekamen. Diese vielen Antworten wurden aber weder diskutiert, um eine gemeinsame Antwort zu entwickeln, noch zusammengefasst veröffentlich. Zu viele Fragen verwirren uns. Niemand stellt sich hundert Fragen auf einmal. Das überfordert und belastet uns eher. Jahre später wurde die Webseite aus dem Netz genommen.
Die richtige Frage zur richtigen Zeit und am richtigen Ort gestellt, kann aber unser Leben verändern. Fragen können uns auf bislang verdeckte Ziele aufmerksam machen und das Interesse an der Beantwortung wecken.
Was sind nun wichtige Fragen und wichtige Antworten? Das muss man letztendlich selbst entscheiden. Es gibt aber Fragen, die sich fast alle Menschen einmal irgendwann in ihrem Leben stellen. Deshalb nenne ich sie Lebensfragen. Leider sind dies Fragen, die sich nicht so leicht beantworten lassen, wenn man eine überzeugende Antwort wünscht. Diese Fragen werden häufig nicht ernst genommen oder nur scheinbar beantwortet („So ist das Leben nun einmal. Es gibt Höhen und Tiefen!“). Danach werden die Fragen meistens verdrängt, weil sie doch eher als lästig empfunden werden. Es gehört auch ein bisschen Mut dazu, sich diesen Lebensfragen zu stellen.
Der norwegische Schriftsteller Jostein Gaarder (*1952) hat die Grundfragen des Lebens in seinem Bestseller „Sofies Welt“ aus Sicht der Philosophen so gestellt: Wie wurde die Welt erschaffen? Hat die Erschaffung der Welt einen Sinn? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie sollten wir leben? 1
Mit der ersten Frage hat sich der Astrophysiker Steven Hawking in seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ intensiv auseinandergesetzt. Die unvorstellbare Geschichte des Urknalls kann allerdings auch als Beleg für die Wahrheit der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments gedeutet werden. Die Frage nach dem Zufall bzw. der Schöpfung hat uns seitdem nicht mehr losgelassen. Mit der Beantwortung dieser Frage hängt natürlich auch die Art der Beantwortung der Frage nach dem weltlichen Sinn zusammen. Wenn alles nur ein Zufall ist, dann kann es ja eigentlich keinen vorgegebenen Sinn neben den Regeln der Naturgesetze geben. Vielleicht gibt es aber auch einen triftigen Grund, warum wir den Sinn nicht erfassen können?
Auch die Frage nach dem Charakter des Todes ist eine dieser großen Fragen. Die Beantwortung dieser Frage hängt eng mit der Aufklärung des Wesens von Geist und Materie zusammen. Sind Verstand, Ich-Bewusstsein, Intuition und Gefühle nur Funktionen des Gehirns oder existieren einzelne Teile auch unabhängig davon und treten nur in eine Wechselbeziehung dazu? Was wissen wir bislang über Nahtod-Erlebnisse und Wiedergeburt? Wie lassen sich die damit zusammenhängenden Phänomene wissenschaftlich deuten? Die letzte Frage der Philosophen bzw. Philosophinnen („Wie sollten wir leben?“) kann sinnvoll nur beantwortet werden, wenn man die Fragen davor beantwortet hat.
Die Fragen nach dem warum und dem wohin setzen ungeahnte geistige Kräfte frei, weil sie den Kern der menschlichen Existenz berühren. Die Beantwortung von existenziellen Fragen führt zu einer anderen Selbstwahrnehmung. Wir erkennen, dass sich die Welt nicht um uns dreht, sondern dass wir ein einzigartiger Baustein im Gesamtgefüge sind. Aus diesem Bewusstsein entsteht nicht nur viel Selbstbewusstsein, sondern auch viel Freude an der Natur und den Mitmenschen.
Die Geschichte zeigt, dass man zuerst erkennen muss, etwas nicht zu wissen, um neugierig zu werden und weiter zu forschen. Ein Beispiel dafür sind die „weißen Flecken“ unbekannter Regionen bei der Weltkarte aus dem Jahre 1525. Davor dachte nicht nur Kolumbus, dass die damalige Weltkarte - ohne Amerika - vollständig sei. Die Karten wurden dementsprechend gezeichnet. Erst die Erkenntnis des Nicht-Wissens über die Ausdehnung und die Kontinente unserer Welt hat die Expeditionen und Forschungen beflügelt.
Aus der Geschichte der Naturwissenschaften können wir viel lernen.
Wenn jemand meint, wir wüssten doch schon alles zu einem Wissensbereich, dann lohnt es sich, genauer hin zu schauen. Es gab auch Zeiten, da behaupteten namhafte Professoren, dass es sich nicht mehr lohnen würde, Physik zu studieren, da wir ja schon alles wüssten. Dann kam die Quantenphysik und hat alles Wissen auf den Kopf gestellt.
Fragen, die ich mir vor diesem Hintergrund gestellt habe:
Wie ist die sogenannte
„Kognitive Revolution“
und damit der Ursprung des Homo sapiens vor etwa 60.000 Jahren zu erklären? Nur durch Annahme einer zufälligen Mutation?
Wie unterscheiden wir uns von den Tieren und Pflanzen? Gibt es nur die
Evolution
oder auch Schöpfungsprozesse? Was können wir von intelligenten Tieren lernen?
Ist das Gehirn der Ort unserer gesamten
Ich-Persönlichkeit
und unseres Willens? Laufen vielleicht Informationsprozesse außerhalb des Gehirns ab, die auch zum Denkprozess dazu gehören? Haben wir einen freien Willen oder ist das nur eine Illusion?
Was passiert in unseren Träumen und unserem
Unterbewusstsein?
Gibt es einen unbewussten Informationsaustausch auch mit anderen Menschen, Tieren und Pflanzen auf zellularer Ebene?
Was ist der Ursprung für
Intuition
und Kreativität? Warum spielt unser Verstand in unserem Bewusstsein so eine dominierende Rolle?
Wie wirkt sich
Künstliche Intelligenz
und die Kommunikation mit digitalen Systemen auf unser menschliches Wesen aus? Welche Zukunft hat der Mensch neben der Künstlichen Intelligenz?
Dies sind Fragen, deren Beantwortung mich besonders herausgefordert haben. Ich habe deshalb intensiv recherchiert, was wir heute zur Beantwortung schon definitiv wissen und wo es unterschiedlich zu interpretierende Fakten und Erklärungsmodelle gibt. Natürlich habe ich mir dazu auch meine eigenen Gedanken gemacht. Die große Frage, die dahintersteht, ist natürlich die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Bringt uns die Beantwortung der Teilfragen einer Beantwortung dieser Grundfrage der Philosophie näher?
Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade heute eine verständliche Antwort auf die Sinn-Frage ohne den Rückgriff auf alte Mythologien benötigen, um uns in unserer immer komplexeren Welt zurechtzufinden. Dazu gehört sicher auch die Wiederentdeckung und Nutzung unserer natürlichen Spiritualität, die ein Teil unseres Wesens ausmacht. Die technologische Entwicklung unserer Gesellschaft hat dazu geführt, dass wir den Kern unseres menschlichen Wesens immer weniger wahrnehmen. Bevor wir verstärkt in den Wettbewerb mit Künstlichen Intelligenzen geraten, sollten wir wissen, was unsere wirklichen Stärken sind. Diese könnten durch Digitalsysteme nicht ersetzt werden.
Die Wahrnehmung der Wirklichkeit fängt zuerst bei uns selbst an. Deshalb ergibt es Sinn, am Anfang unsere Probleme mit uns selbst und den Menschen zu beschreiben und zu analysieren. Erst danach ziehe ich den Kreis weiter. Bis an den Anfang des Universums und der mysteriösen Welt der Quanten.
Die neuen Zukunftsängste
Dreht die Menschheit langsam durch? Diese Frage stelle ich mir immer häufiger, wenn ich die täglichen Nachrichten über das Geschehen auf unserer Erde verfolge. Geht es nur noch um schnelle Profite und die eigene Selbstvermarktung ohne Rücksicht auf die Folgen?
Wir haben heute eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen, um gemeinsam ein friedvolles und interessantes Leben für alle Menschen zu gewährleisten. Stattdessen werden die Arbeitsergebnisse immer ungerechter verteilt, der Kampf um die letzten sich erschöpfenden Ressourcen unseres Planeten nimmt wieder zu und die wachsende Gefahr einer Klimakatastrophe führt eher zu Abwarten als zum konsequenten Handeln.
Die Globalisierung der Wirtschaft und die Digitalisierung aller Lebensbereiche verstärkt noch die vorhandenen Zukunftsängste, weil die Komplexität zunimmt und die Wirkungen unserer Handlungen immer weniger vorhersehbar erscheinen. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen sich geordnete alte Zeiten und Systeme wünschen, die sie noch verstehen konnten. Die mit der Komplexität verbundene Sinnkrise möchten einige Menschen dann mit der Hinwendung zu neuen spirituellen Bewegungen kompensieren.
Da eine objektive Sicht auf die Welt durch Soziale Netzwerke und die Zunahme von Fake-News ohnehin nicht mehr möglich erscheint, wird alles geglaubt, was uns nützt und eine einfache Perspektive ermöglicht. Gemeinsames Handeln, um eine positive Zukunft für alle Menschen zu gestalten, ist nur noch selten ein Thema.
Heute liegen national-egoistische Ziele im Trend wie „America first“ und der „Brexit“. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Ist der Homo sapiens nur eine kurze Laune der Natur und seine angebliche soziale Intelligenz nur ein Mythos? Ist der Untergang der Menschheit unabwendbar, weil sich unsere „egoistischen Gene“ verselbstständigen und sich die globalisierte und digitalisierte Wirtschaft durch Algorithmen der Spieltheorie selbst zerstört?
Möglicherweise wird die Zunahme von gesellschaftlichen Krisensituationen durch Naturkatastrophen, Börsencrashs und Pandemien ein Umdenken und Umschwenken bewirken. Das ist nicht ausgeschlossen, wenn dadurch die gesamte Menschheit zum gemeinsamen Handeln gezwungen würde. Es kann natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben, dass jede Gesellschaft erst an sich selber denkt und sich vom Rest der Welt isoliert. Auf Grund der internationalen Arbeitsteilung wäre solch eine Strategie mit vielen Unwägbarkeiten und Nachteilen verbunden.
Wir haben zwar eine globalisierte Wirtschaft und weltweite digitale Kommunikationswege, aber eine gemeinsame Vision einer kooperativen menschlichen Gesellschaft fehlt. Erst recht fehlen entsprechende Regeln des internationalen Rechts und Institutionen, die machtvoll genug sind, diese Regeln durchzusetzen. Solange wir unser Handeln nach dem Nutzen für uns selbst beurteilen, bleibt die globalisierte Welt das Terrain konkurrierender Gruppeninteressen.
Ist der Untergang des Homo sapiens also vorprogrammiert, weil er von seinem Wesen her kein angeborenes Interesse am Überleben aller Individuen seiner Art hat und ihm echtes Mitgefühl fehlt? Was muss passieren, damit wir uns ändern? Können uns bei der Beantwortung dieser Fragen die Natur- und Sozialwissenschaften, die Religionen und die Philosophie weiterhelfen?
Ich glaube, es ist Zeit für eine schonungslose und vorurteilsfreie Inventur! Was wissen wir heute über uns selbst und die Welt, in der wir leben? Könnte dieses Wissen - wenn man die inhärenten Sprachbarrieren und Dogmen beseitigt und die wesentlichen Erkenntnisse bündelt - einen neuen Kompass für die Entwicklung der Menschheit bedeuten? Ich möchte diesen Fragen nachgehen.
Das, was bisher Stabilität erzeugt hat, muss sich wandeln bzw. ersetzt werden. Niemand kann vorhersehen, wie sich die Welt dann verändert. Das erzeugt auch Zukunftsängste und wahrscheinlich auch Fluchtverhalten in vergangene nationale und autokratische Strukturen.
Ich glaube nicht, dass es allein reicht, ein politisches aufklärerisches Bollwerk dagegen zu errichten, weil sich die Hauptprobleme auf der psychischen und emotionalen Ebene der Menschen festgesetzt haben. Menschen, die Zukunfts- und Lebensängste haben, neigen dazu, ihre Selbstbestimmung aufzugeben, wenn Ihnen der Zugang zu Strukturen erlaubt wird, die Sicherheit über starre Regeln und Kontrolle versprechen. Wenn Menschen mit anderen Menschen um ihre Lebenschancen konkurrieren müssen und in andersartigen Menschen eher eine Bedrohung sehen, dann können Machteliten sie leicht für ihre eigenen Ziele und Interessen einspannen. Wenn die Menschheit überleben will, dann müsste sich meines Erachtens hier etwas Grundlegendes ändern.
Ich bin davon überzeugt, dass nur eine respektvolle vorurteilsfreie Kommunikation und ein fairer Handel den Frieden in der Welt und ein Überleben der Menschheit sichern kann. Dazu muss aber das in den Vordergrund gerückt werden, das uns verbindet und nicht spaltet. Ohne einen spirituellen Reifeprozess wird der Homo sapiens nicht überleben können. Hierzu können und müssen die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und auch alle Weltreligionen ihren Beitrag leisten. Das setzt die Dialogbereitschaft voraus und bedarf auch politischer und diplomatischer Aktivitäten.
Wir brauchen einen weitergehenden internationalen Grundkonsens über die gemeinsamen Ziele und die zu sichernden Menschenrechte. Dazu gehört, dass alle Regierungen akzeptieren, dass der von uns erzeugte Klimawandel die Menschheit und die Erde als Ganzes bedroht und gemeinsame Gegenmaßnahmen abgestimmt und umgesetzt werden müssen.
Leider gibt es noch viele Nationalstaaten, die tatsächlich glauben, dass sie zu den Gewinnern einer Klimakatastrophe zählen könnten. Das ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern hochgradig verrückt! Natürlich gibt es auch religiöse Gruppen, die glauben, dass Gott nur die Ungläubigen strafen wird und das auch in der Bibel prophezeite „Harmagedon“ unausweichlich sei. Diese Gruppen werden einen Zulauf erfahren, weil sie einen scheinbaren Ausweg bieten.
Insgesamt wird die geistige und emotionale Desorientierung auch durch die Vereinheitlichung der Denkweise durch digitale Algorithmen noch zunehmen. Unser Bild von uns selbst wird dabei großen Schaden nehmen, weil durch den Wettbewerb mit den künstlich erschaffenen Computer-Intelligenzen das eigentliche Wesen des Menschen in den Hintergrund rückt und entwertet wird. Dies zeigt sich schon jetzt durch eine starke Zunahme von psychischen Erkrankungen.
Durch die Dominanz ökonomischen Denkens, das sich an den berechenbaren Eigenschaften des Menschen orientiert und das durch die Spieltheorie des Mathematikers John Nash (1928 bis 2015) beflügelt wurde, wird die spirituelle und emotionale Seite des Homo sapiens immer weniger wahrgenommen. Damit verlieren wir möglicherweise einen wichtigen Wesenszug unserer Spezies: die ganzheitliche Wahrnehmung der Wirklichkeit und das Mitgefühl für das Leiden anderer Menschen. Dieser Mechanismus läuft langsam und im Unbewussten ab, weil unsere natürlichen Wertmaßstäbe durch die digitalen Werte unserer neuen Welt Stück für Stück ersetzt werden.
Globalisierung und Digitalisierung
Die Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft hat digitale und globale Netzwerke und Medien geschaffen. Die Menschen auf der Erde rücken virtuell zusammen und können direkt miteinander Interessen, Fakten und Meinungen austauschen. Auch wenn internationale Konzerne wie Google, Facebook und Amazon das Internet immer mehr geschäftlich nutzen und faktisch eine größere Macht als viele Nationalstaaten besitzen, haben sie zu einem kulturellen Zusammenwachsen und Verständnis beigetragen, das selbst eine neue politische Qualität erzeugt hat.
Am Anfang war das Internet nur eine Plattform für den Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse. Heute tummeln sich weltweit alle Interessengruppen darin. Natürlich finden sich dort auch alle nützlichen und schädlichen Aktivitäten, die weltweit in Konkurrenz zueinander treten. Der Internet-Blogger und Kommunikationswissenschaftler Sascha Lobo (* 1975) schrieb dazu:
„Die Veränderungen durch Globalisierung und Digitalisierung führen zu großer Verunsicherung und Zukunftsangst. Selbst bei Leuten, die zuvor meinten, sich niemals Sorgen machen zu müssen. Für das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren, ist auch ein oft unterschätzter Faktor ausschlaggebend: Überforderung ... In einer solchen Angst- und Abwehrstimmung erscheint Komplexitätsreduktion sehr attraktiv.“ 2
Diese Entwicklung lässt sich nicht mehr einfach zurückdrehen. Das Internet ist noch weitgehend unreguliert und zeigt uns in seiner Vielfalt das ungeschönte Wesen des Homo sapiens. Das ist auch erschreckend, wenn man die Aktivitäten krimineller Organisationen, Waffenhändler und Kinderschänder des „Darknet“ mit einbezieht. Diese grenzenlose Freiheit darf aber nicht ohne persönliche Verantwortung bleiben. Dies bedeutet, dass in Zukunft wenigstens die von Konzernen geschaffenen Strukturen, wie z.B. Instagram, Facebook oder YouTube die Anonymität ihrer Nutzer aufheben müssten, damit angerichtete Schäden auch mit Konsequenzen verbunden werden können.
Das Internet hat auch viel Positives bewirkt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können mächtige Eliten ihre meinungsbildende Kraft nicht unbeschränkt ausdehnen. Besonders die Jugend nutzt die internationalen Vernetzungsmöglichkeiten, um sich Meinungen zu bilden. Dies haben die neue Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ und viele YouTuber gezeigt. Durch die Google-Plattform YouTube sind mittlerweile sehr reichweitenstarke Kanäle entstanden. Diese symbolisieren nicht nur eine ökonomische Macht beim Produkt-Placement, sondern sie treten zunehmend auch als Konkurrenz zu den klassischen Medien auf.
Dies ist besonders durch das YouTube-Video von Rezo vor der Europawahl 2019 klar geworden, der zu den eher unbedeutenden Aktivisten zählte (ca. 350.000 Abonnenten). Sein Video zur „Zerstörung der CDU“ wurde allerdings über 12 Millionen Mal heruntergeladen.
Die einflussreichsten Youtuber wie beispielsweise Felix Kjellberg aus Schweden oder German Garmendia aus Chile mit jeweils etwa 70 Millionen Abonnenten haben sich bisher noch nicht politisch verortet. Hier kann man aber ahnen, welche Meinungsmacht dahinterstehen könnte. Im Augenblick sind die meisten YouTuber noch völlig unpolitisch und als sogenannte Influencer im Werbebereich unterwegs. Das kann sich aber schnell auch ändern. Unklar ist, ob die Abonnenten bzw. Abonnentinnen den Kurswechsel mit machen würden und in welche Richtung sich das Ganze dann bewegt.
Auch im Kurznachrichten-Netzwerk Twitter werden Meinungen vervielfältigt und viele Fake-News verbreitet. Die Popularität des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wäre ohne diese Meinungsmaschine nicht möglich gewesen. Da kommen die klassischen Medien schon längst nicht mehr mit. Auch der Tesla-Chef Elon Musk nutzt dieses Medium um seine Wirksamkeit zu erhöhen. Heute folgen ihm hier etwa 50 Mio. Menschen. Als er ankündigte über 1 Mrd. Dollar in Bitcoins zu investieren, explodierte der Kurs dieser virtuellen Währung förmlich.
Mittlerweile ist das Internet zum Hauptmedium vieler Menschen geworden und hat die traditionellen Medien wie Zeitungen und Fernsehen verdrängt. An der auflagenstarksten deutschen Tageszeitung „Bild“ kann man sich das gut klar machen. Der Springer-Verlag verkauft davon heute nur noch knapp 1,5 Mio. Exemplare. Vor 20 Jahren wurden noch 4,5 Mio. Bild-Zeitungen verkauft! Die „Bild“ gibt es auch als Digitalangebot „Bild plus“ - aber bislang nur mit etwas über 0,4 Mio. Abonnenten. Wo die Bildzeitung politisch steht, ist seit Jahrzehnten ein ewiges Ärgernis, aber dies ist bekannt und kalkulierbar. Wo sich die Meinungsmaschine Internet mal hinbewegt, ist hingegen unkalkulierbar und für Politik und Wirtschaft ein großes Risiko.
Wir stehen jetzt vor einem wachsenden Berg an nicht mehr zu bewältigenden Informationen. Alle, die Zugang zum Internet haben, können an diesem fast unendlich großen Pool nach für sie wichtigen Informationen suchen. Dies ist eine große Chance, aber auch eine enorme Herausforderung, da wir uns leicht in dem Meer an Meinungen verirren können und erst recht nicht mehr wissen, was wirklich wichtig ist im Leben.
Ohne Suchmaschinen wie z. B. Google würden wir mit dieser Informationsmenge nichts anfangen können. Die Filterstruktur, die durch diese Organisation vorgegeben wird, ist aber sehr stark mit ökonomischen Interessen verknüpft, da die Such-Algorithmen über Werbeeinnahmen refinanziert werden. Es gibt Hinweise, dass bei der Geburt dieses Unternehmens auch nationale Geheimdienste mitgewirkt haben und die Auswertungen für ihre eigene Arbeit nutzen. Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld (*1962) stellte dazu fest:
„Wer sich anders informieren will, muss erst einmal den Algorithmus überwinden, der den persönlichen Nachrichtenstrom lenkt ... Die schrillsten Meldungen verbreiten sich am schnellsten.“ 3
Informationen sind schon immer mit Interessen verbunden gewesen. Wenn viele Menschen etwas für wahr oder wichtig halten, hat das die Verbreitung erhöht. Das Internet-Raster verstärkt den Mainstream der Gedanken sogar noch und führt zu einer gewissen Vereinheitlichung der globalen Wahrnehmung. Über Kulturgrenzen und Entfernungen hinweg kann sich jetzt aber auch so etwas wie ein Weltbewusstsein entwickeln. Wir sehen, dass die verschiedenen Kulturen der Erde unterschiedliche Wahrnehmungen der Wirklichkeit haben und verschiedene Werte und Ziele verfolgen. Das führt am Anfang erst einmal zur Desorientierung und einer eventuell nachhaltigen Verwirrung.
Das Internet revolutioniert alle Bereiche des Lebens und setzt neue Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Gesellschaft in Gang. Das betrifft aber nicht nur den Internet-Handel, IT-Dienstleistungen und die Unterhaltungsbranche (z.B. Streaming-Angebote bei Netflix und Spotify). Das Internet liefert auch Lebens- und Gesundheitsberatung in einer unüberschaubaren Vielzahl. Plötzlich stehen auch die großen Kirchen mit ihren traditionellen Angeboten zum Sinn und Ursprung des Lebens im Feuer. Nicht nur wissenschaftliche, sondern auch spirituelle Weltmodelle werden in Frage und auf den Prüfstand gestellt. Damit wird auch der Einfluss von Pfarrern, Priestern und Imamen schwinden. Das mag am Anfang die vorhandene Desorientierung vieler Menschen erhöhen. Aber jeder Mensch hat jetzt die Chance, seinen Lebensentwurf und sein Weltbild unabhängig von kulturellen Zwängen zu überprüfen und sich passende Anregungen zu holen und auszuprobieren. Ursula Weidenfeld in ihrem Buch „Regierung ohne Volk“:
„Digitalisierung und Globalisierung wirken als gewaltige Kräfte nicht nur auf die Unternehmen und das Arbeitsleben des Einzelnen. Sie bringen auch die scheinbar unverrückbaren Gewissheiten der demokratischen Gesellschaften ins Wanken.“4
Das Corona-Virus hat zwar auch dazu beigetragen, die wissenschaftlichen Kapazitäten und den Informationsaustausch international zu stärken. Gleichzeitig hat die gesundheitliche Bedrohung die Handlungen einzelner Nationalstaaten verstärkt, sich gegenüber anderen abzuschoten. Die Europäische Gemeinschaft und die UNO wurden eher weiter geschwächt.