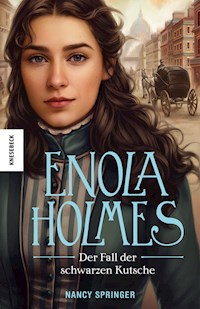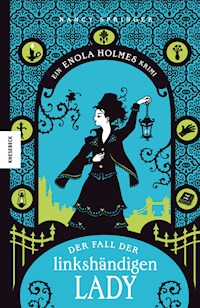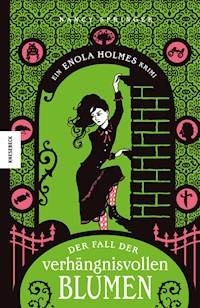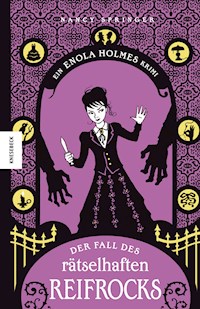3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Fantasyvolle Romankomödie um einen Froschkönig, der nach dem obligaten Kuß in einem malvenfarbenen Cabrio davonfährt. Glitzernder Humor und ironische Seitenhiebe auf die moderne Gesellschaft und die Männer und einige sehr vernünftige Lektionen über die Liebe. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Ähnliche
Nancy Springer
Im Zauberreich der Liebesmacht
Roman
Aus dem Amerikanischen von Helga Augustin
FISCHER Digital
Inhalt
Erstes Kapitel
»Es war einmal eine Frau, die war Anfang Vierzig«, deklamierte Buffy Murphy inmitten der Bäume, »als ihr Erzarsch von Ehemann sie einfach sitzenließ, und das einen Monat nach ihrem zwanzigsten Hochzeitstag.« Buffy legte auf ihrem Marsch durch den Naturpark noch einen Gang zu, wobei sich ihre stattlichen Oberschenkel heftig aneinander rieben. Es dauerte gar nicht lange, und sie fing an zu keuchen. »Nachdem die Frau … das College abgebrochen hatte, um ihm sein Jurastudium zu finanzieren, nachdem sie … ihr eigenes Leben praktisch hatte ausfallen lassen, um ihre drei Kinder großzuziehen, gibt er ihr den Laufpaß und haut mit seinem Flittchen ab.«
Achtlos stampfte Buffy einen mit Kiefernnadeln bedeckten, rutschigen Hügel hinunter und sinnierte über die Worte Laufpaß, Abhauen und Flittchen nach. Der drastische Klang gefiel ihr gut, und sie fühlte sich augenblicklich besser. Sie warf sich in ihre voluminöse Brust und wiederholte die Worte noch einmal ganz laut.
Ob jemand sie hörte, war Buffy egal. Im April traf man an Wochentagen sowieso keine Menschenseele im Naturpark, und selbst wenn: Sie hatte wirklich andere Sorgen, als sich über schickliches Verhalten Gedanken zu machen. Und wenn es nicht normal war, mitten im Wald lauthals und wütend Geschichten zu erzählen – na schön, dann war sie eben nicht normal. Sonst noch was? Mit erhobener Stimme deklamierte Buffy: »Und närrisch, wie sie nun einmal ist, sagte die Frau zu ihm: ›Klar, aber sicher, ich schaff es schon alleine, ich brauch dein verdammtes Geld nicht, ich kann doch gut Märchen und Geschichten vortragen, das mach ich zu meinem Beruf.‹« Na, klasse. Bis jetzt hatte Buffy nicht einmal die Ausgaben für ihre Visitenkarten reingeholt. Ihr elender Brotjob war es, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestritt, nicht das Geschichtenerzählen.
»Der Mistkerl glaubt, er kann sich mit mickrigen Unterhaltszahlungen freikaufen und zwanzig Jahre Ehe dann einfach vergessen. Aber das wird die Frau nicht zulassen. Er soll sein verdammtes Geld behalten und seine Schuld spüren, Herrgott noch mal. Sie ist so sauer wie … wie …« Im frostigen Schatten hochragender Tannen lief Buffy auf dem Grund des Tals entlang und suchte nach einem treffenden Vergleich. Da ihr aber keiner einfiel, blieben sowohl ihre Beine wie auch ihr Mundwerk stehen.
Ihr Sprechorgan kam als erstes wieder in Gang. »Die Frau ist völlig verzweifelt, okay?« Buffy schüttelte ärgerlich den Kopf. Nicht weinen. Nützt ja sowieso nix. Genausowenig wie dem Wald ihre Geschichte zu erzählen. »Ich rede mit den Bäumen«, murmelte sie, »aber sie hören mir nicht zu.« Doch wer hatte ihr schon jemals zugehört? Trotzdem erzählte sie Geschichten.
»Am ersten Jahrestag ihrer Scheidung«, teilte sie einem grobrindigen Hickorybaum mit, »machte die Frau also einen langen Spaziergang tief in den Wald hinein. Sie war unglücklich.« Buffy trat nach einem Aronstab, der wie ein Phallus unverschämt neben ihr emporragte, und setzte sich wieder in Bewegung. Sie gehörte nicht zu denjenigen, die auf markierten Wegen liefen, sondern stampfte quer über den feuchten Blätterboden, der unter ihren Füßen quatschte und vor sich hin muffte wie sie selbst.
»Und was passierte im Wald? Absolut nichts. Schluß, aus. Ende der Geschichte. Diese Frau hat nichts mehr zu erwarten. Und wollt ihr wissen, warum? Weil sie fett ist. Fett.«
Stimmt nicht. Buffy war nicht richtig fett, bloß übergewichtig. Dreißig Pfund. Na ja, vielleicht vierzig.
Dann nimmt sie also einfach ab, und schon ist sie wieder begehrenswert? Als ob ihre körperlichen Reize alles wären, was sie zu bieten hat? Schon bei dem Gedanken daran bekam sie Lust, jemandem den Hals umzudrehen.
Weiter vorn, am Talgrund, glänzte und spiegelte etwas Helles. Buffy steuerte entschlossen darauf zu. Warum zog es sie im Freien immer zum Wasser hin? Selbst aufgemotzte Vogeltränken im Hintergarten fremder Leute wirkten wie ein Magnet auf sie. Es gab keinen einleuchtenden Grund dafür, und doch passierte ihr das ständig. Wasser hatte irgend etwas an sich. Dabei sollten sich vernünftige Menschen so weit wie möglich von Morast und Moskitos fernhalten, aber Buffy hatte schon als Kind eine Art Urliebe für den Sumpf entwickelt, der verborgen im Wald hinter dem Haus ihrer Eltern lag. Dort war ihr alles so lebendig erschienen: Es gab Falken, Schlangen und Schnecken, und Rohrkolben, die aus dem Schlamm schossen. Feuchte Gerüche, als wäre es Gottes Badezimmer. Enten, Karpfen, und die Bisamratten mit den ekligen nackten Schwänzen. Bei jeder Gelegenheit war sie dort hingegangen.
Aber das war damals, und jetzt war jetzt. Kindliches Staunen war im Augenblick nicht angesagt.
Buffy stand mitten im Wald am schlammigen Ufer des kleinen Teichs, starrte auf das zittrige Spiegelbild der Äste und versuchte zu erspüren, welche Botschaft dieser Ort ihr übermitteln wollte – welches Zeichen, welches Versprechen auf Erlösung. Sicher, das hier war ein verwunschener, hübscher Ort, eine Miniversion vom Garten des Paradieses. Grüner, pferdeohriger Drachenwurz säumte den Rand des Teiches, und sie entdeckte Fingerkraut, das schon bald blühen würde. Langbeinige Wasserläufer spazierten über die mit Entengrütze bedeckte Wasseroberfläche.
Zwischen Zweigen, Schilf und einem übelriechenden, glänzenden Haufen Unrat schwamm nahe am Rand eine verbeulte, goldschimmernde Bierdose, die irgendein Umweltraudi hineingeworfen hatte.
Soviel zum Paradiesgarten.
Auf der Bierdose kauerte ein glitschig-grüner Ochsenfrosch, der im Vergleich zu anderen Fröschen groß war, aber klein für einen Ochsenfrosch, also jung. Er starrte Buffy mit Glubschaugen an, die den gleichen trüben Goldton hatten wie sein Thron.
»Kannst du denn nicht auf einem Seerosenblatt oder Ast oder so was sitzen?« beschwerte sich Buffy.
Der Frosch grinste. »Küß mich«, sagte er.
Moment mal. Buffy war wie vom Donner gerührt. Verstand, Herz, Atem, Zeit, ja selbst die Erdumdrehung – alles kam zum Stillstand. Alles schien zu schweben. Der Frosch … konnte sprechen? Was er gesagt hatte … was hatte er gesagt? Auch das schwebte noch in der Luft. Der Frosch … konnte reden?
Wie ein Kinderkarussell setzte sich die Zeit ruckartig wieder in Bewegung. Der Frosch … hatte gesprochen? Ja. Ja. Buffy war sich hundertprozentig sicher. Sie lauschte den Worten nach, deren Klang noch in der Luft hing. KÜSS MICH. KÜSS MICH, hatte er gesagt, der freche kleine Kerl.
Wenn überhaupt, dann bekam Buffy diese Art von Anmache von Bauarbeitern zu hören. Früher, als sie noch radgefahren war, hatte ein Typ in einer leuchtend orangefarbenen Weste ihr einmal zugerufen, sie sollte sich auf sein Gesicht setzen und seine Ohren als Pedale benutzen. »Küß mich« klang da vergleichsweise harmlos, aber von einem Frosch geäußert, reichte es aus, sie aus ihrer Trostlosigkeit und Selbstbezogenheit zu reißen, was eine Wohltat war. Sie glotzte den Frosch an.
Der Frosch glotzte zurück. »Ich bin ein verzauberter Prinz«, sagte er mit hochmütiger männlicher Stimme. »Küß mich, dann ist der Zauber gebrochen, und ich tue alles, was du willst.«
Spielte ihr jemand einen Streich und versuchte, sie als blöd hinzustellen? Wollte ihr Exmann sich rächen und ein Video für eine Fernsehsendung à la »Versteckte Kamera« mit ihr machen? Buffy blickte sich um, aber in diesem langweiligen Wald standen die Bäume wie lange, dürre Mannequins herum – die typische Wiederaufforstungsmethode in den Appalachen. Weit und breit gab es kein verdächtiges Unterholz, in dem sich jemand verstecken konnte. Zudem hatte sich das Maul des Frosches beim Sprechen bewegt. Buffy hatte seine lachsfarbene Kehle gesehen, seine eklige, gelbliche Zunge, die wild rumzappelte beim Formen der Worte.
Da ihre Knie sich etwas weich anfühlten, gestattete sich Buffy die Hinwendung zum Boden, wo sie ihr ausladendes Hinterteil im Matsch plazierte.
»Küß mich«, sagte der Frosch, sein Geduldsfaden hörbar gespannt. »Mach was ich sage. Hier noch mal im Klartext: ›Du küßt mich, und ich verwandle mich in einen Prinzen.‹«
Buffy bekam sich schließlich soweit in den Griff, daß sie sprechen konnte. »Wir leben in den neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts«, flüsterte sie. »Wir befinden uns in Pennsylvania in den Vereinigten Staaten von Amerika.«
»Und was willst du damit sagen?«
»Hier gibt es keine Prinzen. Hier gibt es nicht mal Kennedys.«
»Zigeuner haben mich hier zurückgelassen.« Die Stimme des Frosches klang zunehmend herrisch. »Ich bin ein verzauberter Prinz. Ich bin Prinz Adamus d’Aurca. Mach was ich sage, und du wirst sehen, was passiert.«
Obwohl der kalte Schlamm ihren Hosenboden durchdrang, wurde es Buffy heiß vor Wut. Dieser Frosch sprach in demselben Ton wie ihr Exmann in seinen weniger liebenswerten Momenten.
Vor lauter Empörung vergaß sie, verblüfft zu sein, was gleichzeitig ihren Verstand aktivierte. Und sofort hatte sie sich wieder im Griff. Sie lächelte und sagte mit hoher, bewußt dümmlich und unterwürfig klingender Stimme: »Ich kann dich nicht küssen, wenn du dort bist und ich hier.«
»Dann komm rüber zu mir und mach’s!«
»Aber ich kann nicht schwimmen.« Das Wasser zwischen Buffy und dem Frosch war vielleicht dreißig Zentimeter tief, aber warum sollte sie ihre Turnschuhe naß machen? Sollte er doch zu ihr kommen.
Seine Hoheit, Prinz Adamus d’Aurca, maulte: »Heiliger Schwanzbeutel!«, stieß sich mit seinen kräftigen Hinterbeinen ab und tauchte in den Teich ein. Ein weiterer Stoß beförderte ihn aufs Schlammufer, dorthin, wo seine Prinzessin im Dreck thronte. Naß glänzend nach dem kurzen Bad und in ein geflecktes, saftiges Dunkelgrün getaucht, hüpfte er an Buffy vorbei und blieb erwartungsvoll in Reichweite sitzen.
Schweigend legte sie Daumen und Finger ihrer rechten Hand um seine wabbelig-weiche Mitte und hob ihn auf wie eine überreife Banane. Als Kind hatte sie sich ein paar Dollar verdient, indem sie Frösche für ihren Biologielehrer fing, so daß ihr die Berührung nicht fremd war. Doch selbst wenn sie tagtäglich Frösche anfassen müßte, könnte sie sich doch nie an die klebrige, feuchte Froschhaut gewöhnen, die wie ein schlaffer Hodensack in ihrer Hand lag. »Iiiih«, sagte sie.
Prinz Adamus streckte ihr sein plumpes Gesicht entgegen, das feuchte Maul leicht geöffnet. Seine Hinterbeine, doppelt so lang wie der Rest seines Körpers, zappelten unruhig. »Nun mach schon!« befahl er.
Buffy hielt ihn mit ausgestrecktem Arm möglichst weit von sich, stand schwerfällig auf und fuhr mit der anderen Hand in die Jackentasche.
»Küß mich.«
»Daraus wird nichts.« Buffy zog ihre Strickmütze aus der Tasche, beugte sich vornüber (etwas kurzatmig, da ihr der Bauch im Weg war) und weichte sie am Teichrand im Wasser ein, wobei interessante Schlammwölkchen aufwirbelten.
Die Froschstimme wurde ganz schrill. »Du hast gesagt, daß du mich küßt!« Mehr in Panik als in böser Absicht, sonderte er einen Exkrementenstrahl ab, der Buffys Fuß nur knapp verfehlte. »Du hast es versprochen!«
»Ich habe lediglich angedeutet, daß ich dich küssen würde.«
»Du hast mich getäuscht!«
»Pech gehabt.«
»Aber ich bin ein Prinz!«
»Wofür brauche ich verdammt noch mal einen Prinzen?« Männer. Jeder glaubt, etwas ganz Besonderes zu sein. »Ich bin gerade erst einen arschköpfigen Ehemann losgeworden. Ich brauche keinen neuen.« Besonders da sie einen Punkt in ihrem Leben erreicht hatte, wo das Zölibat der lähmenden Angst vor einer Schwangerschaft jederzeit vorzuziehen war. »Und von was in aller Welt willst du der Prinz sein? Von England? Von Monaco? Die Stellen sind bereits besetzt.«
»So ’ne Art Prinz bin ich nicht!«
»Was du nicht sagst.« Buffy zog ihre triefnasse Mütze aus dem Wasser, setzte vorsichtig den Frosch hinein, hielt sie oben zu und eilte schlammverschmutzt den Weg zurück, den sie gekommen war.
»Du nimmst mich gefangen!« Die Mütze bewegte sich heftig. Prinz Adamus’ Stimme drang gedämpft und hysterisch daraus hervor.
»Betrachte es einfach als einen Rollentausch«, sagte Buffy. »Du wirst einfach hinfortgerissen. Liest du denn keine Liebesromane?«
»Laß mich gehn!«
Buffy antwortete nicht. Sie stapfte schnaufend den ersten Hügel hinauf und konnte keinen Atem vergeuden. Aber ihre Gedanken waren auf hämische Weise viel heiterer als noch vor einer Stunde. Sie mußte daran denken, wie oft sie in den vergangenen Monaten bei der Vergabe von Geschichtenerzähl-Jobs übergangen worden war. Und wer hatte sie bekommen? Bessere Geschichtenerzähler? Nein, Leute mit einem zusätzlichen Gimmick. Ein Pantomime. Ein Clown. Ein Typ mit Zaubertricks.
»Laß mich frei! Ich, Prinz Adamus d’Aurca, befehle es!«
»Dafür kannst du dir auch nichts kaufen«, keuchte Buffy.
Die sumpfige Stimme des Frosches bekam etwas Flehendes. »Du glaubst nicht, daß ich ein Prinz bin?«
Sie hatte noch nicht weiter darüber nachgedacht und es auch keineswegs vor, besonders jetzt nicht, wo sie so verbittert war. »Ich hab dir doch gesagt, daß ich weder einen Prinzen brauche noch sonst ein männliches Exemplar der menschlichen Gattung«, brummte sie in Richtung Mütze. »Viel interessanter und derzeit wesentlich nützlicher für mich ist ein sprechender Frosch.«
Zwanzig Kilometer entfernt war ein plastikumsäumter Goldfischteich mit einem großen, giftgrünen Plastikfrosch, der hirnlos einen Wasserstrahl wie Pipi aus dem Maul spie. Die alte Frau haßte den Plastikteich, den hirnlosen Plastikfrosch, die alten Dummköpfe in Rollstühlen, die den Frosch hirnlos anstarrten, die Krankenschwestern, die sie zum Starren dorthinrollten, und sich selbst, weil sie genauso hirnlos war wie alle anderen. Obwohl kräftig und noch flink auf den Beinen, waren die Tassen aus ihrem Schrank verschwunden, hatte ihr Dach einen Schaden, war sie nicht richtig im Oberstübchen und für den Rest ihres Lebens unterbelichtet. Sie war Mom und nicht Mom. Sie hatte ein paar andere Namen, und sie wußte das auch, konnte sich aber nicht mehr an sie erinnern. Alles war sie selbst und auch etwas anderes, einschließlich sie selbst. Dieser Ort, wie nanntest du ihn noch, sie erinnerte sich nicht mehr, wie sie hierhergekommen war, all die hirnlosen uralten Menschen, die aufgereiht dasitzen, stumpfsinnig. Pi, pi, pi, machte der große Frosch, und ein hübsches Mädchen in Weiß kam auf sie zu, mit Plastiklächeln und einem gebrechlichen grauhaarigen Mann, der an ihrem Arm hing. Mom kannte ihn. Er saß da und spielte an seinen Pimmel herum, wenn er sich unbeobachtet glaubte. Mom rief laut wie eine Krähe: »Zu alt! Er ist zu alt für dich!«
Zu alt, alt, alt.
Das hübsche Mädchen in Weiß lächelte sie an, wortlos und ohne den Gesichtsausdruck zu ändern, eine Tochter, eine Krankenschwester, eine Braut in häßlichen Schuhen. Ja, es war eine Hochzeit, eine Hochzeit, eine Hochzeit so still wie eine Beerdigung. Jetzt erinnerte sich Mom. Sie erinnerte sich an ihre Hochzeit, an all die alten Leute mit ihren feierlichen Mienen. Aber die Braut war noch ein Kind. Die Braut war noch ein Kind.
Mom stand mucksmäuschenstill da und fühlte, wie ihr das Herz brach. Lichte Augenblicke bewirkten das immer bei ihr.
Sie flüsterte: »Ich verliere den Verstand.«
Weil sie ihr so das Herz brachen, ließ sie lichte Momente schnell vorbeiziehen. Den Verstand verloren und nichts davon übrig – das hatte die Heirat mit dem steinalten Mann ihr angetan. Alter Mann, der nur seinen zappelnden Wurm im Sinn hatte. Mom schrie und lachte und hüpfte wie eine Grille um den Goldfischteich. Mom fing an, sich auszuziehen.
»Sei still«, fuhr Buffy ihren brandneuen sprechenden Frosch an, als sie die triefnasse Mütze auf den Beifahrersitz ihres Escort legte.
»Monster, menschenfressende Riesin, ich spucke auf dein Nasenhaar.«
Buffy ließ den Wagen an, um ihren Fang nach Hause zu fahren, und legte ruckartig den Gang ein. »Sei still, oder ich nehme dir dein nettes feuchtes Gefängnis weg und lasse dich vertrocknen.«
»Du wolltest einen sprechenden Frosch, jetzt hast du einen sprechenden Frosch. Ich werde solange reden, bis du dir wünschst, in einen tauben Fisch verwandelt zu werden. Bimbam Schelle, Muschi ist in der Quelle, also da, wo auch ich verdammt noch mal sein sollte, in einer tiefen dunklen Quelle mit einer goldenen Kugel …«
»Dir ist doch sicher bekannt«, unterbrach Buffy ihn zuckersüß, »daß ein Frosch außerhalb des Wassers im vollen Sonnenlicht schon innerhalb weniger Minuten sein halbes Körpergewicht verlieren kann?«
»Du kannst mir keine Angst einjagen, alte Vettel. Ich habe Reiher und Eulen und die stinkenden Klauen von Waschbären überlebt, und ich werde auch dich überleben, du Hexe. Ich bin ein Prinz. Ich bin Prinz Adamus d’Aurca de la Pompe de la Trompe de l’Eau. Die Sonne ist nicht prächtiger, als ich es bin. Jungfern geraten bei der Erwähnung meines schönen Namens in Verzückung.«
Buffy war keine Jungfer und geriet auch nicht in Verzückung. Sie rollte die Augen und stellte das Autoradio an, um Prinz Adamus etc. zu übertönen. Klassikrock schüttelte die Lautsprecher.
»Aaah!« kreischte der Frosch. »Wilde im Anmarsch! Barbaren! Alle Mann in Stellung!«
Dabei war es lediglich John Cougar, der sein kleines Liedchen von Jack und Diane sang. Echt schön. Buffy stimmte ein, das Radio plärrte und der Frosch brüllte Verwünschungen, bis sie schließlich vor ihrem Haus anhielt.
Oder besser gesagt vor ihrer Bruchbude; der heruntergekommene Bungalow verdiente wohl kaum die Bezeichnung Haus. Ein exzentrischer Heimwerker hatte, die Zuhilfenahme von Lot und Reißschiene scheuend, die kleine Hütte aus dem Holz einer niedergebrannten Büstenhalterfabrik zusammengeschustert. Ein einstöckiger, windschiefer Bungalow mit schrägen Fenstern und Türen, schiefen Seitenwänden, einem Dach, das wohl ursprünglich für ein anderes Haus gedacht war, und einer angrenzenden Garage, die sich jedes Jahr mehrere Zentimeter den Hügel hinunter neigte. Aber was soll’s. Für ein Haus mit rechten Winkeln konnte Buffy die Miete nicht zahlen.
»… für ein Kunstwerk ein Prinz ist«, plapperte der Prinz. »Wie edel seine Beweggründe, wie grenzenlos seine Fähigkeiten, in Form und Bewegung so bestimmt und bewundernswert, seine Taten so engelsgleich! Ein Auffassungsvermögen wie ein Gott! Schönheit …«
Buffy hoffte, daß ihre Nachbarn nicht zu Hause waren und irgendwas davon mitbekamen, eilte mit ihm ins Haus und ließ ihn unsanft aus ihrer Mütze ins Aquarium plumpsen.
»… von dieser Welt. Das Muster von … blub!« Einen Moment lang selige Stille. »He!« beschwerte sich Adamus, als er wieder auftauchte. »Land! Ich bin eine Amphibie, ich brauche auch festen Boden!«
»Wir werden gleich sehen, wie lange du wassertreten kannst.« Buffy legte ihren schweren Reader’s Digest Weltatlas auf das Aquarium, um eine Flucht des Froschprinzen zu verhindern.
»Luft! Ich bin eine Amphibie, ich brauche Luft!«
»Wir werden gleich sehen, wie lange du durch die Haut atmen kannst.«
»Unflätiges Stachelschwein. Dreizüngige Schlampe! Alte Vettel!«
»Sehr gut, ausgezeichnet«, lobte Buffy und machte einen Abgang. Die Beleidigungen des Frosches heiterten sie auf. Sie waren viel interessanter als das, was sie gewöhnlich zu hören bekam. Amerikaner mußten wirklich lernen, einfallsreicher zu fluchen. Vielleicht sollten sie und der Frosch Unterricht erteilen?
Buffy lächelte beim Anblick des wildwuchernden Rechtecks hinter dem Haus, das der Besitzer Garten nannte. In ihrem Recyclingbehälter fand sie ein Glas mit Deckel, ging zum nächstgelegenen Abfallhaufen, spreizte die Beine mit mehr Entschlossenheit als Anmut, bückte sich und begann wie ein Bär zu buddeln. Sie drehte alte Schornsteinbrocken um und sammelte kleine rote Würmer, Kellerasseln und andere gruselige Kriechtierchen auf. Die gleiche Beute machte sie unter einem Backstein und einer kurzen, bemoosten und fauligen Holzplanke, die sie beide aufhob und mit zurück ins Haus nahm.
Der Frosch schwamm entspannt im chlorfreien Wasser des Aquariums, fing aber sofort an zu strampeln und mitleiderregend zu zappeln, als er sie kommen sah. »Monstrum! Mißgeburt!«
»Stimmt.« Sie legte ihre Beute auf ein Blatt Zeitungspapier, fischte eine Margarinedose aus der Geschirrablage, fand ihren Putzeimer und fing an, Wasser aus dem Aquarium zu schöpfen.
»Was machst du da? Wasser! Ich bin eine Amphibie, ich brauche Wasser!«
»Würdest du vielleicht still sein und etwas Respekt zeigen? Diese Goldfische werden deinetwegen geopfert.«
Aber der Frosch war nicht still. »Aristophanes hatte recht. Wir werden noch mehr Übel erdulden müssen, wir Frösche, wir werden noch mehr Übel erdulden müssen.«
Er fuhr fort, über das Schicksal der Frösche zu wehklagen, über Thomas den Reimschmied, Odysseus und andere berühmte Gefangene der Weltliteratur. Buffy ignorierte seinen Monolog, leerte das Aquarium bis auf etwa zehn Zentimeter Wasser aus, in dem drei Goldfische – Überbleibsel aus der Grundschulzeit ihrer jüngeren Tochter – trostlos herumschwammen. Sie zog das Plastikfarnkraut heraus, häufte einige Kieselsteine in einer Ecke auf, legte den Backstein und das Stück Holz darauf und schaffte so eine feuchte Plattform, auf der sich der Frosch außerhalb des Wassers ausruhen konnte. Die ganze Zeit über ließ sie ihn keinen Moment aus den Augen. Sollte er versuchen, aus dem Aquarium zu hüpfen, würde sie ihn auffangen. Aber er wirkte entmutigt. Er machte nur pro forma den Versuch, die Wand hochzuklettern, und stand dann mit seinen langen, schwimmhäutigen Hinterfüßen auf dem Kies, die vierfingrigen Hände ganz reizend ans Glas gedrückt.
»Hier«, sagte Buffy, »Abendessen«, und sie beförderte drei Käfer und einen roten Wurm aus ihrem Chilisoßenglas in den Glaspalast des Frosches.
Adamus flüchtete in die hinterste Ecke. »Iiihh! Würmer, Maden!«
»Ich kann mir vorstellen, daß du fliegende Insekten bevorzugst, aber …«
»Insekten? Du fliegenköpfiges altes Weib, seit tausend Jahren lebe ich von Insekten. Davon habe ich jetzt genug! Bring mir gebratenes Spanferkel, aber schnell!«
»Aber ich dachte, es muß noch zucken, damit du es fressen kannst.«
»Dann mach, daß es zuckt!«
Noch während Buffy über eine passende Entgegnung nachdachte, klopfte es an der Haustür. Sie rollte die Augen, knallte den Weltatlas aufs Aquarium, marschierte zur Tür und riß sie auf. Davor stand ihre Jüngste, gerade erst sechzehn, und so blond und exquisit und sauertöpfisch dreinschauend wie ein Girlie aus einer Calvin-Klein-Reklame.
»Emily!« Buffy konnte ihre spontane Freude nicht unterdrücken, was ihre Tochter regelmäßig mit einer finsteren Miene quittierte.
Emily reagierte wie erwartet. »Ich bin auf dem Weg in die Shopping Mall«, betonte sie, damit ihre Mutter auch ja nicht auf den Gedanken kam, daß der Besuch ihr gelte, »und mein blödes Auto ist stehengeblieben. Ich war auf der Suche nach einem Telefon und hab gesehn, daß du zu Hause bist. Warum bist du nicht auf der Arbeit?«
Buffy wich mit einer Gegenfrage aus. »Warum ist dein Auto stehengeblieben?«
»Als wenn ich das wüßte.« Mit ihren wunderschönen Augen musterte Emily gelangweilt ihre Mutter. »Mom, du siehst fürchterlich aus.« Emily trug ein dunkelgraues, geripptes Seidenoberteil, einen dunkelgrau- und blaßlilafarbenen langen weiten Rock und Birkenstockschuhe. Buffy trug hauptsächlich Dreck.
»Oh. Ja, ich muß mich saubermachen.« Buffy trat einen Schritt zur Seite und bat ihre Tochter mit einer Handbewegung hinein. Emily lief an Buffys Mobiliar vorbei, das zum größten Teil aus gebrauchten Stücken vom Flohmarkt bestand, und zeigte bemerkenswerte Reife und Zurückhaltung, indem sie nur ganz leicht die Lippen kräuselte. Unglücklicherweise strebte sie schnurstracks auf das Aquarium zu.
»Wie geht’s denn meinen Fischlein? Iijj!« Sie machte einen Satz zurück. »Iijj, igittigitt, was ist das denn?«
»Das ist ein Exemplar der Gattung Frosch«, sagte Buffy ganz ruhig, während sie sich die Hände in der Küchenspüle wusch. Sie gab sich ja Mühe, nicht alles auf die Goldwaage zu legen, fragte sich aber oft, wie sie zu dieser Tochter kam. Sie war zwar dabei gewesen, als Emily schlüpfte, aber trotzdem – konnten Mutter und Tochter so unterschiedlich sein? Buffy zwängte ihre glatten, angegrauten Haare gewöhnlich in einen Pferdeschwanz, den sie mit einem Gummiband zusammenhielt; Emily brauchte jeden Morgen zwanzig Minuten, um ihre dauergewellten Locken in Form zu bringen. Buffy rasierte ihre Beine nur, wenn sie zum Gynäkologen mußte; Emily rief den Notstand aus, wenn ihre Wegwerfrasierer alle waren. Buffy aß pfundweise Fleisch; Emily war Vegetarierin. Buffy angelte gern mit einem aufgespießten Wurm am Haken; Emily demonstrierte für Tierrechte. Buffy tötete Spinnen, die ins Haus kamen; Emily schmetterte ihnen Sopranschreie entgegen.
»Küß mich«, sagte der Frosch.
Emily schrie auf, machte einen noch größeren Satz zurück und hielt sich die Hände vor den Mund.
»Bitte!« Adamus richtete sich auf, wobei sein heller Bauch sichtbar wurde, und drückte die zierlichen Hände wieder ans Glas. »Ich bitte Euch inständig, edles Fräulein, befreit einen bemitleidenswerten Gefangenen. Ich bin ein verzauberter Prinz. Küßt mich und brecht den Bann, der über mich verhängt ist.«
Nett. Sie, Buffy, bekam die Peitsche und ihre Tochter das Zuckerbrot.
Emily, deren Girlie-Getue schlagartig verpufft war, starrte den Frosch mit großen Augen an. Buffy stand mit tropfenden Händen da und beobachtete ihre Tochter, prägte sich den Moment gut ein, denn trotz ihrer Wut schmolz ihr Herz dahin. Sobald die dünne Schale aus Teenagerblasiertheit einen Knacks bekam, war Emily so jung, so ernsthaft und so verletzlich.
»Wa-wa-wa-«, stammelte Emily.
»Das ist einfach ein ganz normaler sprechender Frosch«, sagte Buffy gedehnt, während sie sich die Hände am Pullover abtrocknete.
»Schöne, süße Prinzessin Emily«, flehte Adamus.
Buffy sagte: »Ich habe vor, ihn beim Geschichtenerzählen zu benutzen.«
Augenblicklich kam die unerbittliche Emily zurück, wandte sich gegen sie. »Na großartig, Mom. Ganz toll.«
Der Sarkasmus war Buffy so vertraut, daß sie kaum mehr mit der Wimper zuckte. »Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht?« Schnürschuhe beleidigten das erlesene Geschmacksempfinden dieses Mädchens. Die falsche Küchenrollenmarke. Kulis der Marke Bic. Beinahe alles.
»Oh. Verstehe. Du weißt es nicht?«
»Müßte ich das denn?« Unterdessen bettelte und brabbelte der Frosch, eine Nervensäge im Hintergrund, wie im Restaurant das weinende Baby anderer Leute. Buffy spürte erste Anzeichen von Kopfschmerzen. Es war schwer, nicht gereizt zu klingen.
»Aber sicher, wenn du nicht immer nur an dich selber denken würdest«, sagte Emily mit schriller Stimme. »Genau das hasse ich, Mom. Du bist so egoistisch! Du mußt alles und jedes für dich benutzen.«
Buffy seufzte und kniff die Lippen zusammen. »Benutzen« war offensichtlich das anstößige Wort gewesen, das sie besser vermieden hätte. Damals, als Emily hysterisch geworden war und darauf bestanden hatte, bei ihrem Vater zu wohnen, war »benutzen« eines der häufig verwendeten Worte in ihren Scheindiskussionen gewesen. Buffy hoffte, daß das Mädchen die Reife und Geduld, die sie, ihre Mutter, bewiesen hatte, eines Tages zu schätzen wissen würde. Sie hatte nicht versucht, Emily bei sich zu behalten, und verabscheute Menschen, die ihre Kinder als Waffe in einem erbitterten Scheidungskrieg »benutzten« – schon wieder das Wort. Emily hatte das Recht, ihren Vater zu lieben. Emily war schon immer Daddys kleine Prinzessin gewesen und außerdem an einen bestimmten Lebensstil gewöhnt. Und Emily war das Kind; ihre Bedürfnisse standen an erster Stelle. Buffy hatte ihre eigenen Gefühle hintangestellt und eingewilligt, sie bei ihrem geliebten Vater leben zu lassen.
Buffy merkte, wie sie vor Wut zitterte.
Aber sie hielt ihre Stimme im Zaum. »Emily, ich war diejenige, die benutzt wurde. Zwanzig Jahre lang.«
»Dann machst du die verlorene Zeit aber in Windeseile wieder wett.«
»Stimmt.« Das hatten sie alles schon mehrmals durchgekaut. Buffy verdrehte die Augen und ließ das Thema fallen. »Komm, wir sehen mal nach, was dein Auto hat.«
»Und was ist mit meinen Fischlein? Sie haben nicht genug Wasser. Das ist genau das, was ich meine … du kriegst einen sprechenden Frosch, und schon ist dir egal, was mit meinen Fischlein passiert!«
»Prinzessin, du mußt mich küssen!« Die Vehemenz des Frosches hatte sich in Raserei gesteigert, und er schoß wie angestochen im Aquarium umher.
»Herr im Himmel, dann kümmer dich doch selber um deine verdammten Fischlein!« Wie kam es eigentlich, daß die Pflege der lieben Haustierchen immer an den Müttern hängenblieb? Buffy, die ihre Gereiztheit nicht länger unterdrücken konnte, zog Plastiktüten aus einer Schublade und füllte sie heftig spritzend mit dem Aquariumwasser, das noch immer im Putzeimer mitten im Zimmer stand. »Mach schon, hol sie raus, bevor er sie auffrißt.«
»Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin!« Der Frosch hüpfte aufgeregt umher und blieb dann hoch aufgerichtet stehen, als Emily sich mit dem Kescher näherte. Sie starrte ihn an, die jungen Augen wie mitternachtsblauer Samt, und plötzlich fühlte Buffy sich unbehaglich.
»Also gut, ich mache es schon.« Sie nahm ihrer Tochter den Kescher aus der Hand. Der Frosch verkroch sich schweigend in eine Ecke, während sie die Fische aus ihrem zu flachen Gewässer holte.
»Was meint er damit, er sei ein verzauberter Prinz?« fragte Emily, die hinter Buffys breiter, dreckverkrusteter Rückseite stand.
Dank moderner Erziehung hatte das Mädchen wahrscheinlich noch nie etwas von dem Märchen gehört. Es war schon komisch, daß in der Grimmschen Version die Prinzessin den Frosch nicht küßt, sondern ihn wutentbrannt mit voller Wucht an die Wand schleudert, und genau dadurch verwandelt er sich in »einen Prinzen mit freundlichen und wunderschönen Augen«. Echt abartig. Eine interessante Variante der zahlreichen älteren Versionen, die noch abartiger waren. In einigen davon schlief die Prinzessin drei Wochen lang mit dem Frosch, bevor er sich schließlich in einen Prinzen verwandelte.
»Mach dir darüber keine Gedanken«, erklärte Buffy ihrer Tochter. »Es bedeutet gar nichts. Er ist wie ein Papagei und plappert einfach nur rum.«
Zweites Kapitel
Buffy erkannte auf den ersten Blick, was mit Emilys nagelneuem malvenfarbenem metallic-lackierten Ford, den Daddy ihr geschenkt hatte, nicht stimmte. »Du mußt Benzin nachfüllen, Schatz«, sagte sie so freundlich wie möglich.
»Oh. Na ja, woher soll ich das wissen? Den Sarkasmus kannst du dir sparen.«
Emilys Verärgerung war jedoch nicht so groß, daß sie sich selbst um die Beseitigung des Problems gekümmert hätte. Sie haßte Benzingeruch an den Händen oder – Gott bewahre! – an der Kleidung. Buffy war es, die bei der Tankstelle an der Ecke einen Kanister borgte, Benzin kaufte und in Emilys Tank füllte, damit Emily zur Zapfsäule fahren konnte; sie bezahlte zudem die Tankfüllung und stand am Bürgersteig, um ihrer Tochter hinterherzuwinken. Doch Emily brauste ohne sich umzusehen in Richtung Shopping Mall davon.
Emily lebte für dieses Einkaufsparadies. Daß sie nicht auch darin lebte, lag allein daran, daß es nachts geschlossen hatte. Die Mall war ihr ein und alles – Märchenwelt, Konsumparadies, Gegenwart und Zukunft. In der Mall traf sie ihre Freunde. Ja, die Shopping Mall war ihr Freund. Und seit der Scheidung ersetzte sie ihr auch die Familie, dachte Buffy niedergeschlagen; sie liebte diesen Konsumtempel offensichtlich mehr als ihr Zuhause, mehr als ihre richtige Mutter.
Buffy stieß einen Seufzer aus, machte noch einen Abstecher zur Tankstelle, um sich eine Trosttüte Kartoffelchips zu kaufen, und trottete dann mampfend nach Hause.
Immerhin, es gab ja auch Lichtblicke. Zumindest hatte sie ihren sprechenden Frosch.
»Hallo Frosch.«
Er saß auf seinem Backstein im Schatten des Weltatlas und beäugte Buffy mürrisch. Eine Antwort bekam sie nicht. Anscheinend mißfiel Prinz Adamus d’Aurca die saloppe Begrüßung.
»Ich mach’s dir ein bißchen gemütlicher.« Buffy polterte in den Keller hinunter, wo Stücke des schweren Maschendrahts lagen, mit dem der Besitzer des Hauses sein Anwesen vielleicht mal auf Ghetto zu trimmen gedacht hatte; sie nahm sich einen kleinen Rest davon, ging hinauf und legte ihn anstelle des Atlasses aufs Aquarium. Jetzt bekam ihr Baby auch Luft. Sie bog die Ecken um, damit der Draht nicht verrutschte, hastete hinaus in den Garten (wobei diverse Körperteile heftig hüpften) und holte vier Steine, um die Ecken zu beschweren und Baby an der Flucht aus dem Laufställchen zu hindern. Als nächstes plazierte sie eine Pflanzenlampe über dem Aquarium, damit Baby es schön warm hatte. Dabei opferte sie bereitwillig das Wohlergehen ihrer Topfpflanzen, wie sie auch die Fische zu opfern bereit gewesen war. Die Käfer kletterten umgehend aus dem Aquarium, aber der rote Wurm war schon ertrunken; sie nahm ihn heraus. »Bald gibt’s Abendessen«, gurrte sie. Höchst zufrieden mit sich und ihren mütterlichen Vorkehrungen, duschte Buffy, wechselte (endlich) die Kleidung und steckte ihre Jeans in die Waschmaschine. Dann wärmte sie ein Brathähnchen in der Mikrowelle auf, pulte das helle Fleisch vom Flügel, hob das neue Maschendrahtdach an und wedelte mit dem Flügel vor der Froschnase herum. Und der Frosch biß zu.
Wie eine in Bedrängnis geratene Maus war er hochgesprungen und hatte sie in den Finger gebissen. Es war wie der Angriff einer Heftmaschine mit Gummiklammern. Die beiden lächerlichen Zähne in seinem Oberkiefer hinterließen gerade mal zwei Bluttropfen – eine Maus hätte da mehr Schaden angerichtet. Trotzdem lief es Buffy eiskalt den Rücken hinunter. Und sie wurde sauer. Sie zog die Hand zurück und damit das Essen. »Dann hungerst du eben!« schrie sie ihn an.
»Mit Freuden, du übergewichtige Schlampe.«
Buffy ließ ihr Hähnchen links liegen, stürmte zum Kühlschrank und holte einen Familienbecher Eiscreme aus dem Gefrierfach.
Sie hockte sich an den Tisch und begann, ihr aufgewühltes Innenleben mittels Kältezufuhr zu besänftigen. Der Frosch hatte jedoch sein stoisches Schweigen aufgegeben und jammerte nun in einem fort. »Ich bin ein Prinz, gib mir ein Shrimps. Darnieder liegt Adam, in Fesseln gebunden, lulli, lulla, lulla, laß mich hier raus du stummelzähnige Schrulla!«
Buffy griff nach der Tüte Schokoküsse von Hershey. »Halt’s Maul.«
»Mettwurstiger Rollmops!«
»Halt’s Maul.«
»Wer will mir den Mund verbieten? Ich bin ein Prinz vom königlichen Geblüt derer von Aurca. Ich …«
Buffy sprang auf. »Es war einmal«, brüllte sie, »eine laute Prinzessin. Sie konnte lauter heulen als Wölfe und Wind und Donner, sie konnte eine Rohrdommel übertönen, sie konnte durch ihre Schreie Gänse vom Himmel fallen lassen. Aber ihre Mutter sagte ihr …« Als der Frosch sich still hinhockte und sie mit großen Augen anstarrte, senkte Buffy ihre Stimme und flüsterte. »Ihre Mutter sagte ihr, daß kein Prinz sie jemals heiraten würde, wenn sie nicht mit leiser Stimme sprechen würde. Also sprach sie leise und lächelte lieblich, und ein Prinz heiratete sie. Und ihre Mutter war glücklich. Aber die Mutter des Prinzen war eine Hexe.« Buffy dachte an ihre eigene frühere Schwiegermutter und verzog das Gesicht. Sie erfand die Geschichte beim Erzählen, aber das Magenkribbeln sagte ihr, daß sie gut war. »Eines Tages bekam die Prinzessin eine Tochter, ein kleines Mädchen, das wie eine rosafarbene Rose erblühte. Und als sie mit ihrer Tochter im Arm in ihrem weißen Spitzenbett lag, sagte die Hexe zu ihr: ›Gib mir das Kind‹, und die Prinzessin sagte laut: ›Nein‹, denn sie wollte nicht, daß die Hexe ihre kleine Tochter berührte. Aber weil die Prinzessin laut gesprochen hatte, belegte die Hexe sie mit einem Fluch …«
Buffy hielt inne, atmete tief durch und überlegte sich einen Fluch. Der Frosch wartete geduldig, daß sie weitererzählte.
»Der Fluch der Hexe über die Prinzessin lautete, daß von jetzt an nur noch die Vögel in der Luft sie hören konnten. Und so geschah es. Ihre Tochter wuchs heran, und wenn die laute Prinzessin sagte: ›Ich bin deine Mutter‹, setzten sich Zaunkönige auf ihre Schulter, aber das kleine Mädchen konnte sie nicht hören. Wenn die laute Prinzessin sagte: ›Ich liebe dich‹, kamen Schwäne und legten sich ihr zu Füßen, aber das kleine Mädchen konnte sie nicht hören. Das kleine Mädchen sagte: ›Wer ist diese Frau?‹, und ihre Großmutter, die Hexe, sagte: ›Das ist deine Stiefmutter‹ Und das kleine Mädchen hatte gehört, daß alle Stiefmütter gemein und bösartig waren. Also wickelte es ein Stück Brot und Käse und einen Apfel in ein Seidentuch und machte sich auf die Suche nach seiner richtigen Mutter.
Es wanderte von einem Königreich zum anderen, war müde vom vielen Laufen und konnte doch keine Mutter finden. Als es sich auf einer grünen Wiese zum Essen niedersetzte, kamen Lerchen angeflogen und versuchten, an ihrem Brot und Käse zu picken, aber das Mädchen verscheuchte sie. Dann legte es sich zum Schlafen nieder. Doch plötzlich flogen alle Vögel auf der Wiese davon. Das kleine Mädchen wußte nicht, was sie aufgeschreckt hatte.
›Mein Kind! Wo ist mein kleines Mädchen?‹«
Buffy spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete, erzählte aber weiter.
»Die laute Prinzessin weinte so laut, daß alle Vögel auf Erden erschraken. Aber zu Hause konnte sie niemand hören. Laut rufend suchte sie im Schloß von den Türmen bis zu den Kerkern, doch niemand antwortete ihr. Sie schrie ihre Schwiegermutter an: ›Wo ist mein Kind?‹, aber die Hexe hörte sie nicht. Sie schrie ihren Mann, den Prinzen, an: ›Wo ist meine kleine Tochter?‹, aber er hörte sie nicht, und es war ihm auch egal. Sie schrie so laut, daß die Steine des Schlosses Risse bekamen, und als sie dann laut rufend durch das Tor hinauseilte, fiel das ganze Schloß hinter ihr zusammen. Und nun konnten die Hexe und der Prinz sie ganz gewiß nicht mehr hören, denn sie waren tot.«
Reines Wunschdenken, dachte Buffy. Aber es war eine gute Geschichte. Sie spürte es am Magenkribbeln. Sie erzählte weiter.
»›Wo ist meine kleine Tochter?‹, schrie die laute Prinzessin, und ein Falke kam vom Himmel geflogen und sagte: ›Ich bringe dich zu ihr‹.
In weiter Ferne machte sich das Mädchen wieder auf den Weg. Es konnte nicht schlafen, und so lief es immer weiter, von einem Königreich zum anderen, und konnte doch keine Mutter finden. Als es müde vom Laufen war, ließ es sich in einem Wald zum Essen nieder, und die Drosseln versuchten, an ihrem Brot und Käse zu picken, aber das Mädchen verscheuchte sie. Es …« Buffy wollte eigentlich an dem Schema festhalten, weil in Märchen immer alles dreifach passierte, aber egal. Es gab ja auch die künstlerische Freiheit. »Es wanderte so lange umher, bis nur noch der Apfel übrig war. Als es an einen See kam und die Wasservögel versuchten, an ihrem Apfel zu picken, fing es an zu weinen. ›Ach, ihr könnt ihn haben‹, sagte es und gab ihren Apfel einem Schwan. ›Alles, was ich will, ist meine Mutter‹.
Aber als das Mädchen den Apfel weggab, hörte es, was es zuvor nicht hatte hören können: Es hörte die Vögel sprechen. Ein Falke kam herbeigeflogen und sagte: ›Hier kommt deine Mutter.‹ Eine Lerche flatterte auf und sang: ›Deine richtige Mutter.‹ Eine Drossel rief: ›Deine wirkliche Mutter, die dich liebt.‹ Und weil die Vögel ihm die Ohren geöffnet hatten, konnte das kleine Mädchen schon aus meilenweiter Entfernung hören, wie die laute Prinzessin ihm entgegeneilte und rief: ›Meine Tochter, mein Baby, wo ist mein kleines Mädchen?‹ Und das kleine Mädchen sprang auf und rief: ›Mama! Ich bin hier!«‹
Buffy wollte eigentlich noch erzählen, daß die beiden sich im Wald in einem Häuschen niederließen, von den Vögeln mit Nahrung versorgt wurden und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber wegen dem Kloß im Hals mußte sie ihre Geschichte frühzeitig beenden. Sie setzte sich hin.
»Ist das alles?« fragte Adamus mit leiser, froschiger Stimme.
»Ja.«
»Sie war wunderschön. Bitte, erzähl noch eine.«
Buffy richtete sich auf ihrem Stuhl auf und starrte ihn an. Seine Pupillen glitzerten wie schwarze Tränen.
»Sie hat dir wirklich gefallen?«
»Ja! Sie hat mich getröstet. Sie hat mich zurück in die Zeit versetzt, als ich …« Er sprach nicht weiter.
Was der Frosch gesagt hatte, verschlug Buffy die Sprache. Die gefühlsmäßigen Reaktionen des Publikums auf ihre Vorträge waren gemeinhin eher lauwarm. Ihr Ehemann hatte sich nie für ihre Geschichten interessiert, ob sie nun erfunden waren oder nacherzählt, ob sie aus Boulevardblättern stammten oder sie sie selbst im Supermarkt erlebt hatte. Und mit ihrer Lebensgeschichte brauchte sie ihm schon gar nicht zu kommen – Prentis wollte nichts davon hören. Bei ihren Kindern – Marjorie, die jetzt verheiratet war und in Wisconsin lebte; Curtis, der gerade das College abschloß, und Emily – war es schon kurz vor dem Teenageralter mit dem Zuhören vorbei. Die Kinder auf Schulund Geburtstagspartys rollten die Augen und bevorzugten Videospiele. Sie hörten nur zu, weil sie von den Erwachsenen dazu gezwungen wurden – als wären die Geschichten Spinat und deshalb gut für sie. Selbst der Spiegel in Buffys Badezimmer hatte beim Lauschen einen zynischen Glanz.
Aber Adamus hatte entzückt zugehört, mit nachtschwarz glänzenden Augen.
Buffy wußte nicht, was sie sagen sollte. »Willst du jetzt dein Abendessen?« brachte sie schließlich hervor.
»Nein, vielen Dank. Ich muß nicht jeden Tag essen. Ich könnte jetzt nichts runterbringen. Deine Geschichte klingt in mir nach.«
Buffy war stumm vor Dankbarkeit.
Adamus sagte: »Ich habe die Geschichte noch nie zuvor gehört. Woher kennst du sie?«
»Ich habe sie mir gerade ausgedacht.«
»Du hast sie selbst erfunden? Aber … sie hallt wie Glocken wider, die kein Sterblicher hören sollte.«
Das Lob und Staunen des Frosches wirkte echt und warmherzig, doch Buffy durchzuckte es eiskalt. Glocken, die kein Sterblicher hören sollte? Solchen Übertreibungen mißtraute sie. »Es ist nur eine Geschichte«, murmelte sie.
»Nur eine Geschichte? Ist Aschenbrödel nur eine Geschichte? Ist Die Schöne und das Biest …«
Moment mal. »Ich bin Märchenerzählerin«, unterbrach Buffy ihn. Sie war hier der Profi, das war schließlich ihr Beruf – oder vielmehr ihre Berufung. »Ich kenne die Märchen, ich benutze sie in meinen Geschichten. Aber ich bin nicht verrückt. Ich glaube doch nicht, daß sie wahr sind.«
Schweigen. Der Frosch saß da wie ein grüngesprenkelter Stein.
»Es sind einfach nur Geschichten«, wiederholte Buffy.
Die Stimme des Frosches glich einem eisigen Wind, der über Glockenblumen wehte: »Bin ich nur eine Geschichte?«
Buffy stand auf. Es war erst sieben Uhr, und bestimmt war Emily mit ihren Freunden noch in der Shopping Mall. Für die meisten Leute fing der Abend gerade erst an, aber das war ihr alles egal. Der Tag war einfach zu merkwürdig gewesen. »Ich gehe ins Bett.«
»Aber es ist unmöglich, daß du nicht an sie glaubst«, sagte Adamus. »Du mußt an sie glauben, sie für wahr halten. Du kannst mich hören. Es sind schon viele Prinzessinnen an dem Teich vorbeigekommen, aber du bist die einzige, die mich hören konnte.«
Schwachsinn. Der Frosch mußte irgendeine Art Trick sein. Vielleicht experimentierte die Regierung gerade mit neuer Spionagetechnologie und sie hatte einen entlaufenen Spionfrosch gefunden. Früher in der High School hatten die Lehrer so etwas als ein Wunder der modernen Technik bezeichnet. Ungefähr zu dieser Zeit hatte Buffy aufgehört sich zu fragen, wie das alles funktionierte. Nach ihrer Erfahrung gaben die meisten Frauen ihre Neugierde auf – sie nutzte ja sowieso nichts. Sich zu fragen, wie ein Auto funktionierte oder das Computersystem der Bank oder das Außenministerium, brachte einen nicht weiter. Für Frauen drehte sich die Welt nur um Lippenstift und Glück. Es ging darum, den richtigen Ehemann zu finden. Oder einen sprechenden Frosch. »Gute Nacht«, sagte Buffy.
»Nein. Laß mich raus«, flehte der Frosch. »Bitte. Ich bin in einen fremden Körper verbannt, und jetzt steckst du mich auch noch in dieses Glasgefängnis …«
»Also hör mal, bei mir hast du alles, was du brauchst«, entgegnete Buffy. »Essen, Licht, Wärme, deinen eigenen kleinen Sumpf, ärztliche Behandlung im Krankheitsfall. Also, wo ist das Problem? Bei mir bist du in Sicherheit. Keine Schlangen oder Reiher, nichts, was Jagd auf dich macht …«
»Wirst du mich küssen? Küß mich oder laß mich frei!«
»Gute Nacht.« Buffy knipste das Licht aus. Der Frosch hockte in seinem Glaspalast, ein algenfarbener, schweigender Kloß, dessen Kehle pulsierte wie ein schlagendes Herz.