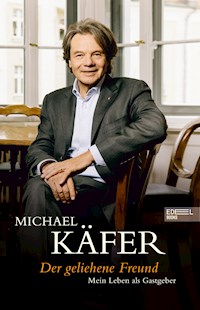
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Münchner Michael Käfer gehört zu den spannendsten Unternehmern Deutschlands. Er leitet ein Feinkost- und Fine-Dining-Imperium, das weit über die bayrischen Grenzen hinaus reicht. Sein Party-Dienst wird von St. Tropez bis Moskau gebucht. Er bekocht die politische Elite Deutschlands, ebenso wie Gäste im Lokal Käfer in Tokio und Shanghai verköstigt werden. In seiner Autobiografie zeigt sich Michael Käfer von seiner persönlichen Seite. Er gewährt tiefe Einblicke in seine Welt als Gastgeber, Unternehmer und Familienmensch. Eine Welt, zu der der Fußball ebenso gehört wie Politik und Kunst. Aufgewachsen in großer Distanz zu seinem Vater, steigt er nach wilden Jahren als Gründer des P1, der legendären Münchner Nobeldisco, doch in das väterliche Familienunternehmen ein, und führt es erfolgreich zur heutigen Größe. Neben dem Unternehmertum und der Gastronomie ist Fußball eine weitere große Leidenschaft im Leben Michael Käfers. So ist die Käfer Wiesn-Schänke auf dem Oktoberfest ebenso legendär wie die Feste, die er für Spieler und Funktionäre des FC Bayern München ausrichtete, dem er eng verbunden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Prolog
Die verlorenen Karten
Moderüffel vom Kaiser
Bankdrücker bei der Alkoholverdunstungsstunde
Eine Cola für Rummenigge
Neue Vorhänge für Neuschwanstein
Schwarzmarktgeschäfte
Mein Basquiat
Eine Nacht mit Papa
Sechzig Flaschen Champagner
Nachtschichten bei Gisela
Krisenstimmung bei Gunter Sachs
Schwankender Ozeanriese
New Yorker Lektionen für die Nacht
Ein Hochzeitstag in den Fischhallen
München boomt
Nachts im Einser
Birnen und Bankräuber
Erfrischungstücher mit Zitronengeschmack
In luftigen Höhen
Die Erpressung
Dämmerzustand
Flip-Flop-Held
Das Erkenschwick-Dilemma
Nachts im Englischen Garten
Unbezahlbare Schätze
Der falsche Wagen
Bauchgrummeln
Freundschaften
Epilog
Danksagung
Quellen und Literaturhinweise
PROLOG
Mit einem Mal stand da dieser Mann vor mir. Aus dem Nichts war er aufgetaucht und lächelte mich ein wenig verkrampft an. Ich kannte sein Gesicht, konnte es aber nicht sofort zuordnen. Irgendetwas passte nicht, dachte ich mir, während ich ihn dezent von oben bis unten scannte.
Er trug eine knielange Lederhose und ein blütenweißes Trachtenhemd. Sein Janker stand ihm gut. Aber die weißen Sneaker, die er dazu gewählt hatte, irritierten mich ein wenig.
»Sie müssen mir bitte helfen«, sagte der Zuagroaste. Dass er kein gebürtiger Münchner, ja nicht einmal Bayer war, ließ nicht nur sein nicht ganz traditionelles Wiesn-Outfit, sondern auch sein lupenreines Hochdeutsch vermuten.
In der Hand hielt er sein Handy, darunter geklemmt mehrere Blätter Papier und einen Stift.
»Uli Hoeneß ruft mich jeden Moment zurück. Ich brauche dringend ein Plätzchen, an dem ich mit ihm in Ruhe sprechen kann«, bat der Mann mit leichter Nervosität.
Langsam dämmerte es mir, woher ich ihn kannte. Wir waren uns schon auf diversen Sportpartys begegnet. Er war Reporter, arbeitete für die Bild München. Wo immer der Rekordmeister war, war er auch.
Ich musste ein bisschen grinsen angesichts seiner Bitte. Wir waren auf der Wiesn. Auf dem größten Volksfest der Welt. Inmitten dieses wundervollen, blau-weißen Ausnahmezustands, bei dem sich das Grölen von Tausenden Stimmen mit dem Klirren von Krügen und dem Rhythmus der Musikkapellen zu einem herrlich fröhlichen Klangbad vermischt. In den Zelten ist es laut, vor den Fahrgeschäften sowieso. Hier ein Rattern, da ein Kreischen. Überall wird der Freude lautstark Ausdruck verliehen.
»Kommen Sie bitte mit«, sagte ich zu Kai Psotta, inzwischen war mir sein Name wieder eingefallen. Ich führte ihn raus aus unserer Käfer-Schänke und brachte ihn zu einem der Container, die wir hinter unserem Festzelt aufgestellt hatten. Dort befanden sich unsere Wiesn-Büros, zu denen eigentlich nur unsere Mitarbeiter Zutritt haben. Ein anderer Ort, um in Ruhe mit Uli Hoeneß zu telefonieren, fiel mir auf die Schnelle nicht ein.
Warum und wieso dieses Interview so dringend war, dass Kai Psotta seine Maß und sein Hendl sofort stehen ließ, wusste ich nicht, aber das war auch nicht entscheidend. Uli Hoeneß und er werden ihre Gründe für das Spontangespräch gehabt haben. Mehr als drei Stunden hockte er in unserem Bürocontainer. Spätabends entdeckte ich ihn wieder an seinem Tisch, mit den Freunden ausgelassen schunkelnd. Offensichtlich war das improvisierte Gespräch erfolgreich geführt und in die Redaktion übermittelt worden.
Wir verloren uns nicht mehr aus den Augen. Ein paar Jahre später saß er sogar mit seiner Verlobten bei mir im Büro und wir planten ihre Feier nach der standesamtlichen Trauung bei uns im Restaurant.
Sie entschieden sich für die Hochzeits- und Kristallstube. Wir servierten ein Hochzeitssuppentreppchen mit einer Rinderkraftbrühe, einer Bärlauchcremesuppe mit pochierten Wachteleiern und einer Essenz von Strauchtomaten-Topfennockerl mit Basilikumschaum. Als Hauptgang gab es unter anderem Spargel mit einem Kaiserkalb und Morchelrahmsoße.
Im Vorfeld erfuhr ich viel über die beiden, über ihr Kennenlernen und ihre Familien und Freunde. Wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. Sie öffneten mir, wie ganz viele unserer Kunden, für die wir Events planen dürfen, ihr Herz und baten mich wie einen Freund, ins Innenleben ihrer Familie einzutreten. Ich wurde, wie ich es gerne ausdrücke, zu einem geliehenen Freund für Kai und Christina.
Für einen bestimmten Zeitraum lässt einen der Gast nah an sich heran, teilt mit uns manchmal auch intimste Familiengeheimnisse, wenn es zum Beispiel um die Sitzordnung geht – und wer auf keinen Fall nebeneinander platziert werden sollte.
Doch nach Abschluss der Feier war es das auch. Dann entfernen wir uns wieder. Die Intensität der Gespräche nimmt ab.
Doch in dem Fall war es anders. Seitdem kommen einen Tag vor Weihnachten Psottas, inzwischen mit zwei Kindern, immer zu uns – und auch an ihrem Hochzeitstag, dann allerdings allein.
Wir sind verbunden geblieben. Auch nachdem Kai seinen Job als Journalist hinter sich gelassen hat. Nun besucht er uns mit seinen Klienten; er arbeitet im Management von namhaften Fußballern. Das Interesse an Menschen, seine Neugier, seine Lust am Fragestellen und Hinterfragen hat er nie verloren. So hat er sich auch immer für mich interessiert und nach meiner Geschichte gefragt und mir genau zugehört. Und irgendwann, wir kannten uns schon zehn Jahre, gemeint, dass es lohnend sei, meine Geschichte aufzuschreiben.
Ich hatte das nie für mich in Erwägung gezogen. Aktiv wäre ich niemals auf die Suche nach einem Ghostwriter oder einem Verlag gegangen. Aber die Anfrage erwischte mich mitten im Corona-Lockdown, noch dazu zu einer Zeit, in der ich mich intensiv mit mir und meiner künftigen Rolle im Unternehmen beschäftigte.
Michael Reichardt, ein ganz, ganz enger Freund und auch Förderer von mir, hatte mir kurze Zeit zuvor einen Satz gesagt, der hängen geblieben war: »Man schaut in den Spiegel und sieht nicht, wie alt man geworden ist.«
Ich habe zwar keine Angst vorm Älterwerden und behaupte mal, auch keinem verschobenen Selbstbild zu unterliegen. Trotzdem hatte mich Michaels Satz dazu gebracht, mich mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen.
Ich bin 64 Jahre alt, meine beiden Söhne, die gerade zehn Jahre alt sind, sind noch zu jung, um direkt meine Nachfolge im Unternehmen anzutreten. Deshalb beschäftige ich mich auch mit diesem Thema.
Um meine Rolle für die Zukunft zu finden, hilft es, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen. Ganz genau in den Spiegel zu schauen. Die Werte herauszuarbeiten, die ich mir zu eigen gemacht habe und die mich geprägt haben. Mir selbst noch einmal zu vergegenwärtigen, wie ich mich entwickelt habe und was mir wichtig ist.
Also habe ich zugestimmt, mich in vielen, vielen Gesprächen meiner Geschichte zu stellen, Einblicke zu gewähren, die ich bisher nicht zugelassen habe. Der Blick in die eigene Vergangenheit hilft, um sich der Zukunft zu stellen und klarer in sie zu blicken.
Ich habe Kai Psotta meine Geschichte erzählen lassen. Nicht in Form einer klassischen, vollständigen Autobiografie. Mein Leben muss nicht lückenlos erzählt werden. Auch nicht in der Selbstherrlichkeit eines Ratgebers. Sondern Episoden und Erlebnisse ausbreitend, in dem Rahmen, der mir als Dienstleister und geliehener Freund erlaubt ist, wohl wissend, dass meine Kunden immer auch ein Höchstmaß an Diskretion von mir erwarten und es selbstverständlich auch bekommen.
Und wenn letztlich doch der ein oder andere Rat hängen bleibt, meine Geschichte und Erfahrungen exemplarisch anderen Leute helfen, dann freut es mich umso mehr.
Ich lebe vom Dankeschön meiner Kunden. Denn jedes Fest ist immer ein Danke an die eingeladenen Personen.
Deshalb möchte ich Ihnen, verehrte Leserin, lieber Leser, noch bevor Sie den ersten Satz meiner Geschichte gelesen haben, für Ihr Vertrauen danken, mich und uns als geliehene Freunde gewählt zu haben. Wir waren und sind sehr, sehr gerne und mit größter Leidenschaft an Ihrer Seite!
KAPITEL 1
DIE VERLORENEN KARTEN
Eben waren sie noch da. Jetzt waren sie unauffindbar. Weg, verschwunden, egal wie tief ich auch in meinen Hosentaschen buddelte.
Vor zehn Minuten, da war ich mir sicher, hatte ich sie noch in meinen Händen gehalten.
Eilig rannte ich zurück zum Fanshop, der eigentlich nicht mehr war als ein umdisponierter Anhänger, wo ich vor wenigen Minuten zwei Fanschals für mich und meinen Freund Detlef gekauft hatte. »Finale Wembley 2013« war darauf mit weißer Wolle auf rotem Grund gestickt, denn selbstverständlich hatte ich die Bayern-Edition gekauft – die schwarz-gelbe Variante überließ ich den BVB-Anhängern.
Eine beachtliche Schlange hatte sich mittlerweile gebildet. Über mangelnden Umsatz konnte sich der Verkäufer an diesem Champions-League-Finaltag gewiss nicht beschweren, schoss es dem Unternehmer in mir durch den Kopf, während der Fußball-Fan in mir den Verkaufstresen scannte, in der Hoffnung, dort meine verlorenen Eintrittskarten zu entdecken.
Ich rief mir den Ablauf der letzten Minuten in Erinnerung. Nach dem Kauf der Schals hatte ich die Verpackung in einen Mülleimer gestopft. Hatte ich dabei womöglich mehr als nur überflüssiges Plastik und Pappe weggeschmissen? Nämlich aus Versehen unsere Karten?
So was passiert mir eigentlich nie. Ich habe sogar für Handy und Autoschlüssel jeweils einen festen Ablageplatz bei uns im Haus, wo beides deponiert wird, sobald ich heimkomme.
Also begann ich im Abfall zu wühlen. Dummerweise hatte wohl kurz vorher irgendein Fan seinen nicht ganz leeren Bierbecher in die Tonne gekippt. Jedenfalls war alles, was sich in der obersten Schicht befand, triefend durchnässt, teilweise auch noch mit Senf beschmiert. Unsere Karten aber, senfverschmiert oder bierfeucht, in dem Moment war mir das einerlei, blieben verschwunden.
Ich zückte mein Handy, um dem Rest unserer Reisetruppe mein Missgeschick mitzuteilen und den verdienten Spott zu kassieren. Aber bei so vielen Menschen geballt auf einem Haufen, die allesamt versuchten, noch Fotos an die Daheimgebliebenen zu schicken oder sie telefonisch an der Stimmung teilhaben zu lassen, kam – wenig überraschend – erst gar keine Verbindung zustande.
Keine Karten. Kein Handyempfang. Und weniger als eine Stunde, bis das Spiel des Jahrzehnts beginnen sollte.
Weiter vom Stadion wegzugehen, bis Telefonieren wieder möglich wäre, und mich bei einem der Bayern-Verantwortlichen zu melden, damit er Detlef und mich ins Stadion bringt, war für mich vollkommen ausgeschlossen. Ich hatte vorher schon geholfen, einen meiner Bekannten mit seiner Frau nach dem Finalspiel zum feierlichen Bankett des FC Bayern ins Lancaster Hotel zu bringen. Aber für mich selbst, auch wenn Detlef dadurch mit der Leittragende war, würde ich meine guten persönlichen Beziehungen in dieser vertrackten Situation nicht ausnutzen.
Unsere Männer-Reisegruppe war erst am Mittag am Flughafen Heathrow angekommen. Mit einem Minivan hatten wir uns Richtung Stadion bringen lassen. Es gab gut gekühltes Dosenbier, während ein Fahrer uns durch den zähen Londoner Verkehr chauffierte, und Fachsimpelei vom Allerfeinsten.
Ich hoffte so sehr, dass die Bayern gewannen. Ich hatte 370 Tage zuvor aus nächster Nähe in die leeren Gesichter der Bayern-Profis geschaut, nachdem sie das Finale dahoam gegen Chelsea verloren hatten. Wir waren vom Verein ausgewählt worden, die Party hinterher im Postpalast zu veranstalten. Eine große Ehre, der wir natürlich mit einem rauschenden Fest gerecht werden wollten.
So oft schon hatten wir mit den Bayern unglaubliche Nächte erlebt. Zum Beispiel mein persönlicher Favorit: der 50. Geburtstag von Ottmar Hitzfeld. Nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund, mit denen er zweimal die Meisterschaft und einmal die Champions League gewonnen und somit den Aufstieg zum Welt-Clubtrainer geschafft hatte, war er ein halbes Jahr zuvor nach München gekommen. Uli Hoeneß hatte mich gebeten, Hitzfeld im Januar 1999 ein Geburtstagsfest auszurichten, das er nie vergessen würde. »Ich möchte, dass er sich endgültig in München und unsere Gastfreundschaft verliebt. Das muss ein Fest werden, wie Hitzfeld es noch nie erlebt hat.«
Wir organisierten es auf der Praterinsel, einem der schönsten Plätze Münchens. Wo früher Franziskanermönche ihr Gemüse anbauten, wunderschöne Kastanien im Garten stehen und die Isar fließt, erfüllten wir Ulis Wunsch.
Auch bei der zweitbesten Feier, die ich mit Bayern erleben durfte, war Ottmar Hitzfeld dabei. Es war gerade einmal eineinhalb Jahre nach seiner großen Geburtstagssause.
Am 30. Spieltag der Saison 1999/2000 hatte Bayern die Tabellenführung verloren. Nach einer Pleite gegen – heute schwer vorstellbar – 1860 München. Bei den Löwen spielten damals noch so klangvolle Namen wie Thomas Häßler und Martin Max, Trainer war Werner Lorant.
Leverkusen schob sich an meinen Bayern vorbei und hielt die Spitzenposition bis zum letzten Spieltag, an dem sie bei der Spielvereinigung Unterhaching antreten mussten. Eine vermeintlich klare Angelegenheit. Die Leverkusener hatten fast doppelt so viele Tore erzielt – was sich in der Tabelle mit neun Plätzen Unterschied zu den Hachingern bemerkbar machte. Außerdem waren sie seit vierzehn Spieltagen ungeschlagen und entsprechend selbstbewusst.
Der Sportpark Unterhaching, Ort des Showdowns, erinnerte mit seinen 10 000 Zuschauerplätzen eher an eine Dorfsportanlage. Na ja, streng genommen ist er das ja auch. Ein paar Journalisten lästerten, es hätte den Anschein, als würde Leverkusen in einem Vorbereitungsspiel gegen einen Sechstligisten antreten und nicht im entscheidenden Spiel um die Deutsche Meisterschaft.
Medienwirksam hatte Uli Hoeneß den Hachinger Spielern »Weißwürste bis zum Abwinken« versprochen, sollten sie Leverkusen schlagen. Und Stefan Effenberg, damals Kapitän der Bayern, versuchte durch öffentliche Sticheleien Nervosität zu schüren: »Die Nerven verliert man nur in Extremsituationen, und Leverkusen erlebt am Samstag eine solche. Die Bayer-Elf hat mehr zu verlieren als wir. Als Leverkusener Spieler würde ich, wenn es dieses Jahr mit dem Titel nichts werden sollte, jahrelang das Kotzen kriegen.«
Lediglich vierzehn Kilometer Luftlinie trennten Bayer und Bayern in diesem Fernduell, für die Münchner ging es am gleichen Tag im ehrwürdigen Olympiastadion gegen Werder Bremen.
Ich war an diesem Nachmittag nur wenige Minuten vom Unterhachinger Sportpark entfernt und bereitete mit meiner Mannschaft in der Alten Gärtnerei in Sauerlach eine, so war es explizit geordert worden, Saisonabschlussfeier vor. Denn trotz aller öffentlichen Kampfansagen und Durchhalteparolen glaubte in Wirklichkeit kaum jemand daran, die Leverkusener, die lediglich ein Pünktchen brauchten, noch abzufangen.
Während wir dekorierten und der Location den letzten Schliff verliehen, liefen die Radios. Außerdem hatte ich noch einen Fernseher samt Decoder in die Alte Gärtnerei bringen lassen. Damals hieß Sky noch Premiere, und die meisten Fernseher, inklusive meinem mitgebrachten, waren noch quadratisch und verdammt schwer. Erst im Jahr zuvor waren überhaupt die ersten Plasmageräte auf dem Markt erschienen. Die waren schweineteuer, kosteten weit über 20 000 Mark – und ihre Bildqualität war im Vergleich zu heute, nun ja, Sechste gegen Erste Liga.
Tom Bayer meldete sich aus dem Olympiastadion, Marcel Reif war in Unterhaching, ich in der Alten Gärtnerei. Wo ich mich gerade darüber ärgerte, dass die Stühle nicht vernünftig aufgestellt waren. Sie standen aus meiner Sicht zu wild, also mit unterschiedlichen Abständen zum Tisch.
Die Lektion habe ich schon als Fünfzehnjähriger gelernt. Ich arbeitete damals bei einer Veranstaltung im Münchner Hofbräuhaus einem Oberkellner zu. Es galt, ein Event für knapp 1000 Leute vorzubereiten. Die sollten an zehn Tischen sitzen, mit jeweils fünfzig Stühlen pro Seite.
Am Ende des Aufbaus holte der etwa sechzigjährige Oberkellner eine Kordel hervor, befestigte sie an der Lehne des Stuhls, der am Tischende stand, und richtete alle anderen Stühle millimetergenau an ihr aus.
»Warum machen Sie das?«, fragte ich ihn. »Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist doch nicht schlimm, wenn da mal ein Stuhl einen Zentimeter weiter vorne steht.«
»Doch«, entgegnete er. »Erstens haben die Besucher, wenn sie eintreten, das Recht, einen perfekten Saal präsentiert zu bekommen. Das sieht einfach schön aus, wenn alles vernünftig steht. Und außerdem«, so erklärte er mir, »und das ist noch viel wichtiger, zeigen wir damit unseren Mitarbeitern, dass wir total ordentlich arbeiten und dass es auch auf die kleinsten Kleinigkeiten ankommt. Wenn wir Ordnung und Klarheit von unseren Mitarbeitern einfordern, dann muss ich die auch selbst vorleben. Und zwar überall.«
Wie gesagt, Lektion gelernt, also war ich gerade dabei, unsere Stühle entsprechend zu verrücken, als Tom Bayer seine Stimme erhob. Carsten Jancker hatte soeben, nach nur zwei Minuten Spielzeit, die Münchner Führung erzielt.
Zehn Minuten später rannte ich schon wieder zum Fernseher, um mir die Wiederholung von Janckers zweitem Treffer anzuschauen, nachdem er auf 2:0 gegen Werder erhöht hatte. Mein Herz begann schneller zu schlagen.
*
Ich bin Bayern-Fan, solange ich denken kann. Und zwar wegen eines Mannes, den nur die wenigsten kennen: Hans Bauer, der erste Weltmeister des FC Bayern. So mehr oder minder jedenfalls. Im Finale von 1954 gegen Ungarn ließ ihn Bundestrainer Sepp Herberger nicht ran. Auch nicht im Halbfinale gegen Österreich. Und genauso wenig im Viertelfinale gegen Jugoslawien. Immerhin stand er aber beim vorherigen Entscheidungsspiel gegen die Türkei, beim 7:2, 90 Minuten auf dem Platz. Und er gehörte auch zur Elf, die in der Vorrunde mit 3:8 gegen Ungarn verloren hatte.
Als die Mannschaft mit dem WM-Titel im Gepäck aus Bern zurück nach Deutschland kam, wurde ihr auf dem Münchner Rathausbalkon ein rauschender Empfang bereitet. Der damalige Oberbürgermeister Thomas Wimmer ehrte die Weltmeister um Fritz Walter, Helmut Rahn und Toni Turek, hob aber in seiner Rede explizit hervor, »dass mit Hans Bauer auch ein Münchner in der deutschen Expedition stand«.
Damit war Bauer, auch wenn es ihm selbst unangenehm war, in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen mehr Weltmeister, als es vielleicht in Wirklichkeit der Fall war.
Aber den Münchnern tat es gut, so ihren Teil am »Wunder von Bern« zu haben und entsprechend begeistert mitzufeiern.
Man mag es heute kaum glauben, aber Erfolge waren zu dieser Zeit beim FC Bayern keine Selbstverständlichkeit. Gerade mal ein einziger Deutscher Meistertitel war bis dato geholt worden. Im Dezember 1957 kam der erste Erfolg im DFB-Pokal hinzu, und Hans Bauer durfte als Kapitän im Augsburger Rosenaustadion die verdiente Trophäe entgegennehmen. Und er bekam, so wie alle anderen aus der Siegermannschaft, einen Ring, ähnlich wie die Ringe, die auch heute noch beim Gewinn der NBA-Meisterschaft verliehen werden.
Diesen Ring hat Hans Bauer mir geschenkt. Er war die Jugendliebe meiner Mutter, ist mit ihr sogar viele Jahrzehnte später im hohen Alter noch einmal zusammen gewesen. Sie sind einst als Jugendliche in der gleichen Nachbarschaft aufgewachsen – und hatten ihr ganzes Leben lang eine besondere, innige Verbindung zueinander, die sie nie ganz losgelassen hat.
Ich war sieben Jahre alt, vielleicht acht, so ganz genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, als meine Mutter Hans fragte, ob ich nicht irgendwo in einem Verein Fußball spielen könne. Meine Eltern hatten sich gerade getrennt und meine Mutter versuchte mir Halt, Stabilität und Ablenkung zu bieten.
Hans hatte zu dem Zeitpunkt seine Karriere bereits seit mehreren Jahren beendet, kannte an der Säbener Straße aber natürlich Gott und die Welt, sodass ich beim Training vorbeischauen durfte.
Das Gelände des FC Bayern hatte mit dem heutigen rein gar nichts zu tun. Es gab kein Klubhaus, keinen Fanshop, keine Schranken oder Tiefgaragen mit direktem Kabinenzugang. Auch Fußballplätze gab es nur einen oder zwei, ansonsten war da ein großes Baseballfeld, das vermutlich die Amerikaner in der Besatzungszeit angelegt hatten.
Umziehen musste man sich in einer Baracke. Wenn man da unvorsichtig auf den Bänken hin- und herrutschte, konnte es passieren, dass man sich Spreißel in den Allerwertesten einzog. Trotzdem fühlte ich mich wohl. Am Wochenende trugen wir graue Trikots mit einem weinroten Streifen. Und Schnüren am V-Ausschnitt. Trotz aller Einfachheit hatte es für mich etwas Erhabenes, in diesen Dress zu schlüpfen.
Ich war nie sonderlich gut. Im Laufe der Jahre wurde meine Position auf dem Spielfeld immer defensiver, bis ich schließlich ins Tor gesteckt wurde. Meine Reaktionen waren immerhin so, dass ich auf der Linie eine passable Figur abgab. Kritisch wurde es, wenn ein Rückpass kam, den ich zwar laut Regelwerk damals noch mit der Hand aufnehmen durfte, der mir aber trotzdem jedes Mal aufs Neue, auch wegen einer gewissen Unkonzentriertheit, Probleme bereitete.
Meiner Verbundenheit mit dem Verein tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil, der FC Bayern wurde immer mehr emotionale Heimat für mich.
Mit zwölf Jahren, es war im September 1970, besuchte ich zum ersten Mal ein Spiel im Grünwalder Stadion. Damals war das Olympiastadion für die Spiele zwei Jahre später noch im Bau. Die Bayern traten gegen Gladbach an.
Als Libero fungierte Franz Beckenbauer, der wenige Tage zuvor seinen 25. Geburtstag gefeiert hatte. Georg Schwarzenbeck und Gerd Müller trafen für uns. Klaus-Dieter Sieloff und Jupp Heynckes für die Borussia.
Ich stand unmittelbar hinter Wolfgang Kleff, dem Schlussmann der Borussia, und rief vorpubertäres Zeug, um ihn aus der Fassung zu bringen, bei dem ich mich unheimlich witzig fand. Kleff war derlei Rufe hinter seinem Tor wohl gewohnt und beachtete uns gar nicht.
Uli Hoeneß, der wenige Monate zuvor zu uns gewechselt war, konnte nicht spielen, was mich total ärgerte. Dieser junge Kerl, mit seinem unbändigen Willen, ein Spiel zu gestalten, an sich zu reißen und Verantwortung zu übernehmen, hatte mich sofort in seinen Fußballbann gezogen. Er führte die Bayern dreimal in Folge zur Deutschen Meisterschaft, machte sie zum Pokalsieger und ebenfalls dreimal in Folge zum Europapokalsieger der Landesmeister. Und dann, im Oktober 1978, kam er auf die Schnapsidee, nach Nürnberg zu gehen – ich konnte es nicht fassen!
Heute würde man seinen Unmut darüber auf Instagram äußern oder bei Twitter. In 180 Zeichen. Oder wie wenig Text man auch immer dort zur Verfügung hat. Man würde großzügig Emojis benutzen und öffentliche Zustimmung ernten – oder einen Shitstorm.
Aber 1978 hieß Social Media eben Deutsche Bundespost. Also habe ich mich hingesetzt und Hoeneß einen Brief geschrieben, in dem ich meine Wut, Enttäuschung und Fassungslosigkeit zum Ausdruck brachte. Mit jeder Zeile, die ich mehr zu Papier brachte, wurde meine Schrift krakeliger, so sauer war ich, dass mein Idol meinen Verein im Stich lassen wollte. »Wie kannst du uns Bayern-Fans das nur antun«, warf ich ihm vor und noch vieles mehr. Am Ende fehlte mir der Mut, ihn abzuschicken.
Zu der Zeit war mein Vater bereits ziemlich eng mit einigen prägenden Bayern-Machern befreundet und hatte auch geschäftlich viel mit ihnen zu tun. Zum Beispiel mit Robert Schwan, den Karl-Heinz Rummenigge viele Jahrzehnte später als großen Visionär beschrieben hat, »der in seiner Art den FC Bayern groß gemacht hat und dazu beitrug, dass unser Verein zu den Großen des internationalen Fußballs gehört«.
Schwan war vor seiner Zeit als Bayern-Manager Gemüsehändler auf dem Viktualienmarkt und arbeitete auch als Versicherungsdirektor. Als er sich einst der Mannschaft vorstellte, sagte er: »Ich will nicht viele Worte machen, Fußball spielen kann ich nicht, aber dafür seid ihr ja da. Ich werde darauf achten, dass die Kasse stimmt, auch eure. Man hat mir gesagt, dass ihr nach einem Sieg immer nur eine schöne Rede gehört habt. Ich rede nicht gern. Aber ich schlage was anderes vor. Wenn ihr gewinnt, gibt es hundert Mark für jeden, bei Unentschieden fünfzig Mark.«
Auch Willi Hoffmann, der erst Schriftführer, dann Schatzmeister und später Präsident des FC Bayern war, gehörte zu den Vertrauten meines Vaters. Willi war häufig Gast bei uns im Laden, feierte nach Siegen gerne mit Champagner, was den Münchner Boulevard freute und ihm den Spitznamen »Champagner-Willi« einbrachte, der rasch Kultstatus erlangte.
Willi hatte einen Sohn, Lemmy, der mein bester Freund wurde. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium, spielten auf dem Shakespeareplatz Fußball. Ich wurde für die Familie zu einem sechsten Kind, sie nahmen mich am Wochenende mit, wenn sie in ihr Ferienhaus an den Ammersee fuhren, und auch mit in den Urlaub.
KAPITEL 2
MODERÜFFEL VOM KAISER
Diese Kontakte meines Vaters öffneten mir – ohne dass ich darum gebeten hatte – Türen, die zu der damaligen Zeit allerdings gar nicht richtig verschlossen waren. Wenn mein Vater geschäftlich mit den Bayern zu tun hatte, nahm er mich einfach mit. Und weil Fußballer damals noch keine Entourage hatten, jedenfalls nicht so wie heute, und auch keine Millionen Follower auf Social-Media-Kanälen, überhaupt alles ein wenig unaufgeregter war als heute, durfte ich zum Beispiel einfach mitfliegen, als es für Bayern im Mai 1974 nach Brüssel ging, um im Heysel-Stadion, das seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr so heißt, gegen Atlético Madrid im Finale des Europapokals der Landesmeister anzutreten.
Nach der Ankunft in Brüssel, verspätet wegen einer Bombendrohung, die sich als ganz schlechter Scherz entpuppte, checkte ich im gleichen Hotel ein wie die Bayern-Profis und wohnte auf dem gleichen Flur wie sie. Das war einerseits Wahnsinn, andererseits fühlte ich mich in dieser gelassenen Atmosphäre einfach als geduldeter Teil der Reisegruppe.
Am Abend vor dem großen Finale lief ich Franz Beckenbauer in die Arme, als ich gerade mein Zimmer verließ. Er war mittlerweile 28 Jahre alt, zwölf Jahre älter als ich, hatte im Sommer 1972 die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zum EM-Titel geführt und war im Anschluss zum ersten Mal mit dem Ballon d’Or als bester Fußballer Europas ausgezeichnet worden. Und er war der Kaiser.
Am 10. Juni 1969, das habe ich viele Jahre später nachgelesen, hatte die Bild-Zeitung ihn erstmals so genannt. Genauer, nachdem die Münchner zum ersten Mal Bundesligameister geworden waren und Beckenbauer von den Reportern die dritte Saison in Folge die beste Durchschnittsnote aller Ligaspieler erhalten hatte. Da Gerd Müller damals schon als »Bomber der Nation« bezeichnet wurde, es für seinen genialen Doppelpasspartner aber bis dahin keinen adäquaten Superlativ gab, ernannte Bild ihn kurzerhand zum »Kaiser von Bayern«.
Kurze Zeit später, es dürften wirklich nur wenige Tage gewesen sein, traten die Bayern im Frankfurter Waldstadion zum Pokalfinale gegen Schalke an. Spielführer der Königsblauen war Reinhard Libuda, den sie im Pott nur »Stan« nannten. Dort wurde er als Jahrhundert-Dribbler verehrt. Und als Meister des Antäuschens. »An Gott kommt keiner vorbei«, verkündete angeblich in den Sechzigerjahren eine Plakataktion des amerikanischen Predigers Billy Graham. Und angeblich schrieb ein Schalke-Fan darunter an die Litfaßsäule: »… außer Stan Libuda«.
Andere Ruhrgebietslegenden behaupteten, er, der den Ehrentitel »König von Westfalen« trug, könne drei Gegner in einer Telefonzelle ausspielen. Und dass an einem seiner guten Tage, an denen er einen Haken nach dem anderen schlug, selbst ein Rudel Jagdhunde ihn nicht hätte einfangen können.
Franz Beckenbauer reichte ein Griff an die Hose und Libuda stoppte gezwungenermaßen. Dieses Foul kam einer Majestätsbeleidigung gleich. Die Schalke-Anhänger pfiffen bei jedem seiner Ballkontakte, was Beckenbauer dazu verleitete, kurz vor einem Eckball genau vor ihnen provokant den Ball zu jonglieren – und eine private Zirkusnummer aufzuführen.
Nach dieser zur Schau gestellten Selbstherrlichkeit und einem 2:1-Sieg griffen auch andere Zeitungen, von der tz bis zur Süddeutschen, den Beinamen »Kaiser« auf.
Nachdem dann auch – eher aus Zufall – nach einem Freundschaftsspiel bei Austria in der Wiener Hofburg ein Foto von Beckenbauer neben einer Büste seines Halb-Namensvetters, des früheren Habsburger Kaisers Franz Joseph I., entstanden war und wieder vom »Kaiser« geschrieben wurde, war der Ehrentitel endgültig in aller Munde, nicht zuletzt dank der entsprechenden Bebilderung.
Bei dem Auftritt in der Hofburg war Beckenbauer in einem gemusterten Sakko herumstolziert, das nur wenige tragen können beziehungsweise sich trauen zu tragen.
Beckenbauer war also Fußballkaiser, aber auch ein bissl Modekaiser. Und als solcher watschte er mich bei dieser Begegnung vor meinem Hotelzimmer ab.
Kurz vor der Reise hatte ich mir ein Paar sündhaft teurer Plateauschuhe gekauft. Lange hatte ich dafür gespart. Die waren für mich mehr als nur ein schnöder Gebrauchsgegenstand. Aber auch kein klobiger Beinverlängerer, um mit jemandem auf Augenhöhe zu kommen, so wie es Humphrey Bogart beim Casablanca-Dreh machen musste, um Ingrid Bergman in die Augen schauen zu können. Ich trug sie nicht aus Hochstapelei, sondern putzte und polierte sie schon vor dem ersten Tragen. Über die Schuhe wollte ich mich ausdrücken.
Mehrere hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Male hatte ich im Feinkostladen meines Vaters die Einkäufe der Kunden feinsäuberlich in Tüten gepackt und sie ihnen nach draußen getragen, um mir so ein kleines Trinkgeld zu verdienen. Ebenso eisern hatte ich die Pfennigbeträge gespart, die es von meiner Mutter und unseren Nachbarn gab, wenn ich mich am Tag, wenn der Heizöllieferant kam, als Laufbursche und Packesel verdient gemacht hatte. Die neue Lieferung wurde, weil es billiger war, immer nur bis an die Tür gebracht. Von dort aus stapfte ich, mit einem Zehn-Liter-Kanister bewaffnet, wieder und wieder und wieder die Treppe rauf und runter, bis die Speicher der Heizungen auf den jeweiligen Etagen befüllt waren. Ich meine, es waren etwa fünfzig Pfennig, die ich im Höchstfall pro Wohnung erhielt. Eigentlich viel zu wenig, vor allem angesichts der Hausbesitzerin, die zur Furie werden konnte, wenn ich dabei auch nur den kleinsten Tropfen Öl im Treppenhaus verschüttete, das mit Teppich ausgelegt war.
Die Schuhe fielen also in die Rubrik »hart erarbeitet«. Doch anstatt bewundert zu werden, so stylisch aufzutreten, fragte mich Beckenbauer nur ungläubig: »Wen willst du damit denn erschrecken? Schreckliche Dinger.«
Minuten später schmiss ich die Schuhe in meinen Koffer und zog sie nie wieder an. Mein Selbstbewusstsein, mit dem ich hohen Fußes aus dem Zimmer stolziert war, zerplatzte wie ein Luftballon. Aus Stolz wurde Scham. Aus der Überzeugung, en vogue zu sein, wurde die Brüsseler Schuheschande. Aber so war das in den Siebzigern: Von der Lässigkeit zur Peinlichkeit war es im wahrsten Sinne des Wortes oft nur ein kleiner Schritt.
Das Spiel war mäßig, jedenfalls erinnere ich mich an nicht mehr viel, womöglich auch, weil mir der Moderüffel von Beckenbauer wirklich zugesetzt hatte. Nach neunzig Minuten war noch immer kein Tor gefallen. Die »Los Colchoneros«, so wurden die Spieler von Atlético mit ihren gestreiften Trikots genannt, die an ähnlich gestaltete Matratzen erinnerten, hatten auf dem Weg ins Finale ohnehin nur zwei Gegentreffer kassiert, und diese zudem in Abwesenheit ihrer Nummer eins.
Meine Bayern hatten sich bis zu diesem Finale teils dramatische Schlachten geliefert. Bereits das Weiterkommen in der ersten Runde gegen den schwedischen Verein Atvidabergs war alles andere als ein Selbstläufer gewesen. Nach einem souveränen 3:1 im Hinspiel hatte Hoeneß die Bayern gerade so ins Elfmeterschießen gerettet, das sie für sich entscheiden konnten.
Gegen Dynamo Dresden, im damals ersten Duell eines BRD-Meisters gegen einen Champion aus dem Osten nach siebzehn Jahren Europapokal, drohte ebenfalls ein Ausscheiden. Mein Vater war von Robert Schwan gebeten worden, das Catering zu übernehmen. Die Bayern waren skeptisch, ob die Köche in Dresden nicht irgendwas ins Essen mischen würden, damit die Münchner über den Toiletten hängen würden. Weil es meinem Vater nicht erlaubt wurde, die Hotelküche vor Ort zu benutzen, bereitete er das Essen in einem Omnibus auf dem Parkplatz vor der Unterkunft vor.
Doch nun standen die Bayern in Brüssel im Finale und mussten in die Verlängerung. Unruhig rutschte ich auf meinem Platz hin und her. Beckenbauer hatte ich nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit und ein paar guten Aktionen doch zu verzeihen beschlossen. Ich wollte unbedingt diesen Sieg meiner Bayern.
Die Nachspielzeit war fast vorüber, als Atlético einen Freistoß aus nur siebzehn Metern Torentfernung zugesprochen bekam. Luis Aragonés legte sich den Ball am linken Strafraumeck bereit. Er machte nur fünf Schritte, dann zirkelte er den Ball mit seinem rechten Fuß so präzise über die Mauer ins linke Eck, dass Sepp Maier gar nicht erst den Versuch unternahm, ihn zu erreichen. Bereits bevor der Ball die Torlinie überquert hatte, jubelte Aragonés – während bei mir von einer auf die nächste Sekunde die komplette Körperspannung entwich und ich auf meinem Platz zusammensackte. Das konnte doch nicht wahr sein!
Nun rannten die Spieler von Atlético, wann immer sie den Ball hatten, damit in Richtung einer der Eckfahnen und versuchten alles, damit meine Bayern in den verbleibenden Minuten gar nicht erst noch einmal in Ballbesitz kommen konnten. Es war zum Verzweifeln. Es war grauenhaft – als würde man einen Sekundenzeiger mit den Augen verfolgen, wie er erbarmungslos und in immer dem gleichen, nervig schnellen Takt weitertickte.
Tatsächlich waren es nur wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff, als Bayern endlich doch einmal den Ball bekam. Schiedsrichter Vital Loraux hatte soeben auf seine Uhr geschaut, und Trainer Udo Lattek stapfte bereits in Richtung Kabinentrakt. Noch einmal trieb Beckenbauer den Ball durchs Mittelfeld, wusste aber nicht so richtig etwas mit ihm anzufangen. Also passte er ihn zu Georg Schwarzenbeck weiter.
Für die meisten Fans, auch in der anschließenden Berichterstattung, war Schwarzenbeck eher der Adjutant des Kaisers und von dessen Glanz überstrahlt. Ein Vorstopper, schmucklos und unscheinbar. Vor allem nahm ihn die breite Masse kaum in der gegnerischen Hälfte und schon gar nicht als Goalgetter wahr.
Bei mir aber kamen sofort Erinnerungen an meinen erwähnten ersten Stadionbesuch bei einem Spiel der Bayern hoch. An diesen besonderen Samstag im September 1970, als ich erstmals Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller spielen gesehen hatte. Als ich zum ersten Mal von den übrigen 44 000 Zuschauern im Grünwalder Stadion in den Bann gezogen wurde, wie sie das 2:2 gegen Gladbach bejubelten, die immerhin als Tabellenführer gekommen waren. Es war genau 15.44 Uhr, als ich das erste Mal gespürt habe, welche Emotionen Bayern München auslösen kann, nachdem Georg Schwarzenbeck nach Vorarbeit von Gerd Müller den Führungstreffer geschossen hatte.
Schwarzenbeck war für mich nie nur ein Putzer des Kaisers oder bloß ein Torverhinderer. Er hatte sich als erster echter Torschütze in mein Gehirn gebrannt. Kein Wunder, dass ich nun, nicht ganz vier Jahre später in Brüssel, plötzlich merkte, wie im Bruchteil weniger Sekunden wieder Hoffnung in mir aufkeimte.
Schwarzenbeck war irgendwas zwischen fünfundzwanzig und dreißig Metern vom Tor von Miguel Reina, dem Unbezwungenen, entfernt. Mindestens zwölf Beine und zwei Hände waren in seinem Weg. Doch als Beckenbauer ihm zurief, er solle einfach schießen, tat er es – und schrieb mit seinem Wunderschuss Geschichte.
Der brachte ihm ein Gedicht von Wolf Wondratschek ein, einem Mann, der viel im alten Schumann’s abhing und mit dessen Besitzer Charles boxen ging, aber auch immer wieder bei uns im P1 war – und Bayern München ein Wiederholungsspiel, da es damals bei einem Unentschieden noch kein Elfmeterschießen gab.
Zwei Beine, ohne Interesse an Genialität,
vereinfachter Mechanismus, nichts
Brasilianisches,
kein Sternenlauf, kein Jubel in den
Fußgelenken,
Standbein, Schussbein, nichts für
Genießer,
und trotzdem einer, dessen die
Menschen,
die ihn spielen sahen, gedenken.
Ein großer Dorn, der stach und dicht-
hielt,
der die Anstürmenden ersaufen ließ, das
Feuer zertrat,
das sie bereit waren zu entfachen.
Nichts da,
ich arbeite, ich komme aus der Vorstadt,
ich bin geboren für das Einfache.
Nicht einmal
Siege sind es am Ende, die zählen.
Unzuständig für alles Künstlerische!
Kein Dribbling, kein nie gesehener
Trick,
stattdessen Luft für neunzig Minuten,
und notfalls
für die Verlängerung, wenn die Kollegen
Krämpfe quälen.
Merkwürdig, dass so einer, eckig wie eine
leer gegessene
Pralinenschachtel, etwas trifft, das rund
ist.
Karl-Heinz Rummenigge, der erst wenige Monate später aus Lippstadt nach München wechselte, sagte viele Jahrzehnte später, als er Vorstandsvorsitzender der Bayern war: »Das war vielleicht das wichtigste Tor in 116 Jahren Bayern München.«
Unmittelbar nach dem Treffer von Schwarzenbeck sei Atlético, so beschrieb es Reina, »innerhalb von Sekunden in eine tiefe Depression gefallen. Und zwar körperlich wie mental, wir waren wandelnde Leichen.«
Im Nachholspiel, das zwei Tage später im gleichen Stadion stattfand, hatte sich Atlético immer noch nicht von dem Schrecken erholt. Uli Hoeneß erzielte zwei Tore, Gerd Müller ebenfalls. Es war die Sternstunde meines Klubs, der Beginn einer Ära, mit drei Landesmeistertiteln in Folge, bei der ich hautnah dabei sein durfte. Und ich meine wirklich hautnah.
KAPITEL 3
BANKDRÜCKER BEI DER ALKOHOLVERDUNSTUNGSSTUNDE
Das Finale war am Freitag gegen 22 Uhr abgepfiffen worden. Am Samstag um 15.30 Uhr hatten die Bayern zum letzten Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach anzutreten. Eigentlich ein absolutes Topspiel. Der Erste gegen den Zweiten. Beide hatten zwanzig Siege in der Saison geholt. Doch weil Gladbach am vorletzten Spieltag gegen Düsseldorf verloren hatte, war die Entscheidung um die Meisterschaft bereits gefallen.
Trotzdem mussten die Bayern 17 Stunden und 30 Minuten nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte im Bökelbergstadion sein – und zumindest physische Präsenz zeigen. Zu mehr waren sie auch nicht in der Lage.
Von Brüssel nach Mönchengladbach waren es 185 Kilometer mit dem Bus. Vier Stunden dauerte die Fahrt. Ich war todmüde und so ausgelaugt, als hätte ich selbst 210 Minuten Fußball gespielt. Doch an Schlafen war im Mannschaftsbus, der sich in einen Partybus verwandelt hatte, nicht zu denken. Der Busfahrer hatte eine Kassette, eines dieser Dinger, die man vor Jahren halt benutzte, um Musik abzuspielen, in den Rekorder geschoben. Nun hatte so eine Kassette pro Seite dreißig oder sogar fünfundvierzig Minuten Spielzeit, aber unser Fahrer hatte, so habe ich es in Erinnerung, anscheinend nur ein Lied aufgenommen, aber das hatte es in sich: Vicky Leandros’ Hit Theo, wir fahr’n nach Lodz. Immer und immer wieder spulte er zurück auf Anfang, selbst nach der x-fachen Wiederholung schien der Chart-Knaller niemandem aus den Ohren herauszukommen. Immer und immer wieder ging es musikalisch nach Lodz, während wir an Viversel, Zonhoven und Genk vorbeituckerten.





























