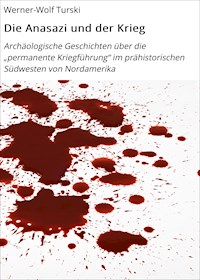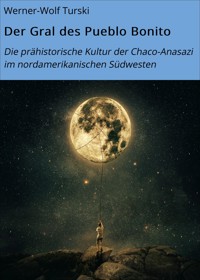
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das reale Spiritualgefäß "Bonito-Gral" wird als "Aufhänger" für die Darstellung der Herausbildung der Kultur der Chaco-Anasazi genommen. Die Darstellung knüpft an archäologich belegte wissenschaftliche Fakten an und verknüpft diese mit substistenziellen, geographisch-topographischen und tendenziell belegten klimatischen Erscheinungen. Wesentlich sind die Interpretation spiritueller Anlagen und die möglichen Ursachen ihrer Erscheinung und Veränderung im Laufe der Zeit. Im Text wird auf achtenswerte archäologische Leistungen und noch offene Leistungsfelder der Archäologen sowie auf Bereiche hingewiesen, die sich einer archäologischen Erkenntnis entziehen. Das vom Autor angestrebte möglichst realitätsnahe Bild über die Kultur der Chaco-Anasazi weicht teilweise stark von aktuellen Mainstream ab. Es gibt jedoch keine Wahrheit an sich, sondern nur unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner-Wolf Turski
Der Gral des Pueblo Bonito
Die prähistorische Kultur der Chaco-Anasazi im nordamerikanischen Südwesten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort/Einleitung
Die Archäologie
Das Gebiet der Chaco-Anasazi
Die Anfänge der Anasazi-Kultur (ab 1 u.Z.)
Die Pueblo Zeit (700/750 bis 900 u.Z.)
Die “Geburt” des Großhauses (nach 900 u.Z.)
Die Post-Chaco-Zeit von 1130/1150 bis 1250 u.Z.
Zusammenfassung
Eine persönliche Abschlussbemerkung zu einem Kulturkollaps
Impressum neobooks
Vorwort/Einleitung
Der Bonito-Gral!?! Was veranlasste mich, das mythische, ätherische bis esotherische Gefäß der Wunder aus dem keltischen christianisierten Sagenkreis im semiariden bis ariden nordamerikanichen Südwesten, im Pueblo Bonito aus dem Chaco Canyon von New Mexico, einem Bundesstaat der USA, zu verorten. Ein Blasphemie-Vorwurf gegen mich steht schon im Hintergrund.
Ich möchte die Kultur der Anpassung der steinzeitlichen, urgesellschaftlichen Anasazi, deren „Mutterkultur“ sich im Chaco Canyon und seiner engeren Umgebung formierte, philosophisch bildhaft darstellen. Das semiaride bis aride Gebiet des Colorado Plateaus ist auf Grund seiner Trockenheit und der daraus sich ergebenden guten Erhaltungsbedingungen von Spuren menschlicher Aktivitäten ein archäologischer Gunstraum, der neben den klimaschen Vorteilen auch ein breites qualitatives und quanitatives Spektrum an prähistorischen architektonischen Anlagen aufzuweisen hat. Letztere fallen - touristisch medial gefördert - optisch jedermann ins Auge und überdecken mit ihrem Eindruck auf die heutigen Menschen oft die Sicht auf die prähistorischen Menschen, die diese Anlagen schufen, und deren Motive und Ursachen für dessen Gestaltung.
Die Archäologie ist eine Gesellschaftswissenschaft, die wie alle Gesellschaftswissenschaften mit ideologischem Filter arbeitet. Sie stellt einerseits durch Ausgrabungen und Folgeuntersuchungen wissenschaftlich fundierte Fakten fest und bewegt sich dann mit Interpretationen und Modellvorstellungen unvermeidlich von der exakten Wissenschaft fort, wie die Vielzahl von „wissenschaftlichen“ Diskussionen und teilweise sogar Streitereien belegen. Die Differenzen entstehen durch eine unterschiedliche Sicht auf die Fakten und deren Nutzung im ideologischen und akademischen Machtkampf, bei dem es um „Deutungshoheiten“ geht.
Auch ich habe meine Sicht, die wesentlich durch eine antipatriarchale Weltanschauung geprägt ist und damit weitgehend gegen den Mainstream steht. Ich war nie persönlich im Südwesten oder gar im Chaco Canyon, sondern habe nur Fakten und Ansichten aus über das Internet erreichbaren Quellen entnommen („Alles nur geklaut!“). Die Quantität der Fakten ist erdrückend groß, sie sind jedoch nur ein „µ“ vom vorhandenen Quellenmaterial. Und auch das Quellenmaterial widerspiegelt nur einen winzigen Teil der kulturellen Substanz der Anasazi und speziell der hier betrachteten Chaco-Anasazi, der Chacoaner, die zwischen 1 und 1300 u.Z. im zentralen San Juan Becken lebten und ihr Leben gestalteten und sich harten klimatischen Anforderungen ausgesetzt sahen. Ich als nichtprofessioneller Autor bin mir meines Mangels an Faktenwissen gegenüber einem US-amerikanischen Profi bewusst, glaube aber trotzdem, ein Bild der kulturellen Aktivität dieser Menschen „malen“ zu können, wobei ich die optische Attraktivität von archäologischen Stätten zu Gunsten der sie schaffenden Menschen, ihrer Bedürfnisse, Fähigkeiten und Motivationen etwas in den Hintergrund drücke.
Hierbei werden die praktischen Bedingungen des unmittelbaren Lebenserhaltes und die damit untrennbar verbundenen spirituellen Vorstellungen der Chacoaner betrachtet. Spätestens bei den spirituellen Vorstellungen und Motivationen der Anasazi und speziell der Chacoaner gelange ich in die von belegbaren Fakten fast freie Zone und bin offen für Angriffe von Personen, die meist auch nicht mehr Fakten, sondern nur ihre Ansichten ins Feld führen können. Deshalb habe ich für den Titel meiner Darstellung das Bild vom GRAL gewählt, nur eben für den Chaco Canyon und sein größtes Bauwerk, das Pueblo BONITO, adaptiert – jedoch mit dem feinen Unterschied zum mythischen Gral, dass es dieses „wunderbare GRAL-Gefäß“ wirklich gab. Seine maßgeblichen Reste wurde freigelegt und das Gefäß rekonstruiert.
Ich bin gern bereit meine geschilderten Ansichten zu revidieren, wenn Beweise gegen meine Ansicht sprechen oder ausreichend plausible Erfahrungen gegen sie vorliegen. Es gibt keine Wahrheit, sondern nur unterschiedliche Grade der Wahrscheinlichkeit eines Geschehens. Aber eines sollte man sich noch bewusst sein: Diese prähistorischen Menschen waren Menschen wie DU und ICH, es gab nur einen Unterschied – sie mussten sich nur an die Natur anpassen, denn sie hatten noch keinen HERREN und seinen HERRlichen Macht-Apparat über sich.
Die Archäologie
Die Archäologie ist eine gesellschaftswissenschaftliche Disziplin, die bei allen ihren bemerkenswerten und achtenswerten wissenschaftlichen Leistungen zu einem großen Teil aus tradiertem Glauben, patriarchal-monotheistischer christlicher Herrschaftsreligion, Ideologie und Weltanschauung besteht.
Zum wissenschaftlichen Arsenal dieser Gesellschaftswissenschaft gehören alle materiellen Artefakte (Gegenstände, die durch menschlichen Einfluss geformt worden waren), Spuren von menschlicher Aktivität in der/dem vom Menschen genutzten Landschaft/Heimat/Revier wie Bauten, Feuerstellen, Gruben und Gräben sowie durch menschliche Aktivitäten wie über große Entfernungen nur transportierte, aber ansonsten unveränderte („exotische“/revierfremde) Materialien wie spezielle Molluskenschalen, Federn, Steine, Mineralien und mittels wisenschaftlicher Methoden und Apparate ermittelte Daten/Ergebnisse von Artefakten und anthropogen beeinflussten Bodenschichten. In diese Faktenkategorie gehören auch alle Formen von graphischen Einheiten unterschiedlicher Größe, Form und technischer Gestaltung wie Felszeichnungen durch Farbauftrag oder Materialabtrag, Geoglyphen durch Steinauflagen/-legungen und Bodenabtrag (Scharrzeichnungen).
Die physischen Artefakte haben im Allgemeinen eine konstant bleibende Form und Struktur. Manche bewahren sie jedoch nur bei entsprechend guter und schneller Konservierung nach ihrer Freilegung; manche müssen sofort/kurzfristig allgemeinverständlich dokumentiert werden, da eine qualitätserhaltende Konservierung mit heutigen Methoden - noch - nicht möglich ist. Letzteres betrifft vor allem organische Materialien und Farben. Scheinbar unveränderliche und durch wissenschaftliche Methoden ermittelte Daten von Artefakten und anthropogenen Spuren können jedoch durch neue, bessere, verbesserte Untersuchungsmethoden erkentnistheoretischen Veränderungen/Korrekturen unterliegen ohne deshalb ihren wissenschaftlichen Charakter zu verlieren – man muss jedoch das zur Zeit der Datenermittlung vorhandene wissenschaftliche Untersuchungsniveau berücksichtigen. Eine vor 100 Jahren getroffene und zu ihrer Zeit völlig korrekte wissenschaftliche Aussage kann durch neue, aktuelle Untersuchungsergebnisse stark verändert bis widerlegt werden.
Die völlig berechtigte Ausrichtung auf wissenschaftliche Belege führt aber auch dazu, dass mögliche Fakten und Sachverhalte, die wissenschaftlich nicht ermittelt wurden, auch in praxi nicht existieren oder als Möglichkeit weitgehend unbeachtet (geblieben) sind. Wenn z.B. die untersuchten Abfallhaufen nur Knochen von Kleinwild enthalten, dann gab es eben - mangels Belegen - keine Jagd auf Großwild. Dass vom eventuell erlegten Großwild - falls es nicht schon am Ort seiner Erbeutung zerlegt und verzehrt worden war - nur das wertvolle Fleisch und anderes nutzbares organisches Material bis zum Standort des archäologisch untersuchten Abfallhaufens kommt, wird außer acht gelassen. Der erlegte Hirsch ist ohne Funde von Knochen, Geweih und/oder Hufschalen zwar gemäß Erfahrungen durchaus wahrscheinlich, aber eben nicht bewiesen. Hier kommen dann „Glaubenfragen“ und Vermutungen unterschiedlicher Plausibilität in die Betrachtung der untersuchten Kultur hinein.
In die informelle Kategorie des Glaubens in der Archäologie gehören alle „Geschichten“ um die oben genannten wissenschaftlichen Fakten, die als Glauben, Vermutungen, Erfahrungen, Interpretationen, Modelle und Vorstellungen präsentiert werden und Gegenstand teils heftiger und kontroverser, mehr oder weniger wissenschaftlicher Diskussionen und Streite sind. Ein Teil der „Glaubensinformationen“ stützt sich auf Erfahrungen und/oder Analogien oder gibt vor, sich auf solche zu stützen. Ob dokumentierte Erfahrungen und Analogien wissenschaftlichen Kriterien genügen und ob diese methodisch wissenschaftlich sind, ist oft eine Frage und eine Grundlage für weitere Diskussionen im Kreis von „Experten“. Von heutigen vatikanischen Zeremonien auf die religiösen Aktivitäten in den frühchristlich genutzten römischen Katakomben zu schließen wäre – in meinen Augen – ein solch unwissenschaftlicher Akt, aber bei den Gemeinschaften in zentralen San Juan River Becken im nordamerikanischen Südwesten wird diese Verfahrensweise oft (noch) als legitim angesehen (z.T. im Rahmen der political correctness).
Die verbalen Aktivitäten um Deutungshoheiten bestimmter akademischer Schulen in der Archäologie sind wie in allen Gesellschaftswissenschaften/Geisteswissenschaften von der Ideologie der HERRschenden Finanzierer archäologischer Aktivitäten abhängig und damit durch ideologische Vorgaben und/oder Erwartungen relativ wissenschaftsimmun. („Wess´ Brot ich ess´, dess´Lied ich sing!“) Das bedeutet keinesfalls ein Verzicht auf die Erlangung wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber sie müssen in den HERRschenden ideologischen Kontext passen. Im Glaubensfeld der Archäologie gibt es ein permanentes „Wabern“, das teilweise von neuen wissenschaftlichen Fakten, aber noch mehr durch Ideologien und Anschauungen und auch deren Wechsel im Gang gehalten wird. Ein „Umschreiben der Geschichte“ tritt also aus unterschiedlichen Gründen immer wieder auf. Diese Zusammenhänge zwischen Datenlage und ihrer Interpretation sind bei jeder archäologischen Darstellung und Interpretation zu beachten.
Und Wissenschaftlichkeit ist nicht automatisch gegeben, wenn ich einen Autor und seine Aussage(n) ordnungsgemäß zitiere. Für ein aus den wissenschaftlichen Fakten abgeleitetes möglichst realitätsnahes Bild (wenige Fakten, viel Glauben) ist jeder Autor selbst verantwortlich – ein akademisches Verstecken hinter „Experten“ ist unethisch, aber weit verbreitet. Der gesamte Informationspool an ermittelten und publizierten wissenschaftlichen Fakten und Glaubenssätzen ist menschliches geistiges Allgemeingut, aber kein einzelner Mensch kann diesen Pool ausschöpfen. Es wird also im Kopf des einzelnen publizierenden Menschen immer ein Informationsmangel bestehen und dieses Individuum muss sich auch der Möglichkeit der durch ihn erfolgten mangelhaften bis fehlerbehafteten Vernetzung von wissenschaftliche Fakten bewusst sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für das geistig konsumierende Individuum, die Leserrin/den Leser einer solchen Publikation.
Archäologie und Kunstraub sind kriminelle Geschwisterkinder der patriarchalen HERRschaft. In Form des profitablen Antikenhandels erhalten sie ihre zivilisatorisch-kommerzielle und inspirierende/motivierende Form. Sie dienen dem Repräsentationsbedürfnis der HERRschenden. Schändung/Zerstörung von Grabstätten und Ritualanlagen waren die ergiebigsten Quellen für Repräsentationsobjekte, für die, ab dem europäischen Feudalismus, Kunstkammern und Museen eingerichtet wurden. Diese Trophäen belegen den siegreichen HERRen und die physische und/oder spirituelle Vernichtung des Anderen, des Vergangenen, des Besiegten. Dass durch diese Trophäenschau einige wenige Zeugnisse der spirituellen und handwerklichen Fähigkeiten und der Kunst der (eigenen oder fremden) Ahnen der heutigen Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wurden, ist nur eine gesellschaftliche Nebenerscheinung des Repräsentations- und Legitimationsbedarfes der HERRschenden. Der Erwerb von Wissen über die Ahnen ist ein angenehmer Kollateral-Nutzen der oben genannten kriminellen Aktivitäten. Auch ich bin ein Nutznießer dieser Aktivitäten, dieses Umgangs mit den materiellen Kulturzeugnissen ganzer Epochen und Völker.
Der nordamerikanische Südwesten war auf Grund seines trockenen Klimas und einer relativ geringen heutigen Bevölkerungsdichte und ihrer zerstörenden Einwirkungen auf Spuren der „Ahnen“ ein archäologischer Gunstraum (gute Erhaltungsbedingungen alter Aktivitäten und Artefakte), der außerdem noch bemerkenswerte (große, attraktive, gut sichtbare) Spuren der früheren Bewohner aufwies. Im spanisch-mexikanischen Bereich wurden durch frühe Reisende und Missionare einige auffällige alte Ruinenstätten zur Kenntnis genommen und informell als relativ uninteressant (kein Erwerb von „Schätzen“ und Prestige) abgelegt. Die Vernichtung der nichtchristlichen indigenen Kulturen war für die Spanier/Mexikaner wichtiger als eine mögliche Erforschung von deren Ursprüngen.
Die US-Amerikaner betraten „ihr“ Südwestgebiet erst nach dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo (02. Februar 1848). Erste Kenntnisnahme von prähistorischen Ruinenstätten erfolgte durch US-amerikanisches Militär. 1849 „entdeckten“ bei einem militärischen Zug der U.S. Army Topographical Engineers der First Lt. James H. Simpson und sein indianisch-mexikanischer Reiseführer Carravahal die Ruinenstätte von Pueblo Bonito und auch von Pueblo Pintado, Una Vida, Hungo Pavi, Chetro Ketl, Pueblo del Arroyo und Peñasco Blanco, die von ihm und/oder seinen mexikanischen Führern ihre noch heute bekannten Namen erhielten. Danach publizierte J.H. Simpson eine Beschreibung der Stätte und einiger weiterer Ruinen/Bauten aus dem Chaco Canyon mit einigen Illustrationen der Stätten durch zwei mitgereiste Künstler.
In den USA hatte sich jedoch im Osten durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den physischen Erscheinungen und Überresten der sogenannten Moundkulturen bereits eine allmählich wissenschaftlich getragene archäologische Tradition entwickelt. Zwischen 1850 und 1900 wurde der Südwestbereich von den US-Amerikanern allmählich wirtschaftlich und auch archäologisch-ethnographisch erfasst und erschlossen. Es entstand die „Archäologie des Südwestens“, primär getragen durch US-amerikanische Menschen, Interesssenten und Geldgeber. Hauptsächliche Triebkraft der ersten Ausgrabungen und Grabungsexpeditionen war die Erlangung von attraktiven Artefakten für die Museen der Geldgeber (s.o. Grabraub).
Der wissenschaftlich-archäologische „Startschuss“ für die archäologische Erschließung des Südwestens war die auf die Ruinen-Stätte von Pueblo Bonito angesetzte Hyde-Expedition, die unter der praktischen Leitung von Richard Wetherill und unter der wissenschaftlichen Leitung von George H. Pepper vom American Museum of Natural History stand und von 1896 bis 1900 ca. 190 Räume von insgesamt ca. 650 bis 800 Räumen von diesem Pueblo von Mauerschutt- und Erosionsmassen suchend und untersuchend freilegten. Die Finanzierer waren die sehr vermögenden New Yorkerer Sammler und Philantropen Frederick und Talbot Hyde, die nach Abschluss der Expedition die gewonnenen Artefakte (Pfeile/Pfeilspitzen, zugeschnittene Holzteile, Flöten, Steinfiguren, Zylindergefäße und große Mengen an Türkis) dem American Museum of Natural History übergaben. Sie hatten ihren gesellschaftlichen Image-Gewinn bezahlt und überließen die musealen und wissenschaftlichen Folgekosten dem Staat.
Für diese Zeit Ende der 1890er Jahre entsprachen die Ausgrabungsmethoden des Ranchers Wetherill, der seine archäologisch-wissenschaftlich Grundausbildung von dem schwedisch-finnischen Gelehrten Gustaf Nordskiöld erhalten hatte, dem wissenschaftlichen Stand der Zeit. Nordenskiöld erkundete ab Juli 1891 unter Führung von Richard Wetherill (und dessen Verwandten) prähistorische Stätten im Mesa Verde Gebiet und sandte die ausgegrabenen Artefakte in seine schwedische Heimat. R. Wetherill war auch der „Erfinder“ der Basketmaker. Er erkannte bei seinen Expeditionen, dass die Erbauer von Pueblos und Hersteller von Keramik die kulturellen Nachfolger von Nomaden waren, deren archäologisch wichtigste Behältnisse Körbe (engl. baskets) waren.
Das allmähliche Erkennen kultureller Hintergründe (heidnisch, primitiv! aus der Sicht der frühen Forscher) war eine sich ergebende Begleiterscheinung. Ungeachtet der Motivation „Artefakt-Erlangung“ ist der physische und geistige Einsatz früher Photographen (Jackson) sowie ernsthafter Amateurarchäologen (Wetherill-Familie, speziell Richard Wetherill) und professioneller Wissenschaftler wie z.B. Mindeleff und Pepper nicht hoch genug einzuschätzen.
Im 19. Jahrhundert entstand auch ein Markt für indianische Artefakte und damit eine Profitquelle, die von Raubgräbern bedient wurde und bis heute noch bedient wird. Auch der Südwesten brachte jetzt seinen Anteil dafür ein. Über den wissenschaftlichen Schaden brauche ich mich hier nicht mehr auszulassen.
Das Gebiet der Chaco-Anasazi
Der Lebensbereich der Anasazi (Abb. 1) in nördlichen Teil des nordamerikanischen Südwestens lag geographisch bis 1300 u.Z. im Wesentlichen auf dem flach schüsselförmigen Colorado Plateau, das Teil des Colorado Dränagegebietes ist und durch verschiedene geologische Aktivitäten spezifische Formen erhalten hat und eine Höhe von durchschnittlich 1.500 m NN (über dem Meeresspiegel/Normal Null) aufweist. Da das Gebiet über weite Bereiche eine höhere durchschnittliche Verdunstung aufweist als die dort auftreffende Niederschlagsmenge, ist dieses Gebiet arid, eine Wüste. Die bestehenden topographischen Differenzen gestalten jedoch das Klima lokal sehr unterschiedlich.
Innerhalb des Colorado Plateaus besteht die geologische Form des ca. 12.000 km² großen San Juan Beckens im östlichen Teil des 64.000 km² großen Dränagegebietes des San Juan River, einem der östlichen Nebenflüsse des Colorado River. Auch diese Region ist topographische durch Erhebungen, Täler und ebene Bereiche sehr unterschiedlich gestaltet und der Chaco Canyon und sein Umfeld im zentralen San Juan Becken (Abb. 1) sind darin ein sehr markantes Gebiet.
Abb. 1 Verbreitungsgebiet der Anasazi-Kultur und der Kulturbereich der Chaco-Anazasi im Mittleren San Juan Becken
Das geologisch profilierte zentrale San Juan Becken ist im Norden vom San Juan River, im Süden vom Dutton Plateau und der Lobo Mesa, im Osten vom Nacimiento Uplift und im Westen von den Chuska Mountains begrenzt. (Abb. 2) Es umfasst den Ober- und Mittellauf des Chaco River, die Chakra Mesa und den Chaco Canyon, das Gebiet südlich und westlich der Chakra Mesa (der sogenannte „Beckenboden“) und das Chaco Plateau südlich der Gallegos Mesa (südlich von Farmington). Dieses Gebiet, der sogenannte Chaco Kern, und der Beckenboden südlich des Canyon ist der Lebensraum der Chaco-Anasazi.
Abb. 2 Das Mittlere San Juan Becken mit dem Wasserlaufsystem des Chaco River mit dem Chaco Wash und der Lage des maßgeblichen Teils des Chaco Canyon; der Bereich des Chaco Canyon National Monuments (= engerer Chaco-Kern) ist dunkel hinterlegt.
Der im Zentrum des San Juan Beckens liegende Chaco Canyon erstreckt sich entsprechend der Länge des ihn durchfließenden Chaco Wash über ca. 40 km. Sein Talboden liegt 45 bis 150 m tiefer als die Oberflächen der umliegenden Sandstein-Tafelberge (Mesas). Das Gefälle des Canyonbodens beträgt 6 m/km. Seine größte Breite misst 600 bis 1000 m. Das Gebiet ist heute mit einem durchschnittlichen Niederschlag von 230 mm/a sehr trocken. Für Trockenbodenbau im nordamerikanischen Südwesten sind mindestens 305 m/a Niederschlag für die zu bewirtschaftenden Flächen erforderlich. Seine bedeutendste archäologische Stätte, das Pueblo Bonito, liegt auf einer Höhe von ca. 1.900 m NN.
Der Canyon mit seiner etwa nordwestlich-südöstlichen Streichrichtung und die ihn umgebenden und markierenden Flachmassive/Tafelberge/Mesas liegen innerhalb des sogenannten Chaco Kerns/„ChacoCore", der sich von dem breiteren Chaco Plateau, einer flachen Graslandregion mit heute seltenen Baum-Beständen und einer, auch in prähistorischen Zeiten geringen Besiedlung unterscheidet. Das Tiefland besteht aus Dünenfeldern, Rücken/Graten und Bergen. Die kontinentale Wasserscheide von Nordamerika liegt nur 25 km östlich des Canyons.
Das Kerngebiet der Anasazi-Kultur im Chaco Canyon (Abb. 3) erstreckt sich aber nur über einen 15 km langen Canyon-Teil, wo sich 12 der meist genannten Großhäuser und ca. 160 Kleinhäuser/Einheitspueblos befanden, die zwischen 850 und 1130 u.Z. erbaut wurden. In dem den Chaco Canyon umgebenden Gebiet von ca. 85 bis 90 km² sind weitere 3.000 Wohnstätten mit bis zu maximal 20 Räumen von den Archäologen registriert worden. (Für sogenannte Kleinhäuser gilt als ungefähre obere Grenze eine Anzahl von 50 Räumen, bei mehr als 50 Räumen werden die Bauwerke, mit großem Vorbehalt!, als Großhäuser bezeichnet.) Im Gesamtgebiet, das einmal von der Chaco-Kulturtradition beeinflusst worden war, gibt es ca. 150 sogenannte Chaco-Außenstellen (outliers) unterschiedlicher Größe, die bis zu 185 km vom Chaco-Zentrum entfernt liegen. Teilweise ist die Benennung einiger dieser Bauwerke bzw. Stätten als Chaco-Außenstelle oder auch als Großhaus umstritten, wie z.B. die von Wupatki als der möglicherweise westlichsten Chaco-Außenstelle, die ca. 320 km vom Chaco Canyon entfernt liegt.
Abb. 3 Der Unterlauf des Chaco Wash mit der Lage der maßgeblichen Großhäuser und den Wasserabflussgebieten von der Mesa in den Canyon
In anderen Quellen wird die Anzahl der Fundstellen (nicht Wohnstätten!) im Chaco Canyon und seiner näheren(?) Umgebung für die Zeit von 900 bis 980 u.Z. mit ca. 500 angegeben, von denen ca. 350 in die Kategorie Pueblo-Bauten/übertägige Mauerwerksbauten eingeordnet wurden. Die Stättenanzahl sagt nichts über die Anzahl der Pueblo-Räume, deren Funktion und Lebensdauer aus. Für die Zeit um 1050 u.Z. wurden nur 280 Pueblos angegeben, was wiederum nichts über die Anzahl der Räume, deren Funktion, Nutzungs- und Lebensdauer aussagt. Diese Zahl ist demographisch nicht zu interpretieren, sie zeugt nur von einer gewissen Dynamik im Niederlassungsmuster dieses Gebietes. Man vermutet, dass die Bevölkerungsanzahl in diesem Gebiet annähernd konstant geblieben ist.
Grundsätzlich ist für alle von den Anasazi errichteten Bauten festzustellen, dass sie unterschiedliche und vielfältige Funktionen hatten. Die Anzahl der rechteckigen übertägigen Raumzellen in den Anasazi-Bauten können nicht als Maßstab für eine Abschätzung der Bevölkerungsgröße der Niederlassung genutzt werden, denn die „Räume“ hatten von Struktur zu Struktur nicht immer die gleiche Bedeutung/Funktion und sogar innerhalb einer Struktur wechselte die Raumfunktion von Raum zu Raum und gegebenenfalls auch über die Zeit beim gleichen Raum (Umwidmung von Räumen!). Flachdachige rechteckige "Räume" sind keine direkte Widerspiegelung einer Bewohneranzahl der Stätte und je höher ein (mehretagiges) Bauwerk ist, desto vorsichtiger sollt man bei der Zuordnung einer Bewohneranzahl sein.
Der den Canyon durchfließende Chaco Wash ist ein intermittierend Wasser führender und über die Talebene/Flutebene mäandernder Wasserlauf, in den eine Anzahl charakterlich ähnlicher, aber kürzerer Neben“flüsse“ einmündet. Die Wasserführung wurde von der Schmelze der meist allmählich abfließenden winterlichen Niederschläge und von denen der heftigen Sommerniederschläge/Gewitterstürme bestimmt. Über dem Felsbett des Canyons lagern ca. 15 m (einige Quellen sprechen auch von 38 m) mächtige Schuttmassen und alluviale und äolische Erosionssedimente, die von den umliegenden Mesas im Laufe vieler Jahrtausende abgetragen wurden. Für die Nebencanyons und die Lücken (Gaps) zwischen den Mesas sind ähnliche Zustände anzunehmen. Dieser Sedimentboden gehört grundsätzlich in die Kategorie der sogenannten „leichten“/tonarmen Böden, die in ihre relativ großen Poren schnell Wasser aufnehmen und bei Trockenheit und Austrocknung keine nennenswerte Rissbildung aufweisen.
Bei oberflächlicher Austrocknung steigt durch Kapilarsogkraft aus dem Untergrund bzw. Grundwasser Wasser nach oben. Erst eine zu lange Trockenheit/Austrocknung führt zu einer solchen Absenkung des Grundwasserspiegels, dass die Kapilarkraft nicht mehr ausreicht, um (für die Pflanzen) Wasser ausreichend nah nach oben (bis zu deren Wurzeln) zu transportieren. Dann erst wird eine Dürre für die Pflanzen und die Pflanzennutzer akut.
Nicht der direkte Niederschlag beziehungsweise seine Menge und Dauer sind wesentlich, sondern der für Pflanzen maßgebliche Grundwasserstand, der natürlich auch im Rahmen der Niederschläge schwankt, aber mit zeitlicher Verzögerung im Rahmen seiner eigenen Kapilarregularien und Bodenschichtungen. Erst ein entsprechender Erosionseinschnitt (Arroyo) im Sedimentboden führt durch seine tiefe und schnelle Entwässerung der Sedimentschicht zu einer nachhaltigen Störung bis Zerstörung eines Grundwasserstandes und zu einer Versteppung bis Verwüstung der Landfläche, so wie sie heute im Chaco Canyon mit seinem erosiv bedingten 10 m tiefen und bis 30 m breiten Wash-Einschnitt/-Arroyo zu sehen ist. Zur Zeit der Chaco Kultur floss der Wash mit wechselndem Wasserstand mäandernd und relativ ruhig über die Flutebene des Canyons. Als Anschauungsbeispiel kann der Canyon de Chelly dienen, wo nachweislich in den letzten 2.000 Jahren ca. 2 m Sedimente abgelagert wurden, der jedoch keinen Arroyo wie der Chaco Canyon aufweist und durch seinen mäandernden Wasserlauf für ausreichend Feuchtigkeit für einen, nach heutigen Maßstäben bescheidenen Bodenbau sorgt. Er fiel aber durch große Dürren auch trocken und wurde deshalb von den Anasazi bis/um 1300 u.Z. verlassen.
Klimatische Bedingungen im Bereich des Chaco Canyon
Das Klima ist der durchschnittliche Verlauf oder Zustand des Wetters an einem Ort und meist über einen Zeitraum von Jahren. Es umfasst dem Komplex von Temperatur, Wind/Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Diese Daten können für die Vergangenheit durch eine Reihe von Messungen und Untersuchungen, selbstverständlich mit Streuungen, Unsicherheiten und breiter Verallgemeinerung, einer Durchschnittsbildung, bestimmt werden.
Zyklisch auftretende Dürrezeiten sind eine klimatische Determinante des nordamerikanischen Südwestens seit frühen Zeiten bis zur Gegenwart. Schwankungen in den Niederschlägen im zentralen San Juan Becken sind mehr eine Regel als eine Ausnahmeerscheinung. Diese Schwankungen sind in zwei feste Determinaten eingebettet: (1) Sommerwärme und Winterkälte und (2) Aridität. Jede Kultur, die dort entstand, erlebte Dürreperioden und passte sich entsprechend der Zeitperiode und ihrem Kulturstand an diese mit unterschiedlichem Erfolg an, einschließlich der Abwanderung aus dem betroffenen Gebiet.
Durch pollenanalytische Untersuchungen aus dem Südwesten ist belegt, dass die Zeit vom 8. bis zum 12. Jahrhundert u.Z. eine Periode war, in der eine Verschiebung von einem winter-dominanten zu einem sommer-dominanten Niederschlagsregime stattfand. Dabei wurden die Winter etwas milder, die Frühjahrstrockenheit wurde länger und ein größerer Anteil des jährlichen Niederschlags kam in Form intensiver Sommergewitter. Die topographisch bedingten Niederschläge, die ihre Feuchtigkeit aus den Sturmsystemen erhalten, steigen an Bergketten auf und fallen in der Umgebung des Chaco Canyon und sind zumeist Sommer- und Winterniederschläge. Die Niederschlagsmenge steigt mit dem ansteigendem Höhenniveau des Gebietes. Gelegentliche anomale Nordströmungen der innertropischen Konvergenzzone können die Niederschläge in einigen Jahren erhöhen. Der Chaco Canyon liegt im Regenschatten der westlich von ihm aufsteigenden Chuska Mountains. Die Thermikdifferenzen zwischen Mesa-Hochflächen und den Canyons und Nebencanyons gestalten das Niederschlagsgeschehen lokal sehr differenziert.
Gemäß Baumringanalysen galt die Zeit vor 700/800 u.Z. wegen ihrer extremen Wetterwechselhaftigkeit als ungünstig für den Bodenbau; zwischen 800 und 900 u.Z. trat eine klimatische Verbesserung für Bodenbaubedingungen ein, trat der oben genannte Wechsel von winterdominanten zu sommendoninanten Niederschlägen ganz allmählich auf.
Klimaanalysen sind immer mit einer gewissen Zurückhaltung aufzunehmen, denn die Kenntnis über den tendenziellen Verlauf eines Parameters, der Niederschlagsmenge, ist zumindest mit dem zweiten Parameter Temperatur zu einem Komplex zu verbinden. Dazu kommt noch, dass die Datenerfassung über das Bauholz, die zum Bau genutzten Bäume, immer nur auf Proben von den ganz konkreten Wachstumsbedingungen am Baumstandort zurückgreifen kann. Die Wachstumsbedingungen auf der Mesa-Oberfläche, auf einem Schutthang oder auf der Canyonsohle sind für einen Baum sehr unterschiedlich. Man versucht, dies durch eine statistisch große Anzahl von Proben auszugleichen, trotzdem weiß man nicht, aus welchen Wachstumsbedingungen die Holzproben stammen – man kann weder eine gleichmäßige Mischung garantieren, noch eine Homogenität der Wachstumsbedingungen.
Dazu kommen weitere stark beeinflussende Differenzierungen. Die Niederschlagsmenge wird als Jahresdurchschnitt angegeben. Damit ist nichts über seine Verteilung über das Jahr gesagt, die mal günstig und mal ungünstig für den Bodenbau mit Ein-Jahres-Pflanzen gewesen sein kann. Das Gleiche gilt für die Temperatur: Der Chaco Canyon weist spürbare klimatische Extreme auf, die der Mensch für sich persönlich abfangen kann (Kleidung, Schutzraum u.ä.), die aber für Pflanzen und ihr Wachstum ungünstig bis vernichtend sind. Die Temperaturextreme liegen heute zwischen -39°C bis +39°C und können an einem einzigen Tag um 33°C schwanken. Die Region hat im Durchschnitt weniger als 150 frostfreie Tage pro Jahr (sehr wesentlich für den Bodenbau!) und die örtlichen Klimaschwankungen wechseln wild von Jahr zu Jahr zwischen reichlichen Niederschlägen und lang anhaltender Trockenheit. Der starke Einfluss der El-Niño-Southern Oscillation trägt maßgeblich zum schwankenden Klima des Canyons bei.
Zu allen diesen Einflussfaktoren kommen noch die topographischen Differenzen der Landschaft hinzu. Die Frostfreiheit wird auf der Mesa sicher später eintreten (und damit die potenzielle Wachstumszeit der Kulturpflanzen verkürzen) als auf dem Canyonboden oder in geschützten Nischen wie Nebencanyons (Rincons). Nicht die Niederschlagsmenge selbst spielt die maßgebliche Rolle sondern sie muss als Bodenfeuchtigkeit zur für den Bodenbauer „richtigen“ Zeit am „richtigen“ Ort sein; das gleiche gilt auch für die optimale Wachstums- und Reifetemperatur.
Der „Wert“ des Klimas (gutes oder schlechtes Wetter) wird nach seiner Wirkungsweise auf die Subsistenzbedingungen/Produktionsbedingungen konkreter Menschengruppen in ihrer konkreten Region und Lokalität bestimmt, nicht abstrakt von irgendeiner Temperatur oder von irgendeiner Niederschlagsmenge. Eine Wüste bleibt eine Wüste, selbst wenn dort wegen Unachtsamkeit alle paar Jahre Menschen in einem schon lange ausgetrockneten Wasserlauf – ob Canyon, Klamm oder Wadi – ertrinken, wenn nach einem Gewitterguss eine Flashflut herankommt.
Und ein weiter Faktor ist, wie der Mensch mit „seinem“ Wetter und seinen Schwankungen umgeht, um möglichst gute Subsistenz-/Produktionsbedingungen und damit eine hohe Lebensqualität zu erreichen. Letzteres drückt sich in seiner auch durch die Lokalität geprägten Kultur aus (siehe Flusstal-Oasen).
Die Anfänge der Anasazi-Kultur (ab 1 u.Z.)
Es gibt kaum eine dümmere Formulierung, als von einem „Anfang der Anasazi-Kultur“ zu sprechen. Diese Formulierung suggeriert, dass die Menschen bis zum Tag X praktisch keine Kultur hatten und dann war ganz plötzlich, wie bei einem Eintritt in einen Verein, eine (neue, andere) „Verbandssatzung“ aktuell geworden.
Die Menschen beziehungsweise Menschengemeinschaften, deren kulturelle Anpassung an eine oben kurz angedeutete harsche Umwelt mit starken Klimaschwankungen heute dargestellt wird, hatten in den Augen der modernen Betrachter noch nichts bemerkenswertes oder gar sensationelles „zu Stande“ gebracht. Die Erkenntnisse, die die Archäologen über diese Menschen aus der Zeit vor der christlichen Zeitenwende zu Tage gefördert hatten, war keine auflagenerhöhende Meldung für die Medien, also nichts „sensationelles“. Die abwehrende oder verächtliche Handbewegung eines Verantwortlichen in den modernen Medien kann sich jeder selbst vorstellen. Wenn dieser kulturell sicher hochstehende Medienverantwortliche, nur ausgerüstet mit Steinzeitwerkzeugen und ohne heutige Kleidung drei Monate in dieser rauen Umwelt überlebt hätte, dann hätte er sicher eine sensationelle Story daraus gemacht. Ich gehe davon aus, dass wegen eines frühzeitigen Exitus dieser Person keine solche Story erschienen wäre.
Fangen wir also um das Jahr 1 u.Z. an. Es ist klar, dass es einen solchen Stichtag nicht gab und nicht gibt, aber die HEUTIGEN brauchen bei Vorstellungen über die Vergangenheit eine zeitliche Orientierung. Anpassungsprozesse und kulturelle Entfaltungen kommen nicht als Blitzeinschläge, Erleuchtungen oder wie eine Katastrophe, obwohl plötzliche Ereignisse („natürliche Unfälle“) durchaus initiierende Anstöße für neue subsistenzielle und spirituelle Vorstellungen und Gedanken geben können.
Die Menschen, die um 1 u.Z. auf dem Colorado Plateau lebten, waren zur Zeit einer Jahrzehntausende währenden Klimakatastrophe, einer Eiszeit, auf den amerikanischen Kontinent gewandert. Vielleicht waren einige auch mit einfachen Wasserfahrzeugen an der Eiskante entlanggeschippert – wer weiß es beziehungsweise kann es beweisen? Nichtsdestotrotz überlebten die kontinentalen Neuankömmling auch die nächste Klimakatastrophe, das Ende der vorangegangenen Eiszeit-Katastrophe, eine Periode der Klimaerwärmung begann. Dieses Ende, diese Erderwärmung, zog sich mit variabler Intensität und lokal wechselndem Bild bereits über 10.000 Jahre hin. Und diese Zeit beinhaltet 10.000 Jahre Anpassung an wechselnde harsche Lebensbedingungen. Der Erfolg dieser Anpassung bestätigt ihr kulturelles Niveau und ihre Lernfähigkeit. Und leicht machte ihnen „Mutter Natur“ das Leben und Lernen nicht.
Diese Menschen in Gebiet des zentralen San Juan Beckens um die christliche Zeitenwende waren SammlerInnen und JägerInnen, die wandernd, also als „fußgängige“ Nomaden, nach Wasser und Nahrungsstoffressourcen suchten und bei erfolgreicher Suche diese schnell oder langsam ausbeuteten, je nach Bedarf und Ressoucengröße bis zur Ressourcenerschöpfung. Um 2000 v.d.Z. war auf dem Colorado Plateau nachweislich durch menschliche Einwirkung bereits die noch sehr dürftige Kulturpflanze Mais angekommen und im Chaco Canyon gab es domestizieren/kultivierten Kürbis auch bereits seit 1000 v.d.Z.
Der in Mesoamerika herangezüchtete und von dort nomadisch transferierte Mais wuchs nur dann, wenn man einen Teil der kargen Samenernte wieder an einer für sein Wachstum günstigen Stelle in den Boden legte. Keine leichte mentale und intellektuelle Anpassungsaufgabe für Nomaden - einen Nahrungsstoff, statt ihn zu essen in die Erde zu stecken und so der augenblicklichen Bedürfnisbefriedigung zu entziehen. Sie mussten eine gute Ortskenntnis und ein gutes Timing haben, um zur rechten Zeit wieder am rechten (Ernte)-Ort zu sein, um die Früchte ihres früheren Verzichtes auf nahrhafte Samen zu ernten - wenn sie Glück mit dem Wetter hatten und ihnen keine Fressfeinde/Nahrungskonkurrenten (Vögel, Hasen, Waschbären u.ä.) zuvorgekommen waren. Das war ein langwieriger und komplizierter Lern- und Anpassungsprozess, bei dem ein Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen unterschiedlichen wandernden Menschengruppen mit ähnlichen Praktiken mit Sicherheit eine große Rolle spielte. Die Gedanken und die Erfahrungen wanderten wie die Maiskörner oder besser mit den Maiskörnern auf diesem Weg allmählich von Süden in den Norden. Auch beim Kürbis war es nicht anders. Von der damaligen noch sehr kleinen Kürbis-Frucht waren nur die Samen genießbar. Die Kürbisschale war für Nahrungszwecke (noch) ungeeignet. Sie konnte bestenfalls im getrockneten Zustand als kleines Gefäß dienen, kaum auffindbar für Archäologen. Trotz der Nutzung und eigenzüchterischen Anpassung von Kulturpflanzen waren sie noch jahrhundertelang vom „Stand“ der Bodenbauer entfernt. Der Anteil der Kulturpflanzen an den gesamten Nahrungsstoffen der Anasazi wird um die Zeitenwende lokal differenziert auf 1 bis 3% geschätzt.
Diese Menschen, die 1000 Jahre später die großen Bodenbauer des Südwestens waren, neben den anderen Kulturgruppen der Hohokam, der Mogollon, der Salado, der Sinagua, wurden von den Archäologen als Basketmaker (= Korbmacher) bezeichnet, da sie noch keine gebrannten Tongefäße herstellten. Das Artefakt Korb ist insofern bemerkenswert, weil es noch die wesentlichste „Gefäßart“ (neben Beuteln und Säcken) vor der Herstellung von keramischen Gefäßen repräsentiert. (Gefäße aus Holz oder Rinde sind archäologisch in diesem Raum nicht belegt. Und damit informell nicht existent.) Dementsprechend formulierten die Archäologen eine chronologische Abfolge der kulturellen Anpassung der Anasazi, der späteren Pueblo-Indianer. Die Basketmaker wurden jedoch bereits ab 400-500 u.Z. „Potmaker“/„Topfhersteller“, aber das wird nicht in eine Veränderung der kulturellen Bezeichnung umgesetzt. Der Übergangszeit vom Grubenhaus zum übertägigen Mauerwerksbau führte allerdings zur Namensgebung Pueblo (I), ab der einige Quellen wegen der dann differenzierter werdenden kulturellen Erscheinungen erst von Anasazi sprechen.
Zeit 1 - 400 u.Z-
Chaco Phase -- / Anasazi-Periode Frühe Basketmaker II
Zeit 400 - 500 u.Z
Chaco Phase -- / Anasazi-Periode Späte Basketmaker II
Zeit 500 - 700/750 u.Z
Chaco Phase La Plata / Anasazi-Periode Basketmaker III
Zeit 700/750 - 900 u.Z
Chaco Phase White Mound / Anasazi-Periode Pueblo I
Zeit 900 - 1040 u.Z
Chaco Phase Early Bonito / Anasazi-Periode Pueblo II
Zeit 1040 - 1090 u.Z
Chaco Phase Classic Bonito / Anasazi-Periode Pueblo II
Zeit 1090 - 1140u.Z
Chaco Phase Late Bonito / Anasazi-Periode Pueblo III
Zeit 1140 - 1200 u.Z
Chaco Phase McElmo / Anasazi-Periode Pueblo III
Zeit 1200 - 1300 u.Z
Chaco Phase Mesa Verde / Anasazi-Periode Pueblo III
Angesichts dieser Zeitangaben soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese Zahlen bestenfalls allgemeine Richtwerte für die Chronologie einer allmählichen kulturellen Veränderung darstellen. Die Zahlen schwanken von Quelle zu Quelle und von Region zu Region.
Das Leben der Frühen Korbmacher II/Early Basketmaker II
Die Menschen in dieser Zeit und aus diesem Gebiet waren wie „DU und ICH“ - d.h. „faul und gefräßig“. Der lebenserhaltende Drang nach essbaren Nahrungsstoffen und trinkbarem Wasser in für die Gemeinschaft ausreichender Menge und Qualität war der Motor ihrer physischen und geistigen Bewegung, ihrer Mobilität. In klimatisch extremen Zeiten (Winter) spielte auch das Aufsuchen und die Nutzung natürlicher Schutzräume (wind- und wassererosiv entstandener Aushöhlungen/Höhlen im Sandstein) eine Rolle. Es gab nur einen wesentlichen Unterschied zwischen den „Damaligen“ und uns „Heutigen“ – sie waren noch keiner patriarchalen HERRscherschicht und deren apparativer Willkür ausgesetzt. Sie mussten sich nur, wie alle Lebewesen auf der Erde, mit den natürlichen Bedingungen auseinandersetzen, sich ihnen anpassen, diese lebenserhaltend ausnutzen. Diese Bedingungen zwangen sie zu einer guten Beobachtung ihrer Umgebung und einer Analyse ihrer so erhaltenen Informationen.
Die Ergebnisse ihrer Beobachtungen setzten sie in lebenserhaltende Aktivitäten wie die Erlangung von Nahrungsstoffen und Wasser um. Die Qualität ihrer Beobachtungen und deren Umsetzung in lebenserhaltende Aktivitäten belegt ihre spezifische Klugheit und ohne diese ihre Klugheit hätten sie nicht leben können. Diese Kombination nennt man Anpassungsfähigkeit. Diese allgemeine Anpassungsfähigkeit war verknüpft und wurde verstärkt durch die sie tragende Gemeinschaft mit ihrem kommunikativen Austausch, Erfahrungen wurden weitergegeben. Und solche einzelnen Arbeits- und Kommunikationsgemeinschaften waren wiederum kommunikativ miteinander verbunden - interagierten physisch, intellektuell, informativ und spirituell miteinander.
Die zum Zwecke der Nahrungsstoffsuche nomadisierenden/wandernden Menschengemeinschaften aus der Zeit zwischen 1 und 400 u.Z. bestanden aus ein oder zwei sogenannten Haushaltsgruppen. Der Begriff Großfamilie wird von mir wegen seines patriarchalen Charakters als unzutreffend für die Anasazi abgelehnt. Die Wandergruppengröße ist abhängig von der sozialen Struktur der Gemeinschaft(en) und vom erwarteten Potenzial der zu besuchenden Nahrungsstoffressourcen.
Die einfachsten und deutlichsten Wanderwege waren die trocken gefallenen oder wasserführenden Flussläufe. Sie boten den Wandernden Wasser, gegebenenfalls durch die Anlage einfacher Brunnenausgrabungen bis zum noch bestehenden Grundwasser in den trockenen Flusslaufsedimrnten. Das Feuchtigkeitspotenzial dieser Wasserläufe förderte den Wildpflanzenwuchs auf der Flutebene und an deren Rändern und bot damit ein Potenzial an pflanzlicher Nahrung wie auch Möglichkeiten für die Jagd auf Pflanzenfresser und deren tierische Feinde. Der Flusslauf bot damit neben Wasser auch den unterwegs zu erwerbenden „Reiseproviant“ auf dem Weg zu ergiebigeren Nahrungsstoffressoucen, die das Ziel der regionalkundigen nomadischen Gruppe waren. Die Flutebenen der Wasserläufe waren ideale Wanderwege mit einer klaren Orientierung, trotz teilweiser starker Mäander. Der Weg die Wasserläufe aufwärts führte zur nächsten Wasserscheide und eröffnete ein neues/anderes Becken mit „Wasserwanderwegen“.
Die bequemen Wege schlossen natürlich keinesfalls „Querwege“ auf und über die Berge und Hochflächen aus, wenn dort attraktive, nutzbare Nahrungsstoffressourcen und eventuell auch mögliche Schutzräume gegen die Winterkälte zu erreichen waren. An den Wanderrouten gab entsprechend den Rastplätzen und Verweilstätten temporäre „Niederlassungen“, die mit Ausnahme von „Stätten spezieller Nutzung“ wie z.B. Steingewinnung- und –bearbeitungsstellen, erst mit dem Bau „fester“ Behausungen (Grubenhäuser) für die Winterzeit durch die Archäologen nachweisbar wurden.
Der Motor für die Bewegung dieser (wie aller) Menschen bestand aus zwei Triebkräften: der Angst und der Lust. Alle Motivationen (auch „faul und gefräßig“) lassen sich diesen zwei Triebkräften zuordnen. Dabei können beide Triebkräfte eng miteinander verkoppelt sein. Die instinktive Angst zu verhungern führt bei der Überwindung dieser Angst durch Nahrungsaufnahme zur Lust des Essens und der Angstvertreibung (siehe Adrenalin-Kick). Die Aufteilung der Aufgaben der Gemeinschaft erfolgte nicht geschlechtsspeziefisch, sondern nach dem Mobilitätspotenzial der einzelnen Gemeinschaftsmitglieder. Es ist völlig klar, dass stillende Mütter, Mütter mit Kindern, Schwangere und Alte nicht so schnell sein können wie kräftige Männer und Frauen ohne Kinder. Dementsprechend wurden die Aufgaben für den Gemeinschaftsunterhalt verteilt.
Wenn eine solche Gruppe auf die Jagd ging, dann war die Jagd eine Gemeinschaftsjagd (kein HERRliches Solovergügen). Die Jagd erfolgte mit dem Wurfspeer und dem Schleuderspeer/dart (unter Einsatz eines Schleuderbretts/Atlatl). Welche Zielgenauigkeit mit diesen Jagdgeräten erreicht wurde, ist nicht bekannt (Auch heute gibt es nur einen Speerweitwurf und keinen -zielwurf!) Der Speerwerfer musste sich in eine aufrechte Position begeben, um sein Gerät auf das Ziel zu schicken. Gezielte Würfe sollen nur über eine Entfernung von 20 bis 25 m möglich gewesen sein. (Der Dart-Speer reichte weiter, aber über seine Treffergenauigkeit liegen mir keine Aussagen vor.) Und da reagiert ein Fluchtwild schon sehr aufmerksam und flieht. Das Wild musste für eine erfolgreiche Jagd also von einer Werfergruppe umstellt sein. Es gab ein gemeinschaftliches Anschleichen und Umzingeln und auf ein Zeichen, den Speerwurf des maßgeblichen Werfers, ging die Jagd los. Alle warfen ihre Speere. Das oberste Jagdprinzip der Gruppe bestand vorerst nicht im Erlegen des Wildes, sondern darin, das Wild in seiner Bewegungsfähigkeit so einzuschränken, damit es einen Todesstoß oder -schlag bekommen konnte.
Für diese Umzingelung bedurfte es möglichst vieler Akteure. Dabei brauchten auch nicht alle mit einem Speer ausgerüstet zu sein. Mit gut gezielten Steinen konnte man auch sein Jagdziel erreichen. Ich bin der Ansicht, dass ein simpler Stein als Jagdgerät viel zu wenig Beachtung findet – vor allem bei der Jagd nach Kleinwild. Ein Kaninchen möchte ich auch nicht mit dem Speer erlegen müssen. Sie würden sich wahrscheinlich totlachen. Aber ein simpler Wurfstein fällt durch das archäologische Raster. Ähnlich ist es auch mit entsprechenden Wurfstangen oder -hölzern. Sie zerfallen zu schnell, zerbrechen oder werden verbrannt. Vereinzelt wurden bumerangähnliche Wurfhölzer gefunden und sogar als solche definiert/identifiziert. Und Holzkeulen kann man sowohl als Wurfkeulen als auch als Schlagkeulen benutzten. Und sie brauchten keine aufwendigen Spitzen aus ausgewähltem Steinmaterial. Das beste Steinmaterial (amorphe Gesteine wie Feuerstein, Obsidian, Chalzedon u.ä.) wurde für Schneidgeräte benötigt. Steinspitzen von Speeren und Darts fallen dem Archäologen jedoch besser beim Sieben und/oder Waschen ausgegrabener Erde auf.
Die Beute wurde sicher relativ gleichmäßig verteilt. Lediglich beim Fell konnte man sich über die Zuordnung streiten. Vielleicht ging es da nach der Bedürftigkeit bezüglich der Kleidung/Winterschutz. Bestimmte Teile/tierische Werkstoffe wie Knochen oder Horn wurden sicher auch nach Bedarf verteilt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle erlangbaren/erlegbaren Faunenvertreter einschließlich Reptilien und Amphibien auf dem „Speisezettel“ der Basketmaker standen. Auch Insekten wurden sicherlich nicht ausgeschlossen. Lediglich spezielle Lebewesen, die eine mythologische und spirituelle Bedeutung hatten, konnten „tabu“ sein. Fische und Mollusken spielten mangels Substanz sicher keine Rolle. Die faunale Biomasse des zentralen San Juan Beckens war sehr begrenzt. Größere Säugetiere gab es meist nur in den randlichen Gebirgsgegenden. Und deren Knochen sind dann nur als Werkzeuge (z.B. Schaber, Ahlen u.ä.) verarbeitet im Abfall bei einer Raststelle oder temporären Niederlassung zu finden.
In der Sammelwirtschaft war ebenfalls die gesamte Gemeinschaft im Einsatz. Auch hier wurde sicher alles gesammelt, was essbar war. (Bitte keinen heutigen Maßstab ansetzen!) Die eingesetzten Werkzeuge waren unspektakulär (Holzschlegel, Grabstöcke, Körbe). Das florale Spektrum reichte von Weichfrüchten (zum sofortigen Verzehr) über hartschalige Früchte (Nüsse, Eicheln) bis zu Samen, Stängeln, Blättern, Blüten, Knollen und Wurzeln. Ein Teil von ihnen konnte bei entsprechender Lagerung/Aufbewahrung auch als Wintervorrat abgelegt werden. Belege für Konservierungsmethoden (Trocknen, Räuchern, Rösten) wurden nicht gefunden. Eine thermische Nahrungsstoffzubereitung war sicher nur „am Spieß“, auf einem erhitzten Stein oder in heißer Asche möglich. Belege für das Garen mit Steinen (Steinkocher-Prinzip) und/oder Erdöfen wurden bei den Basketmakern nicht gefunden.
Über den dritten und wichtigsten Nahrungsstoff wird kaum gesprochen: Wasser!Und das in einem ariden Gebiet. Eine Wasserquelle/-ressource ist für den Archäologen unsensationell und „Wasser läuft ihm durch die wissenschaftlichen Finger“. Die Basketmaker-Menschen im zentralen San Juan Becken sahen das sicherlich ganz anders. Inwieweit Wasser und Wasserstellen das Leben, die Subsistenz und die Wanderzüge dieser Menschen bestimmten, bleibt nur unserer Spekulation überlassen, meist nach ethnographischen Analogien. Die Archäologen suchen bei jeder untersuchten Stätte auch nach aktiven oder ehemaligen Wasserquellen oder Reservoiren. Der Einfluss von Wasserstellen war mit Sicherheit bedeutend und wird von uns oft übersehen und deshalb unterschätzt. Dabei darf man nicht nur an den „Sommer-Durst“ bei über 30°C denken, sondern muss auch den Winter berücksichtigen, wenn strenge Minustemperaturen (bis -39°C) die Quellen erstarren und damit praktisch versiegen lassen. Der dürftige Schneefall liefert zwar „essbares“ Wasser, aber diese Ressoucen sind durch die Sublimation von Eis und Schnee unter diesen klimatischen Bedingungen sicher bald erschöpft. Der Schnee wird von der Sonne „gefressen“ und dann kann es mit Trinkwasser knapper als im Sommer werden, als man noch in Flusssedimenten „buddeln“ konnte. Deshalb steht die Frage, ob ein Winterlager eher wegen Wassermangel oder eher wegen Nahrungsstoffmangel geräumt werden musste.
Übersehen werden mangels Artefakten oft auch die Leistungen, die in verrottbaren Materialien manifestiert waren. Steinbearbeitung ist gut belegt, Körbe sind trotz der geringen nachgewiesenen Anzahl namengebend für die Menschen dieser Zeit in der Großregion geworden. Jedoch sind die Fragen der Fellbearbeitung, des Gerbens und der Lederherstellung sowie der Kleidung „mangels Substanz“ extrem unterbelichtet. Die Nutzung des Flächenmaterials Fell und seine entsprechende Verarbeitung zählen zu den ältesten handwerklichen Aktivitäten der Menschen. Sie waren eine Grundbedingung für ihr Vordringen in permanent oder temporär kältere Bereiche aus dem tropischen Ursprungsgebieten des Menschen. Deshalb kann ohne Zweifel diese handwerkliche Fähigkeit auch bei den Basketmakern vorausgesetzt werden. Über eine Notwendigkeit braucht man bei den angegebenen Wintertemperaturen nicht zu diskutieren.
Die Bearbeitung der Felle war eine allgemeine Angelegenheit. Jeder konnte sie und setzte sie nach seinem persönlichen Bedarf ein. Es ist kaum anzunehmen, dass hier eine oder einer für andere (Auftraggeber) tätig geworden ist (Mutter für ihr Kind ist eine Ausnahme). Ein Problem des besprochenen Gebietes bestand darin, dass Großwild wie Wapiti, Rotwild oder Pronghornantilopen nur spärlich vorhanden und deshalb wahrscheinlich auch als Jagdbeute und damit als Felllieferant spärlich vertreten waren. Für großflächige Formen (Decken u.ä.) mussten die Felle von Kleinwild zubereitet und zusammengenäht/-geheftet werden. Kaninchen und Präriehunde, aber auch Füchse, Dachse, Stinktiere und seltener Luchse waren potenzielle Felllieferanten. Die Felle bzw. das Leder wurde zur Kleidungsherstellung verwendet. Die Grundform waren sicher größere oder kleinere Decken, in die man sich nach Bedarf einwickeln konnte und die mit Faser- oder Lederschnüren am Körper befestigt wurden. Ein zweiter Nutzungsbereich war die Herstellung von Beuteln und Säcken unterschiedlicher Größe für die Aufbewahrung und den Transport von Gegenstanden verschiedener Art und Gewicht. Ab wann Faserschnüre mit Fellstreifen umwickelt zu ersten Web- oder Flechtstücken verarbeitet und zur Kleidungsherstellung verwendet wurden, bleibt im Dunkel der Artefaktlosigkeit verborgen. Fellumwickelte Schnüre wurden jedoch bereits in dieser Zeit hergestellt.
Die Herstellung flächiger, flexibler Objekte durch Flechten und Verknüpfen von runden und/oder breiten „Fasern“ war ein bekanntes Verfahren und wurde bei der Produktion von Körben, Matten, Sandalen und ähnlichen Objekten eingesetzt. Diese Wissens- und Fähigkeitstradition führte zur späteren Weberei und zur Netzherstellung. Die seltenen Artefakte dieser Art sind unspektakulär und können nur archäologische Materialkundler begeistern.
Um 400 u.Z. ±100 Jahre erbauten diese Menschen die ersten, für die Archäologen nachweisbaren, „festen“ Behausungen, die sogenannten Grubenhäuser. (Abb. 4) Grubenhausbauten waren speziell in klimatisch „anspruchsvollen“ Gegenden der Erde als ursprüngliche Klimaschutzbauten weltweit verbreitet und fanden auch in Nordamerika unterschiedliche Ausprägungen zu unterschiedlichen Zeiten. Dies waren im Prinzip geschlossen überdachte Gruben, eine Art flacher Erdbunker, ein Defensivbau gegen die „körperenergie-fressenden Feinde“, die Kälte und den Wind. Die Menschen nutzten schon immer Schutzräume, speziell gegen Kälte- und Windeinflüsse. Es besteht für uns HEUTIGE nur das Nachweisproblem. Die Nutzung natürlicher Schutzräume wie Felshöhlen war durch Artefaktfunde weltweit belegt. Temporäre, von nomadischen Menschen angelegte Schutzhütten standen - schon aus ethnographischen Erkenntnissen - nie in Frage, waren aber wegen ihrer Vergänglichkeit archäologisch nicht mehr greifbar. Das Maximum an Beweisen bestand in Steinkreisen. Mit den Steinen waren Holzteile der Schutzhütte am Boden fixiert worden. Die wenig arbeitsaufwendigen Bauten der Nomaden waren immer nur kurzzeitig benutzt und dann wieder verlassen worden. Selbst wenn eine solche Stätte auch wiederholt besucht wurde, blieben die Hüttenbauten leicht und vergänglich; lediglich die noch umherliegenden Steine wurden wieder zur Fixierung der Holzteile genutzt. Solche Steinkreise sind jedoch im Chaco-Gebiet nicht gefunden worden.
Für die Basketmaker-Zeit bis ca. 700/750 u.Z. sind im Bereich des Chaco Canyon und seiner Umgebung (ca. 25 bis 50 km²) ca. 200 solcher Niederlassungsstätten nachgewiesen. Die Zahl klingt gewaltig, ist jedoch nur bemerkenswert. Mit einer Dunkelziffer ist zu rechnen, denn keiner kann garantieren, dass schon alle solche Stätten gefunden und registiert worden sind - trotz eines relativ guten Erkundungsstandes. Diese beeindruckende Anzahl von Stätten muss man sich aber über ihre Substanz, ihre Lebensdauer und ihre Größe etwas relativieren.
Solche Niederlassungen werden in der Literatur je nach ihrer Größe oft als Weiler (hamlet) oder Dörfer (village) bezeichnet. Durch unsere zivilisatorischen Traditionen interpolieren wir aber mit diesen Begriffen Vorstellung in diese vergangene Zeit, die verzerrend wirken und zeitliche Veränderungen und Entwicklungen stark ausblenden. Diese Basketmaker-Niederlassungen sind einmalig oder mehrmalig über kurze oder längere Perioden genutzte Winter-Camp-Plätze mit meist nichtdefinierbaren Nutzungspausen. Sie können sich auf ihrer Stätte räumlich durch weitere Bauten ausbreiten, Bauten auf dieser Stätte verfallen bei fehlender Nutzung und Instandhaltung oder allgemeiner Verrottung nach spätestens 15 Jahren ihrer Existenz. Die saisonale Nutzungsdauer hängt vom Klima-Schutzbedürfnis der Menschen und den im Umkreis verfügbaren Nahrungsstoff- und Wasserressourcen ab.
Eine solche Stätte und ihr Umgebungsrevier, das Streif- und Beschaffungsrevier der diese Stätte nutzenden Menschengemeinschaft, kann nach einiger Nutzungszeit eine solche Bedeutung für die Gemeinschaft und eventuell auch für einige mit ihr interagierende Nachbargemeinschaften erlangt haben, dass für sonst ohne bauliche Anlagen praktizierte spirituelle Aktivitäten ein extra Raum geschaffen wird: das kann die Gestaltung eines „Tanzplatzes“/plaza