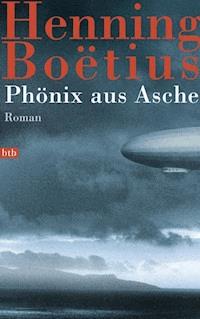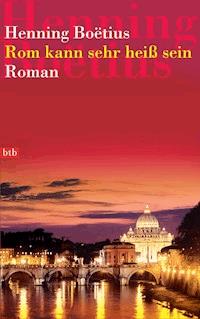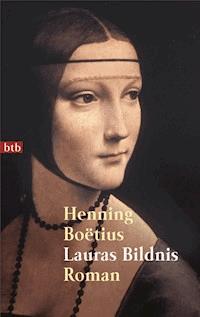2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Der Insulaner“ ist das eindrückliche Porträt eines bewegten Lebens, einer fast schon versunkenen Zeit, einer ganzen Welt. Und nicht zuletzt: eine einzigartige Liebeserklärung an die Kunst und an das Meer.
Als der Schriftsteller B. sich wegen eines Tumors am Gehirn operieren lassen muss, fürchtet er seine Erinnerung für immer zu verlieren. Doch dann wird die Operation für ihn zu einem langen Gang durch die verschlungenen Pfade seines Lebens: Von den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs über die Wirtschaftswunderjahre und die rebellischen 60er Jahre bis in die Gegenwart.
In seinem Narkosetraum erzählt er einem Analytiker die Geschichte seines Lebens. Er erzählt von der sensiblen Mutter, die ihre künstlerischen Ambitionen nie wirklich ausleben durfte, und von dem bewunderten, meist unnahbaren Vater, der einst als Offizier auf dem Luftschiff „Hindenburg“ die Katastrophe von Lakehurst. Und er erzählt von der Insel im Meer, auf der er aufwuchs und wo er sich doch stets als Außenseiter empfand… Bis er schließlich wieder aus der Narkose erwacht, ist sein ganzes Leben an ihm vorbeigezogen – und mehr als ein halbes Jahrhundert zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1419
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Als der Schriftsteller B. sich wegen eines Tumors am Gehirn operieren lassen muss, fürchtet er seine Erinnerung für immer zu verlieren. Doch dann wird die Operation für ihn zu einem langen Gang durch die verschlungenen Pfade seines Lebens: von den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs über die Wirtschaftswunderjahre und die rebellischen 60er Jahre bis in die Gegenwart.
In seinem Narkosetraum irrt er durch die labyrinthischen Straßen einer anonymen nebelgrauen Stadt irgendwo am Meer auf dem Weg zu regelmäßigen Terminen bei einem Analytiker. Diesem erzählt er die Geschichte seines Lebens. Er erzählt von der sensiblen Mutter, die ihre künstlerischen Ambitionen nie wirklich ausleben durfte, und von dem bewunderten, meist unnahbaren Vater, der als Offizier auf dem Luftschiff »Hindenburg« die Katastrophe von Lakehurst überlebte und später als Kapitän zur See fuhr. Er erzählt von der Insel im Meer, auf der er aufwuchs und wo er sich doch stets als Außenseiter empfand. Er beschreibt seine Begeisterung für die Geheimnisse der Naturwissenschaften und wie er in seiner Jugend die Magie der Literatur entdeckte … Bis er schließlich wieder aus der Narkose erwacht, ist sein ganzes Leben an ihm vorbeigezogen – und mehr als ein halbes Jahrhundert zugleich.
»Der Insulaner«, der autobiographisch fundierte neue Roman von Henning Boëtius, ist das eindrückliche Porträt eines bewegten Lebens, einer fast schon versunkenen Zeit, einer ganzen Welt. Und nicht zuletzt: eine einzigartige Liebeserklärung an die Kunst und an das Meer.
Autor
HENNING BOËTIUS, geboren 1939, wuchs auf Föhr und in Rendsburg auf und lebt heute in Berlin. Er studierte Germanistik und Philosophie und promovierte 1967 mit einer Arbeit über Hans Henny Jahnn. Boëtius ist Verfasser eines vielschichtigen Werkes, das Romane, Essays, Lyrik und Sachbücher umfasst. Sein Roman »Phönix aus Asche« wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er außerdem durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen niederländischen Kommissar Piet Hieronymus.
Henning Boëtius
Der Insulaner
Roman
Inhalt
Am diesseitigen Ufer
Die Waldkolonie
Die Insel
Festland
Die Seereise
Die Wälder rechts und links der Gewissheit
Niemandsland
Zurück
Am diesseitigen Ufer
* * *
Er baute aus den Waben der Erinnerung und dem Bienenschwarm seiner Gedanken sein Haus.
Walter Benjamin über Marcel Proust
Er hatte sich bewegt. Jetzt, nachdem er aufgewacht war, kam es ihm jedenfalls so vor. Bevor er eingeschlafen war, hatte der Mantel anders ausgesehen. Um eine winzige Nuance musste er seine Position verändert, sich ein wenig von ihm weggedreht haben. Vielleicht hatte ihn der Anblick eines Schlafenden gestört, diese Schutzlosigkeit eines Menschen, dessen Sinne vorübergehend blockiert sind, wie bei jemandem, der die Alarmanlage seiner Wohnung ausgeschaltet hat, weil er nach Hause zurückgekommen ist. Und es stimmte, er war zu Hause, in sich, wenn auch ohne es zu wissen. Irgendwo in sich steckte er, bei herabgelassenen Läden, verriegelter Tür. Der andere aber war nicht da, nicht mehr, um genau zu sein. Vor Jahren schon war er ausgezogen, auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Nur sein Bademantel war noch da. Ein schönes Stück aus flauschigem Frottee, mit blauen, roten und grünen Streifen. Ein Geschenk des Sohnes, als der Vater wegen einer Operation ins Krankenhaus musste. Der Sohn hatte den Mantel geerbt und mitgenommen, als auch er ins Krankenhaus musste. Jetzt hing er an der Tür zum Badezimmer. B. hatte ihn noch nicht benutzt. Etwas hielt ihn davon ab. Eine diffuse Angst, es könnte etwas Ungeheuerliches geschehen, wenn er ihn tragen würde, während er im Flur auf und ab lief.
Als B. später das Krankenzimmer verließ, kam es ihm vor, als sei es der Mantel, der mit schlenkernden Ärmeln und fließenden Bewegungen ausschritt, und er, der in ihm steckte, sei gezwungen, ihm zu folgen, an den Schwestern vorbei, diesen Tempelpriesterinnen des Lebens, die ihre Körper hinter ihren weißen Kitteln wie einen Teil eines Mysteriums verbargen. Irgendwann hatte er das Gefühl gehabt, durch sich selbst zu laufen, durch einen dieser vielen Gänge in seinem Inneren, durch Adern, Lymphgefäße, Nervenbahnen.
Schließlich erreichte B. eine Tür mit einem Schild, auf dem Sprechzimmer stand. Es wäre ihm lieber gewesen, es hätte Schweigezimmer geheißen. Er zögerte. Sein angewinkelter Finger schwebte einen langen Augenblick über dem Türblatt. Dann klopfte er und trat ein.
Sein Blick fiel auf den von Papieren bedeckten Schreibtisch, dann auf den salopp gekleideten Mann in Jeans und kariertem Hemd und schließlich auf eine lange, von innen beleuchtete Mattscheibe, an der mehrere große Aufnahmen hingen. Sie sahen aus wie die Arbeiten eines Grafikers, der immer das gleiche Motiv variiert. Der Mann am Schreibtisch wirkte übertrieben gesund mit seinem braungebrannten, jungenhaften Gesicht, den dichten, kurzgeschnittenen Haaren, den markanten Händen mit dem goldenen Siegelring. B. wusste, dass der Arzt gerade aus Mallorca zurück war, von einem Kongress, den er mit einer Woche Urlaub verbunden hatte. Er sah B. direkt in die Augen. Dabei lächelte er wie jemand, der unbedingt gute Stimmung verbreiten möchte. »Haben Sie gut geschlafen?«
»Ja. Den Umständen entsprechend. Ich bin ein paarmal aufgewacht, vermutlich durch mein eigenes Schnarchen.«
Der Arzt wirkte ernst, während er aufstand und B. die Hand gab. »Die Nachtschwester hat mir berichtet, dass Sie nicht nur schnarchen, sondern auch ungewöhnlich lange Atemaussetzer haben. Apnoe nennt man das. Eine nicht ungefährliche Anomalie und eine starke Belastung für das Herz.«
Er ging zu den Fotos und winkte B. heran. »Das hier ist das Ergebnis der PET/CT. Ein sehr genaues Abbild Ihres Kopfes in mehreren Schichten und aus mehreren Perspektiven. Sie müssen als Kind einen schweren Unfall gehabt haben, denn die Partien hier, die Nasenscheidewand und die Nebenhöhlen, sind nicht in dem symmetrischen Zustand, in dem sie sein sollten. Das ist wohl auch der Grund für Ihr Schnarchen und die Atemaussetzer. Vermutlich auch für Ihre Hyptertonie. Und deshalb sind Sie zu uns gekommen. Wir werden das irgendwann auch in einer einfachen Operation korrigieren. Aber zuvor müssen wir uns um etwas anderes, viel Gravierenderes kümmern.«
Die Mimik des Arztes veränderte sich. Es war, als glitte eine Wolke über sein Gesicht und hinterließe dort einen Schatten. »Wie Sie wissen, ist das menschliche Gehirn ein außerordentlich komplexes Organ. Man kann es recht gut mit einem Haus mit vielen Zimmern vergleichen, genauer gesagt mit einem symmetrisch konstruierten Doppelhaus, denn fast alles in ihm ist in einer linken und einer rechten Hemisphäre vorhanden.«
Er wandte sich wieder den Aufnahmen zu und deutete mit einem Stift auf eine bestimmte Stelle. »Dies hier ist das Großhirn, der Cortex mit dem Frontallappen, in dem das Bewusstsein steckt. Der Cortex ist so etwas wie der öffentliche Bereich des Hauses. Hier treffen durch verschiedene Eingänge wie Ohren, Augen, Mund, Tastzellen die wichtigsten Informationen aus der Außenwelt ein. Die Post sozusagen, die E-Mails, die Besucher. Hier liegen die Büros, die Flure und Gesellschaftsräume, in denen diskutiert wird, Entscheidungen fallen oder manchmal auch einfach nur gefeiert wird. Es gibt übrigens auch einen eigenen Kinosaal, in dem die Außenwelt auf die Leinwand unseres Bewusstseins projiziert wird. Ähnlich wie bei einer Camera obscura. Und hier, ein Stück tiefer im Haus, gleichsam abgesunken, liegt die geheimnisvolle Reilsche Insel, auch Inselcortex genannt. Wir kennen ihre Funktion nicht genau, aber in ihr treffen sich offenbar Sinneseindrücke und Erfahrungen mit Grundgefühlen wie Lust und Ekel, Angst und Hoffnung. Auch für unser Zeitempfinden scheint diese Region zuständig zu sein. Sie haben mir bei unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie auf einer Insel großgeworden sind. Sie werden also aus eigener Erfahrung wissen, wie eng oft auf einer Insel Gefühle, Gedanken und Geheimnisse miteinander verwoben sind.«
B. stellte sich die Reilsche Insel als ein schönes tropisches Eiland vor, mit weißem Sandstrand und einem schwarzen Flutsaum. Der Arzt räusperte sich und fuhr dann fort: »Das ist aber nicht weiter schlimm. Es gibt genügend andere Areale im Hirn, in denen alles schön getrennt voneinander ist. Hier zum Beispiel, noch weiter innen, liegen die Schlafräume, die Küche, das Bad, die intimen Bereiche sozusagen, die nicht so leicht für einen normalen Besucher zugänglich sind. Von hier aus werden wichtige Interna über den Menschen in den Cortex geschickt. Stimmungen, Gefühle, Positionen von Gliedmaßen und so weiter. Zwischen diesen beiden Bereichen gibt es eine Art Korridor, Thalamus genannt, hier, sehen Sie, dieser Bereich im Zwischenhirn. Thalamus ist ein griechisches Wort und heißt Schlafraum. Das ist ein irreführender Name, denn gerade im Thalamus herrscht eine besonders große Aktivität. Hier wuseln die Dienstboten herum, hier gibt es Freunde, Berater des Hausherrn, heimliche Liebhaber der Hausfrau. Hier werden häufig die eigentlichen Entscheidungen getroffen, ähnlich wie in den Hinterzimmern der Politik. Man könnte auch sagen, im Thalamus wird aus der Überfülle der von außen und innen kommenden Informationen das für lebenswichtige Entscheidungen Relevante herausgefiltert, bearbeitet und weitergeleitet.«
Er machte eine Pause und blickte aus dem Fenster. Die kahlen Äste, die man dort sehen konnte, bewegten sich heftig. Anscheinend war es ein stürmischer Tag. Dann hörte B. wie aus weiter Ferne wieder die Stimme des Arztes.
»Und selbstverständlich gibt es in unserem Haus auch einen Keller. Hier, sehen Sie, die Basalganglien und der Hirnstamm. Was hier passiert, liegt immer noch weitgehend im Dunkeln. Es handelt sich jedenfalls um mehr als die klassischen Funktionen der Willkürhandlungen, der spontanen, unbewussten Reaktionen und Einstellungen des Körpers, der Temperatur- und Blutdruckregelung zum Beispiel. Sie sollten übrigens etwas für Ihren Blutdruck tun. Er ist viel zu hoch. Ich rate Ihnen, zu einem Kardiologen zu gehen. Und schließlich gibt es noch ein Nebengebäude, das eine Art Eigenleben führt, auch wenn es mit dem Hauptgebäude eng verbunden ist: das Kleinhirn.«
B. beschlich ein ungutes Gefühl. Was sollten all diese umständlichen Erläuterungen. Er war doch nicht in einem Hörsaal. Er war hier, um sich die oberen Atemwege operieren zu lassen. Der Arzt beobachtete ihn genau. Seine Stimme hatte jetzt etwas Beschwörendes.
»Und hier, unterhalb des Thalamus, in der Nähe des Hirnstamms, sehen Sie zwei auffällige Regionen. Die eine erinnert an eine Mandel, die andere an ein Seepferdchen. Das sind die Amygdala, auch Mandelkern genannt, und der Hippocampus, der seiner Form nach tatsächlich an ein Seepferdchen erinnert. Beide sind wiederum doppelt vorhanden. Beide sind seltsame, jedoch lebenswichtige Rumpelkammern in der Tiefe des Hirns. Die Amygdala ist vor allem für die Entstehung negativer Gefühle wie Angst und Panik verantwortlich. Der Hippocampus entscheidet über die Speicherung von Erlebnissen aus allen Phasen des Lebens. Er ist sozusagen die Datenbank der persönlichen Erinnerungen eines Menschen. Beides sind entscheidende Navigationssysteme für das Leben. Sie müssen zum Beispiel Angst haben können, um gefährlichen Situationen zu entkommen. Und ohne funktionierende Hippocampi können Sie keine Erinnerungen speichern, keine hilfreichen Erfahrungen machen. Es handelt sich übrigens um entwicklungsgeschichtlich sehr alte Gehirnstrukturen, fast so alt wie das Stammhirn. Aber setzen wir uns doch.«
Der Arzt nahm auf seinem Bürostuhl Platz und machte eine einladende Geste in Richtung eines kleinen schwarzen Ledersessels, der seitlich neben dem Schreibtisch stand.
»Das haben Sie eben schön gesagt«, sagte B. »Ich bin, wie Sie wissen, Schriftsteller, und für meinen Beruf braucht man tatsächlich nichts nötiger als Angst und Erinnerung. Das Erinnern für das Erzählen, die Angst für den Respekt vor einem möglichen Scheitern oder aber auch vor einem möglichen Erfolg. Ich bin im Innersten überzeugt, dass ein großer Schriftsteller erfolglos sein muss. Autoren wie Arthur Rimbaud zum Beispiel waren Genies, gerade weil sie keinen Erfolg hatten und im Leben gestrandet sind. So paradox es klingen mag: Ich habe mich zwar immer nach Ruhm und Anerkennung gesehnt, jedoch gleichzeitig auch höllische Angst davor gehabt. Als liege darin eine Art Verrat an meiner Mission. Daher habe ich meinen Erfolg instinktiv immer wieder zunichtegemacht, wenn er sich einzustellen schien.«
»Das klingt ein wenig nach Masochismus. Ich habe übrigens Ihr Buch im Urlaub mit großen Vergnügen gelesen. Stört Sie das etwa?«
B. hatte inzwischen den Verdacht, dass der Arzt so viel redete, um einer unangenehmen Wahrheit auszuweichen, als schliche er wie eine Katze um den heißen Brei.
»Ich habe Angst«, sagte B. leise und mit zitternder Stimme. »Meine Amygdalae scheinen also offenbar zu funktionieren. Kommen Sie bitte endlich zur Sache.«
Der Arzt nickte. »Ich verstehe Ihre Beunruhigung. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Problem.«
Sie erhoben sich und gingen wieder zum Leuchtschirm. »Dies hier, dieser kleine Schatten zwischen der linken Amygdala und dem linken Hippocampus«, der Arzt zeigte mit dem Stift auf einen walnussgroßen grauen Fleck, »das ist der böse Untermieter in Ihrem Schädelhaus, der Tumor. Wir haben ihn zufällig bei der Durchmusterung der Fotografien entdeckt. Er zahlt keine Miete und benimmt sich frech und aufdringlich. Er ist auch verantwortlich für die typischen Herdsymptome, die wir bei Ihnen festgestellt haben, für Ihre Gangstörungen, Ihre Visusstörungen, Ihre Erinnerungslücken. Wenn er weiter wächst, was er bestimmt tun wird, verlieren Sie möglicherweise die Fähigkeit, Angst zu haben, was durchaus gefährlich sein kann. Auch Ihr Kurz- und Langzeitgedächtnis können bedroht sein. Ich will Ihnen nichts vormachen. Wie die histologischen Untersuchungen ergeben haben, handelt es sich um einen malignen Tumor der Stufe drei, mit anderen Worten, er ist bereits bösartig. Er wird weiter wachsen. Wir sprechen in einem solchen Fall von einer lebensbedrohlichen Raumforderung. Der Begriff Untermieter ist also zu harmlos. Es handelt sich eher um einen aggressiven Hausbesetzer. Für eine Bestrahlung allein ist es zu spät. Ein operativer Eingriff ist leider nicht zu umgehen. Das Problem dabei: die Lage der Geschwulst. Sehen Sie, hier, direkt unterhalb der Insula. Dies macht einen Eingriff kompliziert. Wir werden auf jeden Fall nicht umhinkommen, am offenen Schädel zu operieren. Eine Trepanation oder Kraniotomie, wie wir Ärzte sagen. Eine uralte Praxis, bei der mit einem Bohrer der Schädel geöffnet wird, um zu der erkrankten Hirnregion zu gelangen. Früher wandte man sie an, um bösen Geistern einen Weg aus der von ihnen befallenen Person zu bahnen. Das trifft es im Grunde auch heute noch. Dieser Tumor ist Ihr böser Geist. Ich will Ihnen nichts vormachen. Jede Kraniotomie ist mit gewissen Risiken verbunden. Es kann beim Herauslösen des Tumors zu Verletzungen der umliegenden Hirnsubstanz kommen, mit Folgen wie bei einem Schlaganfall. Das bedeutet im schlimmsten Fall den Rollstuhl, bleibende Artikulationsprobleme, Störungen des Erinnerungsvermögens, auch des Zeitgefühls. Doch wenn wir nichts tun, kommt das alles sowieso und dazu noch ein früher Tod. Wenn wir uns aber zu dem Eingriff entschließen, besteht immerhin die Möglichkeit, dass Sie noch ein paar Jahre ein normales Leben führen können.«
Der Arzt stand auf und gab B. die Hand und drückte sie fest. Dabei sah er ihm in die Augen. »Entscheiden Sie sich bitte bis übermorgen. Wir könnten in einer Woche operieren.«
B. nahm das Abendessen an dem kleinen Tisch am Fenster ein. Er hatte keinen Appetit und ließ das meiste stehen. Er hatte die Jalousie heruntergelassen, denn ein Blick nach draußen kam ihm unangemessen vor. Dann zog er sich aus und legte sich ins Bett, dessen Rückenteil er mit der Fernbedienung so einstellte, dass er fernsehen konnte. Der Apparat lief ohne Signal. Er starrte auf den flimmernden Schirm. Das Bildrauschen, dieses Schneetreiben aus kleinen aufleuchtenden und wieder verlöschenden Punkten, kam ihm vor wie eine Darstellung all der Augenblicke seines Lebens, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. Irgendwann schaltete er das Gerät aus, und der Bildschirm des alten Röhrenapparates wurde dunkel. Ein schwaches Nachleuchten, dann war alles vorbei. Immer noch starrte er auf die Mattscheibe. Plötzlich erschien dort ein Bild, das ihm aus seiner Jugend vertraut war. Im flachen Wasser hinter dem Flutsaum sah man ein Monstrum mit zahllosen gelben Gliedern, die sich ständig bewegten, Scheren, die sich öffneten und schlossen, dünne Beine, die sich gegen Panzer stemmten. Es war ein ganzer Klumpen von Krebsen. Er hatte in seiner Kindheit auf der Insel oft Miesmuscheln gesammelt, sie mit Steinen aufgeschlagen und ins Wasser geworfen. Es dauerte nur kurze Zeit, bis sie aus allen Richtungen herbeikamen, Wollhandkrabben und Taschenkrebse, und sich mit gespreizten Scheren über das Muschelfleisch hermachten, es aus den Schalen herausrissen und sich in ihre auf- und zuklappenden Chitinmäuler stopften. Die Kurgäste, die gerade ins Wasser gehen wollten, reagierten verschreckt und mieden die Stelle. Das war der Sinn der Sache: Kurgastärgern, für die einheimischen Kinder der Insel im Sommer ein beliebtes Spiel. Jetzt war dieses Monstrum mitten in seinem Kopf und machte sich daran, am Flutsaum seines Ichs die aufgeschlagenen Muscheln der Erinnerung zu fressen.
B. bat die Nachtschwester, die Tür einen Spalt offen zu lassen, damit aus dem erleuchteten Flur ein schmaler Streifen Licht in sein Zimmer fallen konnte. »Wenn Sie etwas brauchen, drücken Sie doch einfach den Knopf über Ihrem Bett. Dann geht im Flur die rote Lampe über Ihrer Tür an, und ich komme.«
»Bitte«, wiederholte B. »Nur einen kleinen Spalt. Ich habe das als Kind gebraucht, in den Bombennächten und an Weihnachten. Sonst konnte ich nicht einschlafen. Ich habe hinter der Tür das Paradies vermutet. So ist es noch immer.«
Die Nachtschwester zögerte einen Augenblick, aber dann gab sie B.s Wunsch nach. Der Lichtstreifen bildete eine helle Spur auf seiner Bettdecke. Er tastete mit der Hand nach ihm und sah, wie der Streifen sich auf der Haut rötlich färbte. Dann sank er in einen traumlosen Schlaf.
B. erwachte erst wieder, als man ihm das Frühstück brachte. Zwei wattige Brötchen, eingeschweißte Marmelade, eiskalte, harte Butter, trüber Kaffee. Auch eine Art von Sterbehilfe, dachte er. Nur der Schmelzkäse schmeckte, aber das hatte Gründe, die weit zurück in seiner Kindheit lagen. Als er fertig war, zog er den Bademantel an und verließ sein Zimmer. Er ging am Glaskasten des Pförtners vorbei und durch die automatische Tür hinaus aus dem Gebäude.
Auf dem Vorplatz standen die Raucher. B. betrat die Straße. Die Luft war mild, »eine Luft wie Sekt«, hätte seine Mutter gesagt. Am Ende der Straße lag ein Café. Er ging hinein und setzte sich an einen der kleinen Glastische. Er war der einzige Kunde. Die Bedienung bedachte ihn in seinem Bademantel mit einem skeptischen Blick. B. bestellte einen Pastis ohne Eis. Als sie das Glas brachte, starrte sie auf seine nackten Zehen. Er bestellte ein zweites und ein drittes Glas. Die Dinge um ihn herum bekamen immer schärfere Konturen. Da er seit längerer Zeit keinen Alkohol mehr getrunken hatte, wirkte das Getränk sehr schnell. Als sie das vierte Glas brachte, sah er ihr ins Gesicht. Sie war sehr hübsch, ein wenig blass, als litte sie unter Anämie. Ihre Augen hatten die Farbe vom Aquamarin, ihre Haare waren flachsblond, glatt und zu einem kleinen Zopf zusammengebunden. Das kurze schwarze Kleid und die weiße Schürze standen ihr gut. B. fiel auf, dass sie Kinderknie hatte, die hervortraten und aussahen, als ob ihre Besitzerin häufig auf einem harten Boden knien würde. Sie sah viel jünger aus, als sie vermutlich in Wirklichkeit war, genau der Typ, der bei ihm starke Beschützergefühle auslöste, gemischt mit einem diffusen Begehren.
»Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass ich Sie schon einmal gesehen habe?«, sagte B. mit einer Stimme, die ihm fremd erschien, weil sie viel jünger klang, als sie es in Wirklichkeit war. Die Kellnerin zuckte mit den Schultern, ging an den Tresen und griff zum Telefon. Wahrscheinlich hielt sie ihn für einen Patienten aus der geschlossenen Abteilung. Er leerte das Glas mit der trübgelben Flüssigkeit, legte einen viel zu hohen Betrag auf den Tisch und ging. Er hatte einen Entschluss gefasst.
Später, als B. wieder in seinem Zimmer war, bat er die Schwester, den Chefarzt holen zu lassen. Dieser kam und setzte sich an den Rand des Bettes. »Ich freue mich für Sie, dass Sie sich zu dem Eingriff durchgerungen haben. So ist es doch, oder nicht?«
»Ja«, sagte B.
»Sehr gut. Ich werde ihn persönlich leiten. Die Operation wird wahrscheinlich sieben bis neun Stunden dauern. Das hängt davon ab, wie gut sich der Tumor vom gesunden Gewebe abschälen lässt. Sie werden nichts davon merken. Natürlich könnten wir auch nur eine örtliche Betäubung vornehmen. Das hätte den Vorteil, dass wir während des Eingriffs überprüfen könnten, ob wir eventuell das Sprachzentrum verletzen. Aber ich würde in diesem Fall doch eine Vollnarkose vorziehen. Wir müssen bei der Operation mit unseren Messern sehr exakt navigieren. Die kleinste Bewegung des Kopfes könnte schwere Folgen haben. Ich freue mich für Sie«, wiederholte er, als zweifelte er bereits an B.s Kurzzeitgedächtnis. »Genießen Sie den morgigen Tag. Übermorgen beginnen wir mit den Voruntersuchungen. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen?«
»Auch wenn ich mich wiederhole. Ich habe Angst. Nicht, mein Leben zu verlieren, sondern mich an nichts mehr erinnern zu können. Alles zu vergessen, was meine Identität bedeutet. Dabei ist Vergessen sicher wichtig, auch um der Erinnerung den nötigen Platz zu geben. Ich bin gerade dabei, die Geschichte meines Lebens aufzuschreiben, und wenn man das tun will, muss man wahrscheinlich aus beiden Flüssen der Unterwelt trinken, aus Lethe, dem Fluss des Vergessens, und aus Mnemosyne, dem Fluss der Erinnerung. Dabei frage ich mich, was Erinnerungen überhaupt sind. Vielleicht nur glaubwürdige Fälschungen der Vergangenheit? Ich versuche in letzter Zeit oft, mich an Erinnerungen zu erinnern. Sie haben die Neigung, sich dabei aufzulösen wie Schneeflocken, die zu tauen beginnen, wenn man sie mit der Hand eingefangen hat.«
Der Arzt lächelte: »Erinnerungen sind keinesfalls immer objektiv. Dafür sorgen schon zwei rätselhafte Gehirnregionen. Der Globus pallidus und die Substantia nigra, eine unscheinbare, wegen ihrer Eisenhaltigkeit schwärzliche Formation im Mittelhirn. Beide Basalganglien wirken offenbar auf den Thalamus ein und veranlassen ihn, nur bestimmte Botschaften an den Cortex zurückzugeben. Eine Zensurbehörde gewissermaßen oder eine Art Filter für die Erinnerung. Aber vermutlich können beide Regionen mehr. Sie könnten zum Beispiel bei der Kreativität eine Rolle spielen.«
»Demnach könnte Kreativität etwas mit zensierter Erinnerung zu tun haben? Die Substantia nigra als Sitz der schwarzen Gedanken, die man ebenfalls braucht, um schreiben zu können?«
»Möglich. Die Wissenschaft sieht in Erinnerungen allerdings ganz banal in erster Linie gespeicherte Informationen. Das kann alles Mögliche sein. Eindrücke, Erlebnisse, Gerüche, Mitteilungen, Texte, Musik. Das Gehirn speichert das alles in seinem Langzeitgedächtnis in Form von Veränderungen an den Synapsen, von denen es im menschlichen Gehirn bis zu 500 Billionen gibt. Es existiert kein eigentliches Erinnerungsorgan, keine molekulare Basis des Gedächtnisses, wie man früher dachte, vergleichbar mit der Festplatte eines Computers. Erinnerungen verteilen sich vielmehr als eine Art Muster in den plastisch veränderbaren Synapsen. Viele unterschiedliche Regionen des Gehirns sind daran beteiligt. Vielleicht sind Erinnerungen sogar das, was man früher Seele nannte. Auf jeden Fall haben sie etwas mit Gedächtnis zu tun. Sie sind doch am Meer aufgewachsen und haben sicher oft am Strand gelegen. Wie ein Körperabdruck im heißen Sand, so ähnlich ist das Gedächtnis. Von den Eindrücken selbst geht nichts verloren, aber Sandkörner rieseln nach und verändern sie.«
»Ist diese Veränderung des Abdrucks durch die Lebensumstände vielleicht das, was wir Vergessen nennen?«
»Was wir Vergessen nennen, ist in der Tat eine Verdrängung von Erinnerungen in eine Art Papierkorb, wo sie dem Zugriff des Bewusstseins entzogen sind. Es handelt sich um einen Schutzmechanismus des Gehirns. Es will nicht in der Datenflut der Erinnerungen ertrinken.«
»Und deshalb entzieht es die unwichtigen Erinnerungen unserem Zugriff?«
»Jedenfalls die, die ihm weniger wichtig erscheinen. Das müssen nicht die gleichen sein, die wir selbst für unwichtig halten.«
»Um Ihr Bild aufzugreifen, wenn man sich erneut in die gleiche Mulde legt, dann verändert sie sich dadurch. Sie wird tiefer, breiter. Neues überlagert Altes. Der gleiche Körper, aber ein anderer Abdruck. Und wenn dann noch der Wind hinzukommt, dann verändert sich der Abdruck weiter. Er kann sogar völlig verschwinden, einfach zugeweht werden. Dann sieht man nur noch den Umriss. Und wenn dann noch die Flut hinzukommt und über die Reste des Abdrucks spült, dann ist er ganz verschwunden. Nur noch glatter brauner Sand. Wäre das so etwas wie Amnesie, wie das, was uns erwartet, wenn wir Alzheimer haben oder sterben?«
Der Arzt nickte. »Aber auch wenn die Mulde völlig zugeweht oder überflutet ist, existiert sie unter den Sandkörnern weiter. Wir können sogar davon ausgehen, dass im Gehirn eines Sterbenden die größtmögliche Menge an Erinnerung enthalten ist, nur unerreichbar für sein verlöschendes Ich.«
»Gelänge es irgendwann, diese Datenflut auszulesen, wäre der Tod besiegt, und ewiges Leben wäre erreicht. Man bräuchte dann nur den alten Datenträger gegen einen jüngeren auszutauschen und alles wieder aufzuspielen.«
»So weit sind wir glücklicherweise noch nicht.«
B., der sich die ganze Zeit aufgestützt hatte, ließ sich jetzt ins Kissen zurückfallen. Dann murmelte er: »Noch eine letzte Frage, Herr Doktor. Bei dem Eingriff, wenn Sie mit dem Skalpell in meiner Gehirnmasse herumschneiden, könnte dabei alles im Gedächtnis Gespeicherte aufgewühlt werden wie die Sinkstoffe in einer trüben Flüssigkeit, in der herumgerührt wird? Könnte jenes plastische Netzwerk der Synapsen der verschiedenen Gehirnregionen, das unser Gedächtnis enthält, nicht in Aufruhr geraten? In Unordnung vielleicht? Chaos im episodischen Gedächtnis und Auftauchen längst vergessener Einzelheiten als Folge einer Tumorentfernung?«
Der Arzt war aufgestanden und beugte sich zu B. herab. Mit fester Stimme sagte er: »Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen. Ich werde bei der Exzision mit größter Vorsicht verfahren. Ich glaube nicht, dass sich Ihre Persönlichkeit durch den Eingriff verändern wird.«
Er griff nach B.s Hand, die schlaff auf der Bettdecke lag, schüttelte sie mehrmals und ging. In der Tür drehte er sich noch einmal um und wiederholte, als zweifelte er immer noch an B.s Kurzzeitgedächtnis: »Ich freue mich für Sie. Ich freue mich für Sie. Es wird alles gut.«
In dieser Nacht wachte B. immer wieder auf. Er tastete jedes Mal nach dem elektrischen Wecker, der einst seinem Vater gehört hatte. An der Oberseite befand sich eine Taste. Wenn man sie drückte, leuchtete das Zifferblatt für wenige Sekunden meergrün auf. Es war wie ein Blick in die Tiefe des Meeres. Wenn das Licht erlosch, kamen seine dunklen Gedanken wieder. Sie krochen über den Boden seiner Seele, seltsame schwarze Aale, vollgefressen mit Insektenlarven und Kleinkrebsen, Augenblicken wie Plankton aus einem vergangenen Leben. Die Angst kam in Wellen, süßlich und bitter zugleich. B. tastete nach seinem Handgelenk, bis er seinen Puls fühlte. Er war unregelmäßig und schnell. Endlich schlief er ein.
Am Morgen weckte ihn die Krankenschwester und stellte sein Tablett mit dem in Zellophan verpackten Frühstück auf den schwenkbaren Tisch an seinem Bett. Dann maß sie seinen Blutdruck. »Viel zu hoch«, sagte sie schließlich, nachdem die Luft aus dem Band entwichen war. Es klang wie der letzte Seufzer eines Sterbenden.
»Ist das ein Wunder?«, murmelte B. Er blickte zum Fenster, hinter dem gerade die Sonne aufging. Im Gegenlicht sah der Fensterrahmen aus wie der Rand einer Todesanzeige.
Als B. später mit dem Bus ans Meer fuhr, befand er sich in einer euphorischen Stimmung. Es war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Die See war unnatürlich blau und sehr regelmäßig von kleinen Wellen gemustert. Am Strand waren nur wenige Leute. B. legte sich in den feuchten Sand, in den Flutsaum unmittelbar an der Wassergrenze. Nach einer Weile hatte er das Gefühl, dass das leise Plätschern der Wellen sich mitten in seinem Kopf befand. Er versuchte nachzudenken, nicht angestrengt, sondern im Rhythmus jener Wellen, aber seine Gedanken trieben immer wieder davon wie Rindenstückchen in einem inneren Meer. Als er endlich aufstand, betrachtete er den Abdruck seines Körpers. Die steigende Flut begann bereits die Mulde zu füllen und dabei ihre Umrisse zu zerstören. Ein kleiner, grauer, halb durchsichtiger Ball wurde in sie hineingespült. B. kniete nieder und berührte ihn mit dem Finger. Er gab nach, der Körper einer toten Qualle. »Du kannst sehr alt werden«, dachte B., »weil du weder ein Hirn noch ein Herz hast. Und du bist sehr schön, weil du dich an nichts erinnern kannst.«
B. fuhr zurück in die Stadt und ging wieder in das Café am Ende der Straße. Diesmal schien die Kellnerin zufrieden mit seinem Äußeren, dem sandfarbenen Cordanzug, dem weißen Stetson, den braunen Halbschuhen. »Pastis ohne Eis?«, fragte sie. »Nein, diesmal ein Gläschen Rosé als Versprechen eines kommenden schönen Sommers. Ich weiß übrigens jetzt, woher ich Sie kenne. Sie haben früher im Strandcafé gearbeitet.«
Sie nickte. »Das stimmt. Ein schöner Arbeitsplatz, aber schlecht bezahlt.«
»Wenn alles gut geht, werde ich Stammgast bei Ihnen.«
»Was heißt das? Haben Sie ein Problem?«
»Ja. Das kann man so sagen.«
Sie sah ihn aufmunternd an. »Es wird schon alles gut gehen.«
»Trotzdem ist mir nach Abschied zumute. Abschiede sind der Wellenschlag am Ufer der Zeit.«
»Ich verstehe nicht genau, was Sie meinen«, erwiderte sie, während sie das Glas mit dem Wein vor ihn hinstellte. »Aber es klingt irgendwie gut.«
Mit B.s künstlicher Gelassenheit war es schnell wieder vorbei. Die Diagnose des Arztes begann wie ein ungeheures Gewicht auf seinem Gemüt zu lasten. Da er inzwischen fürchtete, dass sein Gedächtnis immer schlechter wurde und die Bilder der Vergangenheit bereits mehr und mehr verblassten, entsann er sich des Umstands, dass er schon früh Notizbücher in den unterschiedlichsten Formaten vollgeschrieben hatte, billige, schwarzrot eingebundene und linierte Bändchen aus dem Kaufhaus. Keine Tagebücher im eigentlichen Sinne, eher Logbücher des Lebens, voller Termine, Namen, Telefonnummern, Einfälle, Gedichte. Diese Hefte befanden sich zusammen mit zahllosen Briefen in einem alten Überseekoffer, den er jetzt aus seiner Wohnung kommen ließ. Er begann, in den Manuskripten zu lesen. Sprunghaft, ohne Rücksicht auf die Chronologie. Es war der hilflose Versuch, eine Art Sicherungskopie seines Lebens herzustellen. Vielleicht gab es ja so etwas wie ein Muster in all diesen chaotischen Verhältnissen und Erfahrungen, die sein Dasein ausmachten und, wie er empfand, über eine Beliebigkeit erhoben, die das Leben vieler Menschen prägte.
B. aß in der Kantine zu Mittag. Ihm gegenüber saß ein Mann, der das fette Essen mit großer Gier verschlang. Sein Kopf wirkte unförmig wie ein Kürbis, den sein Gewicht deformiert hatte. Der Patient erzählte B., dass er bereits die dritte Operation hinter sich habe. Aber der Tumor in seinem Hirn wachse immer wieder neu. Wie eine Kartoffel, die man in der Ackerfurche vergessen hat. »Ich habe ständig Hunger. Unmöglich, ihn zu stillen«, sagte der Mann. Er erhob sich und holte sich eine zweite Schweinshaxe mit Sauerkraut und Kartoffelbrei.
An einem der folgenden Tage hatte B. einen Termin beim Chefanästhesisten, dessen Büro in einem Nebengebäude lag. Eine Allee kahler Bäume führte dorthin. An ihren Zweigen waren noch keine Knospen, keine Vorboten des kommenden Frühlings zu sehen. Aber es lagen immer noch trockene Herbstblätter in allen möglichen Ecken und Nischen auf dem Boden. Sie raschelten und bewegten sich im kalten Wind, als wollten sie sagen: Seht her, wir leben, auch wenn man uns längst aufgegeben hat. Der Himmel über den Bäumen war ohne Konturen, eine gleichmäßige, trübe Hochnebeldecke. Als ein Schwarm Vögel unter ihr vorbeiflog, sah es so aus, als ob der Himmel Löcher hätte, durch die man ins schwarze Weltall sehen konnte.
Der Anästhesist war ein älterer Mann, der eine große Menschlichkeit ausstrahlte. Aus seinem kahlgeschorenen Schädel blickten zwei freundliche, wasserklare Augen, und sein Mund verlor sein Lächeln nicht, auch wenn er sprach und dabei unschöne Dinge sagte. Er gab B. die Hand und sagte mit einem starken Akzent: »Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie doch bitte Platz.«
B. war darauf gefasst, Fragen nach früheren Krankheiten, nach den vielen Medikamenten, die er einnehmen musste, und anderen medizinischen Aspekten beantworten zu müssen, doch der Narkosearzt blickte ihn nur eine Weile nachdenklich an und meinte dann: »Sie sind Künstler, nicht wahr?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Nun, Sie haben einen Tick. Das ist typisch für kreative Menschen.« Er blickte auf B.s linke Hand, und B. bemerkte erst jetzt, dass er offenbar die ganze Zeit mit den Fingern auf die Sessellehne getrommelt hatte.
»Ach das. Das ist bloß Ungeduld. Ich kenne an mir eigentlich nur einen echten Tick. Wenn es Kartoffeln zum Essen gibt, muss ich immer eine auf dem Teller zurücklassen, egal wie groß die Portion war, und wenn es Kartoffelbrei gibt, genau die entsprechende Menge an Brei. Diese Macke hängt vermutlich mit meiner frühen Kindheit zusammen. Es gab damals eine Weile fast nur Kartoffeln. Die zurückgelassene Kartoffel ist so etwas wie ein Protest gegen den Krieg.«
»Verstehe. Sollten Sie wirklich einen Tick haben, darf Sie das nicht beunruhigen. Das angebliche Normalverhalten der Menschen ist schließlich selbst ein Tick. Das Ergebnis einer überkompensierten Persönlichkeitsstörung. Im Übrigen habe ich Ihre Akte studiert und daraus entnommen, dass Sie ein Savant sind. Sie verfügen über eine typische Inselbegabung und sind zugleich ein Stümper, was Ihr Sozialverhalten anbelangt. Ich vermute, dass alle Ihre Beziehungen gescheitert sind. Wie oft waren Sie verheiratet?«
»Dreimal. Alle Ehen sind tatsächlich gescheitert, die letzte allerdings nicht an sich selbst, sondern an meinem physischen Zustand.«
»Sie sollten es ein viertes Mal versuchen. Ich möchte Ihnen meine Tochter ans Herz legen. Sie heißt Tatjana, und sie ist sehr schön.«
B. atmete auf. Der Anästhesist gefiel ihm, gerade weil er ein ziemlich unkonventionelles Verhalten an den Tag legte. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte B. den Eindruck, einen echten Dialog führen zu können. Vielleicht könnte er sich mit diesem Menschen sogar befreunden. Allerdings ein lächerlicher Gedanke. Er hatte sein Leben lang vergeblich nach Freundschaft gesucht. Jetzt war es dafür längst zu spät. Er würde sich nicht mehr die Mühe machen, einen anderen Menschen wirklich kennenlernen zu wollen, denn das würde bedeuten, ihm alle Masken so behutsam wie möglich vom Gesicht zu nehmen.
»Wen dürfen wir benachrichtigen, wenn es wider Erwarten irgendwelche Komplikationen gibt?«
»Ich habe keine Verwandten mehr, auch keine Freunde. Ich möchte jedoch, dass Sie die Kellnerin informieren, die in dem Café am Ende der Straße bedient.«
»Haben Sie noch eine Rechnung bei ihr offen?«
»Gewissermaßen ja. Aber keine, bei der es um Geld geht. Aus welcher Gegend Russlands kommen Sie?«
»Das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen. Meine Mutter ist Ukrainerin, mein Vater Tschetschene. Ich bin so etwas wie ein sesshafter Nomade. Ich habe meine Jurte immer bei mir. Sie ist in meinem Kopf. Außerdem ist Russe zu sein keine Nationalität, sondern ein Zustand. Ich heiße übrigens Igor.« Er reichte B. die Hand und schüttelte sie.
»Apropos Komplikationen. Was ist, wenn ich nach dem Eingriff nicht mehr aufwache?«
»Sie meinen, wenn Sie nicht mehr in das zurückkehren, was wir lächerlicherweise Leben nennen? Wenn Sie einen sogenannten Hirntod erleiden?«
»Ja. Eine letzte zugefallene Tür, die sich von innen nicht mehr öffnen lässt, weil die Klinke fehlt.«
»Als Russe würde ich lieber von Herztod sprechen. Das Hirn spielt in unserem Land nur eine unwichtige Nebenrolle. Auch der gesunde Menschenverstand ist bei uns ziemlich selten. Aber medizinisch ist der Herztod natürlich nicht mit dem Hirntod gleichzusetzen, also einem irreversiblen Verlust der Gesamtfunktion des Gehirns. Es gibt Schockzustände, die zum Herzstillstand führen, der aber durchaus reversibel sein kann. Man braucht also zusätzliche Indizien, um den endgültigen Ausfall des Gehirns klinisch nachzuweisen. Man leuchtet zum Beispiel mit einer kleinen Lampe direkt in die offene Pupille. Wenn Reflexe ausbleiben, ist das ein Indiz für den Hirntod. Oder man reizt den Trigeminus an bestimmten Druckpunkten, indem man mit einer Nadel hineinsticht. Oder man durchbohrt die Nasenscheidewand mit der Kanüle einer Spritze. Gibt es keine Reaktionen, weder Blutdruckerhöhung noch Veränderungen der Pupillengröße, ist auch das ein gravierendes Ausfallsymptom. Man kann Atropin geben, zwei Milligramm etwa. Wenn der Kreislauf nicht reagiert, deutet das ebenfalls auf einen Hirntod hin. Hirnstammareflexie nennt man das. Als letztes klinisches Ausfallsymptom ist der Nachweis von Apnoe obligat. Apnoe bedeutet das Erlöschen des Atemantriebs. Wenn man den Patienten mit hundertprozentigem Sauerstoff beatmet, steigt der CO2-Druck in den Arterien. Ab einer gewissen Höhe sollte es zur Spontanatmung kommen. Bleibt sie aus, ist der Patient höchstwahrscheinlich tatsächlich mausetot. Ich als Russe brauche diese Hilfsmittel übrigens nicht. Ich spüre es einem Menschen sofort an, ob er lebt oder tot ist. Er kann ja auch schon zu Lebzeiten ziemlich tot sein. Genau genommen leben viele Menschen ihr ganzes Leben in einem Zustand, den ich als Wachkoma bezeichnen würde. Sie denken nicht nach. Sie vegetieren stumpfsinnig dahin, ohne wirkliche Reflexe zu zeigen, auf Gefühle zum Beispiel oder auf neue Erfahrungen. Man könnte es Lebensareflexie nennen.«
»So ist es. Auch ich hatte immer die größte Angst davor, schon zu Lebzeiten ziemlich tot zu sein.«
»Dagegen habe ich ein gutes Mittelchen.«
Der Anästhesist griff in ein Schränkchen unter seinem Schreibtisch und holte eine Flasche und zwei Gläser hervor. Die Flasche hatte ein Etikett, auf dem eine halbnackte Schönheit dargestellt war. Igor schenkte die Gläser randvoll. »Das ist Snow Queen, mein Lieblingswodka.« Er hob das Glas vorsichtig, um nichts zu verschütten, und sagte »Nastrovje«. B. tat es ihm nach. Das Getränk wirkte wie eine Bluttransfusion. B. fühlte sich plötzlich so wohl wie schon lange nicht mehr. Vielleicht war dies bereits der Beginn der Anästhesie.
Der Anästhesist schenkte die Gläser wieder voll. »Früher stellte man sich die Vollnarkose als eine Art Schlaf vor. Heute wissen wir, dass es eher ein komaähnlicher Zustand ist. Das Gehirn ist während der Vollnarkose keineswegs inaktiv, im Gegenteil, es verfällt in eine gewisse Hektik, aber es arbeitet nicht mehr vernünftig, es arbeitet gleichsam russisch. Stellen Sie sich das wie ein völlig überlastetes Internet vor. Zu viel Information, zu viele gleichzeitige Abfragen. Nichts geht mehr. Die Folge: Alle einzelnen Regionen des Gehirns bilden sozusagen Inseln, zwischen denen keine Fähren mehr fahren.«
»Das gefällt mir. Während der Narkose ist das Ich also ein Insulaner, dessen Lebensraum sich über viele voneinander isolierte Inseln erstreckt, über einen ganzen Archipel an Einsamkeiten.«
»So könnte man es sagen. Je mehr wir übrigens das Wesen der Narkose verstehen, desto besser verstehen wir auch, was Wachbewusstsein bedeutet. Man muss auf jeden Fall akzeptieren, dass der Begriff der Wachheit unscharf ist. Denken Sie an das Unbewusste, das sich in Träumen zu Wort meldet. Denken Sie an Komapatienten, die plötzlich die Augen aufschlagen, obwohl sie nicht bei Bewusstsein sind. Auch Schlafwandler, Somnambule, Menschen in Hypnose oder im Drogenrausch bewegen sich in diesem Zwischenreich. Und neuerdings gibt es einige Kollegen, die sogar von einem dritten Bewusstsein ausgehen, das sowohl Eigenschaften der Wachheit als auch der Vollnarkose habe. Man bekommt alles mit, aber man nimmt keinen Kontakt zur Außenwelt auf. Man ist in sich eingeschlossen wie in einem Kerker, tot und lebendig zugleich. Dynästhesie nennt man das.«
»Wie Vampire oder wie Zombies. Oder wie Schrödingers Katze.«
»Schrödingers Katze? Nie von dem Tier gehört.«
»Die Erfindung eines Quantenphysikers namens Schrödinger.«
Der Blick des Anästhesisten ruhte lange und freundlich auf B. Die Zeit verstrich. Beide schwiegen und tranken. Dann fuhr der Arzt fort:
»Sie sind Künstler und reden doch manchmal wie ein Naturwissenschaftler, so als ob Sie diese beiden Welten nicht trennen wollen. Das gefällt mir. Erklären Sie mir dieses Tier.«
»Schrödingers Katze ist eine Untote wie Graf Dracula oder wie Gott, von dem Nietzsche sagt, er sei eigentlich tot, und der dennoch in den Köpfen der Menschen ein unsterbliches Eigenleben führt. Besagte Katze sitzt in einem Kasten, völlig abgeschirmt von der Umwelt. Der Deckel ist zu. Man kann in das Innere nicht hineinsehen. Man weiß nur: als man die Katze hineintat, lebte sie. Neben ihr befindet sich ein Glaskolben, der ein tödliches Gift enthält. Über dem Glaskolben hängt ein Gewicht. Das Gift entweicht und tötet die Katze, wenn ein radioaktives Präparat zerfällt und mit Hilfe eines Geigerzählers einen elektrischen Impuls bewirkt, der wiederum eine Sperre löst, die das Gewicht in seiner schwebenden Position gehalten hat. Wann dies der Fall ist, weiß niemand, denn der radioaktive Zerfall ist nicht vorhersagbar. Er ist spontan, völlig zufällig. Er kann im nächsten Moment oder aber erst in einer Million Jahren stattfinden. Ein Gedankenexperiment.«
»Was wollte Schrödinger mit ihm sagen?«
»Er wollte eine Brücke zwischen der Welt der kleinsten Dinge, der Atome, und unserer Alltagswelt, dem Makrokosmos, schlagen. Er wollte zeigen, dass Quantenphänomene sich nicht immer im Makrokosmos durch Überlagerung gegenseitig auslöschen. Von außen gesehen ist die Lage der Katze fundamental uneindeutig. Sie ist in einem für den gesunden Menschenverstand paradoxen makroskopischen Quantenzustand, in dem sie sowohl lebt als auch tot ist. Erst wenn man den Deckel öffnet und hineinsieht, kollabiert dieser Quantenzustand und macht einer banalen Eindeutigkeit Platz: Die Katze lebt, oder sie ist tot. Sie ist nicht mehr beides zugleich. Auch wenn wir uns verlieben, befinden wir uns in einem uneindeutigen Zustand, nämlich in einem zwischen Wirklichkeit und Einbildung. Und wenn man zu schreiben, zu malen oder zu komponieren versucht, legt man alles darauf an, ebenfalls in einer mehrdeutigen Verfassung zu sein.«
Der Anästhesist nickte. »Wie ich schon sagte, ich habe eine sehr schöne Tochter. Sie sieht nicht ohne Grund der Person ähnlich, die auf dieser Flasche abgebildet ist. Gertenschlank und mit einem makellosen Dekolleté. Sie ist eine echte Snow Queen, kühl und heiß zugleich. Sie hat den klangvollen Namen Tatjana, aber das sagte ich Ihnen ja bereits. Sie ist Pianistin, und weil man von dieser Kunst nicht leben kann, arbeitet sie nebenher als Assistenzärztin. Sie hat ein Faible für reife Männer wie Sie. Sie werden ihr gefallen. Kennen Sie das Märchen von der Schneekönigin? Es geht um einen kleinen Jungen, der das Schöne für hässlich, das Hässliche aber für schön hält, weil ihm der Splitter eines Zauberspiegels ins Auge gedrungen ist, den der Teufel gemacht hat. Für uns Anästhesisten ein sehr lesenswerter Text. Die Schneekönigin küsst den kleinen Jungen zweimal, damit er seine Vergangenheit vergisst. Einen dritten Kuss verweigert sie, denn daran würde er sterben. Alles ist eben eine Frage der Dosierung.«
Der Narkosearzt erhob sich und legte beide Hände auf B.s Schultern. »Wir werden uns wiedersehen, mein Freund. Bestimmt. Sie sind noch nicht reif für den Tod. Dazu haben Sie noch zu viel Leben in sich. Das weiß ich, wenn ich Sie in den dunklen Kasten der Narkose befördere, auch wenn ich selbst nicht hineinblicken kann. Künstler wie Sie stufe ich übrigens grundsätzlich in die Klasse mit dem geringsten Risiko ein.« Dann ging er in Schlangenlinien zur Tür hinaus.
In dieser Nacht wurde B. von schweren Träumen geplagt. Darin tauchte ein Mann auf, der ein sackartiges weißes Gewand trug, ein Totenhemd. Es war Charon, aber er sah aus wie Igor, der Anästhesist. Er ruderte B. über einen Fluss. Dessen Wasser war kristallklar, sodass man bis auf den Grund sehen konnte. Furchterregende Monstren krochen dort herum, riesige Krebse mit weit geöffneten Scheren und schwarzen Stielaugen. Der Fluss mündete in einen anderen, dessen Wasser trüb und giftig war. Igor tauchte ein Gefäß hinein und befahl B., den Inhalt zu trinken. Es schmeckte bitter und machte betrunken.
Am Vormittag kam der Krankenhausfrisör und begann, B.s Schädel kahl zu rasieren. Er sah zu, wie die Strähnen auf den Linoleumboden fielen. Trotz seines Alters war B. immer noch blond. Es war exakt die Haarfarbe seiner Mutter. Nach ihrem Tod hatte er in einer kleinen Schatulle eine Locke von ihr gefunden, zusammen mit einem Rilkegedicht. Er hatte die Locke an seine Haare gehalten und keinen Unterschied festgestellt.
Wenig später lag B. in einem sterilen Nachthemd auf einer Pritsche und wurde durch endlose Gänge geschoben. Er sah überdeutlich jede Einzelheit über sich, jede schadhafte Stelle an der Decke, jeden Riss oder Fleck, jedes Insekt. Eine Frau in einem grünen OP-Kittel beugte sich über ihn. Sie sprach durch den Mundschutz. »Ihnen steht Chefarztbehandlung zu. Der Chefanästhesist ist leider verhindert. Es geht ihm zurzeit nicht gut.«
»Verstehe. Daran ist sicher eine Dame namens Snow Queen schuld.«
»Wie bitte?«
»Ich habe nichts dagegen, wenn Sie mich in den dunklen Kasten der Bewusstlosigkeit befördern. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen.«
»Ich kann Sie beruhigen. Mir ist noch nie jemand weggestorben«, sagte sie. Dann schob sie die Kanüle in sein Handgelenk. B. starrte auf den Schlauch, der zu dem Gefäß mit der klaren Flüssigkeit führte. Die Narkoseärztin öffnete ein Ventil, und Blasen begannen in dem Glasbehälter aufzusteigen. B. versuchte, sich auf den Moment zu konzentrieren, in dem er das Bewusstsein verlieren würde. Wahrscheinlich würde er ihn auch diesmal wieder verpassen, wie schon bei früheren Operationen. Es gab offenbar keinen gleitenden Übergang zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit, zwischen Wachsein und Schlaf, zwischen Leben und Tod. Es war, als ob das Licht plötzlich ausgeschaltet würde. Keine Dämmerung, kein Nachleuchten. So würde es auch diesmal sein. Schlagartig würde es dunkel werden, so finster, dass sich selbst diese Finsternis in all ihrer Dunkelheit verlieren würde.
Die Waldkolonie
* * *
Ich habe um meine Kindheit gebeten, und sie ist wiedergekommen, und ich fühle, dass sie immer noch so schwer ist wie damals und dass es nichts genützt hat, älter zu werden.
Rainer Maria Rilke, »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge«
Es fiel B. später schwer, sich an die lange Bahnfahrt zu erinnern, die ihn in die Stadt gebracht hatte. Nur dass die Waggons fast leer gewesen waren und dass es durch viele Tunnel und eine trostlose Landschaft ging. Die Stadt lag an einem großen Fluss. Er hatte ihn vom Fenster des Waggons aus gesehen. Ein breites graues Band, dessen anderes Ufer man kaum vom Himmel unterscheiden konnte.
Auch die Bahnhofshalle war fast leer. Nur vereinzelte, in schwarze Mäntel gehüllte Gestalten wie Schatten. Das mächtige Gebäude bot einen trostlosen Anblick. Viele der Glasscheiben in der Stahlkonstruktion waren gesprungen oder vom Ruß der Dampflokomotiven geschwärzt. B. lud sein Gepäck auf einen Rollwagen und schob ihn zur Gepäckaufbewahrung. »Wie spät ist es«, fragte er den kleinen Mann mit der Schirmmütze, der seinen Reisekoffer zur Aufbewahrung annahm und ihm eine Blechmarke dafür gab. Der Mann deutete zur riesigen Bahnhofsuhr. »Sie hat keine Zeiger«, sagte B. »Wie soll ich dann wissen, wie spät es ist?« »Zeit spielt hier keine Rolle«, sagte der Dienstmann. »Verlassen Sie sich ganz auf Ihre innere Uhr.«
Auch der Platz vor dem Bahnhof war fast menschenleer. B., der jetzt nur eine Aktentasche und einen kleinen Seesack dabeihatte, ging zum Eingang der Untergrundbahn. Er betrat die endlos lange Rolltreppe und fuhr in die Tiefe. Dabei wehte ihm ein heftiger Wind warmer Luft entgegen. Nur wenige der Lampen an den feuchten Wänden verströmten ihr trübes Licht. Der einzige Mensch auf dem schmalen Bahnsteig unten war ein Bettler. Ein ausgezehrter bärtiger Mann, der B. einen Plastikbecher entgegenhielt, in dem eine Münze klapperte. B., der nirgendwo einen Verbindungsplan entdeckt hatte, warf ein Geldstück hinein und fragte, welche Linie ins Stadtzentrum fahren würde. Der Bettler öffnete seinen zahnlosen Mund und gab einige unartikulierte Sätze von sich. In diesem Moment fuhr ein Zug ein. Eine Schlange kleiner roter Wagen. B. stieg ein, gerade noch rechtzeitig, denn schon ruckte der Zug und fuhr los, in einer rasenden Fahrt, die ihn fast den Halt verlieren ließ. In den Kurven bogen und krümmten sich ächzend die Wagen. Das Kreischen der Räder, das Heulen des Fahrtwinds schwoll an zu einem ohrenbetäubenden Lärm.
B. war nicht allein. Einige Fahrgäste wurden gleich ihm auf ihren Sitzen hin und her geschüttelt. Die meisten waren Frauen. Sie waren nicht besonders reizvoll, starrten vor sich auf ihre Hände, vermieden die Blicke der anderen. Eine Weile kümmerte sich B. nicht darum, wohin die Fahrt ging. War er nicht so sein ganzes Leben unterwegs gewesen? Ziellos? Ohne eine Vorstellung, wo er anhalten, wo aussteigen sollte? Wenn die U-Bahn an einer Station hielt, hörte man eine Stimme aus dem Lautsprecher plärren. Was sie sagte, war unverständlich. Doch einmal meinte B. das Wort »Zentrum« zu hören. Er sprang auf und verließ den Wagen. Die Rolltreppe spuckte ihn auf einem großen Platz aus. Es war inzwischen dunkel. B. erkannte auf einem großen Gebäude die Leuchtschrift Hotel Zentra. Der letzte Buchstabe war offenbar erloschen.
Er betrat mit seinem Gepäck das Foyer. An der Rezeption stand ein junger Mann und blätterte in einem dicken Buch. »Ich habe ein Zimmer gebucht«, sagte B. »Würden Sie mir bitte den Schlüssel geben und die Zimmernummer?« Der Mann reagierte erst, als B. seine Frage mehrmals wiederholt hatte.
»Die 63? Tut mir leid, das Zimmer ist erst morgen frei.«
»Dann seien Sie so nett und geben mir ein anderes Zimmer.«
»Das ist leider nicht möglich. Wir renovieren gerade. Es ist keine Saison. Sie sind unser einziger Gast.«
»Dann suche ich mir ein anderes Hotel.«
»Ich fürchte, Sie werden kein Glück haben. Wir sind das einzige Haus, das nicht geschlossen hat. Aber Sie können in dem Sessel dort schlafen.«
So kam es, dass B. seine erste Nacht in der Stadt in einem unbequemen Sessel verbrachte. Draußen tobte ein Sturm. Windböen rüttelten an den heruntergelassenen Jalousien und raubten ihm den Schlaf. Er fragte sich, warum er sich auf dieses Abenteuer überhaupt eingelassen hatte. Es gab nur einen Grund: Er war zu einer Expedition aufgebrochen, deren Ziel er selbst war. Er hoffte herauszufinden, warum er so war, wie er war, warum sein Leben so verlaufen war, wie es verlaufen war. Gab es einen Sinn? Ein Muster? Eine Art Logik des Schicksals? Oder war alles bloßer Zufall, Kontingenz, wie es in der Philosophie hieß, ein absurdes Spiel der Beliebigkeiten, ein stochastisches Phänomen, wie es die Informationstheorie nennt?
Am Morgen erhob er sich mit schmerzenden Gliedern. »Frühstück gibt es in der Cafeteria. Dort gibt es auch eine Toilette, wo Sie sich frisch machen können«, sagte die Person an der Rezeption. Es war diesmal eine junge Frau, die B. freundlich anlächelte. »Ihr Zimmer wird gerade sauber gemacht. Sie können es heute Nachmittag beziehen.«
Das Institut, von dem sich B. Hilfe bei seinem Projekt erhoffte, lag in der Nähe des Hafens. Er ließ sich von der Dame an der Rezeption den Weg zum Fluss erklären. Dann folgte er der Uferpromenade. Er bemerkte dabei, dass die Strömung des Flusses genauso schnell war wie er selbst. Irgendwann musste er einen Seitenarm des Stroms auf einer Brücke queren. Als Kräne auftauchten – sie ragten wie Giraffenhälse über die Dächer der Lagerschuppen –, wusste er, dass er am Ziel war.
1
Das große Gebäude des Instituts war in einem guten Zustand. Schlicht und funktional, ein kühl wirkender Bau aus Glas und Beton. B. betrat die Drehtür, die sich automatisch in Gang setzte und ihn in einen langen Flur hineinschob. Wieder ging er kahle Wände entlang, wie schon so oft in seinem Leben. Und wie immer empfand er dies als unangenehm, als eine Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit: Irgendwo hinzumüssen, ohne Möglichkeit, zu einer Seite entkommen zu können. Er glaubte plötzlich Schritte zu hören, die ihm in einem gewissen Abstand folgten, als würde ihn jemand beschatten. Aber als er sich umdrehte, war niemand zu sehen. Dann stand er vor einer angelehnten Tür, an der ein Zettel mit seinem Namen hing.
Als B. eintrat, fiel sein Blick zuerst auf den Rücken eines Mannes am Fenster. Die Person musste ihn gehört haben, aber sie drehte sich nicht um. Ihr Schweigen füllte den ganzen Raum. Doch da war auch ein leises Geräusch. Ein fernes, leicht an- und abschwellendes Rauschen. War es der Verkehr? Kam es von der Zentralheizung? War es der Fluss, der ganz in der Nähe ins Meer mündete, oder war es das Meer selbst, das dort draußen Treibgut ans Ufer spülte, Botschaften, die nie jemand würde entziffern können?
Dann hörte er eine Stimme. Sie klang fremd und kühl und drang wie aus weiter Ferne an sein Ohr.
»Legen Sie doch bitte den Mantel ab und setzen Sie sich. Machen Sie es sich bequem. Gefällt es Ihnen bei uns? Es ist vielleicht ein wenig kalt, aber es ist noch zu früh, die Heizung anzustellen. Ich habe Sie erwartet. Aber ich habe auch meine Zweifel gehabt, ob Sie wirklich kommen würden. Erinnern kann wie eine unbarmherzige Sonne sein, die schonungslos ihr Licht auf die Vergangenheit wirft. Dabei kommt oft auch Unschönes zu Tage. Wenn ihre Strahlen auf eine glatte Fläche treffen, werden sie nur Langweiliges zu Tage fördern. Ist die Vergangenheit jedoch rau bewegt wie das Meer, kommt vielleicht ein Kunstwerk zum Vorschein. Wir werden herausfinden, wie es in Ihrem Fall ist. Fangen Sie an. Ich werde zuhören. Hin und wieder, vermutlich sehr selten, werde ich eine Frage stellen, die Sie übrigens nicht zu beantworten brauchen. Es genügt, wenn Sie sie in Ihrem Gedächtnis bewahren.«
B. nahm in dem schweren Ledersessel gegenüber dem Schreibtisch Platz und versuchte sich zu entspannen. Von hier aus konnte man von der Außenwelt nur ein Stück des Himmels hinter den beiden hohen Fenstern sehen. Der Sturm hatte sich inzwischen gelegt, aber die Wellen mussten sich immer noch an der Mole brechen. Die Wolkendecke war aufgerissen. Lücken zeigten sich am Himmel wie blaue Pfützen, deren Tiefe unendlich war. »Rückseitenwetter«, flüsterte B. Ein Fachbegriff aus der Meteorologie, der das wechselhafte Wetter mit Schauern, Sonne und Böen nach dem Durchzug einer Kaltfront bezeichnete. Es war eines seiner Lieblingswörter. Er hatte es zum ersten Mal von seinem Vater gehört.
B. dachte an die schattenhaften Gestalten, die er auf seinem Weg hierher gesehen hatte. Manche von ihnen hatten am Geländer der Flusspromenade gestanden und in die Strömung gestarrt. Sein Herz schlug kräftig. Vielleicht war er zu schnell gegangen.
Der Mann am Fenster ließ sich noch einmal vernehmen. Er sprach gegen die Fensterscheibe, die dabei beschlug. »Wollen Sie eine bestimmte Reihenfolge einhalten?«
»Ja, wenigstens soweit es mir möglich ist. Ich werde versuchen, mich an die Chronologie zu halten, obwohl ich manchmal den Eindruck habe, dass Zeit zu den eher vagen Kategorien meines Lebens zählte. Erinnerungen stehen offenbar keineswegs ordentlich Schlange vor dem Schalter unseres Gedächtnisses. Meistens irren sie ziellos herum wie über einen großen, leeren Platz. Man muss Glück haben, um einer von ihnen zu begegnen. Aber es gibt noch einen anderen, vielleicht besseren Weg zurück in die Vergangenheit. Ich habe während meines Lebens an vielen verschiedenen und sehr unterschiedlichen Orten gewohnt, die mich geprägt haben. Daraus könnte sich eine Art Landkarte meines Lebens ergeben, so etwas wie seine Topographie. Sie würde ich als zweite Koordinate neben dem bloßen Nacheinander der Jahre hinzuziehen. Ich war nie ein Zeitmensch, ein Denk- oder Gefühlsmensch oder gar ein Menschenmensch. Ich war eher so etwas wie ein Ortsmensch.«
»Wie meinen Sie das?«
Der Mann am Fenster drehte sich um und sah ihn vermutlich an. Aber im Gegenlicht war sein Gesicht nicht zu erkennen, sonst hätte er in ihm vielleicht lesen können. Doch wahrscheinlich hätte das alles verdorben. Er war nicht hier, um sich auszusprechen, um Verständnis zu finden bei einem Freund, sondern um selbst etwas zu verstehen, etwas, was ihm bislang ein Rätsel geblieben war: die Summe seines Lebens. Teilbar nur durch sich selbst, wie er hoffte. Eine Primzahl also. Die Quintessenz. Das waren große Worte, aber B. hielt sich an ihnen fest wie ein Ertrinkender an einer Planke.
»Es gab immer Orte, an denen ich mich unwohl gefühlt habe, manchmal sogar alt, krank und gehetzt. Flure zum Beispiel oder Treppenhäuser, Parkplätze, Büroräume, Wartezimmer, selbst manche Wohn- und Schlafzimmer gehören dazu. Aber es gab auch Orte, an denen ich mich jünger fühlte, als ich in Wirklichkeit war. Zugabteile zum Beispiel, wenn sie sich durch die Landschaft bewegten. Und es gab sogar Orte, an denen ich mir einbildete, ganz ohne Alter zu sein. Am Meer oder an einsam gelegenen Seen konnte ich das Zeitgefühl fast völlig verlieren. Ortsmenschen wie ich reagieren meistens nur schwach auf ihre Mitmenschen. Alles, was sie interessiert, ist jenes Theaterstück, das sie ihr Leben nennen, das Stück, in dem Kulissen die Hauptrolle spielen, während die Menschen nur Statisten sind.«
B. hielt inne, denn er hatte das Gefühl, etwas zu zerreden, das sich hinter dem wehenden Vorhang seiner Gedanken verbarg. Der Mann am Fenster reagierte nicht. Sein Schweigen wirkte auffordernd wie das eines Priesters im Beichtstuhl. B. räusperte sich und fuhr fort:
»Es gibt Menschen, die sich am wohlsten in Wohnzimmern fühlen. Zu ihnen gehöre ich nicht. Andere mögen besonders Dachstuben, wegen des weiten Ausblicks. Es gibt auch Menschen, die ein Souterrain oder das Dämmerlicht eines Halbkellers bevorzugen. Wieder andere finden ihr Schlafzimmer am schönsten und richten es wohnlich ein. Es gibt Küchenmenschen oder Personen, denen ihr Arbeitszimmer über alles geht. Manche sind am liebsten in einer Werkstatt, wieder andere lieben die Kargheit einer Mönchszelle über alles oder den Trubel eines vollen Restaurants. Mein Lieblingsraum in einem Haus war immer schon der Wintergarten, die Veranda, diese Zwischenwelt zwischen Drinnen und Draußen. Man ist der Natur nahe und hat dennoch die Verbindung zum Inneren des Hauses nicht verloren. Ein Raum zwischen Winter und Sommer. Im Winter meistens zu kalt, im Sommer oft zu heiß, hat er seine beste Zeit im Frühjahr und im Herbst. Er hat gewöhnlich große Fenster. Auf den Fensterbrettern liegen tote Fliegen. Es gibt dort mehr schöne, sinnlose Dinge als sonst im Haus. Eine undichte Vase mit Strohblumen oder einen staubigen Gummibaum, eine verbeulte türkische Mokkakanne aus Kupfer, ein Glas mit unpolierten Bernsteinen, ein Flaschenschiff, von Seepocken bedeckte Muschelschalen, einen versteinerten Seeigel, das vergilbte Foto im Standrahmen, das einen im Krieg gefallenen Onkel zeigt. Fensterbretter von Veranden sind wie Tangstreifen des Lebens, an denen manches Strandgut angetrieben ist. Es gibt wichtige Veranden in meinem Leben. In ihnen konnte ich immer schon besser nachdenken als anderswo.«
Der Vorhang am Fenster bauschte sich in diesem Moment wie von einem Luftzug. B. merkte, dass er zu viel und zu schnell redete. Im milchigen Licht, das von draußen hereinfiel, glaubte er jetzt die Gesichtszüge des Anderen zu erkennen. Sie wirkten starr wie die einer Larve. B. lehnte sich im Sessel zurück und versuchte, sich zu entspannen. Dabei erblickte er sich wie zufällig im Spiegel. Es irritierte ihn, dass er lächelte. Ein dummes Lächeln, wie es jemand aufsetzt, der keinen Grund dazu hat. Schnell sah er wieder zum Fenster. Ein Vogel flog draußen vorbei. Eine Krähe wahrscheinlich oder doch eine Amsel? »Die schwarze Lina«, flüsterte er. Dann begann er zu erzählen, langsam und stockend zuerst, schließlich immer fließender, als sei er in eine Strömung geraten, die ihn unwiderstehlich mit sich fort zog. Manchmal hatte er dabei das Gefühl, dass sich seine Erinnerungen zu einer eigenen Wirklichkeit verdichteten, die nicht mehr mit der Vergangenheit zu tun hatte als ein Schatten mit der Sonne.
*
Mein erster Lebensort war der Kopf meiner Mutter. Ich existierte dort bereits vor meiner Geburt, ja sogar schon vor meiner Zeugung. Es war ein seltsamer Ort. Seine Einrichtung verriet einen ungewöhnlichen Geschmack. Eine wilde Mischung aus Wünschen, Bedürfnissen, Träumen, Vorurteilen, Ängsten, Lektüre, wobei vor allem die Gedichte Rilkes eine wichtige Rolle spielten. Außerdem waren da einige kreative Fähigkeiten wie eine große zeichnerische Begabung und ein beachtliches Talent, anschaulich zu formulieren, und nicht zuletzt eine fast zwanghafte Neigung zum Inszenieren. Das mag nichts Ungewöhnliches sein, doch bei dieser jungen Frau kam eine enorme Energie hinzu, mit der sie die oftmals gegensätzlichen Stilelemente dieses Interieurs zu einer Einheit zu verbinden suchte. Es waren starke disparate Kräfte, die in ihr wirkten, die sich manchmal gegenseitig blockierten oder verstärkten und die ihre Person zu zerbrechen drohten. Äußerlich sah man ihr die komplizierten Verhältnisse ihres Innenlebens nicht an. Sie war vielleicht ein wenig manisch depressiv oder hysterisch, doch verstand sie es blendend, den Eindruck einer hochbegabten, eleganten, selbstbewusst wirkenden Erscheinung zu erwecken. Die Oszillation ihrer Stimmungsschwankungen ergab, ähnlich wie das Vibrato eines Geigentones, den Gesamteindruck eines warmen, wohlklingenden Tones.
Margarete war schlank, und sie hatte rotblonde Haare. Ihre Stirn war sehr hoch und stark gewölbt. Sie erinnerte an ein Botticelliporträt. Sie trug gern weite sommerliche Kleider oder saloppe Hosen, auch wenn es nicht in die Jahreszeit passte, aber solche Kleidungsstücke betonten ihre Figur. Die runde Stirn und ihr blasser Teint weckten bei Männern Beschützergefühle und die Neugier herauszufinden, welch kostbare Gedanken sich dahinter verbargen. Ihre haselnussbraunen Augen traten wegen einer Schilddrüsenüberfunktion ein wenig hervor, was ihnen einen Ausdruck höchster Interessiertheit verlieh, selbst wenn sie in Wahrheit gerade geistig abwesend war. Sie war in der Tat ziemlich häufig unkonzentriert und mit ihren Gedanken in Gefilden unterwegs, wohin ihr niemand folgen konnte. Das lag daran, dass diese junge Frau in sich wie in einem luxuriösen Gefängnis lebte, aus dem sie zwar ausbrechen wollte, ohne jedoch den Mut und die Mittel aufzubringen. Als sie auf die Idee kam, ein Kind haben zu wollen, suchte sie vermutlich einen ebenbürtigen Zellengenossen, mit dem sie ihre schwierig-schönen Haftbedingungen teilen konnte.