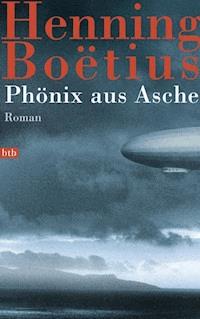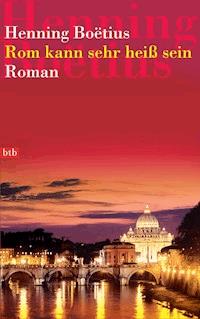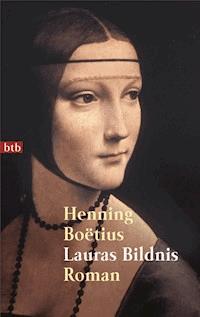11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Arthur Rimbaud – das enfant terrible der Künstlerkreise im Paris des späten 19. Jahrhunderts – war der Wegbereiter des Symbolismus und Surrealismus.
Auf der Flucht vor einer Jugend in provinzieller Enge, getrieben von einem quälerischen Verhältnis zu seiner Mutter, verfing er sich in einer wilden Liebesbeziehung zu Paul Verlaine - der später versuchen sollte, ihn zu töten.
Im Alter von neunzehn Jahren hörte Arthur Rimbaud für immer auf zu dichten. Sein Leben jedoch blieb ein einziges radikales Experiment, er selbst ein ruheloser Nomade zwischen Frankreich und Afrika, bis er mit nur 36 Jahren an Knochenkrebs verstarb.
Kaum ein Dichter war so besessen und widersprüchlich, so kühn und ängstlich, so ekstatisch in seinen Visionen und so nüchtern an Verstand, so rücksichtslos gegen sich selbst und andere und dabei so voller Sehnsucht wie Arthur Rimbaud.
Henning Boëtius verknüpft in seiner Romanbiographie „Ich ist ein anderer“ das Wahre mit dem Wahrscheinlichen und verleiht dem kranken Rimbaud auf dem Sterbebett ein letztes Mal eine Stimme. Es wird eine mitreißende und aufrüttelnde Beichte über ein Leben voller Unrast, Genialität und Raserei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Arthur Rimbaud – das enfant terrible der Künstlerkreise im Paris der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts war der Wegbereiter des Symbolismus und Surrealismus. Bis heute inspiriert das zornige Werk und abenteuerliche Vagabundenleben des dämonischen Weltgenies Generationen zukünftiger Lyriker.
Auf der Flucht vor einer Jugend in provinzieller Enge, getrieben von einem quälerischen Verhältnis zu seiner Mutter, verfing er sich in einer wilden Liebesbeziehung zu Paul Verlaine – der später versuchen wird, ihn zu töten. Aber er verwandelte den Schmutz seines Lebens in poetisches Gold.
Im Alter von neunzehn Jahren hörte Arthur Rimbaud für immer auf zu dichten. Seine Leben jedoch blieb ein einziges radikales Experiment, er selbst ein ruheloser Nomade zwischen Frankreich und Afrika, bis er mit gerade 36 Jahren an Knochenkrebs verstarb.
Henning Boëtius verknüpft in seiner Romanbiographie »Ich ist ein anderer« das Wahre mit dem Wahrscheinlichen und verleiht dem kranken Rimbaud auf dem Sterbebett ein letztes Mal eine Stimme. Es wird eine mitreißende und aufrüttelnde Beichte über ein Leben voller Unrast, Genialität und Raserei.
Autor
Henning Boëtius, geboren 1939, promovierte über Hans Henny Jahnn und leitete anschließend die Herausgabe der historisch-kritischen Brentano-Edition. Seit 1984 arbeitet er als Musiker, Goldschmied, Maler und freier Schriftsteller. Neben seinen Kriminalromanen begründeten vor allem seine Romanbiographien über literarische Außenseiter wie Johann Christian Günther, J. M. R. Lenz, Petrarca und sein sehr erfolgreicher Lichtenberg-Roman »Der Gnom« seinen Ruf.
Inhaltsverzeichnis
Dir, der Du den Dichter liebst, der wederbeschreiben noch belehren will. Dir verabreicheich diese wenigen scheußlichen Blätter desTagebuchs eines Verdammten.
Die rote Stadt
Als ich ein Kind war, haben gewisse Himmel meine Sehkraft geschärft.
Ich habe die gestrige Nacht draußen verbracht, bei den Schakalen. Ich wollte wie sie sein, hungrig und ohne Gewissen. Nun steigt die Sonne auf und befleckt die schmutzigen Mauern der Stadt mit ihrem Blut. Es hat sich hinter schwarzen Bergen angesammelt und ergießt sich nach einem einzigen Schnitt um den östlichen Horizont auf dieses schockierende Gebilde. Harar ist keine gewöhnliche Stadt. Eher eine tödliche Falle, eine Lehm gewordene, uralte, namenlose Angst. Häuser, die sich eng aneinander lehnen, als könnte das eine den Einsturz des anderen aufhalten. Sollte der Tod sich je als Architekt verstehen, er würde eine Stadt wie diese bauen.
Ich schreibe dies in einem Zimmer, einem Raum, der ganz von meinem Schmerz angefüllt ist. In den Pausen, in denen ich die Feder zur Seite lege, schreie ich. Ich schreie so laut wie ein Tier. Aber niemand kommt, Dschami nicht, mein Diener und einziger Vertrauter, und auch das Mädchen nicht. Ich habe es ihnen untersagt und sogar mit der Peitsche gedroht. Ich will keine Zeugen für meine Qualen. Sie demütigen mich, sind ein Schlag gegen meine Person, den ich nicht parieren kann.
Ich habe das Fenster zum Hof verhängt und eine Lampe angezündet, obwohl draußen die Sonne scheint. Ich liebe mein Zimmer. Wie vertraut sind mir die Teppiche an den Wänden mit den für einen Europäer so befremdlichen Mustern, in denen heimliche Botschaften stecken.
Ich habe die Teppiche selber ausgesucht. Für mich sind sie Landkarten, nach denen sich ein Entdecker orientieren könnte, dem es um mehr geht als um das Benennen von Bergen und Flüssen. Auch die wenigen Dinge, die mich auf meinen Reisen begleitet haben, sind um mich versammelt. Das kleine Teleskop, der aus einem Stoßzahn geschnitzte Phallus, die Wasserpfeife, meine Taschenkamera, die beiden silbernen Pistolen, die mir mein alter Boß Alfred Bardey einst schenkte, weil er der irrigen Meinung war, man könne sich mit Gewalt bei den Eingeborenen Respekt verschaffen. Dann sind da noch der Kompaß, der Sextant, das Anacroid-Taschenbarometer, der Reise-Theodolit, die Feldmesserschnur aus Hanf, all diese Werkzeuge eines Landvermessers und Entdeckers. Ich habe sie mir einst nicht als Dekoration gekauft, sondern in der Absicht, sie zu benutzen. Denn ich bin ein Entdecker. Das war ich, wie ich glaube, von Kindheit an. Irgend etwas war in mir, das mich diesen ewig gleichen Schulweg durch die Rue Arquebuse als immer neues Abenteuer erleben ließ. Ausgerechnet diese geradeste aller geraden Straßen meiner schachbrettartigen Heimatstadt erschien mir auf wunderbare Weise gekrümmt. Je nachdem, auf welcher Seite ich ging, war sie konvex oder konkav; ein sichelförmig gebogener Horizont, wie ihn bei klarem Wetter ein Matrose vom Mastkorb aus sieht.
Ich entdeckte bei meinem ewigen Hin- und Herpendeln durch die Rue Arquebuse zwischen unserer Wohnung und dem Institut, in dem man meinen Kopf zuzurichten versuchte im Schraubstock lateinischer Vokabeln, immer neue Steine im Gemäuer der Häuser, die ein bösartiges Geheimnis enthielten. Augen in Fensterhöhlen. Kleine Mädchen, die in dunklen Zimmern trieben wie ertrunken. Und ich sah hier, durch eine enge Querstraße hindurch, zum erstenmal das Meer als eine kleine graue Fahne, die im Wind flatterte.
Ich wußte natürlich, daß ich dies alles nur phantasierte. Jedenfalls bildete ich mir dies zumindest ein. Oh ja, ich war sehr auf Vernunft bedacht, ein schrecklicher kleiner Leonardo mit dem Hirn eines Erfinders, zugleich kühl und ekstatisch. Aber dieser Widerspruch störte mich so wenig wie die Feststellung, daß der Nordpol vermutlich ein uninteressantes Häuflein Eis und Schnee ist. Ein wirklicher Entdecker stört sich niemals an der überraschenden Tatsache, daß es eigentlich nichts zu entdecken gibt. Auch wenn ich bei meinem Tod nichts anderes entdeckt haben werde als das ewige Neuland meiner eigenen Vergangenheit mit all seinen weißen, nebelgrauen und höllenschwarzen Flecken, werde ich eingehen in die Galerie der Unsterblichen, die einen Punkt absoluter Unwichtigkeit als erste betreten haben: die eigene Existenz.
Über meinem Bett hängt das Aquarell von einem Schiff mit Namen ›Prinz von Oranien‹. Ein plumpes Vollschiff mit drei Reihen Kanonenluken. Ein Kriegsschiff also. Völlig veraltet in seiner Konstruktion. Es scheint an seinen Masten von einem Himmel herabzuhängen, der fleckig ist von Nässe. Der unsichtbare Kiel zerschneidet für mich noch immer den Ozean wie einen weiblichen Körper mit wogenden Brüsten und sich wölbenden Hüften. Die Fahrt des Schiffes erinnert an die Bewegungen eines Betrunkenen. Hin und her geworfen von den Wellen, fährt es mal dahin, mal dorthin. Sein Kapitän, der unsichtbar auf der Brücke steht, kennt dennoch die Richtung der Reise. Aber er verrät sie nicht. Immer wenn ich das Bild anstarre, bin ich mir einer Verzweiflung gewiß, die mich alle Zeit vor meinen schlimmsten Neigungen zu Illusionen bewahrt hat. Prins van Oranje, auf deinen Planken habe ich zum erstenmal die Freiheit kennengelernt, auf das vollkommenste vom Nichts eingeschlossen zu sein. Es gibt kein perfekteres Gefängnis als ein Schiff auf hoher See.
Doch davon ein andermal. Ich werde mich zwingen, der Reihe nach zu erzählen, auch wenn es mir schwer fällt, denn diese Art zu erzählen erinnert an die Ehe mit ihrem geordneten Nacheinander von Tagen und Nächten. Ich aber bin lieber kreuz und quer verliebt.
Wieder waren die Schmerzen so bohrend, daß ich das Schreiben mit dem Schreien vertauscht habe. Die peinigenden Dolchstiche teilt mein rechtes Knie aus. Es ist angeschwollen und sieht unnatürlich aus. Es ist wie das Knie eines Fremden.
In diesem Winter hatte ich zum erstenmal Schmerzen beim Gehen. Ich hielt es für Rheuma. Fast alle Europäer hier leiden unter Rheuma. Die Wintermonate sind naß und kalt, aber man ist gewohnt, sich leicht zu kleiden. Als sei die Kälte nur eine Täuschung des Wetters. Schließlich lebt man nahe am Äquator. Also trägt man seine leichte Sommerkleidung einfach das ganze Jahr. Ein helles, baumwollenes Hemd, eine einfache, weitgeschnittene Leinenhose.
Nachts konnte ich nicht schlafen, weil mich fortwährend leichte Hammerschläge von innen gegen die Kniescheibe trafen. Die Adern unter- und oberhalb des Knies schwollen an. Sie glichen vollen Flüssen zur Regenzeit, bläulich mäandernd über weißes Fleisch. Das Blut darin pochte.
Ich bin sechsunddreißig und habe schon Krampfadern wie eine alte Frau. Man altert schnell hier in Afrika. Ich habe auch schon graue Haare. Nur mein Bart ist noch blond.
Ich schrieb meiner Mutter und bat sie, mir einen Krampfaderstrumpf zu schicken. So was bekommt man hier nicht, nicht mal in Aden. Es kostete mich große Überwindung, das Krokodil darum zu bitten. Eine Frau, die so viel älter ist als ich und vermutlich keine Krampfadern hat. Krokodile haben keine Krampfadern.
Vielleicht ist es eine neue, der Medizin unbekannte Art von Rheuma, redete ich mir ein. Anfangs glaubte ich daher, daß Bewegung das beste Gegenmittel gegen diese Schmerzen sei. Ich folgte noch mehr als sonst meiner Neigung, weite Strecken zurückzulegen. Ich erstieg Berge, auf denen es nichts gab als Dürre und die Möglichkeit eines weiten Blicks auf trostlose Wüsten. Oft legte ich an einem Tag über vierzig Kilometer zurück. Ich schindete meine Glieder mit dem Ziel, sie geschmeidig zu halten, aber vergebens. Die Krankheit war es, die voranschritt, nicht ich. Ich glaube jetzt nicht mehr, daß es etwas so Harmloses wie Rheuma ist. Wahrscheinlich ist es der Teufel, der in meinem Knie die Faust ballt, triumphierend, daß er gegen meine wenigen guten Anlagen den Sieg davongetragen hat.
Ich werde bereuen. Das ist mein letztes Mittel gegen diesen Schmerz. Aber noch kann ich es nicht mit der Inbrunst, die nötig ist, ihn milde zu stimmen. Also schreie ich, denn solange ich schreie, spüre ich die Schmerzen nicht.
Draußen, im Hof, höre ich meine Leute singen und tanzen, nach dem Festmahl, das sie jeden Abend auf meine Rechnung einzunehmen pflegen. Ich ziehe den Vorhang ein wenig beiseite und sehe zu, wie die Dämmerung über dem Innenhof zu einer dunkelblauen Samtunterlage wird, auf der die ersten der Juwelen glitzern, die die Nacht tagsüber in ihrem Tresor bewahrt. Rote Vögel, klein wie Spatzen, schwirren durch die Luft. Dschami und die anderen sitzen im Schneidersitz um das niedergebrannte Feuer und singen. Sie haben Kat geraucht. Ihr Singen klingt nicht schön, jedenfalls nicht für die Ohren eines Europäers. Auch ihre Musik nicht, diese wild gekratzten Streichinstrumente, das niederträchtige Arpeggio der abessinischen Harfe, die chaotische Trommelei, die jaulenden Flöten, das Delirium schwankender Stimmen, die wie betrunken dem führenden Instrument folgen. Aber sie ist in Wahrheit schön, diese Musik, denn sie ist der Ausdruck eines Lebensgefühls, das den Menschen des Nordens fremd ist und immer fremd bleiben wird: aufzugehen in den Gerüchen, den Klängen, dem Geschmack der Speisen und Getränke, sich aufzulösen in spiraligen, mit dem Feuer zum Nachthimmel steigenden Schwaden, genausowenig einen Körper zu haben wie einen Geist, nichts zu sein und wie in einem Rausch höchster Liebeslust in Leere zu zerfließen.
Ich halte mir die Ohren zu, denn nur so kann ich es ertragen, nicht bei ihnen zu sein, nicht diese Brocken von Hammelfleisch zwischen meinen Zähnen zu spüren und den süßen Saft der Apfelsinen zu trinken. Und ich schreibe weiter, in den Pausen, in denen der Schmerz ein wenig nachgelassen hat, weil ich ihn aus mir herausgeschrien habe. Ich nehme den Kampf auf gegen den Teufel des Vergessens, der Krieg gegen mich führt. Ich werde das Land meiner Kindheit vermessen, ich werde die höchsten und tiefsten Punkte bestimmen, die Täler und Gipfel, und all das Land dazwischen, das ich in nur sechsunddreißig Jahren durchwanderte, vergeblich auf der Suche nach Glück, nach innerer Zufriedenheit, wie sie zum Beispiel für ein kauendes Kamel so selbstverständlich zu sein scheint.
Gestern habe ich damit begonnen, meine Lebensbeichte zu schreiben. Erstaunlicherweise fiel mir das Schreiben leicht. Es war, als lägen die Worte schon bereit. Ich brauchte sie nur nachzumalen mit meiner Feder. Mich wundert dies, nach all den Jahren, in denen ich die Sprache verachtete, weil ich sie für eine bigotte Hure hielt. Heute haben wir den 27. März des Jahres 1891. Das Wetter ist nicht mehr so schlecht wie in den letzten Wochen. Man ahnt bereits den Frühling. Möge er mir neue Kraft geben, und sei es auch nur, um die Wut gegen mein vergebliches Dasein so rasend zu machen, daß sie diese demütigenden Schmerzen übertönt.
Vier Frauen haben mein Leben bestimmt. Meine Mutter, das Krokodil, Vitalie, meine Schwester mit dem unsinnigen Namen, denn sie starb allzufrüh an Lebensschwäche, Henrika, die Schöne mit dem Baumwollrock, und Ascha, die Sanfte. Doch davon ein andermal.
Beginnen will ich mit meiner Geburt. Sie muß leicht gewesen sein. Meine Mutter hat mich immer schon loswerden wollen, und ich war ein braves Kind! Ich tat alles, was man mir sagte, jedenfalls, wenn ich es verstand. Vieles verstand ich nicht. Dann gab es Schläge. Ich gewöhnte mir früh an, keine unnötigen Tränen zu vergießen. Ich entwickelte einen unheimlichen, geradezu perversen Stolz. Er wurde so groß, daß ich es manchmal der Luft nicht verzieh, daß sie sich von mir atmen ließ.
Meine Heimatstadt – bei diesem Ausdruck muß ich lachen – ich sollte besser sagen: die Stadt meiner Fremdheit, in der ich geboren wurde – liegt am Ufer eines Flusses. Wie ein vom äußersten Rand des Ozeans abgeschnittener Horizont, ein schmaler Saum aus Wasser, schlängelt er sich durch unsere Stadt und entschlüpft in schnellen Windungen in jene düsteren Berge im Norden, dem Wolfsland meiner Jugend, wo er sich offensichtlich wohler fühlt.
Auch ich habe mich dort wohler gefühlt. Diese dicht bewaldeten Hänge und Hochflächen der Ardennen sollten mich bald magisch anziehen. Lange brauchte ich damals nicht, um zu begreifen, daß dieser Fluß mit seiner Strömung irgendwo hinter den Bergen in das wirkliche Meer floß, offenbar in einer pathetischen Geste, die ausdrücken will: hierher kehre ich nie mehr zurück. Jeder Wassertropfen, den ich an euch Menschen dumpfen Geistes vorbeigeschleppt habe, ist ein winziges Stück Freiheit, das dem Meer für immer von mir geschenkt wird.
Wenn ich an Tropfen denke, denke ich an Regen. Warum ist ausgerechnet der Regen meine früheste Erinnerung? Früher als an das Gesicht meiner Mutter, diese Maske aus grausamer Härte und weinerlicher Frömmigkeit, früher als an den Anblick meines ein Jahr älteren Bruders, dessen idiotische Fratze mir immer wie eine Parodie auf den Lebenswillen gewisser Insekten vorkam, früher auch als an das weibische und von Selbstzweifeln bewegte Antlitz meines Vaters entsinne ich mich jener Kreise, die Regentropfen auf Pfützen und anderen ruhigen Wasserflächen erzeugen. Als ich dieses köstliche Bild zum erstenmal bemerkte, kann ich höchstens ein Jahr alt gewesen sein, denn ich war der Sprache noch nicht mächtig. Ja, ich entsinne mich sehr genau an die Ohnmacht, etwas sagen zu wollen, ohne über die dazu benötigten Laute zu verfügen. Hunde bellen aus dieser inneren Qual, sich nicht angemessen artikulieren zu können. Kleine Kinder brechen oft in ein jämmerliches Geschrei aus, das den Folgen eines Dammbruchs gleicht unter dem Druck eines Stausees unsagbarer Worte.
Wahrscheinlich war es am Ufer der Maas, als ich jenes Schauspiel zahlloser aus einem Mittelpunkt hervorwachsender und ineinander quellender Regenkreise zum erstenmal bemerkte. Auf dem braunen, träge dahinfließenden Wasser wob der Regen einen Gobelin von solcher Schönheit, daß ich darüber in verzückte Reden ausbrechen wollte, aber ach, nichts kam aus meinem Mund als ein stupides Lallen, das bald in nerventötendes Geplärre überging. Ich glaube, man schüttelte mich ungeduldig und zog mich in meinem Kinderwagen eilig nach Hause, denn man nahm wohl an, daß mich der Regen störte. Das Gegenteil war der Fall. Schließlich weinte ich, weil man mir den Anblick dieser Welt aus pulsierenden Kreisen entzogen hatte.
Bis heute kenne ich nichts Schöneres als Regen, der auf einen Teich oder einen Fluß fällt. Ich spüre dann jedesmal die süße Melancholie eines Verlorenseins in einer harmonischen Welt des Werdens und Vergehens. Ophelias Bett mit einem Bezug aus Regenkreisen. Sie schläft ihren Irrsinn aus am Grunde des Flusses, und niemand wird sie wecken bis zum Jüngsten Tag.
Mein Vater war Soldat. Ich wiegte mich lange in dem Glauben, er wäre Seemann. Vielleicht lag es daran, daß ich ihn so selten zu Gesicht bekam und daß etwas Fremdländisches von ihm ausging. Er war bei meiner Geburt schon vierzig Jahre alt. Sechs Jahre später trennten sich meine Eltern, und ich sah ihn nie wieder, obwohl er noch achtzehn Jahre lebte. Er muß ein sehr liebevoller Mensch gewesen sein, sehr unsicher auch, vor allem im Umgang mit Frauen. Vielleicht war der Grund seine offenbare Schönheit. Schöne Männer wirken Frauen gegenüber oft hilflos. Sie erinnern an Transvestiten, sie sind Grenzgänger zwischen den Geschlechtern.
Immer wenn mein Vater aus seiner Garnison zu Besuch kam, gab es furchtbare Kräche zwischen meiner Mutter und ihm. Kriege, in denen gewöhnlich mein armer Vater unterlag. Auf der Anrichte stand eine große Silberschale mit gehämmertem Rand. Sie glich einer kalten Sonne, die weder aufnoch unterging. Eisig stand sie am ewigen Himmel unseres Wohnzimmers. Wie oft endete der Streit meiner Eltern damit, daß einer von beiden die Schale ergriff und mit Getöse zu Boden warf! Wie der Gong eines chinesischen Tempels klang es, weithin vernehmbar. Ich schämte mich, daß alle es hören konnten. Um den Lärm zu dämpfen, hielt ich mir die Ohren zu.
Es kam vor, daß mein Vater mich nach einer solchen verlorenen Schlacht mit heftigem Ruck hochhob, in die Luft warf und dann auf seine Schultern setzte. Gemeinsam traten wir den geordneten Rückzug an. Ich konnte dann plötzlich weit sehen, und der Seewind aus seinen Haaren fächelte beißende Salzluft in meine Augen. Ich stellte mir vor, er sei ein Schiff und ich der Kapitän. So steuerte ich ihn mit geflüsterten Kommandos durch die Straßen, weg von meiner Mutter, meistens hinunter zum Fluß.
Wenn er auf meinen Befehl kräftiger ausschritt oder sogar rannte, wurde ich beinahe seekrank von den heftigen Bewegungen des Decks, von dem aus ich navigierte. Ich hatte natürlich eine höchst vage Vorstellung von der Seefahrt. Mein Wissen darüber bezog ich ausschließlich aus der Beobachtung der Maaskähne und einem illustrierten Roman, dessen Text ich zwar nicht verstand, in dem aber die lange Geschichte eines von zu Hause entlaufenen Schiffsjungen erzählt wurde, den es um den ganzen Erdball treibt. Er haust bei Indianern, unter Walfängern, Piraten, erleidet Schiffbrüche, schlägt sich als eine Art Robinson mühselig auf einer einsamen Insel durch, gelangt schließlich zu großem Wohlstand und kehrt zur Freude seiner alleinstehenden Mutter nach Hause zurück. All dies entnahm ich den schön gestochenen Bildern, und es fiel mir durchaus nicht schwer, mir das gleiche Schicksal für mich auszumalen. Allerdings würde ich nicht wie mein Vorbild zur Mutter heimkehren. Das würde ich nie und nimmer. In meinem Fall würde es mein Vater sein. Obwohl er verloren war. Ja, ich hatte einen verlorenen Vater. Es hieß, daß ich ihm sehr ähnlich sehen würde. Das gleiche schmale, kindliche Gesicht mit der auffallend gewölbten Stirn, die gleichen feinen, blonden Haare und wasserblauen Augen.
In Wahrheit war ich uralt, ein Greisenembryo, eingeschrumpft vom Wasser des Lebens. Mein Vater blieb jedenfalls nach einer jener verlorenen Eheschlachten gänzlich weg. Zuvor hatte er mich nach dem chinesischen Tempelgong noch ein letztes Mal mit stürmischen Schritten um die Stadt getragen. Er setzte mich vor der Türe ab, und dann sah ich ihn nie wieder.
Ich war sechs Jahre alt, jedenfalls aus der Sicht der Erwachsenen. In diese Zeit fiel ein Experiment, an das ich mich noch heute mit einem gewissen Interesse erinnere. Ich stahl eines der Gläser, in denen meine Mutter Obst einzumachen pflegte. Dann grub ich einen Regenwurm aus und fing mit Hilfe einer Flasche und etwas Zuckerwasser eine Wespe. Diese beiden so gegensätzlichen Wesen sperrte ich in den Behälter, nachdem ich vorher etwas Schlamm hineingetan hatte. Gerade so viel, daß sich der Regenwurm nicht gänzlich eingraben konnte. Ich verschloß das Glas sorgfältig und warf es in den Strom. Ich stellte mir vor, wie diese beiden Monstren weit draußen am Rande der Welt in stürmischer See einen Kampf auf Leben und Tod beginnen würden, dessen Ausgang ich mir mal in der einen, mal in der anderen Weise dachte.
Befriedigt ging ich an diesem Tag nach Hause und ertrug das Abendessen mit frommer Miene, ebenso das Ritual der kalten Wäsche, die meine Mutter auf höchst rohe Weise an mir vollzog. Sie wusch mich wie einen Gegenstand, wobei sie auch mein Glied nicht verschonte, es hin und her zerrte und mit einem rauhen Lappen abrieb. Nach dem üblichen mir abgenötigten Gebet konnte ich dann endlich an Bord meines Schiffsbettes gehen, mit dem ich in meine allnächtlichen Träume segelte, mit gebauschten Kissen und Decken und schäumenden Teppichen vor dem Bug.
Ich muß gestehen, daß ich meine Mutter nie verstanden habe. Sie war mir auf ihre Weise sicher herzlich zugetan. Sie glaubte erstaunlicherweise auch dann noch an mich, als ich bereits auch die zäheste Mutterliebe aufs tiefste enttäuscht haben mußte. Abgesehen von den Waschungen berührte sie mich nie. Wir waren einander schmerzhaft fremd.
Am schlimmsten war es, wenn sie mich anklagend ansah, ohne ein Wort zu verlieren. Das konnte sie wie niemand sonst. Schattenmund nannte ich sie dann bei mir, denn ihr fest verschlossener Mund verbreitete Dunkelheit und Kälte. Ein Schweigen, das mich frieren ließ. Spitze Kristalle drangen in mein Hirn und ließen jeden Gedanken erstarren, sie stießen in mein Geschlecht hinab und verwandelten es zu Eis. So wurde ich unter ihrem vorwurfsvollen Blick jedesmal eine Art erfrorene Vogelscheuche, die trostlos und Trostlosigkeit verbreitend auf dem Feld des Lebens stand. Die Menschen fürchteten sich vor mir, sie mieden meine Nähe. Dies war für mich schlimm, schien jedoch ganz im Sinne meiner Mutter zu sein, denn so bewahrte sie ihren kleinen Acker vor den räuberischen Angriffen fremder Vögel. Oder wollte sie mich nur für sich? Manchmal glaube ich es. Sie war nicht bereit, mich mit anderen zu teilen, nicht einmal mit Dingen. Die Folge war, daß ich ein übertrieben braver Schüler wurde, der jedoch beständig hinterhältige Gedanken hatte. Ich wurde so etwas wie ein verlogener Wahrheitsfanatiker. Und ich riß den Fliegen Beine aus. Das taten die anderen auch, aber ich ließ ihnen meistens zwei Beine übrig, was ihre Lage noch verschlimmerte, denn so waren sie noch zu den irregulären Bewegungen eines Stockbetrunkenen fähig.
Wenn ich einzuschlafen versuchte, dachte ich manchmal an den Nordpol. Ich stellte mir vor, daß er den ganzen Erdball umschloß wie eine feine, dünne, weiße Haut, unter der ich lag und erbärmlich fror. Der Nordpol war überall. Das aber würde die Suche nach ihm keineswegs erleichtern.
Nachdem mein Vater auf und davon war, begann meine Mutter, ihre häuslichen Verhältnisse wie ein Nachlaßverwalter zu ordnen. Sie holte sämtliche Wäsche aus dem Schrank, zählte die Laken, die Kissenbezüge, die Teller, die Terrinen, sie wusch alles, trocknete es und stapelte es erneut in Kisten und Kasten. Dann zogen wir um. Von einer geschäftigen und sauberen Hauptstraße in eine ihrer stillen und schmutzigen Seitengassen, von der Rue Napoléon in die Rue Bourbon, ein wahrhaft symbolischer Namenswechsel. Schließlich waren die Bourbonen zu Recht nach einer kurzen Phase der Restauration von der Bildfläche der Politik verschwunden, während Napoleon auch nach seinem Tode einen nicht unerheblichen Einfluß auf unser Land bewahrt hat. Für mich als Siebenjährigen war die neue Umgebung eher eine Verbesserung. Ich war plötzlich dem Schmutz näher, der Armut, den Ausdünstungen der Erfolglosen. Gleich am ersten Tag fand ich vor unserer Tür eine tote Ratte. Ich hob sie am Schwanz hoch und schleuderte sie in ein offenes Fenster. Dann rannte ich schnell davon, verfolgt von einem Schwall ordinärster Ausdrücke.
Ich konnte bald feststellen, daß die armen Leute in unserer Nachbarschaft wesentlich freundlicher miteinander umgingen als die Wohlhabenden der Rue Napoléon. Sie waren kleine, entmachtete Bourbonenkönige, verstockt in ihren Ansichten, aber liebenswert in der Ausführung ihrer unsäglichen Dummheit. Sie haßten und verziehen mit der gleichen Impulsivität, und sie verfügten über einen faszinierenden Wortschatz an schlimmen Ausdrücken. Was meinen Ohren und meinen Lippen in der nach Mottenkugeln und billiger Seife riechenden, dunklen Festung meiner Mutter strengstens verboten war, umgab mich draußen in der schönsten Reinheit. Kaum ein Wort, das nicht einen Bezug auf irgendeine Körperöffnung verriet.
Ich trieb also überglücklich in einem Meer ordinärster Ausdrücke, die aus den offenen Fenstern drangen und die Straße bis zu den Dachrinnen füllten. Ich bewegte die Lippen, sprach sie flüsternd nach wie ein frommer Mönch, der ergriffen der Messe folgt. Manchmal tat ich absichtlich so etwas wie das mit der Ratte, nur um endlich wieder in einen obszönen Schwall von Argot getaucht zu werden, der sich über mich entleerte wie ein vollgepißter Nachttopf. »Du widerliche kleine Eiterpustel von einem Bankert ...« und weiter ging’s, nach Hause durch die schwere Eichentür, hinein in die Wohnung meiner Mutter. »Warst du schon wieder fort?« »Ja, Mama.« »Du sollst deine Schularbeiten machen.« »Ja, Mama.« »Aber wasch dich erst gründlich, du stinkst nach Gosse.« »Ja, Mama.«
Wenn ich oft nicht hinaus konnte, weil meine Mutter mich in mein Zimmer sperrte, dann half nur noch eins. Ich öffnete das Fenster und streckte den Passanten die Zunge heraus. Auch das führte oft zu jenen exorbitanten Sprachtiraden, die Balsam für meine Seele waren. Dann konnte ich mit dem Geruch meines pomadisierten Haares in der Nase wieder die Bibel lesen, konnte lange lateinische Gedichte auswendig lernen, indem ich innerlich an jedes Wort die Nachsilbe »Scheiß« hängte.
Es war im übrigen wirklich erstaunlich, vor allem für meine Lehrer, wie zu Hause ich mich bald im Lateinischen, dieser toten Sprache, fühlte. Sie wärmte meine erstorbene Seele wie ein Leichenhemd. Ich begann früh, in ihr zu dichten. Es war eine reine Sprache. Sie wurde von keinen lebenden Menschen mißbraucht. Das gefiel mir. In gewisser Weise kam sie mir wie das Argot der Götter vor. Latein und das Geschimpfe der armen Leute, das waren die beiden Pole, zwischen denen das normale Französisch es schwer zu haben schien.
Ich war ein fleißiger Schüler, ein Musterschüler sogar, der bald viele Preise gewann. Ungeliebt und bewundert, gehätschelt von den Lehrern, gehänselt von den Mitschülern. Ich hatte einen gewaltigen Ehrgeiz, alle zu übertreffen, aber nicht, weil mir dies gefiel. Nein, ich wollte in diese Höhen des Erfolges, weil ich instinktiv fühlte, daß man vom Boden aus nicht stürzen kann.
Immer verfiel ich in der Nähe meiner Mutter in eine lähmende Traurigkeit. Das ging mir schon als Kleinkind so. Ich spürte, daß sie mich liebte, aber nicht mochte. Dieser Widerspruch brachte mich schier zur Verzweiflung, und ich fürchte, er ist noch heute ein unheilvoller Dauergast in meinem Leben.
Während ich dies schreibe, lausche ich auf die Nacht draußen, auf das Summen der menschlichen Termiten in ihrem Bau. Harar gleicht in der Tat einem gigantischen Bauwerk dieser Art, ausgeschieden und mit dem Speichel dieser Tiere verklebt zu zahllosen Höhlen und Gängen, die sich brennendrot über einen Hügel erstrecken, als lägen sie in einem ewigen Sonnenaufgang. Die auffällige Farbe stammt von dem im Glutofen der Sonne gebrannten Lehm, mit dem die Steine zu Häuserwänden gefügt werden.
Ich habe viele Städte geliebt und zugleich gehaßt, diese maßlosen Kehrichthaufen von wirren Einzelschicksalen, Paris, Brüssel, London, Wien, Marseille, Stockholm. Diese Stadt hier ist anders als alle. Harar ist rot, Harar ist ein Traum, den ein Toter deliriert, Harar ist eine Haschischvision, böse und zugleich befreiend. Alles ist leicht hier, weil es ohne Sinn und Verstand ist, weil es nicht so einfältig am Egoismus der Menschen orientiert ist wie anderswo. Harar ist ein Labyrinth aus tausend Hütten, in denen fünftausend Hunde, fünfzigtausend Menschen, fünfhunderttausend Ratten und fünf Milliarden Fliegen leben, umgeben von einer mit fünf Toren versehenen Mauer, die abends gegen das Eindringen wilder Tiere verbarrikadiert werden.
Harar ist eine Krake auf einer 1900 Meter hohen roten Granitkuppe. Das Klima ist feucht und ungesund. Wunden heilen nicht, selbst der kleinste Schnitt eitert wochenlang. Mit Recht ist es den Europäern bis vor wenigen Jahren verboten gewesen, diese Stadt zu betreten. Allzu kühn, zu irritierend ist diese flache Pyramide von rotem Lehm. Schlimm genug, daß es hier Menschen gibt. Am schlimmsten jedoch sind die Hunde. Man hört ihr Jaulen und Kläffen ohne Pause.
Ich habe zahllose von ihnen vergiftet, aber das ist völlig sinnlos. Aus einem toten Köter stehen zwei lebende wieder auf. Sie starren dich an aus bösen Augen, blecken die scharfen Zähne, winseln, jaulen und schnappen nach den Fleischresten, die auf dem nahegelegenen Markt in großer Menge anfallen. Harar, das sind Hunde, Fliegen und Ratten, das sind die euphorisch-stumpfsinnigen, bei jeder Gelegenheit Kat kauenden Haran. Kat, das ist ein Strauch, dessen junge Triebe man ablöst und kaut. Das bewirkt einen Rauschzustand, ähnlich wie bei Haschisch. Angeblich wirkt er aphrodisierend, doch in Wahrheit macht er nur blöde und zufrieden. Auch ich kaue Kat, weil ich dann diese Welt und neuerdings meine Schmerzen besser ertrage.
In Harar lassen sich Schmerzen überhaupt besser ertragen als anderswo. Warum wohl? Weil sie hier noch anonymer sind als in Paris oder London oder Marseille. Gerade jetzt, wo ich wieder vor Qualen zu winseln beginne wie ein Hararihund, spüre ich, welche Kraft mir dieser Ort gibt, solch unmenschliche Folter zu ertragen. Ich fürchte mich vor dem Augenblick, da ich ihn werde verlassen müssen. Es wird mir schwerfallen, die Menschen hier zu verlieren. Nirgendwo auf der Welt habe ich sie so als Tiere erlebt, die nach einfachsten Regeln leben. Es gibt in dieser Stadt mehr Ehrlichkeit des Gebärens und des Sterbens als anderswo. Die Nächte sind von den Schreien der Mütter in den Wehen erfüllt und von den Schreien der Sterbenden. Sie klingen gleich, diese Schreie. Sie erinnern an eine verlorengegangene Musik, die der Zivilisation nicht standhielt. Eine Weile war ich vergeblich auf der Suche nach dieser Musik. Ich habe auf ungewöhnliche Weise Klavier gespielt. Diesem kühlen Instrument, das so viel Intellekt verströmt, habe ich die bizarren Klänge des Schmerzes zu entlocken versucht. Ich war besessen von der Idee, ihm seine tonale Gedanklichkeit abzugewöhnen. Doch davon ein andermal.
Übrigens gibt es in Harar neben einigen Europäern auch erstaunliche Einheimische, Menschen von hoher Bildung wie Ras Makonen, Stellvertreter des Negus. Ich unterhalte mich gerne mit ihm. Er ist ein zartgliedriger, gebildeter Mann, der die weiße Schama mit dem roten Streifen trägt wie ein gewöhnlicher Abessinier. Dennoch hat er die alleinige Macht über Tod und Leben hier, denn er ist der oberste Richter. Der dunkle Teint seiner Haut und seine freundlich melancholischen Augen täuschen darüber hinweg, daß man einen Mann höchster Intelligenz vor sich hat, der mindestens so scharf denkt wie Voltaire. Selbst die Hunde respektieren ihn, laufen mit eingekniffenem Schwanz davon, wenn er sie mit leiser Stimme verjagt.
Ich habe immer im Angesicht des Todes gelebt, ohne die geringste Sympathie für ihn zu empfinden. Der Tod ist ein Idiot. Die Kriterien, nach denen er seine Opfer aussucht, spotten jeglichem natürlichen Rechtsempfinden, jeder Moral, jedem Anstand, jedem Geschmack. Der Tod ist ein Banause. Sein Gefühl für Harmonie, für Ausgewogenheit ist gleich null. Der Tod hat nicht einmal Humor.
Ich war noch keine siebzehn, als ich dem Tod zum erstenmal persönlich begegnet bin. Die Umstände waren einigermaßen kurios. Ich war ein völlig unbekannter Jüngling, der in der Provinz schlechte Verse schrieb, wie viele andere, die in der Provinz schlechte Verse schreiben. Dies ist geradezu kennzeichnend für die Provinz. Sie ist erstaunlich fruchtbar für schlechte Verse. Ich hatte dem berühmten Paul Verlaine einige meiner Elaborate geschickt und einen widerlich arrogant-devoten Brief dazu. Ich machte mich schlecht, erging mich in wehleidigen Orgien der Selbsterniedrigung. Das fiel mir nicht schwer, denn ich fühlte mich wirklich so. Erstaunlicherweise lud Herr Verlaine mich ein. Ja, er schickte mir sogar das Geld für die Fahrkarte.
Auf dem Pariser Nordbahnhof verfehlten wir uns. Das war ein Glück. Denn so lernte ich seine Familie kennen, sein Milieu. Seine Frau und seine Schwiegermutter, sein Sofa und seine Tapeten. Es war erschütternd. Welch kleiner Mann, dieser Verlaine, dachte ich, und in welch heimeliger Kulisse! Der Mief der Spießbürger ist von besonderer Penetranz. Durchdringender als jeder Abort. Das kommt daher, daß diese Leute permanent in sich selbst hineinscheißen.
Seine Frau war ein reizendes Nichts, hübsch anzusehen, eine jener Windeier legenden Hennen, wie sie von Männern geschätzt werden, nicht ihres Gackerns wegen, sondern um ihrer Neigung willen, beim Beischlaf ein glucksendes Geräusch von sich zu geben, aus denen die Hähne das Recht für ihr Kikeriki ableiten. Die Schwiegermutter war bereits von der Zeit gerupft. Sie gluckste nicht mehr. Um so wortreicher hielt sie es mit Meinungen, zum Beispiel mit der, von mir eine schlechte zu haben. Wir plauderten eine Weile, und es klang, als werfe man Fische in siedendes Öl.
Dann kam der Herr des Hauses. Verlaine. Ich mochte ihn auf den ersten Blick. Er war schwach. Seine Glatze schien eine Folge hoffnungslosen Grübelns zu sein. Er sah wie ein eingesperrter Mongole aus. Sein Sibirien war ein steifer Kragen, aus dem er mit einem breiten Lachen seines viel zu großen Mundes hervorguckte, immer guter Dinge bei vollständiger Hilflosigkeit. Die beiden Damen schienen ihn herzlich zu mißachten. Er tat mir leid.
Wir aßen zusammen. Eines jener infernalischen Essen, in denen Spießbürger sich ihre fixe Idee, Gourmets zu sein, zu bestätigen versuchen. Alles schmeckt abscheulich, weil es raffiniert sein soll. Wenn Dummheit sich mit einem Schuß Arroganz aufpäppelt – ein Löffel Sherry in die Mehlsoße –, dann hat es diesen ekelhaften Effekt, den man anspruchsvolles Mittelmaß nennen könnte. Die Unterhaltung war dementsprechend. Einmal sagte ich: »Die Hunde, das sind Liberale!« Alle sahen mich voller Verblüffung an. Der Satz paßte wirklich nicht, wir unterhielten uns gerade über die Auswirkungen der Zeit der Kommune, vor allem auf die zukünftige Stadtarchitektur. »All die schönen Gebäude, die die Kommunarden zerstört haben!« seufzte Mathilde, die Frau meines Gastgebers. »Diese Hunde«, sagte ihre Mutter. »Man wird sie wieder aufbauen, schöner als zuvor«, sagte mein neuer Freund. Ich wiederholte meinen Satz. Verlaines Frau erhob sich und begann, Teller und Besteck hinauszutragen. Die Schwiegermutter sah mich an wie einen Leprakranken. Verlaine lächelte sein über die Maßen breites Lächeln. Gastineau, der Hund der Verlaines, beschnupperte mein Bein. »Sehen Sie«, sagte ich. »Das ist der Beweis.«
Ich war müde von der Fahrt. Paul brachte mich ins Gästezimmer. Wir umarmten uns. Dabei spürte ich, welche Sehnsucht nach Wärme von diesem zerzausten Faun ausging, der sich hier zum Kapaun machte.
Als ich im Bett lag, sah ich ihn. Den Tod. Es war ein Bild, das Porträt eines Vorfahren Verlaines, eines Marquis, wie ich dem kleinen Schildchen auf dem goldenen Rahmen entnahm. Die schöne Pastellzeichnung hatte durch Spakflecken gelitten. Schimmel hatte den Blick des Mannes verändert. Kein Zweifel: es war der Tod. Er sah mich an mit diesem stupiden Blick, mit dem er seine Opfer auszuwählen pflegt.
Ich versuchte zu schlafen. Aber immer wieder erwachte ich. Diese Augen durchbohrten mich förmlich. Schließlich stand ich auf und hängte das Bild ab. Verlaine mußte es am nächsten Tag auf meine Bitte hin wegschaffen.
Heute nacht habe ich ihn wiedergesehen. Den aussätzigen Marquis. Ich erwachte, weil ich seinen Blick auf mir fühlte. Ich erhob mich unter großen Schmerzen und wollte das Bild abnehmen. Aber es war nicht mehr da. Nur der Nagel, an dem es gehangen hatte. Vorher war da nie ein Nagel gewesen.
»Dschami«, schrie ich. Mein Diener schläft nebenan. Er kam sofort. »Woher ist dieser Nagel da!« schrie ich. Dschami nahm wortlos das Bild von der ›Prinz von Oranien‹, das sich über dem Kopfende meines Bettes befindet, und hängte es an den anderen Nagel. »Damit du es besser sehen kannst«, sagte er.
»Warum?« rief ich. »Weil du ein Seefahrer bist«, sagte mein Diener und lächelte, wie nur ein Harari lächeln kann. Dumm, verschlagen, gütig und weise. »Dann bring mir gefälligst Wasser«, brüllte ich. Dschami verschwand, und ich schleppte mich an diesen Tisch, um weiterzuschreiben.
Oh, wie gerne und aus vollem Herzen habe ich verachtet. Das Jahr 77 war der Höhepunkt meiner Verachtung des Daseins. Vielleicht war es Hochmut, ich hielt es jedoch für wissenschaftliche Genauigkeit. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt und hatte das Schreiben vollständig aufgegeben. Niemand wird nachvollziehen können, was für eine Verzweiflungstat dies war. Ich tötete den Dichter in mir. Das war mehr als ein Brudermord. Eine Person meines Namens und meines Aussehens blieb übrig als Gespenst, als weiße Negerin, über den Abgrund am Südpol gebeugt, in den der Ozean rauschend hinabstürzt mit all diesen Illusionen, die das Leben der kleinen Menschen begleiten.
Denkwürdig der Tag, an dem ich mich aufmachte, um davonzugehen. Es war nicht meine erste Flucht. Aber diesmal lief ich nicht vor meiner Familie weg, nicht vor meiner Heimatstadt. Ich lief vor mir selbst davon. Ja, ich glich Orpheus, der nicht mehr dichten wollte, aber ich war auf tragische Weise zugleich meine eigene Eurydike. Ich durfte mich also nicht umdrehen, bevor wir das Tageslicht erreichten, sonst würde meine Geliebte, die ich selber war, wieder umkehren müssen. Das Tageslicht war der Süden, war das Land jenseits der Alpen. Diesseits lag der Hades.
Ein naßkalter Oktobertag des Jahres 1878. Ich war von Hamburg zurückgekehrt, wo ich einmal mehr vergeblich versucht hatte, Fuß zu fassen. Diese Stadt ist wahrlich eine graue Einöde der kaufmännischen Vernunft.
Ich war fast ohne Mittel zurückgekehrt in das, was ich spöttisch meine Heimat nannte. Charleville, diese Unstadt, Charlestown, dieses geschmacklose Häkeldeckchen auf dem Nachttisch der Verzweiflung. Es gab nur eine Stelle hier, die mir gefiel, das Café de l’Univers, eine häßliche Eckkneipe am Bahnhofsplatz, wo der Absinth ein wenig billiger ist und außerdem schärfer als anderswo. Fast genau vor einem Jahr hatte ich hier schon einmal gesessen und dann einen mißglückten Ausbruch riskiert, aus diesem Wartesaal des Lebens, diesem Fegefeuer mit den Barhockern aus braunem Leder. Es gab keinen besseren Platz, um die Übersicht zu haben über die gräßliche Wirklichkeit. Ich hockte hier wie der Jäger auf seinem Anstand und wartete auf das Wild. Das Wild war das Glück, war die Zukunft, die Freiheit. Spätestens nach dem zehnten Absinth drehte sich das Café de l’Univers um mich. Kein Zweifel, ich war jetzt im Inneren des Globus, und es lag an mir, an welcher Stelle ich wieder auftauchen würde. In der Karibik zum Beispiel oder in Afrika. Wenn es nur nicht wieder in diesem widerlichen Charlestown sein mußte.
Katastrophen waren vorausgegangen. Die schlimmste: der Tod meiner Schwester Vitalie im Dezember 1875. Sie starb an einer lächerlichen Geschichte. Eine Krankheit der Gelenke. Gelenkwasserentzündung, sagten die ignoranten Ärzte. Die Knochen schwollen an. Jede Bewegung war mit Schmerzen verbunden. Sie schrie erbärmlich. Ich saß im Nebenzimmer. Hatte mir die Haare abgeschnitten, damit ich sie mir nicht raufen konnte. Als ihre Schreie in ein Wimmern übergingen, schlug ich mit der Faust durch die Scheibe meines Zimmers. Draußen fiel Schnee. Nasser, grauer Schnee. Kein für Kinder gemachter, keiner, um Schlitten zu fahren oder Schneemänner zu bauen. Es war Totenschnee. Er taute schon im Fallen.
Vitalie war tot. Sie war häßlich. Ich fand sie schön. Sie hatte einen viel zu großen Kopf für ihren schmalen Mädchenkörper. Sie sah wie eine alte Frau aus. Dabei war sie genäschig und launisch. Wahrhaftig, es gab nicht viel, was sie den Menschen geben konnte. Aber ich liebte sie mit größerer Inbrunst als je sonst eine Frau. Vitalie war wie ich das Opfer des Krokodils. Sie war zu schwach gewesen, sich aufzulehnen. Sie hatte sich damit begnügt, Kopie einer Frau zu sein, die selber zu kurz gekommen war im Leben. Die Härte ihrer Mutter Vitalie hatte sich in der Tochter Vitalie in eine beständige nervöse schlechte Laune verwandelt. Oh nein, sie starb in Wirklichkeit nicht an Gelenkwasserentzündung, sie starb aus Mangel an Lebenslust. Ich aber verlor den einzigen Menschen, den ich zu bedauern vermochte. Meine Hand blutete, als ich ihr die Augen schloß. Ich schminkte sie dabei mit meinem Blut. Sie sah im Tode nicht schöner aus als im Leben. Wie immer schien sie sich über etwas beklagen zu wollen, vielleicht darüber, daß sie keine Luft mehr bekam und ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen. Nebenan betete das Krokodil für die arme Seele ihrer Tochter. Aber es weinte nicht, wie es sich für ein anständiges Krokodil gehört. Ich aber, ich starrte zum Fenster hinaus in diesen mißlungenen Winter und weinte. So wie ich jetzt hinausstarrte aus den trüben Scheiben des l’Univers.
Plötzlich wußte ich, was zu tun war. Es war eine Eingebung, eine Epiphanie. Ich mußte fort, endgültig fort. Ich mußte über die Alpen gehen, in den Süden hinein, in den neuen Frühling, in die Wärme des Mittelmeers! Eine blaue Vision packte mich. Die Schwaden aus Zigarettenqualm verwandelten sich in Zyperns Küste. Ich bestellte noch einen elften Absinth, und dann torkelte ich hinaus. Ich glaube, ich fiel mehrmals in den Schneematsch. Doch hinderte mich das nicht daran, die Richtung einzuhalten.
Aber wollte ich nicht der Reihe nach erzählen? Ja, ich spüre es deutlich, es ist zu früh, von diesem für mich so epochalen Aufbruch zu erzählen, vom schweigsamen Mann auf dem Paß, von der dort verbrachten Nacht zwischen all den Menschenleibern, von den Schneewänden, an denen ich mich entlangtastete, um aus dem Gefängnis herauszufinden.
Solange ich noch in diesem Zimmer bin, werde ich nicht davon erzählen. Ich werde vielleicht erneut losziehen, zum hundertsten Male. Und dann erst wird es mir möglich sein, von jenem Aufbruch aller Aufbrüche zu reden.
Ich schließe die Augen und denke an Henrika. Ihr langer, brauner, baumwollener Rock gleitet zu Boden. Nackt steht sie vor mir. »Erzähl der Reihe nach, Liebster«, sagt sie. »Ich höre dir zu.«