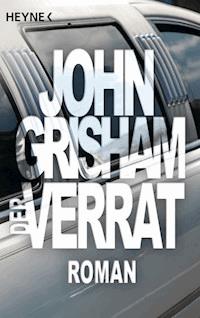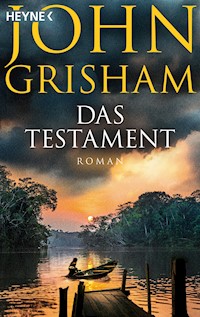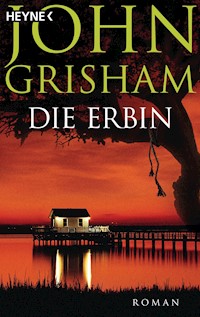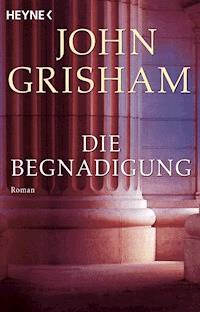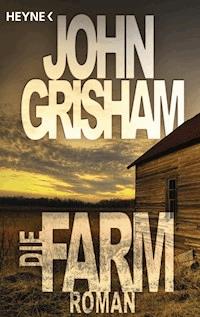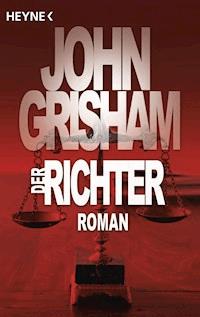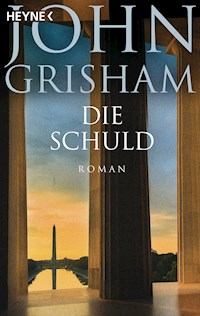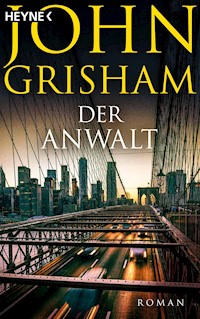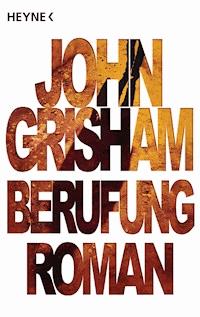9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Kind mit einem tödlichen Geheimnis
Eigentlich wollte der elfjährige Mark auf der Waldlichtung nur eine verbotene Zigarette rauchen. Doch dann beobachtet er den Selbstmordversuch eines Unbekannten. Vergeblich versucht Mark dazwischenzugehen. Aber bevor der Mann, ein Mafia-Anwalt namens Jerome Clifford, stirbt, verrät er ihm ein gefährliches Geheimnis. Nun wird Mark von der Mafia ebenso wie vom FBI gejagt, da Cliffords Information für beide Organisationen außerordentlich bedeutsam ist. Mark verbündet sich mit der engagierten Anwältin Reggie Love, die ihre jungen Klienten verzweifelt aus der Schusslinie zwischen Mafia, Polizei, Justiz und Politik zu ziehen versucht. Reggie weiß genau: Sie haben nur eine einzige Chance ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Eigentlich wollten der elfjährige Mark und sein achtjähriger Bruder Rick auf der Waldlichtung nur eine verbotene Zigarette rauchen. Doch dann beobachten sie, wie ein Unbekannter sich mit den Abgasen seines Wagens zu vergiften versucht. Mark vereitelt den Selbstmord und gerät in die Gewalt des Mannes – eines Mafia-Anwalts namens Jerome Clifford, der ihm ein tödliches Geheimnis verrät. Nachdem sich Clifford vor den Augen der beiden Jungen erschossen hat, wird Mark von der Mafia ebenso wie vom FBI gejagt, da Cliffords Geheimnis für beide Organisationen außerordentlich bedeutsam ist. Mark verbündet sich mit der engagierten Anwältin Reggie Love, die ihre jungen Klienten in einem verzweifelten Kampf auf Leben und Tod aus der Schlußlinie zwischen Mafia und Polizei, Justiz und Politik zu ziehen versucht. Reggie weiß genau: Sie beide haben nur eine einzige Chance ...
Inhaltsverzeichnis
Für Ty und Shea
1
Mark war elf und hatte schon seit zwei Jahren hin und wieder geraucht. Er hatte nie versucht, das Rauchen wieder aufzugeben; aber er hatte darauf geachtet, es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Am liebsten rauchte er Kools, die Marke seines Ex-Vaters, aber seine Mutter rauchte Virginia Slims, zwei Schachteln am Tag, und in einer durchschnittlichen Woche konnte er zehn oder zwölf davon abzweigen. Sie war eine vielbeschäftigte Frau mit einer Menge Problemen und vielleicht ein wenig naiv, wenn es um ihre Söhne ging; ihr wäre nicht einmal im Traum eingefallen, daß ihr Ältester mit elf Jahren schon rauchen könnte.
Gelegentlich verkaufte Kevin, der junge Gangster von der nächsten Straßenecke, Mark für einen Dollar eine gestohlene Schachtel Marlboros. Aber in der Regel war er auf die dünnen Zigaretten seiner Mutter angewiesen.
Vier davon steckten in seiner Tasche, als er an diesem Nachmittag mit seinem achtjährigen Bruder Ricky den Pfad entlangging, der hinter ihrer Wohnwagensiedlung in den Wald führte. Ricky war nervös, weil es das erste Mal sein würde. Er hatte Mark dabei ertappt, wie er gestern die Zigaretten in einem Schuhkarton unter seinem Bett versteckte, und gedroht, es zu verraten, wenn sein großer Bruder ihm nicht beibrachte, wie man rauchte. Sie schlichen den Waldpfad entlang, unterwegs zu einem von Marks Geheimverstecken, an denen er viele einsame Stunden mit dem Versuch verbracht hatte, zu inhalieren und Rauchringe zu blasen.
Die meisten anderen Jungen in der Nachbarschaft standen auf Bier und Pot, zwei Laster, vor denen Mark sich zu hüten gedachte. Ihr Ex-Vater war Alkoholiker; er hatte beide Jungen und ihre Mutter geschlagen, und das war immer nach seinen widerlichen Sauftouren geschehen. Mark hatte die Auswirkungen des Alkohols gesehen und gespürt. Und Drogen machten ihm angst.
»Hast du dich verlaufen?« fragte Ricky, ganz der kleine Bruder, als sie den Pfad verließen und durch brusthohes Unkraut wateten.
»Halt den Mund«, sagte Mark, ohne langsamer zu werden. Ihr Vater war nur zu Hause gewesen, um zu trinken, zu schlafen und sie zu mißhandeln. Jetzt war er fort, Gott sei Dank. Seit fünf Jahren war Mark für Ricky verantwortlich. Er kam sich vor wie ein elfjähriger Vater. Er hatte ihm beigebracht, wie man einen Football wirft und Rad fährt. Er hatte ihm erklärt, was er über Sex wußte. Er hatte ihn vor Drogen gewarnt und vor Rowdies beschützt. Und er fühlte sich miserabel, weil er ihn nun in ein Laster einführte. Aber es war nur eine Zigarette. Es hätte schlimmer kommen können.
Das Unkraut hörte auf, und sie standen unter einem großen Baum; von einem dicken Ast hing ein Seil herab. Eine Reihe von Sträuchern begrenzte eine kleine Lichtung, und hinter ihr führte ein fast zugewachsener Feldweg zu einer Anhöhe hinauf. In der Ferne war der Verkehr auf dem Highway zu hören.
Mark blieb stehen und deutete auf einen Baumstamm in der Nähe des Seils. »Setz dich hin«, sagte er, und Ricky ließ sich brav auf dem Stamm nieder und schaute sich ängstlich um, als fürchtete er, die Polizei könnte in der Nähe sein. Mark musterte ihn wie ein Stabsfeldwebel und holte eine Zigarette aus seiner Hemdtasche. Er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand und versuchte, sich ganz gelassen zu geben.
»Du kennst die Regeln«, sagte er, auf Ricky herabschauend. Es gab nur zwei, und sie hatten sie im Laufe des Tages immer wieder diskutiert. Ricky hatte es satt, wie ein Kind behandelt zu werden. Er verdrehte die Augen und sagte: »Ja, wenn ich es jemandem verrate, dann verhaust du mich.«
»So ist es.« Mark verschränkte die Anne.
»Und ich darf nur eine am Tag rauchen.«
»So ist es. Wenn ich dich dabei erwische, daß du mehr rauchst, dann geht es dir schlecht. Und wenn ich herausfinde, daß du Bier trinkst oder irgendwelche Drogen nimmst, dann ...«
»Ich weiß, ich weiß. Dann verhaust du mich wieder.«
»Richtig.«
»Wie viele am Tag rauchst du?«
»Nur eine«, log Mark. An manchen Tagen nur eine. An anderen drei oder vier, je nachdem, wie viele er sich beschaffen konnte. Er steckte den Filter zwischen die Lippen wie ein Gangster.
»Wird eine am Tag mich umbringen?« fragt Ricky.
Mark nahm die Zigarette aus dem Mund. »Nicht in absehbarer Zeit. Eine am Tag ist ziemlich sicher. Mehr als das, und du könntest Probleme bekommen.«
»Wie viele raucht Mom am Tag?«
»Zwei Schachteln.«
»Wie viele sind das?«
»Vierzig.«
»Wow. Dann hat sie ein großes Problem.«
»Mom hat alle möglichen Probleme. Ich glaube nicht, daß sie sich der Zigaretten wegen Sorgen macht.«
»Wie viele raucht Dad?«
»Vier oder fünf Schachteln. Hundert am Tag.«
Ricky grinste ein wenig. »Dann wird er bald sterben, stimmt’s?«
»Hoffentlich. Er ist ständig betrunken und außerdem Kettenraucher. Da wird er wohl in ein paar Jahren sterben.«
»Was ist ein Kettenraucher?«
»Jemand, der sich eine neue Zigarette an der alten anzündet. Ich wünschte, er würde zehn Schachteln am Tag rauchen.«
»Ich auch.« Ricky warf einen Blick auf die kleine Lichtung und den Feldweg. Unter dem Baum war es kühl und schattig, aber in der prallen Sonne war es erstickend heiß. Mark drückte den Filter zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen und schwenkte die Zigarette vor seinem Mund. »Hast du Angst?« fragte er so herablassend, wie nur große Brüder es sein können.
»Nein.«
»Ich glaube doch. Paß auf, so mußt du sie halten, okay?« Er schwenkte sie näher heran, dann steckte er sie mit einer großen Geste zwischen die Lippen. Ricky sah aufmerksam zu.
Mark zündete die Zigarette an, paffte eine winzige Rauchwolke, dann hielt er sie vor sich und bewunderte sie. »Versuch nicht, den Rauch zu schlucken. So weit bist du noch nicht. Zieh nur ein bißchen, und dann blas den Rauch aus. Bist du so weit?«
»Wird mir schlecht werden?«
»Ja, aber nur, wenn du den Rauch einatmest.« Er tat zwei schnelle Züge und paffte demonstrativ. »Siehst du? Es ist ganz leicht. Wie man inhaliert, zeige ich dir später.«
»Okay.« Ricky streckte nervös Daumen und Zeigefinger aus, und Mark legte die Zigarette sorgfältig dazwischen. »Also los.«
Ricky schob den nassen Filter zwischen die Lippen. Seine Hand zitterte, und er tat einen kurzen Zug und blies Rauch aus. Ein weiterer kurzer Zug. Der Rauch gelangte nie weiter als bis zu seinen Schneidezähnen. Noch ein Zug. Mark beobachtete ihn aufmerksam und hoffte, er würde würgen und husten und blau anlaufen und sich dann übergeben und nie wieder rauchen.
»Es ist ganz einfach«, sagte Ricky stolz, hielt die Zigarette ein Stück von sich und bewunderte sie. Seine Hand zitterte.
»Keine große Sache.«
»Schmeckt irgendwie komisch.«
»Stimmt.« Mark setzte sich neben ihn auf den Baumstamm und zog eine weitere Zigarette aus der Tasche. Ricky paffte hastig. Mark zündete seine an, und dann saßen sie schweigend unter dem Baum und genossen in aller Ruhe ihre Zigaretten.
»Das macht Spaß«, sagte Ricky, am Filter nuckelnd.
»Fein. Und weshalb zittern dann deine Hände?«
»Tun sie nicht.«
»Doch.«
Ricky ignorierte das. Er lehnte sich vor, die Ellenbogen auf den Knien, und tat einen längeren Zug. Dann spuckte er auf die Erde, wie Kevin und die anderen großen Jungen es hinter der Wohnwagensiedlung taten. Es war ganz einfach.
Mark öffnete den Mund zu einem vollkommenen Kreis und versuchte, einen Rauchring zu blasen. Er dachte, das würde seinen kleinen Bruder mächtig beeindrucken; aber es bildete sich kein Ring, und der graue Rauch löste sich einfach auf.
»Ich glaube, du bist zu jung zum Rauchen.«
Ricky paffte und spuckte eifrig und genoß voll und ganz seinen ersten gewaltigen Schritt zur Männlichkeit. »Wie alt warst du, als du angefangen hast?« fragte er.
»Neun. Aber ich war reifer als du.«
»Das sagst du immer.«
»Weil es stimmt.«
Sie saßen nebeneinander auf dem Stamm unter dem Baum, rauchten schweigend und betrachteten die grasbewachsene Lichtung außerhalb des Schattens. Mark war tatsächlich als Achtjähriger wesentlich reifer gewesen, als Rikky es jetzt war. Er war auch reifer als alle anderen Kinder seines Alters. Er war immer reif gewesen. Als er erst sieben Jahre alt war, war er mit einem Baseballschläger über seinen Vater hergefallen. Das Nachspiel war nicht schön gewesen, aber der betrunkene Idiot hatte wenigstens aufgehört, ihre Mutter zu schlagen. Es hatte viele Prügel und Schlägereien gegeben, und Dianne Sway hatte bei ihrem ältesten Sohn Zuflucht und Rat gesucht. Sie hatten sich gegenseitig getröstet und sich geschworen, zu überleben. Wenn er sie geschlagen hatte, hatten sie gemeinsam geweint. Sie hatten sich Tricks ausgedacht, um Ricky zu schützen. Als Mark neun war, überredete er sie dazu, die Scheidung einzureichen. Als sein Vater betrunken bei ihnen auftauchte, nachdem ihm die Scheidungspapiere zugestellt worden waren, rief er die Polizei. Vor Gericht hatte er dann über die Mißhandlungen und die Vernachlässigung und das Schlagen als Zeuge ausgesagt. Er war sehr reif.
Ricky hörte den Wagen als erster. Es war ein leises, surrendes Geräusch, das vom Feldweg herkam. Dann wurde auch Mark aufmerksam, und sie hörten auf zu rauchen. »Bleib ganz still sitzen«, sagte Mark leise. Sie rührten sich nicht.
Ein langer, schwarzer, glänzender Lincoln kam über die leichte Anhöhe und fuhr auf sie zu. Das Unkraut auf dem Feldweg reichte bis an die vordere Stoßstange. Mark ließ seine Zigarette fallen und trat sie aus. Ricky folgte seinem Beispiel.
Als sich der Wagen der Lichtung näherte, kam er fast zum Stillstand, dann beschrieb er einen langsamen Kreis, wobei er die Baumäste berührte. Schließlich hielt er an, mit dem Kühler zum Weg. Die Jungen saßen direkt dahinter, außer Sichtweite. Mark glitt von dem Baumstamm herunter und kroch durch das Unkraut zu einer Reihe von Sträuchern am Rande der Lichtung. Ricky folgte ihm. Das Heck des Lincoln war zehn Meter entfernt. Sie behielten ihn genau im Auge. Er hatte Nummernschilder von Louisiana.
»Was macht er?« flüsterte Ricky.
Mark lugte durch das Unkraut. »Pst!« In der Wohnwagensiedlung hatte er Geschichten gehört von Teenagern, die sich in diesem Wald mit Mädchen trafen und Pot rauchten, aber dieser Wagen gehörte keinem Teenager. Der Motor verstummte, und der Wagen stand eine Minute lang einfach im Wald. Dann ging die Tür auf, und der Fahrer stieg aus und schaute sich um. Es war ein dicklicher Mann in einem schwarzen Anzug. Sein Kopf war groß und rund und haarlos bis auf säuberliche Strähnen über den Ohren und einen schwarz- und graumelierten Bart. Der Mann stolperte zum Heck des Wagens, hantierte mit den Schlüsseln und öffnete schließlich den Kofferraum. Er holte einen Gartenschlauch heraus, schob das eine Ende in das Auspuffrohr und steckte das andere durch einen Spalt am rechten Heckfenster. Dann machte er den Kofferraum zu, schaute sich wieder um, als rechnete er damit, daß ihn jemand beobachtete, und verschwand im Wagen.
Der Motor wurde angelassen.
»Wow«, sagte Mark leise, ohne den Blick von dem Wagen abzuwenden.
»Was macht er?«
»Er versucht, sich umzubringen.«
Ricky hob den Kopf ein paar Zentimeter, um besser sehen zu können. »Das verstehe ich nicht, Mark.«
»Halt den Kopf unten. Siehst du den Schlauch? Die Abgase aus dem Auspuff gehen in den Wagen, und die bringen ihn um.«
»Du meinst Selbstmord?«
»Ja. Das habe ich einmal in einem Film gesehen.«
Sie drückten sich tiefer ins Unkraut und starrten auf den Schlauch, der vom Auspuff zu dem Fenster führte. Der Motor schnurrte im Leerlauf.
»Warum will er sich denn umbringen?«
»Woher soll ich das wissen? Aber wir müssen etwas tun.«
»Ja, so schnell wie möglich von hier verschwinden.«
»Nein. Halt endlich den Mund.«
»Ich verschwinde, Mark. Du kannst zusehen, wie er stirbt, wenn du willst, aber ich haue ab.«
Mark packte seinen Bruder bei der Schulter und drückte ihn wieder hinunter. Rickys Atem ging schwer, und sie schwitzten beide. Die Sonne versteckte sich hinter einer Wolke.
»Wie lange dauert es?« fragte Ricky mit bebender Stimme.
»Nicht sehr lange.« Mark gab seinen Bruder frei und ließ sich auf alle viere nieder. »Du bleibst hier, okay? Wenn du dich von der Stelle rührst, bekommst du einen Tritt in den Hintern.«
»Was hast du vor, Mark?«
»Du bleibst hier. Verstanden?« Mark senkte seinen schmalen Körper fast auf den Boden und kroch auf Händen und Knien durch das Unkraut auf den Wagen zu. Das Gras war trocken und mindestens einen halben Meter hoch. Er wußte, daß der Mann ihn nicht hören konnte, aber er machte sich Sorgen, weil sich die Halme bewegten. Er hielt sich direkt hinter dem Wagen und glitt wie eine Schlange auf dem Bauch voran, bis er sich im Schatten des Kofferraums befand. Er streckte die Hand aus, zog vorsichtig den Schlauch aus dem Auspuffrohr und ließ ihn zu Boden fallen. Den Rückweg legte er etwas schneller zurück, und Sekunden später war er wieder neben Ricky. Sie hockten in dem dichteren Gras und Gestrüpp unter den äußeren Ästen des Baumes, warteten und beobachteten. Mark wußte, wenn sie entdeckt wurden, konnten sie an dem Baum vorbeischießen und auf ihrem Pfad verschwunden sein, bevor der dickliche Mann sie erwischen konnte.
Sie warteten. Fünf Minuten vergingen, aber ihnen kam es vor wie eine Stunde.
»Was meinst du? Ob er tot ist?« flüsterte Ricky. Seine Stimme war trocken und schwach.
»Ich weiß es nicht.«
Plötzlich ging die Tür auf, und der Mann kam heraus. Er weinte und murmelte vor sich hin und taumelte zum Heck des Wagens, wo er den Schlauch im Gras liegen sah, und fluchte, als er ihn wieder in den Auspuff schob. Er hatte eine Whiskeyflasche in der Hand und warf einen verstörten Blick auf die Bäume, dann kehrte er stolpernd und immer noch vor sich hinmurmelnd in den Wagen zurück.
Die Jungen beobachteten ihn voller Grausen.
»Er ist total übergeschnappt«, sagte Mark leise.
»Laß uns von hier verschwinden«, sagte Ricky.
»Das können wir nicht. Wenn er sich umbringt, und wir haben es gesehen, dann können wir eine Menge Ärger bekommen.«
Ricky hob den Kopf, als wollte er den Rückzug antreten. »Dann verraten wir es eben niemandem. Komm schon, Mark!«
Mark packte ihn wieder bei der Schulter und drückte ihn nieder. »Bleib unten! Wir verschwinden erst, wenn ich sage, daß wir verschwinden!«
Ricky schloß die Augen und begann zu weinen. Mark schüttelte angewidert den Kopf, wendete den Blick aber nicht von dem Wagen ab. Kleine Brüder machten mehr Probleme, als sie wert waren. »Hör auf«, knurrte er zwischen zusammengebissenen Zähnen.
»Ich habe Angst.«
»Gut. Aber rühr dich nicht von der Stelle, okay! Hast du gehört? Rühr dich nicht von der Stelle. Und hör auf zu heulen.« Mark war wieder auf Händen und Knien, tief im Unkraut, und bereitete sich darauf vor, abermals durch das hohe Gras zu kriechen.
»Laß ihn doch einfach sterben, Mark«, flüsterte Ricky schluchzend.
Mark funkelte ihn über die Schulter hinweg an und machte sich auf den Weg zu dem Wagen, dessen Motor nach wie vor lief. Er kroch so langsam und behutsam durch den bereits entstandenen Pfad aus leicht niedergedrücktem Gras, daß sogar Ricky, jetzt mit trockenen Augen, ihn kaum sehen konnte. Ricky beobachtete die Fahrertür, wartete darauf, daß der Verrückte herauskam und Mark umbrachte. Er hockte in Sprinterhaltung auf den Zehenspitzen, um notfalls blitzschnell in den Wald flüchten zu können. Er sah, wie Mark unter der hinteren Stoßstange zum Vorschein kam, sich mit einer Hand an der Heckleuchte abstützte und mit der anderen langsam den Schlauch aus dem Auspuff zog. Das Gras knisterte leise und bebte ein wenig, und dann war Mark wieder neben ihm, keuchend und schwitzend und seltsamerweise vor sich hinlächelnd.
Sie saßen wie zwei Insekten im Gestrüpp und beobachteten den Wagen.
»Was ist, wenn er wieder herauskommt?« fragte Ricky. »Und was ist, wenn er uns sieht?«
»Er kann uns nicht sehen. Aber wenn er in diese Richtung kommt, lauf einfach hinter mir her. Wir sind weg, bevor er auch nur ein paar Schritte getan hat.«
»Warum verschwinden wir nicht jetzt gleich?«
Mark starrte ihn wütend an. »Ich versuche, ihm das Leben zu retten, okay? Vielleicht, aber nur vielleicht, stellt er fest, daß es nicht funktioniert, und vielleicht entschließt er sich dann, es vorerst zu lassen oder sonst etwas. Warum ist das so schwer zu begreifen?«
»Weil er verrückt ist. Wenn er sich selbst umbringen will, dann kann er auch uns umbringen. Warum ist das so schwer zu begreifen?«
Mark schüttelte frustriert den Kopf, und plötzlich ging die Tür wieder auf. Der Mann torkelte aus dem Wagen, knurrend und Selbstgespräche führend, und stapfte durch das Gras zum Heck. Er ergriff den Schlauch, starrte ihn an, als wäre er ein ungezogenes Gör, und ließ den Blick langsam auf der kleinen Lichtung herumwandern. Dann schaute er nach unten und erstarrte, als er plötzlich begriff. Um das Heck des Wagens herum war das Gras leicht zu Boden gedrückt, und er kniete nieder, als wollte er es inspizieren; doch dann rammte er statt dessen den Schlauch wieder in den Auspuff und eilte zu seiner Tür zurück. Es schien ihn nicht zu kümmern, ob jemand ihn von den Bäumen aus beobachtete. Er wollte nur sterben, und das möglichst schnell.
Die beiden Köpfe erhoben sich gleichzeitig über das Gestrüpp, nur ein paar Zentimeter. Eine unendliche Minute lang lugten sie durch das Gras hindurch. Ricky war bereit, loszurennen, aber Mark dachte nach.
»Mark, bitte, wir wollen fort von hier«, flehte Ricky. »Er hätte uns beinahe gesehen. Was ist, wenn er einen Revolver hat oder so etwas Ähnliches?«
»Wenn er einen Revolver hätte, würde er ihn für sich selbst benutzen.«
Ricky biß sich auf die Lippen, und seine Augen wurden wieder feucht. Er hatte in einer Diskussion mit seinem Bruder noch nie die Oberhand behalten, und es würde auch diesmal nicht anders sein.
Eine weitere Minute verstrich, und Mark begann zu zappeln. »Ich versuche es noch ein letztes Mal, okay? Und wenn er dann immer noch nicht aufgibt, verschwinden wir. Ich verspreche es. Okay?«
Ricky nickte widerstrebend. Sein Bruder ließ sich auf den Bauch nieder und kroch durch das Unkraut in das hohe Gras. Ricky wischte sich mit seinen schmutzigen Fingern die Tränen vom Gesicht.
Die Nüstern des Anwalts weiteten sich, als er tief einatmete. Dann atmete er langsam aus und starrte durch die Windschutzscheibe, während er sich darüber klarzuwerden versuchte, ob schon etwas von dem tödlichen Gas in sein Blut gelangt war und begonnen hatte, sein Werk zu tun. Auf dem Sitz neben ihm lag eine geladene Pistole, und in der Hand hielt er eine halbgeleerte Flasche Jack Daniels. Er nahm einen Schluck, schraubte die Kappe wieder auf und legte die Flasche auf den Sitz. Er atmete langsam ein und schloß die Augen, um das Gas zu genießen. Würde er einfach hinüberdriften? Würde es schmerzen oder brennen, oder würde er sich vielleicht übergeben müssen, bevor es ihm den Rest gab? Der Abschiedsbrief lag auf dem Armaturenbrett, neben einem Glas mit Tabletten.
Er weinte und redete mit sich selbst, während er darauf wartete, daß das Gas sich beeilte, verdammt nochmal!, bevor er aufgeben und die Pistole benutzen mußte. Er war ein Feigling, aber ein sehr entschlossener, und dieses Einatmen und Davonschweben war ihm wesentlich lieber, als sich eine Waffe in den Mund zu stecken.
Er trank wieder einen Schluck Whiskey und zog die Luft ein, als der Alkohol in seiner Kehle brannte. Ja, es tat endlich seine Wirkung. Bald würde alles vorbei sein, und er lächelte sich selbst im Spiegel zu, weil es wirkte und er starb und er schließlich doch kein Feigling war. Es gehörte Mut dazu, das hier zu tun.
Er weinte und murmelte, als er für einen letzten Schluck abermals die Kappe von der Whiskeyflasche abschraubte. Er verschluckte sich, und der Whiskey floß über seine Lippen und sickerte in den Bart.
Niemand würde ihn vermissen. Und obwohl dieser Gedanke eigentlich schmerzlich hätte sein müssen, beruhigte ihn das Wissen, daß niemand um ihn trauern würde. Seine Mutter war auf der ganzen Welt die einzige Person, die ihn je geliebt hatte. Aber sie war seit vier Jahren tot, also würde es ihr nichts ausmachen. Da war ein Kind aus seiner ersten, katastrophalen Ehe, eine Tochter, die er seit elf Jahren nicht gesehen hatte, aber er hatte gehört, daß sie sich einer Sekte angeschlossen hatte und ebenso verrückt war wie ihre Mutter.
Es würde eine kleine Beerdigung sein. Ein paar Anwaltskollegen und vielleicht ein Richter oder zwei würden erscheinen, alle in schwarzen Anzügen und wichtigtuerisch flüsternd, während die Musik der mechanischen Orgel durch die fast leere Kapelle wehte. Die Anwälte würden dasitzen und auf die Uhr schauen, während der Geistliche, ein Fremder, die üblichen Standardfloskeln für seine teuren Dahingeschiedenen herunterleierte, die nie zur Kirche gingen.
Es würde ein Zehn-Minuten-Job ohne Schnörkel sein. Der Abschiedsbrief auf dem Armaturenbrett besagte, daß sein Leichnam verbrannt werden sollte.
»Wow«, sagte er leise und nahm noch einen Schluck. Er kippte die Flasche hoch, und beim Schlucken schaute er in den Rückspiegel und sah, wie sich das Gras hinter dem Wagen bewegte.
Ricky sah noch vor Mark, wie die Tür aufging. Sie flog auf, als hätte jemand dagegengetreten, und plötzlich rannte der große schwere Mann mit dem roten Gesicht durch das Gras, hielt sich am Wagen fest und knurrte. Ricky stand da, starr vor Angst und Entsetzen, und machte sich in die Hose.
Mark hatte gerade die Stoßstange berührt, als er die Tür hörte. Er erstarrte für eine Sekunde, dachte kurz darüber nach, ob er unter den Wagen kriechen sollte, und das Zögern wurde ihm zum Verhängnis. Sein Fuß glitt aus, als er versuchte, aufzustehen und davonzulaufen, und der Mann packte ihn. »Du! Du kleiner Mistkerl!« knurrte er, während er in Marks Haare griff und ihn auf den Kofferraum des Wagens warf. »Du kleiner Mistkerl!« Mark trat nach ihm und wand sich, und eine dicke Hand schlug ihm ins Gesicht. Er trat noch einmal, nicht so heftig, und wurde abermals geschlagen.
Mark starrte in das irre, wütende, nur Zentimeter von ihm entfernte Gesicht. Die Augen waren rot und feucht. Flüssigkeit tropfte von der Nase und vom Kinn. »Du kleiner Mistkerl!« zischte der Mann durch zusammengebissene, gelbliche Zähne.
Als er ihn festgenagelt hatte und Mark sich nicht mehr wehrte, schob der Anwalt den Schlauch wieder in das Auspuffrohr, dann riß er Mark beim Kragen vom Kofferraum herunter und zerrte ihn durch das Gras zur offenstehenden Fahrertür. Er warf den Jungen durch die Tür und schob ihn über den schwarzen Ledersitz hinweg auf die Beifahrerseite.
Mark rüttelte am Türgriff und suchte nach der Verriegelung, als der Mann sich hinter das Lenkrad fallen ließ. Er knallte die Tür hinter sich zu, deutete auf den Türgriff und zischte: »Rühr den nicht an!« Dann versetzte er Mark mit dem Handrücken einen gemeinen Schlag aufs linke Auge.
Mark schrie vor Schmerz auf und beugte sich vornüber, benommen, jetzt weinend. Seine Nase tat fürchterlich weh, sein Mund noch mehr. Ihm war schwindlig. Er schmeckte Blut. Er konnte hören, wie der Mann weinte und murmelte. Er konnte den Whiskey riechen und mit dem rechten Auge die Knie seiner schmutzigen Jeans sehen. Das linke begann anzuschwellen. Alles war verschwommen.
Der Anwalt kippte seinen Whiskey und starrte Mark an, der vornübergebeugt dasaß und an allen Gliedern zitterte. »Hör auf zu heulen«, fuhr er ihn an.
Mark leckte sich die Lippen und schluckte Blut. Er rieb sich die Beule über seinem Auge und versuchte, immer noch seine Jeans anstarrend, tief Luft zu holen. Wieder sagte der Mann: »Hör auf zu heulen.« Also versuchte er, damit aufzuhören.
Der Motor lief. Es war ein großer, schwerer, ruhiger Wagen, aber Mark konnte den Motor hören, der irgendwo weit weg ganz leise schnurrte. Er drehte sich langsam um und warf einen Blick auf den Schlauch, der sich durch das Rückfenster hinter dem Fahrer wand wie eine wütende Schlange, die sich anschleicht, um zu töten. Der dicke Mann lachte.
»Ich finde, wir sollten zusammen sterben«, verkündete er, ganz plötzlich sehr gefaßt.
Marks linkes Auge schwoll schnell zu. Er drehte sich halb zur Seite und musterte den Mann, der ihm jetzt noch größer vorkam. Sein Gesicht war dicklich, der Bart war buschig, die Augen waren immer noch rot und funkelten ihn an wie die eines Dämons im Dunkeln. Mark weinte. »Bitte, lassen Sie mich raus«, sagte er, mit bebenden Lippen und brechender Stimme.
Der Fahrer steckte sich die Whiskeyflasche in den Mund und kippte sie an. Er verzog das Gesicht und schmatzte. »Tut mir leid, Junge. Du mußtest ja unbedingt ein Schlauberger sein und deine kleine Rotznase in meine Angelegenheiten stecken, stimmt’s? Also finde ich, wir sollten zusammen sterben. Okay? Nur du und ich, mein Junge. Ab ins La-La-Land. Ab zum großen Zauberer. Träume süß, Junge.«
Mark schnupperte die Luft, dann entdeckte er die Pistole zwischen ihnen. Er schaute weg und dann wieder hin, als der Mann einen weiteren Schluck aus der Flasche nahm.
»Willst du die Pistole?« fragte der Mann.
»Nein, Sir.«
»Weshalb siehst du sie dann so genau an?«
»Das habe ich nicht getan.«
»Lüg mich nicht an, Junge, denn wenn du es tust, dann bringe ich dich um. Ich bin total übergeschnappt, okay, und ich könnte dich umbringen.« Obwohl ihm die Tränen übers Gesicht rannen, war seine Stimme ganz ruhig. Er atmete tief ein, während er sprach. »Und außerdem, Junge, wenn wir Freunde sein wollen, mußt du ganz aufrichtig sein. Aufrichtigkeit ist sehr wichtig, weißt du das? Also, willst du die Pistole?«
»Nein, Sir.«
»Ich habe keine Angst vorm Sterben, Junge, verstehst du das?«
»Ja, Sir, aber ich will nicht sterben. Ich muß mich um meine Mutter kümmern und um meinen kleinen Bruder.«
»Ach, wie reizend. Ein richtiggehender Herr im Hause.«
Er schraubte den Verschluß auf die Whiskeyflasche, dann ergriff er plötzlich die Pistole, steckte sie tief in seinen Mund, preßte die Lippen darum und sah Mark an, der jeder seiner Bewegungen folgte, hoffte, er würde auf den Abzug drükken, hoffte, er würde es nicht tun. Langsam zog er den Lauf wieder aus dem Mund, küßte die Mündung. Dann richtete er sie auf Mark.
»Ich habe dieses Ding noch nie abgefeuert«, sagte er, fast flüsternd. »Habe sie erst vor einer Stunde in einer Pfandleihe in Memphis gekauft. Was meinst du, ob sie funktioniert?«
»Bitte lassen Sie mich raus.«
»Du kannst es dir aussuchen, Junge«, sagte er und inhalierte die unsichtbaren Abgase. »Entweder blas ich dir das Gehirn raus, und dann ist es gleich vorbei, oder das Gas gibt dir den Rest. Du kannst es dir aussuchen.«
Mark sah die Pistole nicht an. Er schnupperte die Luft und dachte einen Moment, daß er vielleicht etwas riechen konnte. Die Waffe war dicht an seinem Kopf. »Weshalb tun Sie das?« fragte er.
»Das geht dich einen Scheißdreck an, Junge. Ich bin verrückt. Völlig hinüber. Ich hatte einen hübschen, ruhigen Selbstmord geplant, nur ich und mein Schlauch und vielleicht ein paar Pillen und ein bißchen Whiskey. Ohne daß mir jemand in die Quere kommt. Aber nein, du mußtest dich ja unbedingt einmischen. Du kleiner Dreckskerl!« Er senkte die Pistole und legte sie behutsam auf den Sitz. Mark rieb sich die Beule auf seiner Stirn und biß sich auf die Lippen. Seine Hände zitterten, und er klemmte sie zwischen die Knie.
»In fünf Minuten sind wir tot«, verkündete der Anwalt und hob wieder die Flasche an die Lippen. »Nur du und ich, Junge. Ab zum großen Zauberer.«
Endlich bewegte sich Ricky. Seine Zähne klapperten, und seine Jeans waren naß, aber jetzt dachte er wieder nach, ließ sich aus der Hocke auf Händen und Knien ins Gras sinken. Er kroch auf den Wagen zu, weinend und mit den Zähnen knirschend, während er auf dem Bauch vorwärtsrobbte. Gleich würde die Tür auffliegen. Der Verrückte, der zwar dick war, aber schnell, würde aus dem Nirgendwo hervorspringen und ihn beim Hals packen, genau wie Mark, und dann würden sie alle sterben in dem langen schwarzen Wagen. Langsam, Zentimeter um Zentimeter, bahnte er sich seinen Weg durch das Gras.
Mark hob langsam mit beiden Händen die Pistole. Sie war so schwer wie ein Ziegelstein und zitterte, als er sie auf den dicken Mann richtete, der sich ihr entgegenlehnte, bis der Lauf nur noch zwei Zentimeter von seiner Nase entfernt war.
»So, und jetzt drück ab, Junge«, sagte er mit einem Lächeln, und sein feuchtes Gesicht strahlte und funkelte vor freudiger Erwartung. »Drück ab, und ich bin tot, und du kannst abhauen.« Mark krümmte den Finger um den Abzug. Der Mann nickte, dann lehnte er sich sogar noch weiter vor und biß mit aufblitzenden Zähnen auf das Ende des Laufs. »Drück ab!« brüllte er.
Mark schloß die Augen und preßte die Handflächen gegen den Kolben der Waffe. Er hielt den Atem an und war im Begriff, auf den Abzug zu drücken, als der Mann ihm die Waffe entriß. Er schwenkte sie wie ein Irrer vor Marks Gesicht und drückte ab. Mark schrie, als das Fenster hinter seinem Kopf in tausend Stücke zersplitterte, aber nicht in Scherben ging. »Sie funktioniert! Sie funktioniert!« brüllte er, als Mark sich duckte und sich die Ohren zuhielt.
Ricky vergrub das Gesicht im Gras, als er den Schuß hörte. Er war drei Meter von dem Wagen entfernt, als etwas knallte und Mark schrie. Der dicke Mann brüllte, und Ricky machte sich abermals in die Hose. Er schloß die Augen und krallte sich im Gras fest. Sein Magen verkrampfte sich, und sein Herz hämmerte, und nach dem Schuß rührte er sich eine Minute lang nicht von der Stelle. Er weinte um seinen Bruder, der jetzt tot war, erschossen von einem Verrückten.
»Hör auf zu heulen, verdammt nochmal! Ich habe deine Heulerei satt!«
Mark umklammerte seine Knie und versuchte, mit dem Weinen aufzuhören. Sein Kopf pochte, und sein Mund war trocken. Er klemmte die Hände zwischen die Knie und beugte sich vornüber. Er mußte mit dem Weinen aufhören und sich etwas ausdenken. In einem Fernsehfilm war einmal ein Spinner im Begriff gewesen, von einem Gebäude herunterzuspringen, und dieser coole Bulle hatte auf ihn eingeredet, einfach pausenlos auf ihn eingeredet, und schließlich hatte der Spinner geantwortet und war natürlich nicht gesprungen. Mark schnupperte schnell nach Gas, dann fragte er: »Warum tun Sie das?«
»Weil ich sterben will«, sagte der Mann ganz ruhig.
»Warum?« fragte er noch einmal und betrachtete das säuberliche kleine Loch in der Scheibe.
»Warum stellen kleine Jungen so viele Fragen?«
»Weil sie kleine Jungen sind. Weshalb wollen Sie sterben?«
»In fünf Minuten sind wir tot. Nur du und ich, Junge, ab zum großen Zauberer.« Er tat einen langen Zug aus der Flasche, die jetzt fast leer war. »Ich spüre das Gas, Junge. Spürst du es auch? Endlich.«
Durch die Risse im Fenster sah Mark im Außenspiegel, daß sich das Gras bewegte und erhaschte einen Blick auf Ricky, wie er durch das Unkraut robbte und in dem Gestrüpp in der Nähe des Baums in Deckung ging. Er schloß die Augen und betete.
»Eins muß ich dir sagen, Junge, es ist hübsch, dich hier zu haben. Niemand stirbt gern allein. Wie heißt du?«
»Mark.«
»Mark. Und weiter?«
»Mark Sway.« Immer weiterreden, dann springt der Spinner vielleicht nicht. »Und wie heißen Sie?«
»Jerome. Aber du kannst Romey zu mir sagen. So nennen mich meine Freunde, und weil wir beide jetzt im selben Boot sitzen, darfst du mich Romey nennen. Und keine weiteren Fragen, okay, Junge?«
»Warum wollen Sie sterben, Romey?«
»Ich habe doch gesagt, keine weiteren Fragen. Spürst du das Gas, Mark?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du wirst es bald genug spüren. Sprich lieber deine Gebete.« Romey ließ sich in seinen Sitz sinken, lehnte den fleischigen Kopf zurück und schloß die Augen, völlig mit sich im reinen. »Wir haben noch ungefähr fünf Minuten, Mark. Irgendwelche letzten Worte?« In der rechten Hand hielt er die Whiskeyflasche, in der linken die Pistole.
»Ja. Warum tun Sie das?« fragte Mark und hielt im Spiegel Ausschau nach seinem Bruder. Er atmete kurz und schnell durch die Nase und roch und spürte nicht das geringste. Bestimmt hatte Ricky den Schlauch herausgezogen.
»Weil ich verrückt bin, ein verrückter Anwalt mehr auf der Welt. Man hat mich in den Wahnsinn getrieben, Mark. Wie alt bist du?«
»Elf.«
»Schon mal Whiskey probiert?«
»Nein«, erwiderte Mark wahrheitsgemäß.
Plötzlich war die Whiskeyflasche vor seinem Gesicht, und er ergriff sie.
»Nimm einen Schluck«, sagte Romey, ohne die Augen zu öffnen.
Mark versuchte, das Etikett zu lesen, aber sein linkes Auge war praktisch zugeschwollen, seine Ohren dröhnten von dem Pistolenschuß, und er konnte sich nicht konzentrieren. Er stellte die Flasche auf den Sitz, und Romey nahm sie wortlos wieder an sich.
»Wir sterben, Mark«, sagte er fast zu sich selbst. »Das ist vermutlich hart, wenn man erst elf ist, aber so ist es nun einmal. Daran läßt sich nichts ändern. Irgendwelche letzten Worte, großer Junge?«
Mark sagte sich, daß Ricky es geschafft hatte, daß der Schlauch jetzt harmlos war, daß sein neuer Freund Romey hier betrunken und verrückt war, und daß er nur dann heil hier wieder herauskommen würde, wenn er sich etwas einfallen ließ und redete. Die Luft war sauber. Er atmete tief ein und sagte sich, daß er es schaffen würde. »Was hat Sie verrückt gemacht?«
Romey dachte eine Sekunde lang nach und kam zu dem Schluß, daß die Sache eigentlich auch etwas Komisches hatte. Er schnaubte und kicherte sogar ein wenig. »Oh, das ist großartig. Perfekt. Seit Wochen weiß ich etwas, das sonst niemand auf der ganzen Welt weiß, ausgenommen mein Klient, der übrigens der letzte Dreck ist. Du weißt vielleicht, Mark, daß wir Anwälte alle möglichen Dinge erfahren, die wir nie jemandem weitersagen dürfen. Streng vertraulich, verstehst du? Auf gar keinen Fall dürfen wir jemals verraten, was mit dem Geld passiert ist oder wer mit wem schläft oder wo die Leiche vergraben ist, verstehst du?« Er atmete tief ein und stieß den Atem ungeheuer genußvoll wieder aus. Dann ließ er sich mit geschlossenen Augen noch tiefer in seinen Sitz sinken. »Tut mir leid, daß ich dich schlagen mußte.« Er krümmte seinen Finger um den Abzug.
Mark machte die Augen zu und spürte nichts.
»Wie alt bist du, Mark?«
»Elf.«
»Ach ja, das hast du ja schon gesagt. Elf. Und ich bin vierundvierzig. Wir sind beide zu jung zum Sterben, stimmt’s, Mark?«
»Ja, Sir.«
»Aber es passiert, Junge. Spürst du es?«
»Ja, Sir.«
»Mein Klient hat einen Mann umgebracht und die Leiche versteckt, und jetzt will er mich umbringen. Das ist die ganze Story. Sie haben mich verrückt gemacht. Ha! Ha! Das ist großartig, Mark. Das ist wundervoll. Ich, der vertrauenswürdige Anwalt, kann dir jetzt, buchstäblich Sekunden bevor wir davonschweben, verraten, wo die Leiche ist. Die Leiche, Mark, die meistgesuchte und bisher unentdeckte Leiche unserer Zeit. Unglaublich. Endlich kann ich es sagen!« Seine Augen waren offen und funkelten auf Mark herunter. »Das ist ein Riesenspaß, Mark.«
Mark begriff nicht, worin der Spaß lag. Er warf einen Blick in den Spiegel, dann auf die dreißig Zentimeter entfernte Türverriegelung. Der Griff war sogar noch näher.
Romey entspannte sich wieder und schloß abermals die Augen, als versuchte er verzweifelt, ein Nickerchen zu machen. »Tut mir leid, Junge, tut mir wirklich leid, aber wie ich schon sagte, es ist hübsch, dich hier zu haben.« Er legte langsam die Flasche neben den Brief auf das Armaturenbrett und beförderte die Pistole von der linken in die rechte Hand, streichelte sie sanft und strich mit dem Zeigefinger über den Abzug. Mark versuchte, nicht hinzusehen. »Tut mir wirklich leid, Junge. Wie alt bist du?«
»Elf. Das fragen Sie mich jetzt schon zum drittenmal.«
»Halt den Mund! Ich spüre das Gas, du nicht? Hör auf zu schnüffeln, verdammt nochmal! Es ist geruchlos, du kleiner Blödmann. Man kann es nicht riechen. Wenn du dich nicht eingemischt hättest, wäre ich jetzt schon tot, und du könntest irgendwo Räuber und Gendarm spielen. Du bist ganz schön blöd.«
Nicht so blöd wie du, dachte Mark. »Wen hat Ihr Klient umgebracht?«
Romey grinste, machte die Augen aber nicht auf. »Einen Senator der Vereinigten Staaten. Ich verrate es, ich verrate es. Ich packe aus. Liest du Zeitungen?«
»Nein.«
»Das überrascht mich nicht. Senator Boyette aus New Orleans. Da komme ich auch her.«
»Weshalb sind Sie nach Memphis gekommen?«
»Verdammter Bengel! Du willst wohl alles ganz genau wissen?«
»Ja. Warum hat Ihr Klient Senator Boyette umgebracht?«
»Warum, warum, warum, wer, wer, wer. Du bist eine verdammte Nervensäge, Mark.«
»Ich weiß. Weshalb lassen Sie mich nicht einfach laufen?« Mark warf einen Blick in den Spiegel, dann auf das Ende des Schlauchs auf dem Rücksitz.
»Ich könnte dir einen Schuß in den Kopf verpassen, wenn du nicht endlich den Mund hältst.« Sein bärtiges Kinn sackte herunter und berührte fast seine Brust. »Mein Klient hat eine Menge Leute umgebracht. Er verdient sein Geld, indem er Leute umbringt. Er gehört zur Mafia in New Orleans, und jetzt versucht er, mich umzubringen. So ein Pech, findest du nicht auch, Junge? Wir sind ihm zuvorgekommen. Und er ist der Dumme.«
Romey nahm einen großen Schluck aus der Flasche und starrte Mark an.
»Stell dir das vor, Junge, stell dir das vor. Barry – oder Barry das Messer, wie er genannt wird, diese Mafia-Typen haben alle tolle Spitznamen – wartet jetzt auf mich in einem schmutzigen Restaurant in New Orleans. Wahrscheinlich lauern ein paar von seinen Kumpanen in der Nähe, und nach einem friedlichen Essen wird er mich auffordern, in den Wagen zu steigen und ein bißchen herumzufahren, damit wir über seinen Fall und all das reden können, und dann zieht er ein Messer, das ist der Grund, weshalb er das Messer genannt wird, und es ist vorbei mit mir. Dann schaffen sie meine rundliche kleine Leiche beiseite, genau wie sie es mit Senator Boyette gemacht haben, und New Orleans hat einen weiteren unaufgeklärten Mord. Aber wir haben ihm ein Schnippchen geschlagen, stimmt’s, Junge? Wir haben es ihm gezeigt.«
Er redete jetzt langsamer und mit schwererer Zunge. Während des Sprechens bewegte er die Pistole auf seinem Oberschenkel auf und ab. Sein Finger blieb am Abzug.
Halt ihn am Reden. »Warum will dieser Barry Sie umbringen?«
»Noch eine Frage. Ich schwebe. Schwebst du auch?«
»Ja. Fühlt sich gut an.«
»Aus einem ganzen Haufen von Gründen. Mach die Augen zu, Junge. Sprich deine Gebete.« Mark behielt die Pistole im Auge und warf zwischendurch einen schnellen Blick auf die Türverriegelung. Er brachte langsam den Daumen mit jeder Fingerspitze in Berührung, wie beim Zählen im Kindergarten, und die Koordination war perfekt.
»Und wo ist die Leiche?«
Romey schnaubte und sein Kopf nickte. Die Stimme war fast ein Flüstern. »Die Leiche von Boyd Boyette. Was für eine Frage. Der erste US-Senator, der im Amt ermordet worden ist, hast du das gewußt? Ermordet von meinem lieben Klienten Barry Muldanno, der ihm viermal in den Kopf geschossen und dann die Leiche versteckt hat. Keine Leiche, kein Fall. Verstehst du das, Junge?«
»Nicht ganz.«
»Weshalb heulst du nicht, Junge? Vor ein paar Minuten hast du noch geheult. Hast du keine Angst?«
»Doch, ich habe Angst. Und ich möchte hier raus. Tut mir leid, daß Sie sterben wollen und all das, aber ich muß mich um meine Mutter kümmern.«
»Rührend, wirklich rührend. Und nun halt den Mund. Du mußt wissen, Junge, die Leute vom FBI brauchen eine Leiche, um beweisen zu können, daß ein Mord geschehen ist. Sie verdächtigen Barry, er ist ihr einziger Verdächtiger, weil er es tatsächlich getan hat, verstehst du? Sie wissen sogar, daß er es getan hat. Aber sie brauchen die Leiche.«
»Wo ist sie?«
Eine dunkle Wolke schob sich vor die Sonne, und auf der Lichtung war es plötzlich viel dunkler. Romey bewegte die Waffe sanft auf seinem Bein auf und ab, als wollte er Mark vor jeder plötzlichen Bewegung warnen. »Barry ist nicht gerade der intelligenteste Gangster, den ich kenne. Er hält sich für ein Genie, aber er ist ein ziemlicher Blödmann.«
Du bist der Blödmann, dachte Mark. Sitzt in einem Wagen mit einem Schlauch im Auspuff. Er wartete so still wie möglich.
»Die Leiche ist unter meinem Boot.«
»Ihrem Boot?«
»Ja, meinem Boot. Er hatte es eilig. Ich war nicht in der Stadt, also brachte mein geliebter Klient die Leiche zu meinem Haus und begrub sie in frischem Beton in meiner Garage. Und da ist sie immer noch, kannst du dir das vorstellen? Das FBI hat halb New Orleans umgegraben, um sie zu finden, aber an mein Haus hat niemand gedacht. Vielleicht ist Barry doch nicht so blöde.«
»Wann hat er Ihnen das erzählt?«
»Ich habe deine Fragerei satt, Junge.«
»Ich würde jetzt wirklich gern hier raus.«
»Halt die Klappe. Das Gas wirkt. Wir sind hinüber, Junge. Hinüber.« Er ließ die Pistole auf den Sitz fallen.
Der Motor schnurrte leise. Mark warf einen Blick auf das Einschußloch in der Scheibe, auf die Millionen kleiner gezackter Risse, die von ihm ausstrahlten, dann auf das rote Gesicht und die schweren Lider. Ein kurzes Schnauben, fast ein Schnarchen, und der Kopf kippte abwärts.
Er sackte weg! Mark beobachtete, wie sich sein dicker Brustkorb bewegte. Das hatte er bei seinem Ex-Vater Hunderte von Malen gesehen.
Mark holte tief Luft. Die Türverriegelung würde ein Geräusch machen. Die Pistole lag zu nahe bei Romeys Hand. Marks Magen verkrampfte sich, und seine Füße waren taub.
Das rote Gesicht gab ein lautes, träges Geräusch von sich, und Mark wußte, daß er keine weitere Chance bekommen würde. Langsam, ganz langsam bewegte er seinen zitternden Finger auf die Türverriegelung zu.
Rickys Augen waren fast so trocken wie sein Mund, aber seine Jeans waren klatschnaß. Er hockte unter dem Baum, in der Dunkelheit, weit weg von den Sträuchern und dem hohen Gras und dem Wagen. Fünf Minuten waren vergangen, seit er den Schlauch herausgezogen hatte. Fünf Minuten seit dem Schuß. Aber er wußte, daß sein Bruder am Leben war, weil er hinter den Bäumen fünfzehn Meter weit gerannt war, bis er den blonden Kopf entdeckt und gesehen hatte, daß er sich in dem riesigen Wagen bewegte. Daraufhin hatte er aufgehört zu weinen und angefangen zu beten.
Er kroch hinter den Baumstamm und begann sehnsuchtsvoll zu dem Auto hinüberzustarren, das seinen Bruder von ihm fernhielt, als die Beifahrertür plötzlich aufflog und Mark daraus hervorschoß.
Romeys Kinn sackte auf seine Brust, und in dem Moment, in dem er seinen nächsten Schnarcher begann, hieb Mark mit der linken Hand die Pistole auf den Boden und entriegelte gleichzeitig mit der rechten die Tür. Er zerrte am Griff und rammte die Schulter gegen die Tür, und das letzte, was er hörte, als er sich herausrollte, war ein weiterer lauter Schnarcher des Anwalts.
Er landete auf den Knien und hielt sich an Grashalmen fest, während er sich seinen Weg von dem Wagen weg kratzte und krallte. Dann sprintete er tief geduckt durch das Gras und erreichte Sekunden später den Baum, wo Ricky in stummem Entsetzen wartete. Er hielt am Stamm an und drehte sich um, erwartete, den Anwalt zu sehen, der mit der Pistole hinter ihm herstolperte. Aber der Wagen wirkte harmlos. Die Beifahrertür stand offen. Der Motor lief. Das Auspuffrohr war völlig frei. Er atmete zum erstenmal seit einer Minute, dann sah er langsam Ricky an.
»Ich habe den Schlauch rausgezogen«, sagte Ricky mit schriller Stimme zwischen hastigen Atemzügen. Mark nickte, sagte aber nichts. Er war plötzlich viel ruhiger. Der Wagen war fünfzehn Meter entfernt, und wenn Romey herauskam, konnten sie blitzschnell im Wald verschwinden. Und weil sie hinter dem Baum standen und durch das Gestrüpp gedeckt waren, würde Romey sie auf keinen Fall sehen können, falls er sich entschloß, herauszuspringen und mit der Pistole um sich zu schießen.
»Ich habe Angst, Mark. Laß uns abhauen«, sagte Ricky. Seine Stimme war schrill, seine Hände zitterten.
»Nur noch eine Minute.« Mark beobachtete unverwandt den Wagen.
»Komm schon, Mark. Wir wollen weg hier.«
»Nur noch eine Minute, habe ich gesagt.«
Ricky schaute zum Wagen. »Ist er tot?«
»Ich glaube nicht.«
Also war der Mann am Leben, und er hatte die Waffe, und es war offensichtlich, daß sein großer Bruder keine Angst mehr hatte und über irgend etwas nachdachte. Ricky tat einen Schritt rückwärts. »Ich hau ab«, murmelte er. »Ich will nach Hause.«
Mark rührte sich nicht. Er atmete tief aus und betrachtete den Wagen. »Nur noch eine Sekunde«, sagte er, ohne Ricky anzusehen. In seiner Stimme lag wieder die alte Autorität.
Ricky verstummte und beugte sich vor, legte die Hände auf die nassen Knie. Er beobachtete seinen Bruder und schüttelte langsam den Kopf, als Mark eine Zigarette aus seiner Hemdtasche holte, ohne den Blick von dem Wagen abzuwenden. Er zündete sie an, tat einen tiefen Zug und blies den Rauch zu den Ästen hinauf. In diesem Moment bemerkte Ricky zum erstenmal die Schwellung.
»Was ist mit deinem Auge los?«
Mark fiel es plötzlich wieder ein. Er rieb sanft darüber, dann über die Beule auf seiner Stirn. »Er hat mich ein paarmal geschlagen.«
»Sieht schlimm aus.«
»Kein Grund zur Aufregung. Weißt du, was ich tun werde?« sagte er, ohne eine Antwort zu erwarten. »Ich schleich mich rüber und steck den Schlauch wieder in den Auspuff. Soll der Bastard doch draufgehen!«
»Du bist ja noch verrückter als er. Du machst doch nur Spaß, oder?«
Mark paffte geruhsam. Plötzlich flog die Fahrertür auf, und Romey torkelte mit der Pistole heraus. Er redete laut vor sich hin, während er zum Heck des Wagens stolperte und abermals feststellte, daß der Schlauch harmlos im Gras lag. Er schrie Obszönitäten zum Himmel hinauf.
Mark duckte sich tief und drückte auch Ricky herunter. Romey wirbelte herum und ließ den Blick über die Lichtung schweifen. Er fluchte weiter und fing an, laut zu weinen. Schweiß tropfte ihm vom Haar, sein schwarzes Jackett war durchweicht und klebte ihm am Körper. Er stapfte um das Heck des Wagens herum, schluchzend und vor sich hinredend und die Bäume anschreiend.
Plötzlich blieb er stehen, hievte seinen massigen Körper auf den Kofferraum und rutschte rückwärts hinauf wie ein betrunkener Elefant, bis er gegen das Heckfenster stieß. Seine stämmigen Beine waren ausgestreckt. Ein Schuh fehlte. Er nahm die Waffe, weder langsam noch schnell, und steckte sie sich tief in den Mund. Seine irren roten Augen jagten herum und blieben eine Sekunde lang auf dem Baumstamm über den Jungen hängen.
Er öffnete die Lippen und biß mit seinen großen schmutzigen Zähnen auf den Lauf. Dann schloß er die Augen und drückte mit dem rechten Daumen ab.
2
Die Schuhe waren aus Haifischleder, und die vanillefarbenen Seidensocken reichten bis zu den Kniescheiben, wo sie schließlich aufhörten und die ziemlich haarigen Waden von Barry Muldanno liebkosten, gewöhnlich Barry das Messer genannt oder, was ihm am liebsten war, einfach das Messer. Der dunkelgrüne Anzug glänzte und sah auf den ersten Blick aus wie Echse oder Leguan oder irgendein anderes schleimiges Reptil, aber wenn man genauer hinschaute, sah man, daß es kein tierisches Material, sondern Polyester war. Zweireihig mit einer Menge Knöpfen auf dem Vorderteil. Er saß gut an seinem wohlgebauten Körper. Und er kräuselte sich hübsch, als Muldanno mit selbstbewußten Bewegungen zum Münzfernsprecher im Hintergrund des Restaurants ging. Der Anzug war nicht protzig, er war nur auffallend. Man konnte ihn für einen gutgekleideten Drogenimporteur halten oder vielleicht für einen gerissenen Buchmacher aus Vegas, und das war in Ordnung, weil er das Messer war und erwartete, daß die Leute ihn bemerkten, und wenn sie ihn anschauten, sollten sie Erfolg sehen. Sie sollten vor Angst erstarren und ihm aus dem Wege gehen.
Das Haar war schwarz und dicht, gefärbt, um einen Anflug von Grau zu verdecken, angeklatscht, voll von Pomade, straff zurückgekämmt und zu einem perfekten kleinen Pferdeschwanz zusammengerafft, der sich abwärts bog und exakt bis zum Kragen des dunkelgrünen Polyesterjacketts reichte. Die Pflege kostete Stunden. Der obligatorische Diamantohrring funkelte, wie es sich gehörte, am linken Ohrläppchen. Ein geschmackvolles goldenes Armband umgab das linke Handgelenk gleich unterhalb der diamantenbesetzten Rolex, und am rechten Handgelenk klirrte, während er lässig den Raum durchquerte, ein weiteres geschmackvolles Goldkettchen.
Sein Auftritt endete vor dem Münzfernsprecher, der sich in der Nähe der Toiletten in einem schmalen Flur im hinteren Teil des Restaurants befand. Er stand vor dem Apparat und ließ die Augen in alle Richtungen schweifen. Jeder Durchschnittsmensch, der sah, wie die Augen von Barry dem Messer herumschweiften und Gewalttätigkeit suchten, würde sich vor Angst in die Hose machen. Die Augen waren tief dunkelbraun und standen so eng beieinander, daß jemand, der es fertigbrachte, mehr als zwei Sekunden lang hineinzuschauen, schwören würde, daß Barry schielte. Aber das tat er nicht. Ein säuberlicher Streifen schwarzen Haars verlief von einer Schläfe zur anderen, ohne jede Unterbrechung über der ziemlich langen und spitzen Nase. Eine massige Braue. Gedunsene braune Haut bildete Halbkreise unter den Augen und verriet ohne jeden Zweifel, daß dieser Mann Alkohol und das flotte Leben liebte. Die verschatteten Augen gestanden zahlreiche Kater, unter anderem. Barry das Messer liebte seine Augen. Sie waren legendär.
Er tippte die Nummer des Büros seines Anwalts ein und sprach schnell, ohne eine Antwort abzuwarten: »Hier ist Barry! Wo ist Jerome? Er hat sich verspätet. Er hätte schon vor vierzig Minuten hier sein sollen. Wo ist er? Haben Sie ihn gesehen?«
Auch die Stimme des Messers war nicht erfreulich. Sie hatte den bedrohlichen Unterton eines erfolgreichen Straßengangsters in New Orleans, der schon viele Arme gebrochen hat und mit Vergnügen einen weiteren brechen würde, wenn man sich zu lange auf seinem Pfad aufhielt oder nicht schnell genug mit den Antworten herausrückte. Die Stimme war grob, arrogant und einschüchternd, und die arme Sekretärin am anderen Ende hatte sie schon viele Male gehört, und sie hatte die Augen und die glänzenden Anzüge und den Pferdeschwanz schon oft gesehen. Sie schluckte hart, kam wieder zu Atem, dankte Gott, daß er am Telefon war und nicht vor ihrem Schreibtisch stand und seine Knöchel knacken ließ, und teilte Mr. Muldanno mit, daß Mr. Clifford das Büro gegen neun Uhr morgens verlassen und sich seither noch nicht wieder gemeldet hätte.
Das Messer knallte den Hörer auf die Gabel und stürmte durch den Flur; dann fing er sich, und als er sich den Tischen und den Gesichtern näherte, verfiel er wieder in seinen betont lässigen Gang. Das Restaurant begann sich zu füllen. Es war fast fünf Uhr.
Er hatte lediglich vorgehabt, mit seinem Anwalt ein paar Drinks zu nehmen und dann mit ihm zu essen, damit sie über seine Bredouille reden konnten. Nur Drinks und Essen, sonst nichts. Die Typen vom FBI beobachteten und belauschten ihn. Jerome hatte Barry erst vorige Woche erzählt, er glaubte, sie hätten seine Kanzlei verdrahtet. Also wollten sie sich hier treffen und in aller Ruhe essen, ohne sich Sorgen um Lauscher und Wanzen machen zu müssen.
Sie mußten miteinander reden. Jerome Clifford hatte in New Orleans fünfzehn Jahre lang prominente Ganoven verteidigt – Gangster, Drogenhändler, Politiker – und seine Erfolgsquote war beeindruckend. Er war gerissen und korrupt, jederzeit bereit, Leute zu kaufen, die sich kaufen ließen. Er trank mit den Richtern und schlief mit ihren Freundinnen. Er bestach die Polizisten und bedrohte die Geschworenen. Er plauderte mit den Politikern und war mit Spenden nicht kleinlich, wenn er dazu aufgefordert wurde. Jerome wußte, wie das System funktionierte, und wenn in New Orleans ein angeklagter Ganove, der über genügend Geld verfügte, Hilfe brauchte, dann fand er unfehlbar seinen Weg zur Kanzlei von Rechtsanwalt W. Jerome Clifford. Und in dieser Kanzlei fand er einen Freund, der von Schmutz lebte und loyal blieb, bis der Fall ausgestanden war.
Doch Barrys Fall lag etwas anders. Er war riesig und wuchs von Minute zu Minute. Die Verhandlung sollte in einem Monat stattfinden und ragte drohend vor ihm auf wie eine Hinrichtung. Es würde sein zweiter Mordprozeß sein. Den ersten hatte er im zarten Alter von achtzehn durchgestanden; ein Staatsanwalt mit nur einem höchst unzuverlässigen Zeugen hatte zu beweisen versucht, daß Barry einem rivalisierenden Ganoven die Finger abgeschnitten und die Kehle aufgeschlitzt hatte. Barrys Onkel, ein hochgeachteter und erfahrener Mafioso, hatte hier und da ein bißchen Geld springen lassen. Die Jury des jungen Barry konnte sich nicht auf einen Spruch einigen, und die Sache verlief im Sande.
Später verbrachte Barry wegen Schutzgelderpressung zwei Jahre in einem gemütlichen Bundesgefängnis. Sein Onkel hätte ihn abermals retten können, aber zu der Zeit war er fünfundzwanzig und reif für eine kurze Zeit im Knast. Sie machte sich gut in seinem Lebenslauf. Die Familie war stolz auf ihn. Jerome Clifford hatte eine milde Strafe ausgehandelt, und seither waren sie Freunde gewesen.
Ein frisches Club Soda und eine Limone erwarteten Barry, als er zur Bar stolzierte und seinen Platz wieder einnahm. Der Alkohol konnte ein paar Stunden warten. Er brauchte ruhige Hände.
Er quetschte die Limone aus und betrachtete sich im Spiegel. Er merkte, daß ein paar Leute ihn anstarrten; schließlich war er in diesem Moment der vielleicht berühmteste wegen Mordes angeklagte Mann im ganzen Land. Vier Wochen bis zum Prozeß, und die Leute starrten ihn an. Sein Gesicht war in sämtlichen Zeitungen.
Dieser Prozeß war etwas völlig anderes. Das Opfer war ein Senator, der erste, behaupteten sie, der je im Amt ermordet worden war. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Barry Muldanno. Natürlich, sie hatten keine Leiche, und das stellte die Vereinigten Staaten von Amerika vor gewaltige Probleme. Keine Leiche, kein Obduktionsbericht, keine ballistische Untersuchung, keine bluttriefenden Fotos, die man im Gerichtssaal schwenken und der Jury unter die Nase halten konnte.
Aber Jerome Clifford war dem Zusammenbruch nahe. Er benahm sich seltsam – verschwand einfach, wie jetzt, blieb der Kanzlei fern, beantwortete keine Anrufe, kam immer zu spät ins Gericht, murmelte ständig vor sich hin und trank zuviel. Er war immer niederträchtig und beharrlich gewesen, aber jetzt schien ihn nichts mehr zu interessieren, und die Leute redeten. Offengestanden brauchte Barry einen neuen Anwalt.
Nur vier kurze Wochen, und Barry mußte Zeit gewinnen. Einen Aufschub, eine Vertagung, irgend etwas in der Art. Weshalb reagierte die Justiz so schnell, wenn alles andere als Eile angesagt war? Er hatte sein Leben in den Randzonen von Recht und Gesetz verbracht und erlebt, wie sich Prozesse jahrelang hinzogen. Sein Onkel war einmal angeklagt worden, aber nach drei Jahren aufreibender Kriegführung hatte die Regierung schließlich aufgegeben. Barry war sechs Monate zuvor angeklagt worden, und peng!, schon findet der Prozeß statt. Das war nicht fair. Romey funktionierte nicht. Ein anderer mußte an seine Stelle treten.
Natürlich hatte der Fall für das FBI eine Menge Löcher. Niemand hatte den Mord gesehen. Es würde ein ordentlicher Indizienprozeß gegen ihn geführt werden, vielleicht sogar mit einem Motiv. Aber niemand hatte tatsächlich gesehen, wie er es getan hatte. Es gab einen Informanten, der leicht zu beirren und unzuverlässig war und vermutlich beim Kreuzverhör in der Luft zerfetzt werden würde, wenn er überhaupt vor Gericht erschien. Die Typen vom FBI hielten ihn versteckt. Und Barry hatte diesen einen, wundervollen Vorteil – die Leiche, den kleinen drahtigen Körper von Boyd Boyette, der, in Beton eingebettet, langsam verrottete. Ohne ihn würde Reverend Roy keinen Schuldspruch erreichen. Das veranlaßte Barry zu einem Lächeln, und er zwinkerte zwei Wasserstoffblondinen an einem Tisch in der Nähe der Tür zu. Frauen gab es massenhaft seit der Anklageerhebung. Er war berühmt.
Reverend Roys Fall stand tatsächlich auf schwachen Füßen, aber das hatte weder seinen lautstarken Predigten vor laufenden Kameras Abbruch getan noch seinen vollmundigen Andeutungen, daß der Gerechtigkeit sehr bald Genüge getan sein würde, noch seinen prahlerischen Interviews mit jedem Journalisten, der sich hinreichend langweilte, um ihn zu befragen. Er war ein frommer Bundesanwalt mit öliger Stimme und ledrigen Lungen, widerlichen politischen Ambitionen und mit donnernder Stimme vorgetragenen Ansichten zu allem und jedem. Er hatte seinen eigenen Presseagenten, einen total überarbeiteten Mann, der dafür zu sorgen hatte, daß der Reverend ständig im Rampenlicht stand, damit eines nicht allzu fernen Tages die Öffentlichkeit darauf bestehen würde, daß er ihr im Senat der Vereinigten Staaten diente. Wohin ihn Gott von dort aus vielleicht führen würde, wußte nur der Reverend.
Barry zermalmte sein Eis bei der widerwärtigen Vorstellung, wie Roy Foltrigg seine Anklageschrift vor den Kameras schwenkte und alle möglichen Prophezeiungen über den Triumph des Guten über das Böse heraustrompetete. Aber seit der Anklageerhebung waren sechs Monate vergangen, und weder Reverend Roy noch seine Verbündeten, die Leute vom FBI, hatten die Leiche von Boyd Boyette gefunden. Sie folgten Barry Tag und Nacht – wahrscheinlich warteten sie gerade jetzt direkt vor der Tür, als wäre er so dämlich, hier zu essen und anschließend nur so zum Spaß einen Blick auf die Leiche zu werfen. Sie hatten jeden Säufer und Gammler bestochen, der vorgegeben hatte, Informationen liefern zu können. Sie hatten Seen und Teiche abgelassen; sie hatten Flüsse durchkämmt. Sie hatten sich Durchsuchungsbefehle für Dutzende von Gebäuden in der Stadt verschafft. Sie hatten ein kleines Vermögen ausgegeben für Bagger und Bulldozer.
Aber Barry hatte sie. Die Leiche von Boyd Boyette. Er hätte sie gern woanders hingebracht, aber das konnte er nicht. Der Reverend und seine Engelsscharen beobachteten ihn.
Clifford war jetzt eine Stunde überfällig. Barry zahlte für zwei Club Sodas, zwinkerte den Wasserstoffblondinen in ihren Lederröcken zu und verließ, Anwälte im allgemeinen und den seinen im besonderen verfluchend, das Lokal.
Er brauchte einen neuen Anwalt, einen, der auf seine Anrufe reagierte und sich mit ihm auf ein paar Drinks traf und ein paar Geschworene ausfindig machte, die sich kaufen ließen. Einen wirklichen Anwalt!
Er brauchte einen neuen Anwalt, und er brauchte eine Vertagung oder einen Aufschub oder eine Verschleppung, irgend etwas, das diese Sache so verlangsamte, daß er Zeit zum Nachdenken fand.
Er zündete sich eine Zigarette an und wanderte gemächlich die Magazine Street zwischen Canal und Poydras entlang. Die Luft war dick. Cliffords Kanzlei war vier Blocks entfernt. Sein Anwalt wollte eine schnelle Verhandlung! So ein Idiot! Niemand in diesem Rechtsstaat wollte eine schnelle Verhandlung, aber dann kam W. Jerome Clifford und drängte darauf. Noch keine drei Wochen zuvor hatte Clifford erklärt, sie sollten zusehen, daß der Prozeß so schnell wie möglich stattfände, weil sie keine Leiche hatten und damit keinen Fall, und so weiter und so weiter. Und wenn sie abwarteten, würde die Leiche vielleicht gefunden werden, und weil Barry so ein hübscher Tatverdächtiger war und es sich um einen Sensationsprozeß handelte, bei dem die Anklagevertretung tonnenschwer unter Druck stand, und da Barry den Mord tatsächlich begangen hatte und ganz eindeutig schuldig war, sollten sie unverzüglich vor Gericht gehen. Das hatte Barry schockiert. Sie hatten hitzig diskutiert in Romeys Büro, und seither war es nicht mehr so wie früher gewesen.
Im Verlauf dieser Diskussion vor drei Wochen war ein ruhiger Moment eingetreten, und Barry hatte sich seinem Anwalt gegenüber damit gebrüstet, daß die Leiche nie gefunden werden würde. Er war schon eine Menge Leichen losgeworden und wußte, wie man sie versteckte. Boyette war ziemlich schnell versteckt worden, und obwohl Barry den kleinen Kerl gern irgendwoanders hingebracht hätte, war er dennoch guter Dinge und hegte nicht die geringsten Befürchtungen, daß Roy und die Fibbies ihm in die Quere kommen könnten.
Barry kicherte leise vor sich hin, während er die Poydras entlangschlenderte.
»Und wo ist die Leiche?« hatte Clifford gefragt.
»Das wollen Sie bestimmt nicht wissen«, hatte Barry erwidert.
»Doch, ich will es wissen. Die ganze Welt will es wissen. Also los, verraten Sie es mir, wenn Sie den Mumm dazu haben.«
»Das wollen Sie nicht wissen.«
»Doch. Los, sagen Sie es mir.«
»Es wird Ihnen nicht gefallen.«
»Sagen Sie es mir.«