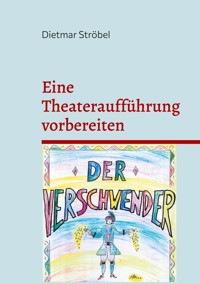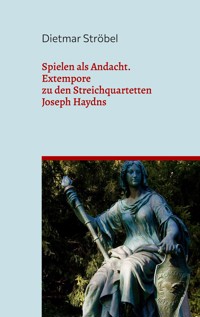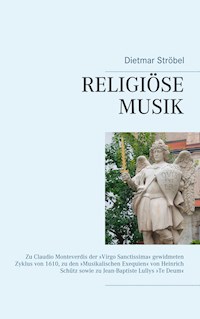9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Der Komponist und sein Amt" eröffnet die Stücke "Zur erwachsenen Musikkultur der Frühen Neuzeit" mit einem Blick auf einige Komponisten im extensiven Sinn. Unter dem Arbeitstitel "Singen - Spielen - Hören" setzt der Autor damit seine Musikgeschichte für Musikpädagogen fort. Ging es in der Musik des Mittelalters (siehe "Ausgerechnet Mittelalter?!", Norderstedt 2010) um die "Kindheit und Jugend unserer Musikkultur", so geht es nun, in der Epoche der Frühen Neuzeit (1500-1800), um deren vergleichsweises Erwachsenenalter. Die sog. Entwicklung unserer Musik wird dabei weiterhin auf der Grundlage eines Begriffs von Musik als einer menschlichen Tätigkeit und aus einem sozialwissenschaftlichen und anthropologischen Interesse heraus überdacht und interpretiert. Da in der anzusprechenden Epoche das Hervortreten von Komponisten als große Persönlichkeiten ein wesentliches Charakteristikum bildet, erscheint es dienlich, Einblicke in Lebensgeschichten einiger Komponisten zu nehmen, hier in die von Orlando di Lasso, Michael Praetorius, Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste Lully, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Joseph Haydn sowie in die sozusagen halbe von Wolfgang Amadeus Mozarts Zeit in Wien. In den siebeneinhalb bio-graphischen Durchgängen tritt dabei nicht zuletzt die zentrale Funktion des Amtes (z. B. eines Kapellmeisters oder Kantors) für die epochale Entwicklung der Musik als ein menschliches Tätigsein hervor: Der "musikalische Mensch" macht sich zu einem über sich als musikalisch Tätigen in wachsender Selbstverantwortlichkeit Verfügenden und damit zu einem kulturell und musikalisch vergleichsweise Erwachsenen. Dies gilt für den solches Tätigsein aus dem Amt des Kapellmeisters oder Kantors heraus entwerfenden Komponisten ebenso wie für den solches sich im Mitvollzug aneignenden Auftraggeber und Adressaten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Siebeneinhalb biographische Diskurse über Lasso, Praetorius, Monteverdi, Schütz, Lully, Bach, Haydn und Mozart (in Wien)
INHALT
»KOMPONIEREN QUA AMT« – Oder: Worum es hier auch geht
ORLANDO DI LASSO / ORLANDE DE LASSUS – Oder: Die »Entdeckung« des Komponisten
MICHAEL PRAETORIUS – Oder: Die Selbstbevollmächtigung des Komponisten
CLAUDIO MONTEVERDI – Oder: Der Zwang zur Selbstrechtfertigung im Amt
HEINRICH SCHÜTZ – Oder: Die Erfüllung des Amtes durch musikalische und persönliche Autorität
JEAN-BAPTISTE LULLY – Oder: Der Komponist als »amtlicher« Schöpfer einer Nationalen Musik
JOHANN SEBASTIAN BACH – Oder: Es ist die Persönlichkeit des Komponisten, die das Amt für sich und seine »Vollendung« in Anspruch nimmt.
JOSEPH HAYDN – Oder: Der selbst-betriebene Werdegang zur »Autonomie« durch das Amt hindurch
MOZART IN WIEN – Oder: Der »abgeschnittene« Versuch, den Komponisten als ein bürgerliches »Amt« zu installieren
NACHGEDANKE UND ÜBERLEITUNG
SCHRIFTENVERZEICHNIS
»KOMPONIEREN QUA AMT«
Oder: Worum es hier auch geht.
Dass ausübende Musiker das, was sie tun, gewissermaßen im Rahmen des Hergebrachten und Tradierten auch „neu“ fassen, das gehörte eigentlich stets zum Selbstverständnis des Musikers, in Europa vor allem seit dem 10. Jahrhundert. Dass einige dies „besser“ konnten als andere, das zeichnete sie aus. Und besonders im sog. Späten Mittelalter, in welchem der Gesichtspunkt des einzigartig heraushebenden Ausstattens (einer Situation eines Auftraggebers) in den Mittelpunkt rückte, gewannen diese Musiker – in der Regel damals Sänger, aber auch schon einige Organisten – an Ansehen und Bedeutung. Trotzdem realisierten sich die meisten weiterhin als praktische Musiker. Diejenigen, die ihr Tätigsein fortschreitend umfassender (und begründeter) zu bearbeiten lernten, wurden als z. B. „Hofkomponisten“ für begrenzte Aufgaben angestellt; viele wechselten dabei – ähnlich den Baumeistern der Schlösser und Kathedralen – öfters den Auftraggeber.
Dass Musiker „komponierten“ und Komponisten als ausübende Musiker Dienst taten, das blieb auch so nach dem Epochenwechsel um 1500. Auch in Mantua in der Zeit um 1600 war Monteverdi nicht der einzige, der Entwürfe zu einem neuen Singen vorlegte (und drucken ließ); neben ihm betätigten sich in der Hofkapelle auch andere als Komponisten; so (vor allem) sein Vorgesetzter, Giaches de Wert, aber auch jener Giovanni Gastoldi (den wir, chorerfahren, von seinen Balletti kennen) oder Benedetto Pallavicino; letzterer wurde erst einmal als de Werts Nachfolger Monteverdi vor die Nase gesetzt. Und auch in der Hofkapelle der Eszterházys entwarf etwa der Geiger und Konzertmeister Luigi Tomasini neben Haydn sowohl Streichquartette, Sinfonien und Konzerte als auch Stücke für das Baryton.
Doch machte sich nach 1500 (unserer musikgeschichtlichen Auffassung nach) mehr und mehr ein neues Moment bemerkbar: Den Ausstattungsgedanken erweiterten die situativ Ausgestatteten u. d. h. die vor allem adeligen und städtischen Auftraggeber unmerklich um ein „Sich“. Nicht nur ging es darum, ihre Situation als Lebenssituation (z. B. als Gottesdienst – Liturgie galt ja lange als von Gott eingesetzt – oder festliche Tafel) mit einem möglichst kunstvollen Singen und Spielen „ad usum“ auszustatten, sondern implizit immer mehr darum, gewissermaßen sich selbst als Person mit einem entsprechenden musikalischen Tätigsein ausgestattet zu erleben. In einem solchen Singen oder Spielen, das mehr und mehr in ihrem Namen geschah, strebten sie (durchaus unwillkürlich) zu einem persönlichen Mitvollziehen sowie dahin, sich als z. B. einen Text in kunstvoller Art Selber-Aussprechende vertreten zu sehen. Im Mit-Singen (also Hören) tendierten sie immer weitergehender dazu, sich selbst „als…“, z. B. als „geistvoller und kunstfertiger Mensch“ unter den Anderen, zur Geltung gebracht zu erleben.
Der „Entdeckung des Ich“ lief also (mit der Entwicklung eines personalen Selbstbewusstseins in der Frühen Neuzeit) eine solche des „Sich“ parallel.1 Damit verbunden war das Hervortreten des Musikers in der Weise einer Dienstleistung ad personam für den Auftraggeber und darin u. U. jener der Erfindung eines neuen, diesem adaequaten Singens und/ oder Spielens. Dass dabei oft genug der/die Nur-Ausführende als unmittelbar Vermittelnde(r) oft mehr Meriten einstrich als der Erfinder solchen Singens und/oder Spielens – denken wir nur an die Sängerinnen und Sänger im Bereich der Oper –, bestätigt ja den hier angedeuteten neuen und persönlichen Wirkungszusammenhang. Damit drängte sich neben dem Mit-Singen und dem Mit-Spielen auch Stück für Stück eine dritte Verhaltensweise in den Vordergrund, die des quasi selbstausdrücklichen musikalischen Hörens.
Begleitet wurde solcher Wandel von dem der organisatorischen Bedingungen, so vom allmählichen Zusammenschluss der kirchlichen Hofkapelle mit dem instrumentalen Ensemble (oft erst einmal der Trompeter) zur „Hofmusik“. Dies hatte zur Folge, dass auch der (Hof-)Komponist und der musikalische Leiter („Singmeister“) der Hofkapelle in einer Personalunion verschmolzen.2 Doch konnte der doppelte Beruf, einerseits „Hofcomponist“ und anderseits „Director der Hofmusic“ (wie im Falle Lassos) im 16. Jahrhundert und oft darüber hinaus im Wortlaut der Anstellungsverträge noch gegenwärtig sein. Wie Reimer anmerkt, gab es aber im ersten Jahrhundert der Epoche noch keine spezifische Festlegung der Erwartung an den Amtsträger jenseits allgemeinen Kunstanspruchs und einer Gebrauchsorientierung.3 Im städtischen Bereich können wir das Heranziehen der Stadt- oder Ratsmusiker u. a. für die Kirchenmusik der Kantorei hier anschließen, die sich erst im 17. Jahrhundert durchsetzte und auch hier bis zu Bachs Mühlhausener Zeit hin4 für Schwierigkeiten sorgte.5
Die neue Personalunion beförderte sicher auch die Erwartung der Auftraggeber, und diese war eingebunden in eine Tendenz zur sozialen Exklusivität, vor allem im höfischen Bereich.6 Zwar blieb es grundsätzlich bei den Dienst- und Amtsverhältnissen, wie sie seit dem späten Mittelalter zwischen dem Landesherrn und den Amtsträgern bestanden hatten; doch zeigt sich der Wandel in der Zweckbestimmung u. a. sowohl in den zunehmenden inhaltlichen Erwartungen, die der Dienstvertrag festhielt, als auch z. B. in der Art der Bezahlung der mit ihm angestellten Musiker, wo die mittelalterliche Bepfründung durch eine Besoldung direkt durch den Auftraggeber selbst abgelöst erschien.7 Noch die bayerische Hofmusik unter Lasso wurde (sozusagen als Übergang) durch eine Besteuerung der Klöster finanziert. Anderseits sind wir über die intensive Rezeption der Entwürfe Lassos durch den bayerischen Herzog sowie über das sehr enge Verhältnis Lassos zu dessen Nachfolger Wilhelm (in Landshut) durch die Briefe Lassos gut unterrichtet. Sie belegen das wachsende Selbstbewusstsein des Komponisten als Voraussetzung für ein solches im musikalischen Tätigsein auf Seiten seiner Auftraggeber, das sich im Entwerfen des Singens und Spielens niederschlug.
Es scheint nur folgerichtig, dass jener (nach wie vor auch) ausübende Musiker, der mit dem, was er als Singen und Spielen erfand, in die persönliche Verfassung des Auftraggebers (zunehmend auch als Mensch und nicht nur als Funktion) eingriff, in ein festes und geordnetes Verhältnis gesetzt wurde. Dieses war ein „Amt“, das Amt des „Kapellmeisters“, des umfassend „Verantwortlichen für“, das wir als ein Amt eines „Kapellmeister-Komponisten“ verstehen können. Solches Amt – bis um 1500 noch situativ bestimmt und grundsätzlich von Geistlichen als Leiter jenes Sing-Kollegiums ausgefüllt, das für die Musik in der Kapelle zu sorgen hatte –, impliziert mit der Erfüllung bestimmter Aufgaben „im Namen“ des Fürsten oder (auch städtischen) Auftraggebers eine Handlungsvollmacht; es ist eben nicht nur mit bestimmten Pflichten, sondern (quasi selbstverständlich) auch implizit mit gewissen Rechten wechselnder bzw. ungewisser Reichweite ausgestattet, sprich: mit unmittelbaren Wirkungsmöglichkeiten auf andere verbunden. Das nun nach und nach vor allem weltliche Amt des Kapellmeisters, in das in der Regel – je nach Bedeutsamkeit des fürstlichen oder städtischen Arbeitgebers – nur die Besten im Bereich eben auch der Erfindung hervorragenden und neuen Singens und Spielens gelangten, bedeutet de facto die Grundlegung (= „Erfindung“) des Kapellmeister-Komponisten als Beruf per se. Dies gilt im ähnlichen Maße für den Kantor einer (protestantischen) Stadt, der zwar als (dritter) Lehrer an der Lateinschule der Stadt zu unterrichten hatte, gleichzeitig jedoch nicht nur für (u. a.) die „Musica“ als Unterrichtsfach, sondern auch für die Organisation des kunstmäßigen (kirchlichen8) Singens zuständig wurde; auch dieses war als ein situationsgerechtes und gleichzeitig als ein die einzelnen und dabei wohl vor allem die gebildeten tonangebenden Glieder der „Gemeinde“ zu Mit-Singenden erhebendes Singen zu entwerfen.
Es ist keine Frage, dass solches „Wirken auf“ auch die Entwicklung der selbstbewussten Persönlichkeit des Komponisten voraussetzte bzw. vorantrieb. Die Er-füllung des Amtes durch die Persönlichkeit des Komponisten bzw. umgekehrt die treibende Funktion des Amtes für die Herausbildung der Persönlichkeit u. a. des Kapellmeister-Komponisten stellt eine der spannenden Aspekte dar, die wir in den folgenden Skizzen mit anzusprechen haben.
Komponieren als fortschreitend selbstverantwortliche „Dienstleistung für“, die sozusagen im Amt geregelt erscheint, das nach und nach aber kraft der (durch das Amt mit-gebildeten) Persönlichkeit des Amtsinhabers gleichsam ausgeweitet und übersprungen, ja tatsächlich hinter sich gelassen wird, u. a. indem der Komponist sich immer konkreter an dem Einzelnen als Menschen innerhalb einer sich (auch kraft musikalischen Tätigseins bildenden!) bürgerlichen Öffentlichkeit orientiert, – dieses bildet eine wesentliche Voraussetzung der Entwicklung der Musik der Frühen Neuzeit. Die ungeheuer reiche und vielseitige Entwicklung der Musik der Hochkultur in Europa zwischen 1500 und 1800 basiert unmittelbar auf der Einführung des Amtes dieses Kapellmeisters und Komponisten in einer Person und damit de facto eines öffentlichen »Amtes des Komponisten«. Es erscheint deshalb nicht verwunderlich, dass wir unsere Stücke „Zu einer »erwachsenen« Musik der Frühen Neuzeit“ mit biographischen Skizzen zu einigen jener Persönlichkeiten eröffnen, die dieses Amt in besonderer Weise ausgefüllt haben.
An den siebeneinhalb ausgewählten Werdegängen derer, die die Musik der Frühen Neuzeit entwarfen, wollen wir (zumindest auch!) einige Aspekt einer Geschichte des „Komponisten“ im ausdrücklichen Sinn skizzieren: von der „Entdeckung“ (für die hier Lasso eintritt) bis zum (vorläufig abgeschnittenen) Versuch (im Zusammenhang Mozart), den Komponisten unabhängig von einem quasi-staatlichen Amt als bürgerliche Institution zu installieren. Konstitutiv für die Entwicklung ist das Amt des „Kapellmeisters“, ist – genauer gesagt – das Verhältnis des Komponisten je zu diesem. „Amt“ bezeichnet die Be-amtung des ein Singen, Spielen und/oder Hören Entwerfenden im Zuge einer Teilgesellschaft (in der Regel als Kantor oder Hofkapellmeister) mit einer mehr oder weniger definierten Aufgabe in dieser und einer gewissen Vollmacht, diese zu bewältigen. Mit dem Eintritt in das Amt ist der Amtsinhaber „im Namen“ des Auftraggebers tätig! Die wesentliche Entwicklung besteht für uns vor allem in der wachsenden Aneignung des Amtes durch die Persönlichkeit des Komponisten, in dessen wachsender Selbstbevollmächtigung: Immer entschiedener wird das Amt (möglicherweise, d. h. dort, wo dem Inhaber dies aufgrund seiner Ausnahmefähigkeiten möglich ist!) real durch die Persönlichkeit des Komponisten definiert, bis es als bürgerliche Institution gleichsam in dieser aufgeht. Doch geschieht dies (durch Mozarts frühen Tod) real erst jenseits der Epochengrenze, erstmals mit Beethoven und (im Kreis einer bürgerlichen Mittelschicht) wohl auch mit Schubert, wo eine begrenzte Bürgerlichkeit „sich“ (in Einsicht seiner Leistung für sie!) einen Komponisten „leistet“; doch bezeichnet dies den Beginn einer neuen Epoche.
Für das „Er-füllen“ des Amtes und gleichzeitig für ein Herauswachsen aus ihm steht vor allem Joseph Haydn; ihn habe ich hier als siebenten Werdegang eingesetzt. Damit blieb für Mozart gleichsam der (nur noch halbe) Platz „dahinter“: als der, der das Amt nicht mehr erreichte, wohl vor allem aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur, einer (beginnenden) dem Amt als solchem entgegenstehenden Individualität. Mozart steht sozusagen „jenseits des hergekommenen Amtes“.
Die Entwicklung des Komponisten (durch das und im Amt, ja als Amt) ist als ein Spiegel der Entwicklung des europäischen Menschen zur Selbstbestimmung hin zu sehen, als Entwicklung von der Renaissance hin zur quasi vollendeten Aufklärung.9 Solche Entwicklung betrifft selbstverständlich und in gleicher Weise auch den sog. Adressaten des kompositorischen Entwerfens, den Mit-Singenden, Mit-Spielenden und also den musikalisch als hörend Tätigen.10 Doch können wir grundsätzlich auch bei dem/den Adressaten eine „Arbeit an sich selbst“ mit dem Ziel einer „Verfügung über sich“ in Riten und Handlungen voraussetzen. Bezogen auf die mit der Frühen Neuzeit zunehmenden Selbstzeugnisse formuliert van Dülmen11:
»Seit dem 16. Jahrhundert nehmen die selbstbezogenen Reflexionen beträchtlich zu. Dies hat nicht nur mit der Zunahme von Schriftlichkeit zu tun, sondern vor allem auch mit der schulischen Erziehung, die die Selbstreflexion fördert, vor allem seit die bürgerliche Wertewelt maßgebend Einfluss auf die Erziehungsprogramme ausübt. Schließlich lässt sich in diesen selbstreflexiven Texten der Neuzeit [– und auch jene des Mit-Singens und Mit-Spielens gehören zu solchen „Texten“! –] ein beträchtlicher Säkularisierungstrend erkennen. Mit der Emanzipation von kirchlich-religiöser Tradition und Kultur vollzieht sich eine Befreiung des Ichs, das erstmals eigenständigen Wert erhält. Indem die religiös-rituelle Hoffnung auf ein Jenseits abnimmt, wird der diesseitige Selbstwert des Menschen und damit die Verpflichtung und Möglichkeit, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, stärker. Die Befreiung von Tradition ist ein Akt der Selbstfindung. An die Stelle der Überwindung der Sünde tritt die Selbsterkenntnis als zentrale Aufgabe des Menschen. / Alle Selbstbezogenheit und Selbstreflexion wurde aus aufklärerischer Perspektive als Zugewinn an Humanität positiv bewertet, und zwar für alle gleichermaßen.«
Mit solcher Selbstbestimmung als einer Art künstlerischer(!) „Verantwortung für sich“ umzugehen, ist ebenso epochal zu entwickeln und lebensgeschichtlich je zu lernen; gleichzeitig ist sie zum einen von Anfang an der manipulativen Beeinflussung durch (nicht-künstlerische) Interessen – wir sprechen dabei oft von wechselnden „Moden“ – ausgeliefert. Doch erfolgt das künstlerische „Erwachsenwerden“ des Adressaten zum zweiten nicht überall im gleichen Tempo. Hier gilt es in der Frühen Neuzeit vor allem den Unterschied zwischen Hof und Stadt zu berücksichtigen. Zum dritten bildet musikalisches Tätigsein nur eine Möglichkeit für den Menschen der Frühen Neuzeit, sich „als Persönlichkeit“ zu formen und zur Geltung zu bringen; denken wir nur an die konkurrierenden Bereiche der Bildende Kunst, der Architektur oder Gartenkunst, vor allem auch an die Leidenschaft des Sammelns u. a.
Zugegeben sei, dass die Auswahl der siebeneinhalb Werdegänge durchaus auch subjektiven Voraussetzungen folgt: Bach steht mir in meiner Spiel- und Hörerfahrung näher als Händel, Mozart näher als Haydn, weshalb ich ihn nicht einfach durch letzteren ersetzen konnte; er blieb mit seinem Wiener Jahrzehnt als der zusätzliche „halbe“ Werdegang in der Reihe der Skizzen. Doch auch die (persönliche) Einschätzung objektiver Gegebenheiten war bzw. ist maßgebend: aus transalpiner Sicht erscheint Lasso „zentraler“ als Palestrina, von Schütz in einem spezifisch deutschen Zusammenhang ganz zu schweigen. Dass an Monteverdi kein Weg vorbeiführt, dürfte so einsichtig sein wie dies umgekehrt bei Lully, den in der französischen Musik bis heute umstrittenen „fremden“ Egomanen, gerade nicht der Fall ist. Doch hat den Autor sein Sich-Bemächtigen des Amtes und des „Geschmacks“ der Adressaten (einer ganzen Nation) gereizt, seine Lebensgeschichte hier aufzunehmen.
Der Rede kurzer Sinn: Die siebeneinhalb Essays beanspruchen keine Vollständigkeit; aber sie stellen mit einiger Absicht geographisch und zeitlich auseinandergerückte Pfeiler einer Entwicklungssicht dar, die mit vielen weiteren Biographien zu verdichten, zu verdeutlichen und zu differenzieren wäre. Diese Entwicklung, die Substitution des Amtes durch die Persönlichkeit des Komponisten, führt im 19. Jahrhundert (freilich aus ganz anderer Perspektive) zur Teilung des Amtes, hie Komponist, dort Kapellmeister. Auch wenn bis in das 20. Jahrhundert immer wieder persönliche Versuche unternommen wurden, beide Ämter sozusagen zu vereinen (um, salopp gesagt, im zunehmend kapitalistisch strukturierten bürgerlichen Musikbetrieb das eine zu betreiben und von dem anderen zu leben), so folgte doch in der Regel ein eher einseitiges „Überleben“ daraus, entweder als Komponist (wie bei Richard Strauss) oder als Interpret (wie beispielshalber bei Gustav Mahler und schließlich auch noch bei Wilhelm Furtwängler). Für den Komponisten blieb und bleibt dann aber immerhin das Amt an einer der seit dem 19. Jahrhundert nach und nach gegründeten Ausbildungsstätten für Musikberufe.
*
Auch der vorliegende Band will Ausschnitt einer »Musikgeschichte für Musikpädagogen« sein; doch wollen wir (Autor und LeserIn) nicht eine Musikgeschichte (als sie selbst) uns vorlegen. Vielmehr thematisieren wir, salopp gesagt, „was wir eigentlich bereits kennen“, was uns also an Ausschnitten historischer Musik als Bestandteil unserer Kultur vertraut ist oder über mediale Vermittlung vertraut sein könnte. Von daher sind keine neuen Erkenntnisse zu den sog. Gegenständen der landläufigen Musikgeschichte zu erwarten. Vielmehr versuchen wir das, was wir kennen, aus einem eigenen Interesse heraus zu thematisieren, um an ihm mittels eines Diskurses (mit uns selbst) humanwissenschaftliche Einsicht zu gewinnen. Unser Interesse ist ein musikpädagogisches: uns etwas über den Menschen als musikalischen u. d. h. als musikalisch Tätigen zu verdeutlichen.
Die hier versammelten Essays versuchen, ohne Notenbeispiele auszukommen; sie beinhalten keine musikalischen Analysen (im engeren Sinn). Solche werden in den folgenden Teilbänden unerlässlich sein. Stattdessen tritt ein charakteristischer Zug unserer Arbeit als Musikpädagogen hervor, der einer Interpretation dessen, was als (scheinbar „wahre“) Information vorliegt. Das, was wir von Lasso oder Schütz oder Haydn wissen, versuchen wir, uns in einen unserem Interesse entsprechenden Interpretationszusammenhang zu übertragen. Dabei greifen wir in der Regel nur auf die Literatur zurück, die wir zur Hand haben, um das Gelesene in einem eigenen Verstehenszusammenhang uns darzustellen.
Dieser wird von einem musikpädagogisch brauchbaren Musikbegriff getragen12, dem es nicht (in erster Linie) um das Kunstwerk (per se), sondern um Musik als menschliche Tätigkeit geht, der aber anderseits nur an den Dokumentationen solchen Tätigseins, vereinfacht: an den überlieferten musikalischen Entwürfen, gebildet werden kann. Trotzdem oder gerade deshalb verstehen sich auch diese Skizzen als ein Beitrag zu einer Musikgeschichte als einer „Humangeschichte“, als Geschichte des Menschen als Kulturwesen innerhalb einer Kultur, der sich unsere Vorfahren als einer sog. Abendländischen (und heute im steilen Abtreten begriffenen) noch zugehörig fühlen konnten.
Vielleicht erschließt sich dem Leser das Selbstverständnis der Essays im Arbeitsvorhaben SINGEN → SPIELEN → HÖREN und besonders im vorliegenden ersten Teilband am ehesten vom Begriff der »Ostense« her. Das lateinische »ostendere« bedeutet soviel wie ausstellen, zeigen, auch sichtbar machen.13 Gerade die hier folgenden Essays zu den siebeneinhalb Werdegängen von Komponisten der Frühen Neuzeit möchten als Beispiele dafür verstanden werden, mit sich selbst ähnlich zu verfahren: sein hie und da Gelesenes aus einem eigenen Interesse zu interpretieren, um mit sich in einen Diskurs „über…“ einzutreten. Denn die biographischen Skizzen wollen zwar (auch) über die angesprochenen Komponisten informieren, aber noch wesentlicher sollen sie dazu anregen, sich aus einem eigenen Berührtsein eine persönliche Meinung zu bilden. Sie verstehen sich – im Zusammenhang eines Vergegenwärtigungsbemühens zur Musik der Frühen Neuzeit in Europa – jeweils als eine Art stets nur momentaner Selbstvergewisserung über das eigene Bild von Menschen, die gleichsam zu unserem Leben gehören und mit denen wir (als musikalisch Gebildete und Musikpädagogen) möglicherweise täglichen Umgang pflegen.
Zur Beschreibung musikalischen Tätigseins verwende ich einige ungewöhnliche Wortbildungen, an die man sich gewöhnen muss. So z. B. „Mit-Singen“ – stets mit Bindestrich! – als Ausdruck für ein spezifisch textgespeistes musikalisches Hören oder „Vorwurf“ als Kennzeichnung von Komposition als Vorlage und Entwurf für das damit entworfene musikalische Tätigsein, dessen Aktualisierung noch das eigentliche „Werk“ in der Musik der Frühen Neuzeit darstellt.14 (Mit dem oft abrupten Wechsel im Tempus, einem dem Diskurscharakter geschuldeten Changieren zwischen einem feststellenden und eine [uns heute so erscheinende] Sachlage beschreibenden Präsens und einem erzählenden Praeteritum, bittet der Autor wohlwollend umzugehen.)
Dietmar Ströbel …/2017/2023
1 Vgl. den Abschnitt „Entdeckung des Selbst“ im großen Sammelband: Richard van Dülmen (Hrsg.), Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Köln bzw. Darmstadt 2001, Ss. 109-266.
2 Vgl. Erich Reimer, Die Hofmusik in Deutschland 1500-1800. Wandlungen einer Institution, Wilhelmshaven 1991, S. 77 ff.
3 Vgl. ebenda, S. 81.
4 Vgl. Bachs Probleme in Mühlhausen, in: Konrad Küster, Der junge Bach, Stuttgart 1996, S. 163 ff.
5 In Osnabrück wurde für die Bezahlung u. a. der Ratsmusiker in diesem Zusammenhang 1636 durch einen Ratsherrn und seine Frau extra eine Stiftung ins Leben gerufen. Vgl. hierzu Franz Bösken, Musikgeschichte der Stadt Osnabrück, Regensburg 1937, S. 137 ff.
6 Vgl. Reimer, S. 17.
7 Vgl. Reimer, S. 62 ff.
8 Aufgrund der engen Verflechtung von religiösem und weltlichem Leben lässt sich die Aktivität eines Kantors nicht auf den kirchlichen Bereich beschränken, denken wir nur an die Ratswechselkantaten Johann Sebastian Bachs.
9 Sicher nimmt das „Amt“ auch für die Zentipetalität menschlichen Strebens in der Frühen Neuzeit eine wesentliche Rolle ein. Es sorgt für Einheitlichkeit, entwirft Wege der Verwirklichung, ermächtigt die Amtsinhaber und befugt sie zur Ermächtigung der Adressaten, setzt aber gleichzeitig den Rahmen der wesentlichen Interessen…
10 Der etwas unglückliche Hilfsbegriff des „Adressaten“ soll hier keinesfalls auf ein Verhältnis kommunikativer Art zwischen Ausführenden und Hörenden verweisen; im Zusammenhang einer tätigkeitsorientierten Darstellung gehen wir grundsätzlich von einer Parallelität der musikalischen Vollzüge aus. Vgl. auch D. S., Musik als Tätigsein. Zur Einführung in eine Musikgeschichte für Musikpädagogen am Beispiel der »Weihnachtshistorie« von Heinrich Schütz, in: Ders., Menschensmusik. Vier Versuche, in eine pädagogisch brauchbare Vorstellung von Musik einzuführen, Norderstedt 2008, S. 42-94.
11 Richard van Dülmen, Einleitung, in: Ders. (Hrsg.), Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Köln bzw. Darmstadt 2001, S. 5. Zur von van Dülmen angedeuteten emanzipatorischen Entwicklung vgl. im Bereich der Musik: D. S., Seinen Glauben selber singen…, Norderstedt 2017.
12 Vgl. (wie o. bereits angemerkt) den Schütz-Essay in: D. S., Menschensmusik…
13 Zum Begriff der »Ostense« vgl.: Vladimir Karbusicky, Systematische Musikwissenschaft, München 1979, S. 179 ff.
14 Eine Generaleinleitung zum Arbeitsbereich »SINGEN → SPIELEN → HÖREN« ist für den Teilband SINGEN vorgesehen.
ORLANDO DI LASSO / ORLANDE DE LASSUS
Oder: Die »Entdeckung« des Komponisten
Man scheint sich einig: Orlando di Lasso15 gilt als einer der Großen der Musikgeschichte. Doch woran misst sich (seine) Größe? Kaum jemand kann „große (= bedeutende) Werke“ von ihm als im heutigen Musikbetrieb zu hörende oder gar selbst gehörte angeben. Wie auch? Es gibt sie nicht; und es gibt sie nicht, weil es sie in dieser Zeit noch nicht gibt.16 Zwar hat auch Lasso Messen hinterlassen, in der Quantität etwa Sonaten oder Streichquartetten der Klassik vergleichbar; dazu mindestens drei Passionen aus dem Alterswerk; und zwar sind von den Prophetiae Sibyllarum (von 1560/63) bis zu den Lagrime di San Pietro (1595) einige zusammengehörende Gruppen als außergewöhnlich geltender Kompositionen auf uns gekommen. Doch zählen seine Kompositionen eher im Dutzend: unter dem Überlieferten finden sich über 200 italienische Madrigale, über 140 französische Chansons, über 90 deutsche Liedsätze, eine Vielzahl lateinischer Motetten, von denen seine Söhne 1604 (im Magnum opus musicum) post mortem 516 herausgaben, über 70 Messen, 100 Magnificat-Vertonungen und anderes mehr.
Damit ist aber gleichzeitig ein zweites Problem angesprochen. Während für manchen seiner Zeitgenossen im 16. Jahrhundert ein bestimmter, dem Wirkungsort verpflichteter Stil sich uns heute einprägt – man denke etwa an eine Römische oder eine Venezianische „Schule“, den jede der auch bei ihnen überaus zahlreichen Kompositionen repräsentiert, stellt sich Lasso uns als Universalist dar, der (nach Moser17) „in Antwerpen wie in München, zu Paris wie am Tiber geistig beheimatet erscheint, da er die Verkehrs- wie die Tonsprachen dieser Brennpunkte gleich spielend beherrschte“. Wer einige Messen und Motetten von Palestrina gesungen hat, der kann sich ein Urteil über Palestrina als historische Tatsache zu bilden versuchen; wer einige Messen von Lasso gesungen hat, der kann dies mitnichten: er muss wenigstens noch einige Madrigale und Chansons und vor allem einige Motetten zur Kenntnis nehmen. Nichts dokumentiert solche Vielseitigkeit besser, als die bis auf uns gekommene Unsicherheit, ihn zu nennen: „Die Schreibform des Namens und Vornamens schwankt zwischen lat., frz. und ital. Fassung; die letztere gebrauchte Lasso selbst, namentlich in seinen erhaltenen Briefen an den herzoglichen Gönner, Wilhelm V. von Bayern18, aus mittlerer Zeit. Seit etwa 1562 wählte man vielfach auch nur den Vornamen Orlando (Orlandus, Orlande, seltener Roland).“19
Aber noch ein Drittes ist zu bedenken: Lassos Jahrhundert ist ein stürmisch sich entwickelndes, das konsequent auf die Differenzierung der Mittel um 1600 hinstrebt. Lasso nimmt daran teil; sein Lebenslauf und seine Entwicklung gehen parallel. Als er geboren wurde, 1532, da war Josquin Desprez (um 1450-1521), der das Mittelalter vollendete und abschloss, noch nicht lange gestorben, Nikolas Gombert (1500-1560) und Jacobus Clemens non Papa (1512-ca.1555) begannen wahrscheinlich gerade zu komponieren; und Adrian Willaert (1480-1562) entwarf vielleicht die ersten Stücke seiner Musica nova (die erst 1559 der Öffentlichkeit zugänglich wurden).
Keiner seiner Zeitgenossen hat vielleicht so früh und so virtuos die zeitgenössischen Entwicklungen aufgegriffen und verfolgt, kaum einer hat sich auch so früh einen Namen gemacht, dergestalt, dass sein eigenes reifes Werk es schwer hatte, sich gegen die Nachdrucke seiner frühen Kompositionen durchzusetzen. (Man vergleiche das berühmte Matona mia cara, früher von gymnasialen Schulchören gerne gesungen: Es entstammt der als „op. 1“ bezeichneten Sammlung von 1555 und lässt den eigentlichen Lasso, den Kontrapunktiker der Motetten, den Wortausdeuter der Madrigale, den Aufrüttler der Bußpsalmen in keiner Weise ahnen.) Wie ansatzweise schon bei Josquin wird es nun bei Lasso immer wesentlicher, die Entstehungszeit einer Komposition mitzubedenken. Doch da sitzen, wie vor allem die Motetten in ihrer überaus großen Zahl zeigen, die Probleme: „Studies of Lassus’s music based on chronology have been made (Boetticher), but much remains to be done. It is not easy to be sure about relative composition dates for much of this music; the publication date is of course not an infallible guide, sometimes not even a usefull one. Details of stylistic growth and change can probably be seen and analysed, but the criteria for such a study have yet to be fully developed.“20
Zu Zeit und Einordnung Lassos
Dass ein Komponist des 16. Jahrhunderts so schwer fassbar erscheint, dies mag in diesem Fall auch schon bei Lasso selbst liegen, bei seiner Begabung, seiner Lebensgestaltung, bei seinem Temperament. Dass er aber so schwer einordenbar erscheint, dies liegt auch an der Zeit. Das Wesentlichste leisten auch hier die Umstände. Ein Komponist des 16. Jahrhunderts komponiert nicht aus eigenem Antrieb, er komponiert auch nicht, wozu er (neuzeitlich gesprochen) „Lust“ hat. Mehrheitlich betreibt er sein Metier als „Dienst“; er produziert im Auftrag, erst einmal ohne eigenes „Geschäft“, als (wiederum modern gesprochen) Angestellter eines Fürsten bzw. einer Institution.21 Anderseits kann und wird der Auftraggeber nur das dem Herstellenden Mögliche von ihm erwarten. Es scheint, als wäre Lasso mehr und Vielfältigeres möglich gewesen, als anderen.
Zu bedenken ist dabei der allgemeine zeitgenössische Kontext der Musikproduktion in der beginnenden Frühen Neuzeit. Unserem heutigen Verständnis nach komponiert ein Komponist ein „Werk“, zwar in der Perspektive eines „Marktes“, aber letztlich autonom, um es dann aufführen zu lassen. Das Werk existiert in der Optik des bürgerlichen Musiklebens des 20. Jahrhunderts gleichsam unabhängig von seiner Realisation als ein geistiges Produkt, als „Kunstwerk“. Solche nachmozartische Vorstellung beginnt sich im 16. Jahrhundert erst vorsichtig anzubahnen. Der Komponist ist Teil einer Hofmusik, ein primus inter pares, entweder als Sänger (wie z. B. Josquin, aber eben auch Lasso) aktiv oder als Instrumentalist (Vokalstimmen z. B. auf einer Laute oder auf einem Tasteninstrument verstärkend, ersetzend oder zusammenfassend, d. h. „absetzend“) beteiligt.22 Er hat das Singen und Spielen dieser Hofmusik im Rahmen definierter Situationen anzuleiten. Solche sind vor allem: Höfisches Fest und täglicher Gottesdienst sowie Kammermusik im weitesten Sinn; sie unterscheiden sich nicht wesentlich, vor allem auch nicht darin, dass der Hof sie sich veranstaltet. Im Mittelpunkt steht, hierzu ein „Aussprechen“ zur akustischen Wirklichkeit zu bringen, in einer Weise freilich, die den an der Situation Beteiligten angemessen erscheint. Dabei spielt die Hofkapelle (u. a.) eine alle(!) vertretende aktive Rolle.
Singen, das feierliche und dem Alltag enthobene „Aussprechen“ von Text, hat sich im Laufe des Mittelalters immer mehr spezifisch menschlichen Vorstellungen vom Schönen (und darin vom Singen) angepasst. Solche Anpassung aber geschah gerade auch im Interesse der Teilhabenden. Das 16. Jahrhundert nun kennzeichnet die Tendenz, Texte so „auszusprechen“ (= zu singen), dass die Teilhabenden auch inhaltlich an ihnen mit-meinend teilhaben können. (Die Reformation mit der besonderen Rolle des Singens in ihr ist nicht zufällig eine Bewegung dieses Jahrhunderts!) Dazu entwickeln Komponisten ein besonders „sprechendes“ Singen, einschließlich der Mittel der sog Affektdarstellung und der figürlichen Heraushebung bedeutungszentraler Begriffe. Die Hofkapelle, die einen Text (den der Potentat als „seinen“ vielleicht selbst ausgesucht bzw. genehmigt hat) als Motette singt, singt ihn so, dass der teilnehmende Hof (und vor allem der Potentat), in dessen Namen die Hofkapelle singt(!), diesen Text gleichsam selbst „ausspricht“ resp. innerlich (mit-)vollziehen kann.
Der Komponist hat also das Hofmusikkollegium in einer bestimmten Situation singen (und spielen) zu machen, in einer Weise, die eine sozusagen aktive Teilhabe derer an der Situation, „für“ die die Hofkapelle als pars pro toto tätig ist, eröffnet. Er tut dies, indem er für das Kollegium, bezogen auf die Situation, ein entsprechendes Singen (und, wie wir sehen werden, fortschreitend Spielen) entwirft. Ist die Tätigkeit vollzogen, ist das „Werk“ getan.23 Dann eröffnet sich aber auch die Möglichkeit, die übriggebliebenen Entwürfe zu sammeln und sie anderen Kollegien oder Kantoreien für analoge Situationen anzubieten. Genau dies ist etwa seit 1500, seit der Erfindung auch des Notendrucks mit beweglichen Lettern, sich vermehrend geschehen. Auch Lasso hat seine „Werke“ regelmäßig an den wichtigsten Druckorten Europas in Sammeldrucken herausgeben lassen.24 Dabei geben nicht selten die Dedikationen einen Hinweis darauf, bei wem resp. wo der Autor einen entsprechenden situationsgerechten Bedarf vermutete.25
Um es nochmals ex negativo zu betonen: Gesungen, gespielt wird nicht, damit andere, wie z. B. der Fürst selbst, zuhören. Es gibt noch kein „Konzert“, das entsteht erst mit dem bürgerlichen Zeitalter des 18. Jahrhunderts; und es wäre verfehlt, eine solche Vorstellung der Musiksituation des 16. Jahrhunderts zu unterstellen. Dass vielmehr der Komponist, hier also Lasso, eine Situation ausstattet und darin seinen Fürsten (und den Hof, von dem die Singenden und Spielenden Teil sind!) im Entwurf des Singens in nuce gleichsam selbst „sprechen“ macht, in einer menschlich persönlichen und hier offensichtlich besonders tiefen Weise, dies, und nur dies, begründet das besondere Vertrauensverhältnis, das Fürsten und Komponisten verbindet.26 Anderseits besteht kein Zweifel, dass solches „Aussprechen“ als persönliche Tätigkeit (der Singenden und Spielenden) über die Aufmerksamkeit durchaus wahrgenommen wird; anders wäre ja die Leistung des Singens für die Adressaten nicht herzustellen.
Lasso allerdings bewirkt seinen Fürsten, sich der Musik als Teil der eigenen und darin selbstbestimmten Daseinsweise zu bedienen, in einer darin idealen Weise, dass sie umfassend ist und damit ein neues Moment exemplarisch hervorhebt: nicht nur das neue Verhältnis zum Text ist entscheidend (dieses eröffnet ja die Generation davor); sondern: dass dieses mit einem reflexiven Verhältnis zum eigenen Setzen des Tones und der Stimme und des Satzes als ganzem verwirklicht wird, dies ist das aufregend Neue und Öffnende: Lasso bedient sich offensichtlich sehr bewusst der Möglichkeiten seiner Zeit in virtuoser Weise und bestätigt darin die differenzierten und z. T. nationalen Entwicklungen seines Jahrhunderts.27 Erst diese reflexive Freiheit mag die Basis abgegeben haben für jenen Schritt der nächsten Generation, den Satz selbst „anzutasten“.
Skizze zu den ersten 25 Jahren
Von seinem sehr bewegten Lebenslauf her ist Orlando di Lasso ein typischer Vertreter der franko-flämischen Epoche in der Musik: Im Grenzbereich des französischen und flämischen Sprachbereichs geboren, kam er in den Süden, nach Italien, um dort musikalisch zu lernen und tätig zu sein. Auch als er seine Lebensstellung in der Münchner Hofkapelle des bayerischen Herzogs gefunden hatte, hinderte ihn dies nicht an vielfältigen Reisen und musikalischen Verbindungen mit anderen Potentaten des Kontinents. Lasso wurde (wie Haar, S. 481, schreibt) „in his time the best-known and most widely admired musician in Europe“.
Wann Lasso genau geboren wurde, wer seine Eltern waren, wie seine Kindheit verlief, darüber wissen wir nichts Genaues. Samuel Quickelberg28 schreibt in seiner Teutscher Nation Heldenbuch von (lateinisch: 1565 resp. deutsch:) 1578, die die früheste und wichtigste Quelle zur Lebensgeschichte Lassos darstellt29:
Orland von Lassen Musicus in Bayeren.
ORlandus ist zu Berga im Hennigauw deß 1530 jar erboren. Wie er siben jar alt worden / tathe man jn zu der schul / damit er in der geschrifft vnderwisen wurde: als er diese ergriffen / hat er sich im 1539 jar mit allem ernst auff die Musica vnd das gesang begeben / vnd ist durch sein hälle liebliche stimm mengklichen angenem gewesen.
Die Fakten interpretiert die Literatur heute so: Lasso wurde in Mons (flämisch: Bergen o. zeitgenössisch Berghen) im Hainaut (= Hennegau) geboren. Sein Geburtsjahr wird heute überwiegend mit 1532 angenommen. Es liegt nahe, dass er Chorknabe an St. Nicholas in Mons war, was bedeutete, dass er dort musikalische Bildung, Schulbildung und Wohnung erhielt, also nicht bei seinen Eltern aufwuchs; eine Unterlage darüber existiert nicht. Die Kathedralschulen im nördlichen Frankreich und vor allem in jenem Gebiet, das heute Belgien darstellt, waren hervorragende Schulen: sie bildeten die eigentliche Grundlage der Musikerausbildung der franko-flämischen Musik; sie brachten einen Großteil der großen musikalischen Begabungen der Zeit hervor.
Nun passiert etwas in dieser Zeit nicht Ungewöhnliches. Quickelberg beschreibt es so:
Wie er diese kunst erlernet vnd vnder den knaben gern gesungen / hat man jn zu dem dritten malen heimmlich auß der schul gestolen. Er ist durch der elteren fleiß zu den anderen malen wider heim gebracht worden. Zu dem dritten mal kam er nicht wider / sonder bewilliget bey Ferdinando Gonzaga den Königlichen statthalter in Sicilia zu verharren / welcher damalen vor S. Desidier vber den Keiserischen hauffen Oberster gewesen. Wie der Frantzösische krieg ein end genommen / zoge er mit jm hinweg / vnd wonet zum theil in Sicilia / zum theil in Meyland gern bey jm / biß er nach sechs jaren angefangen sein stimm zu mutieren vnnd enderen.
Eine abenteuerliche Geschichte! Aber es war durchaus üblich, dass Werber aus Deutschland und Italien die sog. Niederlande nach Sängern und Kapellknaben absuchten. Lasso war offensichtlich eine außergewöhnliche stimmliche Begabung. Ob er wirklich entführt wurde? Feststeht, dass er (offensichtlich mit seiner Einwilligung) in die Kapelle des Mantuaner Herzogs Ferdinando Gonzaga eintrat, der das Heer Karls V. im Französischen Krieg führte, als Vizekönig von Sizilien fungierte und sich im Sommer 1544 in den Niederlanden aufhielt. Lasso blieb also bei ihm; er gehörte zu seinem Hof: zuerst in Frankreich; und nach Beendigung des Krieges in Mantua und (sicher 1547-49) in Mailand ebenso wie in Palermo, je nachdem, wo sein Brotherr sich aufhielt. Dass man Knaben für die hohen Stimmen im Ensemble bevorzugte, lag nicht nur an einem ästhetischen Ideal; Hofkapellen gestalteten in großem Maße Gottesdienste; und nach Meinung der Kirche war es (bis in das 18. Jahrhundert) Frauen geboten, in der Kirche zu schweigen.
Als Kapellknabe angestellt zu sein, bedeutet keinesfalls nur zu „arbeiten“, wenn auch dies, unter bedeutenden Komponisten und Sängern der Zeit, bereits genügend Anschauungsunterricht bot. Die Kapellordnungen der Zeit weisen stets einen für die Knaben zuständigen Präceptor aus, der auch für das allgemeine und vor allem das musikalische Lernen zuständig war; dazu gehörten die Grundlagen der Musiktheorie ebenso wie Grundlagen der zeitgenössischen Satztechnik (Kontrapunkt) sowie das improvisierende Erfinden von Zusatzstimmen zu einem gegebenen stimmlichen Verlauf.30 Im Übrigen fungierte Lernen in dieser Zeit noch weitgehend durch auffassendes Kennenlernen (von Kompositionen anderer), durch Sich-Abschrei-ben derselben (als Muster), durch Bearbeiten (um das Setzen der Stimmen zu lernen), schließlich durch ein Selber-Machen-wie, bei dem man sich Stück für Stück von seinen Vorbildern emanzipierte.31
Lasso muss die Gelegenheiten in Mantua und vor allem in Mailand (wo einst Josquin bereits Kapellknabe gewesen war, wo also ein großes Repertoire vorlag!) genutzt haben; möglicherweise war er auch instrumental, in Tasteninstrument und Laute, unterrichtet worden. Denn nun trat die bis zu Bach und Haydn in den Musikerbiographien oft als dramatisch geschilderte Situation des Stimmbruchs ein; Lasso musste, wollte er weiter Musiker sein, zumindest vorübergehend anderweitig (und nicht als Sänger) sich dienstbar machen. Hören wir wieder Quickelberg:
Also warde er seines alter im 18 jar von Constantino Castrioto gehn Neaplaß gefüret / da er dann bey Margraff de Laterza drey jar verharret. Nach diesem kame er gehn Rom / vnd was deß Ertzbischoff zu Florentz gast in die sechs monat lang / biß er in der nammhaffte Lateranischen kirchen S. Johannis vber die gantze Musicam ein Oberster geordnet.
Welche Karriere: offensichtlich über die fürsorgliche Vermittlung des Fernando nimmt ihn ein Adeliger in Neapel in seinen Dienst. Und er wohnt, wie wir wissen, im Hause des angesehenen Marchese und Dichters Giovanni Battista d’Azzia della Terza, wo er „wichtige Anregungen und Hilfen geboten“ bekommt.32 Lasso gewinnt Zugang zu humanistischen Kreisen und Dichtungen; er beteiligt sich möglicherweise an den Stegreifkomödien der Zeit, zu denen typische Liedsätze, die Villaneschen, gehören (wie sie auch von Lasso kurze Zeit später in Rom gedruckt wurden). Schließlich nimmt ihn der (in Rom residierende) Florentiner Erzbischof in seine Dienste und empfiehlt ihn möglicherweise an den Lateran, wo er in den Jahren 1553 und 54 die päpstliche Kapelle (zwei Jahre vor Palestrina) leitet: „Lassus must by this time have acquired a certain reputation as a musician in order to get a post such as this.“ (Haar, S. 481) Warum er Rom wieder verließ? Hören wir Quickelberg:
Wie er zwey jar da verharret / vnd durch seine krancke elteren wider heim berüffet / hat er sich auff die reiß begeben / vnd seind diese gestorben / ehe dann er heim kommen. Damalen ist er mit herr Julio Cesare Brancaccio einem fürnemmen Musico erstlich in Engelland / demnach in Franckreich gefaren / damit er die Land besichtiget. Auff solliches kame er wider gehn Antorff / vnd lernet etliche edle fürnemme leitt die Music kunst / von welchen er auch geliebet vnd reichlich geehret worden.
Nochmals eine abenteuerliche Geschichte, die möglicherweise Verwicklungen des jugendlichen Lasso in politische und spionageträchtige Unternehmungen verschleiert: Angeblich hatte Lasso Nachricht bekommen, dass seine Eltern krank seien. Um sie noch einmal zu sehen, machte er sich in die Heimat auf, kam jedoch zu spät; sie waren bereits gestorben. Allgemein ein Fragezeichen machen Biographen hinter die Reisen mit dem Sänger, Diplomaten und Abenteuerer Brancaccio; die frühere Lasso-Biographik hatte sie blumig ausgesponnen.33 Dass dieser Brancaccio (möglicherweise im Auftrag des französischen Königs) versuchte, bei Queen Mary the Bloody Einfluß zu gewinnen, verhaftet und abgeschoben wurde, ist überliefert. Ob Lasso wirklich in seinem Gefolge jener Lautenist war, der über die Musik den Einfluss realisieren sollte, dagegen nicht. Auf sicherem Boden bewegen wir uns mit der Nachricht, dass Lasso sich im frühen Jahr 1555 in Antwerpen aufgehalten habe. Offensichtlich unterrichtete er und gewann einflussreiche Leute für sich. Überaus wichtig für ihn war wohl die Bekanntschaft mit den Druckern Tylman Susato und Jean de Laet. „In that year Susato printed what has been called Lassu’s ‚op. 1’, a collection of ‚madrigali, vilanesche, canzoni francesi e motetti’ for four voices.“ Lasso macht sich bekannt. Im gleichen Jahr erscheint in Venedig sein erstes Buch fünfstimmiger Madrigale; und 1556 ließ er das erste Buch seiner 5- und 6-stimmigen Motetten in Antwerpen folgen. Lasso fasst erstmals zusammen, was er bisher entworfen hat: die Frucht eines an italienischen und französischen Vorbildern orientierten kompositorischen Verhaltens. Er empfiehlt sich einerseits als vielseitig („op. 1“), anderseits als „neu“ und konkurrenzfähig in den wesentlichen Gattungen der Zeit: im Madrigal und in der Motette, in der weltlichen, wie in der geistlichen Musik.
Die entscheidende Konsequenz lässt nicht lange auf sich warten:
Wie er dergestalt weit bekandt / warde er im 1557 jar von Albrecht dem Fürsten in Bayeren vnd sonderbaren liebhaber der Music / sampt anderen Niderlenderen gehn München berüffet / damit sie daselben in der Music Kapell alles versehen / vnd wol anrichten sollen; daselben ist er durch seine lieblichen Compositionen / freündtliche geberden / gute schimpffpossen / vnd vieler spraachen erfarnuß dem Fürsten sehr lieb gewesen. Jn volgendem jar warde jm ein tochter auß den Bayerischen Frauwenzimmer verheiratet / von welcher er schöne kinder erboren. Wie er also fürgefaren / warde er im 1562 jar Oberster in der Music Kapell geordnet / da dann die fürnemsten Musici auß mancherley Nationen zusamen kommen: er zoge offt gehn Antorff vnd an andere ort / damit er dem Fürsten die besten senger härzu brechte. Er hat wol in der jugent angefangen zu Componieren / vnd an den Bayerischen hoff dermassen in dieser kunst erfarnuß erlanget / das er fast allen Königen und Fürsten bekandt worden / also das man in allen geistlichen vnd weltlicher Fürsten kirchen vnd höffen seine Compositionen vnd neüwe lieder gebrauchet. Es seind viel seiner muteten in vier / fünff / sechs / acht vnd noch mehr stimmen zusamen gesetzet / welche zu München / Venedig / Florentz / Neaplaß / Antorff / Leon / vnd Pareyß im truck außgangen / so viel zu lang an diesem ort zu erzellen. Jch hab diesen Orlandum in der Fürstlichen Kapel zu München mit sampt anderen lieblich hören singen / vnd mich darab verwunderet.
(Hier endet Quickelbergs kurze Biographie; der Autor starb 1567, 38-jährig.) Lasso wurde als „Cantor und zweiter Tenor“ Ende 1556 nach München in die Hofkapelle des musikliebenden Albrecht V. angeworben, zwar neben anderen Sängern, aber wohl in der Erwartung, eine wesentliche Rolle in der Reorganisation der in Unordnung geratenen Hofkapelle zu spielen34, was sich an einem herausgehobenen Gehalt ablesen lässt. Lasso hat dieser Erwartung letztlich in hervorragender Weise entsprochen. Als Ludwig Daser, der offizielle Leiter der Hofkapelle, 1563 ausschied – Daser war Protestant und gehörte vielleicht zur zeitweisen Liebäugelei Albrechts mit der Reformation –, übernahm Lasso auch offiziell die Leitung. Er behielt sie über 30 Jahre.
Zur Entwicklung bis zum Antwerpener »Selbstporträt«
Mit der Ernennung zum Hofkapellmeister wissen wir, salopp gesagt, was Lasso mit 30 Jahren nun ist. Doch können wir auch Aussagen darüber machen, wer Lasso nun ist? Wie sieht sein möglicher und eigentlicher kompositorischer Werdegang aus? Können wir Annahmen zur sozusagen menschlichen Entwicklung Lassos formulieren: wie wurde dieser Musiker der „große“ Münchner Lasso und was bedeutet (uns) dieser Werdegang?
Den Anfang setzt Mons mit der Ausbildung als Sänger und mit allgemeiner Bildung innerhalb des Kathedralinternats. Hierzu gehören gleichzeitig eine neue
Zugehörigkeit
zu der kirchlichen Institution und die
prägende
Erfahrung mit dem geistlichen Repertoire der Zeit. Dann folgen (in der neuen Zugehörigkeit zu einer Hofkapelle) über Fontainbleau einige Monate Mantua, ein halbes Jahr Palermo und schließlich wieder Mailand, wo geistliche und weltliche Musik im Zusammenhang großer Feste ihn mehr als nur beeindrucken. Boetticher
35
vermutet für Mailand eine wesentliche Begegnung mit einer hochstehenden Lautenpraxis, mit der
Commedia dell’arte
und mit geistlicher Musik am Dom, da u. a. mit Motetten Adrian Willaerts. Am wichtigsten aber erscheint Boetticher die Begegnung mit den Madrigalen Vincenco Ruffos.
Vielleicht markiert der Umzug nach Neapel das Ende der primär rezeptiven Aneignung, sozusagen der „Schulzeit“ Lassos, verbunden mit der Abnabelung von den bisherigen Institutionen, denen er zugehörte, und den Beginn, sich die musikalischen Möglichkeiten der Zeit
produktiv
anzuverwandeln, sprich: sich als zur produktiven Umsetzung Fähigen zu erproben. Sicher geschieht dies nun je in persönlicher Beziehung zu einem Mentor und Vorbild. Boetticher beschreibt die Zeit in Neapel als „die Wiege von Lassos Schöpfertum“ (32). Erproben konnte sich solches vor allem in den Kreisen der Accademien der Stadt mit ihren literarischen Sitzungen und musikalischen Ausführungen von Stegreifspielen, zu denen die Villaneschen gehörten. Lasso muss hier wohl spielend, singend und komponierend mitgewirkt und eine kurze Zeit lang sich am Genre des weltlichen neapolitanischen Liedes erprobt haben.
Mit Lassos Zeit in Rom können wir die Phase verbinden, in der Lasso ernsthaft zu komponieren beginnt: er legt sich eine breite optative kompositorische Identität zu, die einflussreiche Gönner dazu bewegt ihn (aus welchen anderen Gründen auch immer) in ein höchst verantwortungsvolles Amt
36
der damaligen Musikwelt zu vermitteln. Boetticher vermutet (36) dass das Werk Nicolas Gomberts, des Kapellmeisters Karls V., die eigentliche römische Entdeckung Lassos gewesen sein könnte. Ebenso bedeutsam erscheint die Vermittlung von Kompositionen de Rores durch jenen (vorübergehend in Rom residierenden) Florentiner Erzbischof Altoviti. Beide Komponisten wiesen Wege: in den Bereich der Motette (und Messe) der eine, in den Bereich des entwickelten Madrigals der andere.
Lasso hat fast ein Optimum des zu seiner Zeit Möglichen am bildungsmächtigen musikalischen Vorbildern aufnehmen und für sich nutzen können: die grundlegende Tradition und Schulung der franko-flämischen Musik in Mons, die Unterweisung und Praxis in einer ausgebauten Hofkapelle in Oberitalien, die Erfahrung mit wohl vor allem einem auf gesellschaftliche Zusammenkünfte bezogenen weltlichen Singen und instrumentalem sowie szenischem Spielen in Neapel, die großen kirchenmusikalischen Repertoires und die neuesten Entwicklungen geistlicher und weltlicher Musik Italiens in Rom.
Schließlich landet er in der quasi Zwischen- bzw. Wartestation Antwerpen, einem zentralen Ort des damaligen Musikdruckes, wo er sich vor dem neuesten Stand der Veröffentlichungen auf dem Musikmarkt als einzelne und sozusagen (erstmals vollkommen) auf sich gestellte musikalische Persönlichkeit herausgefordert findet. Bei alledem müssen wir von einem bildungsfähigen und bildungshungrigen Menschen ausgehen, der die äußeren Gegebenheiten nutzte, um seine Verhaltensmöglichkeiten zu entwickeln und zu optimieren. (Dass es möglicherweise auch „Irrwege“ dabei gab, die eigene Bedeutsamkeit dadurch zu vergrößern, dass er sich in diplomatische „Dienste“ einspannen ließ, dies gehört vielleicht zur notwendigen Ausstattung mit Lebenserfahrung und Weltsicht.
37
)
Die Zeit in Antwerpen können wir als Beginn des Reflexes auf sich selbst ansehen, aus dem ein bewusstes Zusammenfassen des Bisherigen, ein Sichten und Auswählen resultiert. Diesem ist erst einmal der Band weltlicher Werke von 1555 geschuldet. Doch mehr noch scheint Lasso an der Vorstufe zu einem Neubeginn gearbeitet zu haben: am Sich-Absetzen von den anderen im Bereich der 5- und 6-stimmigen Motette (1556). Boetticher deutet solches Bemühen u. a. als Sich-Absetzen von Clemens non papa und Willaert an: im Sinne eines sich das Auszusprechende figurhaft Verdeutlichens, das gleichzeitig das „Aussprechen“ strafft und harmonisch wie auch in der stimmlichen Besetzung gewissermaßen dynamisiert.
Die angesprochenen Veröffentlichungen der Antwerpener Zeit, wohl auf eine Anstellung im romanischen Teil Europas zielend, sind Ausweis (zuerst und einerseits) eines prinzipiellen Verfügens über das Singen der Zeit, das in einem Amt aber an spezifischen Aufgaben – denken wir nur an die vielen Formen liturgischer Musik (z. B. an das Magnificat), vor allem aber an das Ordinarium Missae – erst noch „umzusetzen“ u. d. h. spezifisch zu entwickeln ist. Doch weisen ihn beide Bände nicht nur als äußerlich „umfassend“, sondern auch in der Verfügung über sein kompositorisches Handwerk als „vielgestaltig“ aus. Boetticher urteilt: „Der weitgespannte Stoffkreis vom Huldigungsgedicht, kultischem Gebet, repräsentativer Kunst und solcher aus privatester Sphäre[…] prägte Lassos Antwerpener Motette, in welcher der zitternde Gesamtklang und die oft gewaltsame, rhetorische Spannung geschichtlich eine einmalige Leistung sind[…]“38
Die beiden Antwerpener Veröffentlichungen weisen Lasso in seiner – wie wir das nannten – optativen Identität als Komponist aus.39 Sie stellen gleichzeitig (und nun anderseits) so etwas wie ein Selbstporträt dar: Lasso präsentiert sich in der Öffentlichkeit und vor sich selbst als der, der er nun ist, in der Auswahl dessen, was er an Fähigkeiten hat. Wenn wir hier von Selbstporträt sprechen und wenn wir die Schwierigkeiten der ersten Münchner Jahre vorausbedenken, die im folgenden anzusprechen sind, so werden wir möglicherweise an die Folge von Selbstporträts Dürers erinnert, besonders auf die beiden in Madrid von 1498 (Prado) und in der Alten Pinakothek in München von 1500. Bei dem einen, dem »Selbstporträt mit Landschaft« des vornehm gekleideten 27-Jährigen, liegt eine abschätzende Aufforderung zur Anerkennung im Blick. „Vielleicht ist das Porträt ein halbes Eingeständnis, dass Dürer sich ein Stück weit verkleidet hat[…]“40 „Grob vereinfacht“ – führt Berger aus – „ sieht das Bild aus, als wolle es sagen: »In Venedig habe ich Maß für meinen eigenen Wert genommen, und ich erwarte nun, dass dieser Wert hier in Deutschland anerkannt wird.«“ Das andere Bild, das frontale »Selbstbildnis im Pelzrock«, ähnelt einer Christusdarstellung. Es ist interpretierbar als neuer Reflex auf sich selbst: Ich bin es, in meiner Verantwortlichkeit. In ihm scheint Dürer sich am nächsten zu kommen; er definiert sich in einem selbsterkannten neuen Selbstbewusstsein, quasi als „Schöpfer“ des (für Adressaten) Sichtbaren. „Seine Unabhängigkeit muss Dürer, zusammen mit dem Stil seiner Kunst, ein ungewöhnliches Machtgefühl vermittelt haben.“41
Ein solches „Machtgefühl“ (über sich!, und von da über andere!) scheint nun in München sich bei Lasso anzubahnen. Wenn bei Dürer zwischen den beiden Selbstporträts vielleicht die entscheidende Wende im Verhältnis zu sich, zum Heraustreten aus der optativen Identität zu einer selbstverantworteten liegt, dann scheint mir, als könnten wir Lassos beide Antwerpener Drucke mit dem ersten Selbstporträt Dürers etwa analog sehen. Leuchtmann42 hat ausführlich darauf hingewiesen, dass man den Umzug nach München nicht aus der Optik des späterhin berühmten Lasso beurteilen dürfe. Lasso wurde nicht „berufen“ – wie die Quickelbergische Wortwahl nahelegt –, sondern als Tenorist angeworben; und dies an einen hochverschuldeten, „engen, damals noch mittelalterlichen“ Hof (111). Lasso war noch nicht berühmt; aber er hatte das Glück, auf einen Fürsten zu treffen, dessen besondere Neigung der Musik galt, die er auch gegenüber der Kritik seiner Räte verteidigte.
Gemäß Boetticher gibt es einige Hinweise, dass Lasso die produktive Aneignung zeitgenössischen Komponierens mit den Veröffentlichungen in der Antwerpener Zeit (die wohl nur eine Auswahl dessen darstellen, was dem Komponisten selbst bereits vorlag) abgeschlossen hatte und dass mit der Münchner Zeit des „Hineinwachsens“ in das Amt des Hofkapellmeisters mit dem Eingehen auf die vielfältigen kompositorischen Erwartungen und Aufgaben die Zeit – wie wir sagen – der Verfügung über sich als Komponisten beginnt.
Von der Bedeutsamkeit des »Amtes« für die Tätigkeit des Komponisten
Die Wortwahl „Hineinwachsen“ erscheint unproblematisch. Doch vielleicht können wir die ungeklärte Rolle Lassos in den ersten sechs Jahren als die besondere Situation interpretieren, die möglicherweise explizit dazu beiträgt, etwas epochal Neues in besonderer Weise hervortreten zu lassen. Denn Lasso, noch nicht im Amt, musste, sollte (oder wollte) sich über sechs Jahre lang so verhalten, als wäre er dies… (Darin scheint mir das eigentliche Problem zu liegen.)
Die Literatur spricht von „Verstimmungen“ in den ersten Jahren:
„Aus dem Briefwechsel zwischen Lassus und Granvellee[…] geht hervor, dass sich der Komponist während seiner ersten Jahre in München nicht recht wohlfühlte und dass er sogar erwog, eine andere Stellung zu suchen. Diese Anpassungsprobleme und Lassus’ Unzufriedenheit gehen vielleicht auf die Arbeitsbedingungen unter seinem Dienstherrn Herzog Albrecht V. zurück. Dieser belastete Lassus mit umfang- und prestigereichen Kompositionsaufgaben, verbot ihm jedoch, diese Werke zu drucken, weil er sie als exklusives Eigentum des bayerischen Hofes betrachtete und für Aufführungen ad usum privatum reservierte.“43
Mit den in den ersten Münchner Jahren möglicherweise entworfenen Kompositionen werden u. a. die lateinischen Zyklen der Prophetiae sibyllarum und der Septem psalmi peonitentiales in Zusammenhang gebracht.44 Die Tatsache, dass der letztere, die sog. Bußpsalmen, in einer 1563 in Auftrag gegebenen und durch den Hofmaler Hans Mielich prunkvoll ausgestatteten Handschrift vorliegt – wir werden ausführlicher auf sie zurückkommen –, bestärkt uns darin, an diesen Entwürfen für ein geistliches Singen der Übergangsproblematik ein Stück weit näher zu kommen. An ihr können wir das Problem des gegenseitigen Selbstverständnisses, einerseits das sich bildende Lassos, anderseits das sich ebenfalls gerade festigende des maximal vier Jahre älteren Albrecht festmachen. Albrecht (auch „der Großmütige“ genannt) lebte von 1528 bis 1579; er war der erste Herzog, der über die bayerischen Herzogtümer unangefochten herrschte. In der Literatur wird er als leidenschaftlicher Kunstsammler beschrieben, der nicht nur eine umfangreiche Kunstkammer anlegte, sondern (u. a.) auch mit seiner Hofbibliothek den Grundstock der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek schuf und eine umfangreiche Sammlung antiker Skulpturen zusammentragen ließ.
Während der Fürst davon ausging, in Lasso einen „Diener“ zu haben, den er mit der Ausstattung seines Lebensbereichs zu beauftragen das Recht hatte, war Lasso vielleicht bereits auf dem Weg zu jenem „reflexiven Verfügen über sich als…“, das mit seinen Kompositionen erst jene Vorstellung des Fürsten zu entwickeln begann, die dessen (= des Fürsten!) Selbstverständnis in einem mehr und mehr mit-meinenden, sich selbst als Mit-Denkender und -Empfindender wahrnehmenden Mit-Singen zu entsprechen hätte.45 Dabei war auch Lasso möglicherweise noch ein Suchender, der es darauf anlegte, in seine Kompositionen alles an bisher Erarbeitetem fruchtbar werden zu lassen.46
Einen entsprechenden Eindruck vermittelt die Durchsicht der Prophetiae Sibyllarum. Man könnte unterstellen, dass der Münchner Lasso, der hier neapelsche Erfahrungen aufgreift, vor einer besonderen Schwierigkeit stand: das „Aussprechen“ ekstatischer Texte in lateinischen Hexametern mit einem Komponieren zu entwerfen, das sich der Sprache wegen an jenem mit volkssprachiger Bedeutungsgebung nicht orientieren konnte, anderseits der außergewöhnlichen „prophetischen Sprache der Sibyllen“ (Therstappen47) gerecht zu werden suchte. „Die Chromatik“ – so Therstappen in seinem Vorwort – „ist in den »Prophetiae« gewiss nicht mehr Experiment und Zugeständnis an eine Zeitmode“ (was auf Lassos Zeit in Neapel zurückweisen würde); „sie ist bedeutsames Ausdrucksmittel einem besonderen Text gegenüber.“
Einschub: Der Rückgriff zum Gestaltungsmittel der Chromatik am Beispiel der „Prophetiae Sibyllarum“
Versenken wir uns zuerst hörend und möglicherweise selbst die Partitur studierend in die Prophetiae Sibyllarum48, so bewundern wir auch hier die spezifisch resultierende Deklamation und die Kunstfertigkeit des Kontrapunkts; aber statt der „Motivik“ der Motette nehmen wir im Besonderen die auf ein Empfinden hinsteuernde Konstruktion einer voranschreitenden Klanglichkeit wahr, in deren Vorangehen der jeweiligen Klang-(=Akkord)folge eine wesentliche Rolle zufällt. Sie fungiert hier als gezielt eingesetztes Mittel einer Ausdrücklichkeit der Erschütterung. Darin hat die Konstruktion eines Hell-Dunkel, einer Härte (Dissonanz) und Weichheit und schließlich einer Chromatik als die einer gleichsam erlebten und „offenbarenden“ Veränderung der Empfindung eine wichtige Funktion.
Wir können uns ein Hervorkommen des Aussprechens und gleichzeitig die (Textworte „umsetzende“) Chromatik, gleichsam personalisiert in der Ausdrücklichkeit durch Stimmtausch zwischen Altus und Tenor bzw. im Weiteren zwischen Cantus und Altus („Haec sunt illa, quibus…“) gleich am einleitenden Vorspruch vergegenwärtigen; ebenso die Erzeugung eines gleichsam Nachsinnens etwa in der Sibylla Hellespontiaca (VII.). Doch steht vor solchem Übertragen in ein „Erleben“ sowie als deren Kern die Interpretation des Textes in der Form einer meinend interpretierenden Aktivität. Diese können wir als Singen oder Mit-Singen an jeder der Prophetien zu rekonstruieren suchen. Doch setzt dies voraus, dass wir den Text als einen den Singenden resp. Adressaten spezifisch angehenden identifizieren: die in Hexametern gefassten Verse mit einer (für unser Schullatein) doch sehr eigenwilligen Wortstellung wollen erst einmal in einer möglichen lexikalischen Bedeutung verstanden werden. Und mit unserem Identifizieren des aus Wortstellung und -wahl resultierenden Textsinns rühren wir an ein hier Entscheidendes: Der (Mit-)Singende (wie auch der Übersetzer) versteht, was er (angesichts seines Vorwissens und seiner Verstehensintention) verstehen u. d. h. mit den Worten „sagen“ resp. meinen will.
Auch von da ist die hier auffallende Chromatik Lassos zu würdigen: sie steht, allgemein gesprochen im Dienste des (Sich-)Auf-deckens, eines Sich-Offenbarens des Geheimnisvollen durch die Singenden resp. Mit-Singenden. Hören wir uns die erste Prophetie durch – wir können beliebig an jeder der 12 Vorwürfe ansetzen –, dann finden wir chromatische Schritte mit „Virgine“ (am Beginn), mit „salutem“, „oracula“, „verbo“ oder „magnus“ verbunden, Schritte, die die persönliche „Interpretation“ herausfordern: als eine Art Sich-Öffnen für das, womit die (Mit-)Singenden die Worte aus ihrem religiösen Wissen als ihr Verständnis füllen. Das gilt im Besonderen für eine „aufsteigende“ Chromatik, für die „Erhöhung“ durch das vorgezeichnete „Kreuz“ (womit in diesen auf Christus vorausweisenden Prophezeiungen ein zusätzlicher Grund für den Einsatz der Chromatik hier angesprochen sei). Überaus eindrucksvoll aber auch jene Stellen sozusagen in umgekehrte Richtung, hier beispielshalber bei „Ille Deus“, wo über das „nascetur“ die Menschwerdung Christi als eine „Erniedrigung“ in den Sinn gelegt erscheint.
Es lohnt sich, wenigstens eine der Prophezeiungen – wir bleiben bei der ersten, der Sibylla Persica – etwas genauer anzusehen! Der Ausspruch ist in Hexameter gefasst, die Lasso hier (zumindest) durchaus als quantitative Größen einschließlich ihrer Mittegliederung berücksichtigt, vor allem, wenn diese mit solchen syntaktischer Art übereinstimmen:
Virgine matre satus pando residebit aselo, Jucundus princeps unus qui ferre salutem Rite queat lapsis tamen illis forte diebus. Multi multa ferent immensi fata laboris. Solo sed satis est oracula prodere verbo: Ille Deus casta nascetur virgine magnus.
Wir sehen, dass viele der Wortverbindungen einem Übertragen in den eigenen Wort- u. d. h. Gedankenschatz (= Übersetzen) einige Akrobatik abverlangen. Die Übersetzung, auch bei Therstappen z. T. „Interpretation“, weil zusätzlich für das Singen mit deutschem Text hergerichtet, könnte einigermaßen wörtlich lauten:
Der mütterlichen Jungfrau entsprossen wird er sich auf einem Esel breit niederlassen, Der eine heitere Fürst, der das Heil bringt Nach herkömmlichen Brauch und dennoch stark in solchen flüchtigen Tagen. Viele tragen schwer einen großen Teil am Schicksal der Mühe. Allein, es ist genug; die Weissagung komme durch das Wort hervor: Jener große Göttliche wird aus der reinen Jungfrau geboren.
Unsere Prosaübersetzung hat ihre Berechtigung auch daher, als Lasso das „Aussprechen“ durchaus als ein am einzelnen Wort orientiertes organisiert. Und da können wir gleich am Beginn nicht nur die wie je auf eine Vollendung hinzielende resultierende Rhythmik nachvollziehen, sondern gleich auch in der auf „satus“ zielenden aufsteigenden Linie das „Bild“ des „entsprossen“, das hier gleichzeitig mit dem gegenläufigen Bass als ideale Eröffnung des Satzes fungiert, trotzdem „Virgine“ erst einmal im oben angedeuteten Sinn sich entfalten lässt, anderseits die zweite Halbzeile unmittelbar mit der ersten verklammert.
Stets beobachten wir einerseits ein Hinzielen, hier zu „sa-tus“ und (vom H-Klang gleichsam zurückgehend) zu „a-se-llo“ usf. und doch gleichzeitig ein Uminterpretieren des vermeintlichen Schließens in einen neuen Ansatz, so, als ob das Singen gerade aus der je langen Pänultima („sa-[tus]“, „[a-]sel-[lo]“) den neuen Schwung gewönne zur Anknüpfung.
Das Aussingen des „Jucundus“, das sich als selbstzuverstehendes „Bild“ belebend auswirkt, zielt zwar auf „princeps“, doch zieht das Singen auch hier weiter, auf das gleichsam erniedrigte „ferre“, das seinerseits in das chromatisch sich öffnende „sa-lu→tem“ strebt. Den hier deutlichen Neubeginn verbinden zwar Cantus und Tenor, doch verdeutlichen die anderen beiden Stimmen hinzukommend das neue Anheben, in welchem, gruppiert um das hervorzuhebende und als Höhe- und Gliederungspunkt fungierende „tamen“, das Singen sich Wort für Wort als eine Art Proklamation in bewusst längeren Notenwerten entfaltet, wobei das wie mühsam nicht enden wollende „diebus“ auf den folgenden Vers vorausweist.
Das wie hinkende49 Zusammengehen der Singenden auf „Multi multa ferent“, das die (sich sozusagen „stets“ wiederholende) „Last des Schicksals“ nach „unten“ drückt, klingt in tiefer Lage (ohne Cantus) auch hier auf „laboris“ überlang aus.
In dieses hinein singt der Cantus wie ein Signal solo sein „So-lo“ in langen Werten; und die anderen Stimmen erweitern dieses mit ihm zu einer Art Verkündigung des „sed satis est“. Gleichzeitig „eröffnet“ die chromatische Akkordverbindung eine wie innere Perspektive; und „o→racu-la“ schließt sich mit solchem „Öffnen“ ebenso an, wie „ver→bo“. Gerade aus solchem geballten „Eröffnen“ durch aufsteigende Chromatik eröffnet sich dem geheimnisvoll ankündigenden „Ille Deus“ mit seiner betonten Rückmodulation und dem gleichsam hervorkommenden „nascetur“ die besondere vertraute Bedeutsamkeit der Worte für die (Mit-)Singenden.
Diese erscheint zusätzlich und „subjektiv“ durch das in der Satzteilwiederholung gegenübergestellte „Reine“ und Weiche des C- und B-Klangs in Beziehung zu „virgine“…
mit dem vergleichsweise „Harten“ und „Kräftigen“ des A- und G-Klangs in Bezug zu „magnus“ hervorgehoben.