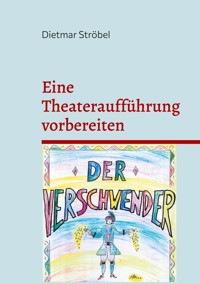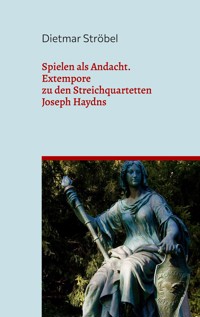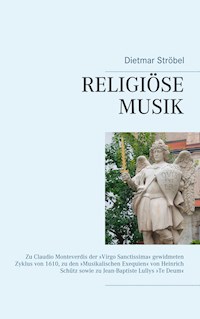
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den fünf Kapiteln dieses Buches mit über 85 Notenbeispielen geht es um Monteverdis Marienzyklus von 1610 mit der sog. »Marienvesper« (samt Messe), um Schützens »Musikalische Exequien« von 1636 und schließlich um Lullys »Te Deum« von 1677, zusammengefasst: um Vokalmusik des 17. Jahrhunderts unter dem Blickwinkel der menschlichen Äußerungsform SINGEN. Beschrieben und interpretiert werden die drei als exemplarische Entwürfe für ein Singen als je gemeinschaftlicher Ausdruck einer persönlichen Religiosität. Doch werden darin auch die unterschiedlichen und quasi nationalen Wege und Ziele der implizierten Selbsttätigkeit in Glaubenssachen deutlich, die wir als Selbstbehauptung, Selbstvergewisserung und Selbstrepräsentation fassen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ZWISCHENTEXTE 5
SINGEN → SPIELEN → HÖREN
Zu einer »erwachsenen« Musik der Frühen Neuzeit (1500-1800) [Arbeitstitel]
TEILBAND: SONDERBAND (2) ZU EINER »RELIGIÖSEN MUSIK« IM 17. JAHRHUNDERT
Inhalt
Über »Religiöse Musik« – ein Vorwort
»Maria – felix porta coeli« – Zu Monteverdis sog. »Marienvesper« im Marienzyklus von 1610
Zum Selbstverständnis der sog. »Marienvesper« und unserer Darstellung
Zum Rahmen einer möglichen „Handlung“ der sog. »Marienvesper«
Ein erstes „Bild“ – Mit der Erwählung Mariens kommt die „christliche Liebe“ in die Welt.
D
IXIT
D
OMINUS
L
AUDATE PUERI
Exkurs zur Bedingtheit unseres Hörens und Beschreibens
N
IGRA SUM
Ein zweites „Bild“ – Mit der »Verkündigung« kommt die Hoffnung auf ein himmlisches Jerusalem in die Welt.
P
ULCHRA ES
L
AETATUS SUM
D
UO
S
ERAPHIM
Ein drittes „Bild“ – Durch Maria kommt der Glaube als ein selbsterfüllt auszulebender in die Welt.
N
ISI
D
OMINUS
A
UDI COELUM
L
AUDA
J
ERUSALEM
Ein viertes „Bild“ – Die Fürbitte als menschliche Reaktion auf die Ermächtigung zur selbsterfüllten Glaubenshandlung
S
ONATA SOPRA
S
ANCTA
M
ARIA
Ein fünftes „Bild“ – »Magnificat«. Singendes Handeln als Ausdruck einer neuen Zuständlichkeit
»Der Glaube und das Wort sind die Flügel, die uns zum Himmel tragen« – Zur
Quasi-Messe
in den
Musikalischen Exequien
von 1636 von Heinrich Schütz
Zum Selbstverständnis der Komposition
Zum Text der Quasi-Messe
Das Quasi-Kyrie als gestaltete Konsequenz eines Sich-Bedenkens
Das Quasi-Gloria als zusammenhängende »Unternehmung« des glaubenden Subjekts
Was dem einen das Tönen der Stimme, das ist dem andern die Artikulation des „Wortes“ – Zu den emanzipatorischen Tendenzen in den Zyklen von Monteverdi und Schütz
Singen als Realisieren einer je persönlichen Religiosität
Wie Schütz das „Aussprechen“ als ein persönliches Artikulieren des „Wortes“ entwirft.
Wie Monteverdi das Aussprechen für ein persönliches Tönen nutzt.
Singen als auf Vollendung gerichtete Handlung bedarf der besonderen musikalischen Gestalt(ung), um Gültigkeit zu erlangen.
Gestaltung als ein Akt generativer musikalischer Syntax – Zum Psalm 121/22, »Laetatus sum«, in Monteverdis sog. »Marienvesper«
Gestaltung als ein Akt generativer musikalischer Semantik (Schütz) – Zur Predigtmotette in den »Musikalischen Exequien«
Der Entwurf des Singens ermöglicht den Singenden und Mit-Singenden eine Positionierung im konfessionellen, sozialen und nationalen Umfeld.
Schützens Entwurf einer „Geleitung“ zu einer gemeindlichen und spezifisch deutschen Glaubensposition – Zur Parentationsmotette in den »Musikalischen Exequien«
Monteverdis Entwurf der „Feier“ einer höfisch-kirchlichen, katholischen und italienischen Glaubensposition – Zur Messe »In illo tempore«
Das Entwerfen Religiöser Musik und deren Realisation als implizit politisches Handeln – eine Zwischenbilanz
»Salvum fac populum tuum, Domine« – Zu Jean-Baptiste Lullys »Te Deum« von 1677
Ein erstes „Bild“ – Feierliches Versammeln und Einstimmen in das Gotteslob als Tableau
Ein zweites „Bild“ – Das Gotteslob der umfassenden Kirche
Ein drittes „Bild“ – Schau und Verherrlichung der göttlichen Trinität; Gewissheit über die Wiederkehr des Herren
Ein viertes „Bild“ – Die Besinnung auf sich aus der Erfülltheit durch die Gottesschau
Ein fünftes „Bild“ – ein Epilog
Die »Arbeit«
mit
der musikalischen Artikulation – Das Gotteslob als konstruktiver Umgang mit dem „eigenen Gott-Loben“ in Lullys »Te Deum«
Singen ist Artikulation im Dienste einer Selbstrepräsentation; es gehorcht bzw. dient einem Voranschreiten als persönliche Aktion.
Gestaltung als ein Akt generativer musikalischer Pragmatik
Das von Lully entworfene Singen ist Ausdruck einer entwickelten Religiosität.
Versuch einer interpretatorischen Annäherung an eine mögliche Handlung von Lullys »Te Deum«
Ergänzendes Resümee
Über »Religiöse Musik« – ein Vorwort
Im folgenden soll über drei exemplarische „musikalische Entwürfe“ gesprochen werden:
über Claudio Monteverdis der „Heiligsten Jungfrau“ gewidmete Publikation von 1610, die neben der berühmten sog. »Marienvesper« mitsamt einem »Magnificat« in zwei Fassungen auch die Messe „In illo tempore“ enthält;
über die »Musikalischen Exequien« von Heinrich Schütz, die 1636 erschienen und eine Quasi-Messe (im Sinn der evangelischen Kurzmesse von Kyrie und Gloria) sowie zwei Motetten enthalten;
und schließlich über Jean-Baptiste Lullys »Te Deum« von 1677, ein (scheinbar) durchkomponiertes Großes Gotteslob.
Alle drei haben (auf den ersten Blick) nichts miteinander zu tun, obwohl Schütz auf seiner zweiten Italienreise Monteverdi oder zumindest dessen Musik kennengelernt haben muss und Lully, 1632 in Florenz geboren, erst mit zwölf Jahren nach Frankreich kam. Und doch dokumentieren sie, als menschliches Tätigsein des Singens und Mit-Singens seitens der Adressaten interpretiert, parallele Schritte zur Selbsttätigkeit in Glaubenssachen, die wir in Richtung Selbstbestimmung oder Selbstversicherung (→Schütz) bzw. Selbstbehauptung (→Monteverdi) und schließlich Selbstrepräsentation (→ Lully) genauer wahrzunehmen beginnen.
Fassen wir den zunehmenden Marienkult des ausgehenden 16. Jahrhunderts und danach – vgl. Lassos Spätwerk für Herzog Wilhelm mit den auffallend zahlreichen Magnificat-Vertonungen – als einen Schritt zur Emanzipation (des katholischen Christen) im Sinne einer beginnenden Selbstbehauptung (auch!) über einen persönlichen Zugang zur Göttlichkeit durch die Vermittlung u. a. Marias und stellen wir diesen neben die Vermittlung durch das „Wort“ im lutherischen Bereich, dann könnten der Marienzyklus Monteverdis und ein Zyklus wie der der »Exequien« von Schütz gewissermaßen etwas Paralleles im Zusammenhang religiöser Emanzipation innerhalb der Frühen Neuzeit darstellen. Gleichzeitig wäre durch sie auch der Unterschied in den Emanzipationsrichtungen etwas genauer anzudeuten. Beide Einsichten, die in ein Allgemeines der religiösen Emanzipation des Menschen im 17. Jahrhundert und die in je unterschiedliche Emanzipationsrichtungen einerseits im katholischen und italienischen Süden sowie anderseits im lutherischen und deutschen Norden, eröffnen uns die Möglichkeit, unter dem Blickwinkel eines deutlich implizierten Politischen des musikalischen Handelns am Beispiel von Lullys »Te Deum« auf die spezifisch französische Richtung einer religiösen Emanzipation im absolutistischen Staat einzugehen.
*
Die drei Vorlagen verbinden wir mit dem Begriff der Religiosität bzw. einer „Religiösen Musik“. Der Begriff bezeichnet uns im Zusammenhang des geistlichen Singens am Beginn des 17. Jahrhunderts eine ansteigende Tendenz zum Persönlich- bzw. Privatwerden von Religion. Und er gehorcht einer subjektiven Zuordnung bzw. Funktionalisierung. Während „Geistliche Musik“ einen geneinsamen objektiven Charakter von Kompositionen feststellt, definiert „Kirchenmusik“ solche von einer objektiven Funktion her. Religiöse Musik aber will ich (hier) verstanden wissen als von der Bedeutung für das Subjekt hergeleitete Bezeichnung. In der Frühen Neuzeit beginnen die Menschen nun die Bereiche des Religiösen und des Kirchlichen für sich innerhalb einer „Geistlichen Musik“ zu trennen (die trotzdem über ein bewusstes Handeln der Menschen signifikant sich überschneiden!). Überspitzt gesagt, beginnt schon im 16. Jahrhundert die persönliche Religiosität auch die Kirchenmusik vor allem dort, wo sie für uns heute „große Musik“ darstellt, gleichsam zu unterwandern.
Deshalb sollte in unserer Darstellung, die sich am Beginn auf die beiden Vorlagen von Monteverdi und Schütz konzentrieren wird, auch die in der Regel stets nur pauschal angesprochene Messe in Monteverdis Publikation von Bedeutung sein. Denn vom „Text“ her realisieren die beiden Zyklen eine Verbindung von der selbstbegriffenen Existenzialität des Menschen zur Gottheit, hier durch die „Heilige Jungfrau“ bzw. dort durch das „Wort“. Erstere wird im Ritus der Messe durch den Rückgriff auf eine Motette Gomberts mehr als angedeutet.1Und die Tatsache, dass Schützens »Exequien« auf im wahrsten Sinn „vor-geschriebenen“ Schriftversen basieren, verdeutlicht ja um so mehr die Beziehung des Einzelnen zum angeeigneten „Wort“. Problematischer gibt sich solche Verbindung mittels Lullys Entwurf, bei dem mir die den Singen-Akt betreffende Beziehung weder emotional noch rational, sondern durch eine quasi körperliche Disziplin(ierung) bestimmt erscheint.
*
Auszugehen ist in allen drei Entwürfen vom Singen und Mit-Singen als ein menschliches Tätigsein, das Schütz und Monteverdi und Lully je entwerfen. Unsere generelle Frage lautet: als was ist dieses Singen (und wäre demnach auch unser Hören!) jeweils von sich aus auf der Welt? Es ist die Frage nach dem Selbstverständnis des musikalischen Tätigseins (und der damit musikalisch Tätigen!), das die Zyklen je dokumentieren, das sie gewissermaßen verbindet und in dem sie sich eben auch manifest unterscheiden. Monteverdi, Schütz und Lully machen Menschen singen, „aussprechen“, nicht nur irgendeinen Text; sie versetzen sie aus einem (unterstellten oder klaren) Anlass heraus in Aktivität und schlagen mit ihrem „Vorwurf“ jeweils vor, diese mit einem (scheinbar) selbstzugenerierenden Sinn in einer klaren Situation zu füllen: um selbst diesen Text auf ein „Ziel“ resp. auf eine Folge gerichtet auszusprechen, das/die in der Struktur aber auch in vielen Einzelheiten des Singens einlösbar wird. Dem Singen ist via Monteverdis bzw. Schützens bzw. Lullys Entwurf je eine Intention der Singenden und Mit-Singenden vorgeschlagen. Auf diese hin ist das Singen genauer anzuschauen.
Wir können dieses Singen – um uns von den Entwürfen der „Vorgänger“ wie z. B. der Gabrielis bzw. Praetorius’ abzusetzen – als ein nun wirklich beginnend handelndes Singen ansehen. Dieses ist möglicherweise auch in Monteverdis Messe durch das bewusste Heranziehen der Gombert-Zitate und deren Bekanntgabe so zu nennen, das mit den Rückgriffen bewusst verfährt. Bei Schütz liegt solches von sich aus keineswegs nahe; auch hier wäre nach dem spezifischen Handlungsmoment der Singenden und Mit-Singenden zu fragen. Möglicherweise gehört auch Schützens Deklaration der Verse und Strophen seines Auftraggebers als Quasi-Messe hierher. Und bei Lullys »Te Deum« kann uns schließlich das Singen als eine handelnd durchlebte Eucharistiefeier (im Geiste) erscheinen.
Einen wesentlichen Stellenwert in diesem Singen der ersten beiden nimmt der sog. Choral ein; bei Monteverdi u. a. und besonders der Rückgriff auf die Psalmodieformeln in den Psalmvertonungen, bei Schütz das Heranziehen der Melodien aus dem Schatz des Gemeindechorals. In beiden Fällen haben wir es mit der Besonderheit zu tun, dass die Komponisten Menschen in der Weise (mit-)singen machen, in der diese sich selbst (sozusagen unbewusst) zur Geltung bringen „wollen“: als katholische bzw. evangelische Christen, die sich ein ihrer Lebenswelt entsprechendes Singen (gleichsam als eigenen Ausdruck) angeeignet haben. Nicht Monteverdi oder Schütz „verwenden“ den Choral, sondern die Menschen, die hier singen sollen, werden als diesen bereits Besitzende durch die Komponisten ermächtigt, sich in diesem Singen in ihrem Sinn zur Geltung zu bringen. Darin liegt ein wesentliches Moment ihres Handelns! Sie verhalten sich nicht (nur), sondern verfügen über sich als jeweils „den Choral“ Besitzende bzw. eben als spezifisch evangelische oder katholische Christen!
Bei Lully ist mir ein Bezug zur choralen Singweise nicht aufgefallen; doch werden wir sehen, dass auch dort der aus der eigenen Religiosität abzuleitende „Besitz“-Anspruch (an sich selbst) ein Stück weit bestimmend ist.
*
Das Lesen dieser Studie setzt (wie bei fast allen meinen Texten) etwas voraus: Der Leser sollte mit der europäischen Musik als Gegenwart und Geschichte im Kontext der europäischen Kulturgeschichte vertraut sein; und er sollte von jenen Kompositionen, über die hier gesprochen wird, eine durch eigenes Singen und/oder Spielen, zumindest aber durch ein professionelles Hören erworbene Vorstellung in seine Lektüre investieren können. Viele, die Bücher „über Musik“ lesen, wollen durch sie „etwas“ über Musik erfahren. Ja oft soll, ja muss das Lesen als Ersatz für eine Selbstbeschäftigung mit ihr dienen.
Solches aber wäre hier vollkommen ergebnislos. Denn meine wissenschaftlichen Texte handeln letztlich von der Erfahrung, die man mit jenen musikalischen Entwürfen machen kann, über die hier gesprochen wird, u. d. h. von solcher Erfahrung, die man bereits gemacht hat. Sie versuchen das, was man selbst (und was nicht zuletzt der Autor selbst) erfahren hat, in eine Plausibilität und darüber in ein neues, eigenes Bewusstsein von europäischer Musik und ihrer Geschichte zu heben.
Selbstverständlich kann (und soll) man für sein musikalisches Tätigwerden wissenschaftliche Literatur auch anderer Autoren hinzuziehen. Aber der Sinn meiner Texte liegt weder darin, diese zu referieren, noch sie zu korrigieren. Denn meinen Texten liegt ein eigenes Denken von Musik zugrunde, das ich in der Regel als musikpädagogisch bezeichne. Es geht (wie bereits angesprochen) von Musik als einer menschlichen Tätigkeit aus einem Interesse am Menschen als musikalischen, nicht aber vom sog. musikalischen Kunstwerk aus. Um diesen Menschen als musikalischen in seiner historischen Entwicklung als Kulturwesen sowie in seinem spezifisch musikalischen Tätigwerden begrifflich zu fassen, benütze ich einige ungewöhnliche Wortbildungen, wie etwa »Vorwurf« (oder einfach „Entwurf“) für eine vorliegende Komposition als Vorlage und Entwurf eines musikalischen Tätigseins, »mit-singen« (stets mit Bindestrich) als spezifischen Begriff für ein inneres Mitvollziehen des musikalisch Ausgesprochenen (u. d. h. für eine bestimmte Art des Hörens im Zusammenhang Singen) und »„aussprechen“« (stets in Anführungszeichen) für ein Tätigsein mit der Singstimme, das sich spezifisch durch das Aussprechen eines Textes hindurch gestaltet.
Schließlich erscheint es – trotz der zahlreich eingestreuten Notenbeispiele, die zum Text gehören und also stets „mitzulesen“ sind – sinnvoll, sich entsprechende Notentexte und CD-Aufnahmen zur Lektüre bereitzulegen (falls man die jeweils angesprochene „Musik“ nicht über ein inneres Hören vergegenwärtigen kann). Auf die hier herangezogenen Notentexte und entsprechende Schallplatteneinspielungen verweisen die Anmerkungen zu „Materialien“ am Schluss des Buches.
Osnabrück, im Oktober 2019
1Die Messe, die durch den Rückgriff auf die Motette „In illo tempore“ Gomberts gekennzeichnet ist – vgl. u. –, erscheint zwar ganz real als ein Singen in seinem Geist. Doch in der Messe realisiert sich damit nicht nur eine Teilhabe (der Adressaten) am Ritus, an der Liturgie im traditionellen Sinn, sondern über den Lukastext Gomberts verbindet sich die Teilhabe mit einer Verehrung der Gottesmutter. Darauf weist ja auch der Titel.
I
»MARIA – FELIX PORTA COELI«
Zu Monteverdis sog. »Marienvesper« im Marienzyklus von 1610
Mit dem Datum 16102 erschien in Venedig Monteverdis Marienzyklus im Druck. Die sieben Stimmbücher und die „partitura“ (= die unbezifferte Generalbassstimme für die Orgel mit teilweisen Eintragungen zu Stimmeinsätzen) enthalten die sechsstimmige Messe „In illo tempore“, Stücke zu einer Quasi-Vesper (= der sog. Marienvesper) mitsamt dem Magnificat in zwei Entwürfen, einem für sieben Vokalstimmen und sechs Instrumente3 und einem für sechs Stimmen und Generalbass.4
Im Einzelnen enthält der Druck folgende Stücke:
Sicherlich „kennt“ man daraus vor allem die sog. Marienvesper oder den ersten der Magnificat-Entwürfe; man hat sie, wenigstens in Teilen, im Laufe seines Lebens öfters gehört, vielleicht sogar einmal als konzertante Aufführung erlebt. Und doch lässt vielleicht erst eine Begegnung mit dieser Musik im Alter einen mit fast ohnmächtiger Bewunderung und mit vielen Fragen zurück. Es erscheint unglaubhaft, dass diese Musik als eine per se liturgische entstanden sein sollte; und es erscheint (mir) ebenso unglaubhaft, dass Monteverdi sie gleichsam per se (und als eine Art Bewerbung für einen Gunstbeweis in Rom etwa) komponiert haben sollte. Wer aber in den Ausgaben und in der Literatur ebenso wie in den oft ausführlichen Kommentaren zu Einspielungen nach Aufklärung über das Selbstverständnis dieser Musik sucht, der stößt fast ausnahmslos auf Versuche, sie als eine liturgische Musik für eine „Vesper“ im ausdrücklichen Sinn zu verstehen und entsprechend zu „bearbeiten“: durch Umstellung von Teilen und/oder durch Hinzufügung von Antiphonen (zu den Psalmen).7 Erst in Helmut Huckes bemerkenswertem Beitrag vom Musikwissenschaftlichen Kongress 19818 findet er Einsichten, mit denen er sich das Vorliegende einigermaßen plausibel machen kann. Doch wären auch diese – Hucke handelt nur von den Psalmen und Concerten der sog. Vesper – in Bezug zum gesamten Druck ergänzungsbedürftig.
Offensichtlich ist es auch nicht selbstverständlich, zur sog. Marienvesper einen gültigen bzw. brauchbaren Notentext zu finden. „Brauchbar“ meint: entweder brauchbar für die Dokumentation des von Monteverdi Hinterlassenen oder brauchbar für das Aufführen bzw. Hören. Denn der sehr spärlich überlieferte Druck Monteverdis ist für die Ausführung – wer genau soll wo singen oder spielen? – und für die Ordnung des Ganzen eher fragmentarisch gehalten. Dies mag z. T. einer selbstverständlichen Freiheit der Ausführenden (in dieser Zeit) entsprechen, wirft aber im Zusammenhang dieses Zyklus vermeintlich das Problem auf, wie das im Druck Vorgelegte überhaupt zu verstehen wäre. Gleichzeitig geben aber Gesamttitel und Einzeltitel (scheinbar) ebenfalls Rätsel auf.
Neben einem 1992 in Belgien erschienen Faksimile (vgl. Whenham9, S. 121), mit dem nur Spezialisten arbeiten können, bietet (nach Whenham, S. 4) Jerome Roche’s Ausgabe in der Edition Eulenburg (No. 8024, London etc. 1994) einen verlässlichen Notentext; für die Messe ist die Ausgabe H. F. Redlichs (ebenfalls bei Eulenburg) hinzuzuziehen. Anderseits mag die von Walter Goehr bei der UE Wien (1956) herausgegebene Partitur der Vespro della Beata Vergine das Herrichten einer Dirigierpartitur für eine konkrete „Aufführung“ anschaulich machen. Eine solche entspricht ja dann auch im Prinzip den (älteren) Einspielungen, wie die von Jürgen Jürgens in der Reihe DAS ALTE WERK (Telefunken). Solche Aufführungen fügen aber den Psalmen – wie gesagt – noch Antiphonen hinzu, um sie im Sinne einer Vesperliturgie zu vervollständigen.
Zum Selbstverständnis der sog. »Marienvesper« und unserer Darstellung
Hucke interpretiert die in der obigen Aufstellung angemerkten Innentitel als (hinzugefügte) Hinweise des Druckers, der hier den Beginn eines neuen „Teils“ kenntlich machen wollte. Maßgebend sei der Gesamttitel:
SANCTISSIMAE / VIRGINI / MISSA SENIS VOCIBUS / AD ECCLESIARUM CHOROS / Ac Vespere pluribus decantandae / CUM NONNVLLIS SACRIS CONCENTIBUS,/ ad Sacella sive Principum Cubicula accommodata./ OPERA / A CLAUDIO MONTEVERDE / nuper effecta / AC BEATISS. PONT. MAX. CONSECRATA./ Venetijs, Apud Ricciardum Amadinum./ MDCX
Gemäß diesem sei das SANCTISSIMAE VIRGINI als eine Art Zueignung an die Gottesmutter, nicht aber als eine liturgische Zuweisung zu verstehen.
(1) Monteverdis Druck von 1610 versammelt »Stücke« zu einem der Virgo sanctissima gewidmeten Tag.
Wir sehen auch, dass der weitere Titel nur die Messe für die kirchliche Liturgie, ohne Festlegung auf ein Fest bestimmt.10 Die „Vespergesänge“ aber – wir sehen sie in der Typographie wesentlich zurückgenommen (wie eine Nebensache) – werden als Komposition für eine höfische Andachtsmusik bezeichnet. Hinzu kommt die bemerkenswerte Anlehnung an den Orfeo im Einleitungsstück („Domine ad adiuvandum me“), das wir hier aber nicht als „Signal“ (wie Hucke andeutet), sondern eher als tatsächliche Eröffnung (im Sinne eines Prologs) anzusehen hätten.
Dass und wie aus der Vesper als „Chorgebet“ der Hofkapelle eine Art geistliches höfisches Festspiel wird (was Hucke ausführlich erörtert), auch dies wäre für uns ein Vorgang einer Aneignung, an der Monteverdi mit diesem Entwurf teilhat und mit der der Hof von Mantua nicht alleine steht. „Den festlichen Komödien, Intermedien, Balletten, Opern wird ein geistliches Festspiel zur Seite gestellt.“ Und dies, die Transposition der Vesper in eine repräsentative musikalische Veranstaltung, meint Hucke (S. 299), sei für die oberitalienische Entwicklung bezeichnend.
(2) Die sog. Marienvesper verwendet u. a. eine den Vespergottesdiensten zugeordnete Psalmenreihe für eine Art „Handlung“.
Die von Monteverdi für dieses Festspiel – wir bleiben vorläufig bei diesem Begriff, auch wenn wir zu der Überzeugung kommen werden, dass die sog. Marienvesper wohl nicht als real zu inszenierendes „Spiel“ gedacht war –, die für dieses „Spiel“ also herangezogenen Texte der Concerte oder Solomotetten erscheinen (nach Hucke) extra für diesen Zweck bearbeitet und zwischen die Psalmen gesetzt, die ihrerseits eine gute Grundlage für eine inhaltliche Folge abgäben11:
„Das Rückgrat der Vesper sind die fünf Psalmen. Dass Monteverdi die Psalmenreihe an Marien- und Jungfrauenfesten wählt, ist ebenso wie sein Ex voto Sanctissimae Virgini und wie die Schlussbitte im letzten Concerto Audi caelum, in der Maria geradezu anstelle des Heiligen Geistes erscheint[…] Zeugnis barocker Marienfrömmigkeit. Überdies ist die Psalmenreihe mit dem Psalm 126, Nisi Dominus aedificaverit domum und mit Psalm 147, Lauda Jerusalem Dominum am Schluss, in dem sich Jerusalem als Gleichnis des irdischen Staats verstehen lässt, für ein höfisches Festspiel weit besser geeignet, als es die Psalmenreihe an Sonntagen und Herrenfesten gewesen wäre.“
Die vermutete inhaltliche Folge aber ist je von der inhaltlichen Deutung der Concertotexte wie auch der Psalmen selbst abhängig. Solche Deutung bewegt sich in einem großen Spielraum, der von der kirchlichen Tradition ebenso wie von mittelalterlichen Spekulationen und zeitgenössischen theologischen Interpretationen ausgefüllt ist.12 Gemäß Hucke und unserem eigenen Verständnis könnte das Thema des Festes die Verbindung von Staat (→ Jerusalem als Sinnbild des himmlischen Staates) und Kirche (→ Jerusalem als Symbol der Kirche) sowie des konkreten Mantua und der göttlichen Trinität sein, vermittelt und personifiziert in Maria (die ja auch selbst als Symbol der Kirche gedeutet wird13). Aber dies wäre in unserer Beschreibung noch zu konkretisieren.
„Es ist offensichtlich,“ so Hucke (S. 304), „dass die Texte der Concerti sorgsam ausgewählt sind und einen Zusammenhang zwischen den Psalmen herstellen.“ Die Concerti „fügen die Psalmen zu einem Libretto zusammen“. Für uns erscheint vorläufig wichtig, dass das, was das Hören (im Falle zumindest des Autors hier) von sich aus vermuten lässt, tatsächlich feststellbar ist: eine „Handlung“; wir werden diese bei der Erörterung der einzelnen Stücke näher anzudeuten versuchen. Die Frage aber – und darüber spricht Hucke nicht – ist für uns: „Wer“ singt hier? Und: Wie gehören diesem Singen etwa die „Sonata“ und der Hymnus (in dieser Reihenfolge!) zu?
(3) Die sog. Marienvesper ist „Geistliche Musik“ (u. d. h. nicht von vornherein „Kirchenmusik“); sie hat etwas mit dem Mantuaner Hof zu tun.
Im folgenden gehen wir davon aus, dass diese Musik (trotz ihrer Widmung an den Papst) nach Mantua gehört. Auffallend ist die Nähe des Singens zu den gleichzeitig entstandenen Mantuaner Opern; und naheliegend ist, dass diese Musik für einen oder (in ihren Teilen) mehrere Mantuaner Anlässe entworfen wurde.
Fraglich bleibt, ob die sog. Marienvesper je als solche realisiert wurde und ob sich in ihr der Hof in Mantua und der Herzog in „geistlichen Dingen“ in analoger Weise wie in den Opern erleben wollten.14 Offen bleibt weiterhin – obwohl die Arbeit in den einzelnen Sätzen (und nicht nur in den sog. „Concerten“) auf eine Personalisierung der Singenvorstellung weist –, ob die „Satzfolge“ einer „Theologie“ Monteverdis sich verdankt. Annehmen können wir: Hier sprechen (im Ansatz) sich Personen aus; hier geht es nicht (mehr) allein um das Aussprechen von Text (durch Menschen). Im jeweiligen Satz und „Aussprechen“ erscheint (mir) eine besondere sekundäre Intentionalität mitkomponiert.15
Es ist demnach zuerst einmal nicht allein Monteverdi, der hier eine „neue“ Geistliche Musik (und wohl schon gar nicht eine „Kirchenmusik“ per se) erfindet – wie weit dies seines Amtes gewesen wäre, das galt lange als umstritten –, sondern es sind wohl Situation sowie literarisches und spekulatives künstlerisches Denken am Mantuaner Hof, die hier „Musik“ zu einem angedeuteten Geschehen „hervorbringen“, die freilich Monteverdi konkret entwirft. Wenn wir lesen16,
„Die Marienvesper stellt nichts Geringeres dar als den Versuch, die vielfältigen Ideen über Kirchenmusik, die um 1600 überall in Italien entstanden waren, zu ordnen, zu kodifizieren sowie sie exemplarisch in gleichermaßen „klassischen“ Kompositionsarten zu verwirklichen und zu präsentieren wie die alte Vokalpolyphonie. Der Druck von 1610 ist Manifest und Retrospektive zugleich, ein Manual über geistliche Musik und die Möglichkeiten der Kirchenkomposition.“,
so halten wir dem entgegen, dass Monteverdi hier zwar seine Verfügung (wie wir sagen) über sich als Komponist demonstriert, der Zweck solcher Verfügung und gewaltigen Arbeit aber nicht in sich selbst liegen könne: diese muss einen Anlass haben und auf konkrete situative Gegebenheiten bezogen sein, die (in Grenzen, ähnlich wie bei Schützens „Exequien“) freilich übertragbar erscheinen, sonst wäre eine Veröffentlichung über den Druck (bei aller Motivation zur Dokumentation) zu jener Zeit und in diesem Alter Monteverdis17 nicht denkbar. Neben dem Anlass, der durch einen mehrfachen der einzelnen Teile substituiert werden könnte, suchen wir aber nach einem Ziel, das aus dem So-Singen selbst resultiert; und dies vor allem dann, wenn man die sog. Marienvesper eben nicht als eine „Kirchenmusik“ betrachtet.
Wir können annehmen, dass Monteverdi mit dieser Messe, der sog. Marienvesper und dem Magnificat gleichsam einen Marienzyklus vorlegte, dessen Teile durchaus in auftragsgestützten Mantuaner Zusammenhängen entstanden sein können (und wohl werden), die möglicherweise als Zyklus sehr bewusst als eine Art Folge zusammengestellt sind; das gilt ebenso für die sog. Marienvesper. (Solche Zusammenstellung schließt Monteverdis Versuch, die Teile evtl. auch als einzelne zu vermitteln, nicht aus.) Möglicherweise handelt es sich um einen sehr gezielt auf den Zugang der Adressaten zur Figur der Maria als persönliche Vermittlerin innerhalb ihres Glaubens hin entworfenen Zyklus, der die Messe ganz bewusst als eine wesentliche Lebenssituation einbezieht.18
(4) Der Druck von 1610 bzw. die sog. Marienvesper sind Ausdruck einer Religiosität des Mantuaner Hofs bzw. seiner Mitglieder.
Im folgenden wollen wir die Vespro della Beata Vergine – da concerto, composta sopra canti fermi – so der Innentitel in der Generalbassstimme – als Ausdruck einer tendenziell persönlichen Religiosität betrachten, als ein „Spiel“ von der Verehrung, ja besser: von der „Erhebung“ Mariens.19 Die Teile einer Vesper (die fünf Psalmen für die Marien- und Jungfrauenfeste und der Hymnus) sind hier als Teile einer religiösen höfischen Festmusik (→ „da concerto“) entworfen und gleichzeitig wohl mit Absicht unter Einbezug des Cantus firmus „gesetzt“.20 Gleichzeitig erscheint die Verehrung Mariens mit Momenten des Pastoraldramas angereichert, sodass Maria fast als so etwas wie eine Frühlings- und Muttergottheit erscheint. So, wie Apoll am nachträglich veränderten Schluss des Orfeo im Gnadenakt christusähnliche Züge annimmt, so nimmt Maria hier die Züge einer „lebensspendenden“ Gottheit an: „Omnes hanc ergo sequamur, qua cum gratia mereamur vitam aeternam.“ (Dann lasset alle uns ihr folgen, durch deren Gnade wir das ewige Leben erringen.) Der für die Interpreten z. T. rätselhafteste Einschub in die Vesper, das Audi coelum, aus der dieser Aufruf stammt, findet so eine finalen Sinn erschließende Erklärung. Ziehen wir das (ebenso im Zusammenhang einer wirklichen Vesper fragwürdige) Duo Seraphim heran – in welchem zwei Engel verkünden „Tres sunt, qui testimonium dant in caelo: Pater, Verbum et Spiritus Sanctus…“ (Es sind drei, die Zeugnis geben im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist.) –, dann können wir dieses „Spiel“ mit aller Vorsicht als eines von der Erhebung Mariens sozusagen zur Quasi-Gottheit per Zeugnis der Heiligen Trinität interpretieren. Erst aus dieser Interpretation auch wird die „Litanei“ der Sonata (an dieser Stelle!) als „Reaktion“ verständlich, als ein „Bild“ oder ein prozessionshaftes Geschehen, das durch instrumentale Gesten angedeutet erscheint. Durch sie erfüllt sich die „Erhebung“ in der entscheidenden Funktion: dem irdischen Glaubenden als Vermittlerin zu dienen und (in der Sonata sopra…) auch angerufen zu werden.
(5) Der räumliche Ort des Auslebens solcher Religiosität bleibt uns (heute) ebenso unbekannt, wie der soziale.
Die Frage nach einem möglichen Ort für ein solches Festspiel können wir kaum beantworten. Zwar liefert der Gesamttitel des Drucks von 1610 einen wesentlichen Hinweis, dessen zweiter Teil, …ac Vespere pluribus decantandae cum nonnullis sacris concentibus ad Sacella sive Principum Cubicula accommodata, die „…feierlichen Vesper[-gesänge] für mehrere (Stimmen) mit einigen geistlichen Concerten“ einer Eignung „für die Kapelle oder die fürstliche Kammer“ zuweist.21 Von da könnten wir sowohl die alte Hofkirche S. Croce in Corte als auch die (alte!) Sala dei Specchi annehmen; auch die neue Palastkirche, die Basilika S. Barbara, käme bereits infrage.22 Doch bleibt uns auch der soziale Ort verborgen: Offensichtlich ist dieser als eine semiprivate religiöse Handlung als etwas der Sacra Rappresentazione oder dem mittelitalienischen Oratorium Paralleles anzunehmen: die Zusammenstellung der Teile zu einer Art Rappresentazione schafft (sich!) erst den sozialen Ort, die ihr entsprechende Lebenssituation. Immerhin können wir die Quasi-Versper als Dokument einer (zeittypischen) Aneignung des geistlichen Singens durch die Adressaten betrachten! Anderseits ist der Titel so gehalten, dass das entworfene Singen eben losgelöst von einem ursprünglichen (spezifisch Mantuaner?) Handlungsrahmen verwendet werden kann. Darauf weist vor allem der Innentitel der Vesper selbst.
Die oft gestellte Frage, ob die „Vespro…“ ein Werk oder eine Zusammenstellung für eine Gelegenheit wie (z. B.) eine Vesper sei, beantworten wir uns also umgekehrt: als Gesänge aus der Vesper, aber angereichert durch „Concerti“. Dem widerspräche der Innentitel eigentlich nicht; er bezeichnete die „Vespro…“ als eine (besondere Art von) Vesper. Hinter den Teilen scheint nicht nur ein religiöses Konzept zu stehen (zu dem Hucke einiges ausführt23), sondern auch eine spezifische situative Vorstellung.
(6) Die sog. Marienvesper dokumentiert im Besonderen die für die Frühe Neuzeit charakteristische wachsende »Verfügung über sich als«.
Literatur und Vorworte24 (der Partiturausgaben) betonen die vielseitige Verfügung Monteverdis über alles, was kompositorisch damals denkbar gewesen sei. Vom Einbezug des cantus firmus über Orientierungen am opernhaften Singen und am stile concertato venezianischer Herkunft bis hin zu Partien vergleichsweise weltlichen Singens (im Sinne von Tanzlied). Doch trifft dies allein nicht das Wesentliche, das darin liegt, wie hier und warum so Monteverdi mit den Möglichkeiten umgeht! Auffallend ist, dass die einzelnen Teile in den stimmlichen Voraussetzungen sich auffallend heterogen geben, – eben wie unterschiedliche Szenen einer „Handlung“! Monteverdi komponiert noch nicht für ein Ensemble als eine feststehende Größe; ein solches Bewusstsein war damals noch nicht möglich! (Ein „Orchester“ oder ein „Chor“ sind noch keine Denkgrößen.) Monteverdi und die Zeit denken noch von real menschlichen Singenden („Stimmen“) her, die sich tendenziell mit einer Vorstellung von Rollen, die die Singenden vertreten bzw. innehaben (Stimmen), verbinden und dafür als Parte in einem musikalischen Satz (Stimmen) notiert werden, Vokal- und Instrumentalstimmen gleichzeitig sein können.25
Wenn wir davon ausgehen, dass Monteverdi ein Singen als Vorstellung eines personalisierten „Aussprechens“ entworfen hat, dann beziehen wir das Singen der Psalmen als tendenziell personalisiertes mit ein. Auch auf die Frage, wer sich hier („als…?“) im Mit-Singen wie und warum so zur Geltung bringt, wissen wir nur eine ungefähre Antwort. Wir vermuten, dass sich in den Teilen der sog. Vesper Personen oder eine höfische Gesellschaft als „ein Volk Gottes“ in herausgehobener Weise zur Geltung bringen wollen; auch so gesehen gehören alle Teile des Drucks zusammen.
Von da könnten wir als eine Art roten Faden der „Handlung“ der sog. Marienvesper die Erschaffung (der Andachtsfigur) der »Maria – felix porta coeli« annehmen, wie sie direkt auch zweimal, im Audi coelum und im Hymnus, benannt wird. Doch tritt die Gestalt der Maria selbst nicht auf; vielmehr wird in den die Erhebung Mariens andeutenden „Bildern“ – wir wagen diese These jetzt einmal – vorgestellt, in welcher Weise die sog. christlichen Kardinaltugenden personell wirksam werden resp. in die Welt kommen: Liebe, Hoffnung und Glaube, diese könnten die drei „Bilder“ betreffen, die die drei mal drei inneren Sätze der sog. Marienvesper, die eigentliche „Handlung“ also, ausmachen. Versuchen wir, uns diese im folgenden als eine solche anschaulich zu machen, aus der die Sonata sopra…, der Hymnus und auch das Magnificat als daraus resultierend einsichtig werden können.
Zum Rahmen einer möglichen „Handlung“ der sog. »Marienvesper«
Sinnvollerweise sollten wir erst einmal davon ausgehen, dass die für uns fassbare „Handlung“ des Festspiels aus den fünf Psalmen und den zwischen oder vor sie gesetzten Motetten inform von Concerten besteht. Auch Hucke sieht wohl in dem letzten der Psalmen gewissermaßen ein Ende, denn er bezieht weder die Sonata sopra… noch den Hymnus „Ave maris stella“ in seine Erwägungen zu einem möglichen „Libretto“ ein.26 Doch abweichend von Hucke wären das einleitende „Domine ad adiuvandum“ sowie der (vermeintlich) abschließende Hymnus und die ihr vorausgehende Sonata sopra… vorläufig als eine Art Rahmen zu betrachten, in welchem die Adressaten unmittelbar auf das „Spiel“ hin einbezogen werden. Eingangssatz, Sonata sopra… und Hymnus sind Teil der Inszenierung der Teilhabe der Adressaten an jenem „Spiel“, das sie sich (im übertragenen Sinn) veranstalten.