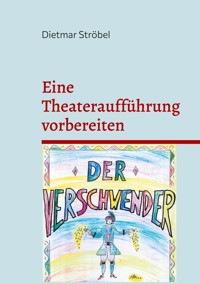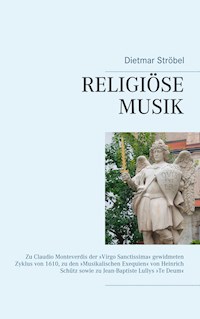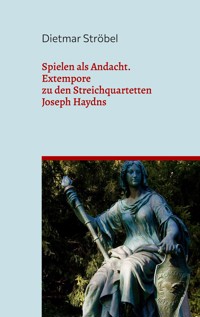
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Spielen als Andacht" ist unmittelbar aus dem Hören der Streichquartette Joseph Haydns anhand von CD-Einspielungen (vor allem des Kodály-Quartetts) formuliert. Hat Haydn das Streichquartett "erfunden"? Sicher nicht! Und doch: wenn auch andere Komponisten, voran Luigi Boccherini, seinerzeit entsprechende Entwürfe für zwei Violinen, Viola und Violoncello vorlegten, so war es eben Haydn, der solches instrumentale Spielen in, ja als "Andacht" in einem quasi-religiösen Sinn entwarf und es damit in eine Ernsthaftigkeit hob, die, von Mozart angefangen, allen folgenden Komponisten zum Maßstab wurde. In Haydns Quartetten wendet sich instrumentales Spielen sozusagen (zuerst) dem Spielenden und dann auch dem Mit-Spielenden (= Hörenden) zu. Es versetzt diese in eine Art hingegebene Konzentration, die sich, wenn auch zugegeben spekulativ, als wohl noch unmittelbar aus einer selbstverständlichen Religiosität des Komponisten herleiten lässt. Die "Quadros" Haydns, als ein Selberspielen "entre nous" entworfen, erscheinen uns so zumindest ab dem sog. Op. 9 als eine abschließende Etappe religiöser Emanzipation innerhalb einer spezifisch katholischen Welt am Ende der Frühen Neuzeit. Indem wir ihnen als einer Art Andacht begegnen, in der persönliche Religiosität bzw. religiöse Ausgangssujets in ein emanzipiert-meditatives Spielen und vor allem Mitspielen (= Hören) übertragen und verallgemeinert erscheinen, lassen sie uns die alte Kontroverse zwischen einem angeblichen "Vergnügen des Verstandes" (Haydn) und einem "emotionalen Wert" (Boccherini) obsolet werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
(ZWISCHENTEXTE 5/5)
SINGEN → SPIELEN → HÖREN
Zur »erwachsenen Musik« der Frühen Neuzeit
(1500-1800)
Materialien zu Teilband (5): FINALE
_______________________________________________
Der folgende Text wurde im Wesentlichen beim Hören (u. a.) der Streichquartette Joseph Haydns inform von Hörprotokollen entworfen. Solches Hören geschah per CD (»Kodály Quartet«) in der Zeit der Pandemie und der verschlossenen Bibliotheken. Zur harmonischen Orientierung diente oft nur eine Stimmgabel. Für einige wenige Quartette lag eine gleichsam „antike“ Taschenpartitur (Eulenburg) als Orientierungshilfe vor. Zur Formulierung hinzugezogen wurden nur solche Schriften, auf die ich in meinem häuslichen Handapparat zugreifen konnte.
Dietmar Ströbel, 2020/2021
»[…]die – ohnehin problematische – Antinomie von wortgebundener und instrumentaler oder „absoluter“ Musik war Haydn fremd, die letztere zu seiner Zeit als Kategorie überhaupt unbekannt. Dennoch wird er, da er ihr den Weg bereitet hat, nur zu gern für sie reklamiert. / Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang eine Frage bislang allzusehr vernachlässigt worden – diejenige, ob das für Haydn postume Denkmodell „absolute Musik“ nicht ältere, angemessenere Maßgaben verdrängt haben könnte, die, von der präzis bestimmten Bildlichkeit der „Affekten“ herkommend, das Hören klarer, exakter und rationeller jeweils auf bestimmte Typologien, Bedeutungsfelder und dergleichen orientierten.«
Peter Gülke, Nahezu ein Kant der Musik (rev. Fassg.), in: Joseph Haydn (= Musik-Konzepte 41), München 1985, S. 73
Inhalt
Zum Selbstverständnis
I. Quartettkomponieren als situations-generierendes Komponieren
II. »Sich-Orientieren an…« Näheres zu den Divertimento-Quartetten Op. 1 und 2
III. Komponieren als Bearbeitung einer sich stellenden Aufgabe in eigener Interpretation. Die Streichquartett-Opera 9 und 17
IV. Auf dem Weg zu einer lebensgeschichtlichen Zwischenbilanz. Die Streichquartette Op. 20
V. Der Schritt zum selbstbestimmten Ethos: Spielen und Mit-Spielen als quasi-religiöse Andacht. Die Streichquartette Op. als Konsequenz aus der Erfahrung der eigenen Wirksamkeit
VI. Komponieren auf dem Weg zur Organisation des Mit-Spielens. Die Streichquartette Op. 50, die »Sieben Worte« (Op. 51) und das Quartett Op. 42
Op. 51
·
71
// Op. 50
·
78
// Op. 42
VII. Komponieren aus der Erfahrung eines Sich-Veränderns der eigenen Welt. Die Streichquartette Op. 54/55
VIII. Eine Wendung zur vergleichsweise öffentlichen Andacht? Die Streichquartette Op. 64 (1790)
IX. Komponieren aus dem Selbstreflex. Die Streichquartette Op. 71/74
X. Sich selbst Gegenüberstehen. Die Streichquartette Op. 76
XI. Das eigene Ende denken. Die letzten Streichquartette: Op. und 103
Schlussgedanken
Literaturhinweise
Zum Selbstverständnis
Der folgende Text entstand (1.) auf der Grundlage eines selbstvergewissernden Hörens von Haydns Streichquartetten (u. a.) im Rahmen (2.) eines Bemühens um die endgültige Formulierung einer Skizze zu Haydns Lebensgang1 aus älteren Notizen und gleichzeitig (3.) in der Auseinandersetzung mit Ludwig Finschers Haydn-Monographie2, – und all dies in der Zeit der Corona-Pandemie u. d. h. ohne bibliothekarischen Zugriff auf Partituren und weitere Haydnliteratur außerhalb des häuslichen Handapparats. Ausschlaggebend für die Formulierung waren die eigenen Hörprotokolle sowie die These von einer für die Musik der Frühen Neuzeit so charakteristischen Tendenz zu einem eigenartigen „Selberspielen“, einem Spielen „entre nous“, darüber hinaus schließlich zu einem gleichsam selbstverantworteten Mit-Spielen. Das Hören der Quartette vermittelte aber auch das „Vorurteil“, dass den Streichquartetten sujetmäßige Orientierungen zugrunde liegen könnten, ab op. 9 bevorzugt solche aus Haydns Religiosität. Damit wäre Haydns Entwerfen solchen Spielens für vier Streicher „unter sich“ in den Gang der fortschreitenden Emanzipation einer Religiosität hin zu einer von konkreten Glaubensinhalten losgelösten „Andacht“ einzuordnen. Der Text versucht, das (u. a. von Finscher, aber vor allem vom Autor) an Haydns Kompositionen Wahrgenommene auf die entsprechende Entwicklung der Persönlichkeit Haydns hin mitzuartikulieren. Versucht werden soll auch hier ein (momentanes) Bild von Haydn, in welchem wir das an den Quartetten Erhörte aus der Optik des Verhältnisses Haydns zu den Adressaten seines Komponierens interpretieren und befragen.
1 Vgl. Dietmar Ströbel, Der Komponist und sein Amt… (= Singen → Spielen → Hören…, Teilband (1.)), in Vorbereitung.
2 Ludwig Finscher, Joseph Haydn und seine Zeit, Laaber 2000, hier: 32017; im Weiteren zitiert als „Finscher“.
I. Quartettkomponieren als situations-generierendes Komponieren
Kompositorisches Entwerfen ist auch bei Haydn – wie oben bereits angemerkt – grundsätzlich noch eine „Dienstleistung für“ u. d. h.: es geschieht aus einem Selbstverständnis, anfangs voll und ganz auf einen Auftraggeber bezogen, aber im Laufe des Lebens so verallgemeinert, dass es (durch den Komponisten selbst nach und nach) abgelegt erscheint: aus der Dienstleistung für den bestimmten anderen Menschen wird eine Dienstleistung gleichsam für die Menschheit. Aus der Investition einer (möglichen) „Inhaltlichkeit“ quasi von außen resp. aus vom Komponisten aufgenommenen bedeutsamen Texten oder Handlungen wird eine aus der lebensgeschichtlichen Erfahrung gewonnene.
Seine ersten Streichquartette entwarf Haydn als Quartett-Divertimenti für den Baron Fürnberg, wohl um 1755 (bis 57?). Die überlieferten 10 Werke (heute als Op. 1 und Op. 2 bezeichnet) bilden eine geschlossene Gruppe, „im Zuschnitt einheitlich, im Detail höchst kunstvoll voneinander unterschieden“ (Finscher, 115). Zwar kommt um diese Zeit, als Haydn seine ersten Quartette entwarf, auch Boccherini nach Wien und schreibt ebenfalls erste Streichtrios und erste Quartette. Doch als Unterschied zu Boccherini merkt Finscher Haydns „rhythmischen Elan“ an, seine sehr schnellen Tempi in den Finalsätzen und die motivische Arbeit, – für uns Zeichen für die Ermächtigung zu einer persönlichen Actio des Spielenden! Im Besonderen können wir die motivische Arbeit als Ermächtigung des reproduzierenden Subjekts zum Selbstausdruck, zur Selbstausdrücklichkeit ansehen.3 Sie scheint bei Haydn offensichtlich vorrangig. Zwar hat die motivische Arbeit nicht genuin etwas mit dem Selber-Spielen mittels eines nicht selbst Entworfenen zu tun. Aber die Substanziierung macht den Selber-Spielenden wie auch den Mit-Spielenden anl. der „großen“ Instrumentalmusik gleichsam (sekundär) ausdrucksfähig, als ob er selber „dächte“.
Finscher betont an den Quartett-Divertimenti, dass sich an ihnen zum ersten Mal Haydns Fähigkeit zeige, eine „Musizier-Situation durch die systematische Entfaltung der in der Situation steckenden kompositorischen Möglichkeiten fruchtbar zu machen“. Da es beim Quartett-Divertimento keine Gattungskonvention gegeben habe, „ereignete sich im Divertimento a quattro die Schöpfung einer Gattung »ex nihilo«“. Was Finscher feststellt, erscheint uns zentral wichtig; doch leitet er daraus gleichsam ein grundlegendes Interesse Haydns ab, Gattungen zu perfektionieren. Unsere Perspektive auf Haydn stellt hingegen die Situation in den Vordergrund, in welcher der spezifische Sinn eines musikalischen Tätigseins zum Tragen kommt. Wir können uns Finschers Feststellung gewissermaßen umdrehen, indem wir unterstellen, dass es Haydn darum ging, die in den kompositorischen Möglichkeiten steckenden Mittel für das Gestalten der privaten i. e. persönlichen Situation eines Spielens als Selber-Spielen „entre nous“ fruchtbar zu machen und mit einem Sinn für die Spielenden zu versehen. Was Haydn hier betreibt, das ist von Anfang an ein situationserschaffendes Komponieren. Nur verschiebt sich hier der Situationsbegriff von einem der gegebenen und vergleichsweise äußeren zu einer tendenziell inneren und einer solchen primär des Subjekts. Letzteres findet sich als Spielenden und Mit-Spielenden wieder, als Selber-(Mit-) Spielenden in einer auf sich selbst bezogenen Situation.
Solches gilt vielleicht erst nur ansatzweise in Bezug zu dem Quartett-Spielen bei Fürnberg. Die Situation ist zwar einzig durch die Spielenden erzeugt und durch kaum eine äußere Tradition vorgegeben. Sie ist aber auch eine der Reproduktion: eines Selber-Spielens, das sich prinzipiell eines Äußerungs-Entwurfs eines anderen bedient, also nicht selbst erfunden ist. Und diese ermöglicht den Nicht-Musiker zu einem Sich-Hören(-Machen), möglicherweise (auch) noch als Ersatz für jene „Musik“, die man sich als kleiner Adeliger nicht leisten kann.
Und genau hier setzt Haydn an, vielleicht verstärkt durch die Tatsache, dass er selbst beteiligt ist: er ermächtigt die Spielenden, ihre Situation je zu einer des persönlichen Ausdrucks zu erheben. Die Situation ist keine in allem lebensweltlich vorgefundene, sondern eine notwendig selbstinitiierte und gleichzeitig auf sich als Selberspielenden bezogene. Und sie wird (kraft des haydnschen Entwurfs) zu einer persönlichen des/der Spielenden (und in den späteren Opera schließlich mehrheitlich wohl der Mit-Spielenden). Haydn setzt dies kompositorisch um; er ermächtigt die einzelnen Spielenden je aus ihrer Rolle heraus am Prozess einer tendenziell typisch menschlichen(!) Ausdrücklichkeit teilzuhaben und von der tradierten Rolle z. B. des Generalbasses (in Abhängigkeit von der tradierten Ausstattung einer Situation) tendenziell abzusehen. Jeder Spieler wird über die spezifische Teilhabe an der thematischen Substanz zum eigenen „Ausdruck“ in objektivierter Form ermächtigt. Er gestaltet sich seine Situation selbst (mit); und – wir werden dies im folgenden darzustellen haben – er bringt sich in seiner Teilhabe an der Spezies „Mensch“ zur Geltung.4 (Dies geschieht nicht von heute auf morgen; dies ist eine lange Entwicklung, die sich erst am Ende der Epoche, um 1800, [auch für Haydn?!] typisch und scheinbar zielgerichtet darstellt.)
Man kann und sollte also die Satzfolgen als je dynamische Komponente der Situation ansehen, als ein Hindurchgehen durch ein quasi handlungsmäßiges Geschehen, wobei die beiden Ausnahmen mit dem je langsamen Beginn in der Satzfolge und dem Scherzo in der Mitte eine von den sozusagen regulären Satzfolgen „abweichende“ Ausgangsbefindlichkeit der Spielenden meinen.
Der sich selbst denkende Mensch, der in der Frühen Neuzeit sich zu sehen beginnt, der sieht sich (1.) in einer situativen Befindlichkeit, die er (2.) handlungsmäßig durchlebt. Solche Handlung kann sich als Entfaltung unterschiedlicher Aspekte in der Zeit darstellen, letztlich abstrahiert in den Sätzen der „Sonate“ Haydns. Und sie kann sich als eine Art Handlung entfalten, für deren Akte die Sätze selber stehen: jeder Satz eine menschliche Handlung für sich, und das Ganze als eine momentan gesehene ideale situative Befindlichkeit des Menschen, ja mehr noch, ein
Durch-Erleben eines menschlichen Handlungszusammenhangs. Das Sich-Sehen ist als ein „Sich Wahrnehmen als“ erscheint räumlich angelegt, wie ein Durchschreiten unterschiedlicher existenzieller „Räumlichkeiten“. Diese sind hier noch rein gedanklich gemeint.6 Die Tatsache, dass die motivische Arbeit im Streichquartett in den Stimmen verteilt ist, trägt zu solcher Räumlichkeit bei: sie meint sicher nicht eine Kommunikation zwischen mehreren, wie einst Goethe interpretierte.
Das von Haydn je derartig entworfene Spielen selbst bleibt nicht unbedingt hermetisch u. d. h. allein auf die Spielenden bezogen zu denken, sondern selbstverständlich wird es vor allem in den späteren Quartetten auf einen Kreis von Mit-Spielenden ausdehnungsfähig7: Im Spielen und Mit-Spielen werden resp. sind auch die Mit-Spielenden mit den Spielenden eines Geistes, Vertreter einer befriedeten vernünftigen und mental geeinten Menschheit im Kleinen!
3 Darin scheint ein endgültiges Ablösen etwa eines Bachschen Spielens, dort mittels besonderer Intervallstruktur, angelegt; vgl. dieses noch bei C. Ph. E. Bach und in den Notenbeispielen bei Finscher, S. 108 und 110 / Takte 5 ff.
4 Beachte: Selberspielen ist keine Vorstellung von Haydn, sondern ein Interpretationsbegriff unsererseits innerhalb der tätigkeitsorientierten Beschreibung einer Musik der Frühen Neuzeit. Er gehört zu Haydns Handeln aus dem heraus, was und wie er ist! Vergleichen wir mit Bach, bei dessen Entwürfen der „Ausdruck“ eben in der Intervallstruktur linearen Fortschreitens angelegt erscheint, die gleichsam alle „Stimmen“ benützen. Doch: Bachs Schule des Selberspielens ist (noch) wesentlich eine solche des Selbsterfindens von Spielen; für dieses allerdings vermag er im Rahmen von Präludieren (einerseits) und quasi textausdrücklichem Fugieren (anderseits) alle möglichen „Formen“ seiner Zeit zu rekrutieren und „ausdrücklich“ abzuwandeln.
5 Das Problem ist wohl nun: zu einer personalen u. d. h. wohl „bürgerlichen“ (= alle Menschen im Staate umfassenden) „Form“ zu finden, die den Finalsatz ernst(er) nimmt, ebenso wie den Eingang, und nicht mehr als „Abgang“, sondern als ein Mit-sich-ins-Reine-Kommen entwirft.
Beachte aber: das Streichquartett, anders als die Symphonie, wird mehr und mehr für „Kenner“ entworfen, vor allem ab bzw. nach op. 33; auch das Quartett bedarf des „über sich verfügenden Spielers als…“!
6 Die Verknüpfung musikalischen Fortschreitens mit der Empfindung einer realen Räumlichkeit ist eine Sache einer „Musik des Alters“; ihr werden wir in der Musik des 19. Jahrhunderts begegnen.
7 Vgl. das Umschlagbild von: Dietmar Ströbel, Von Mozart vor und zurück. Modelle zur Musik zwischen 1500 und 2000, Norderstedt 2011; kommentiert ist das Bild ebenda, S. 54, Anmerkung.
II. »Sich-Orientieren an« – Näheres zu den Divertimento-Quartetten Op. 1 und 2
Für das Selbstverständnis der Divertimentoquartette steht die Frage nach dem Sinn des Spielens und Mit-Spielens noch nicht im Vordergrund; noch partizipiert der Komponist am jenem dem Begriff „Divertimento“ innewohnenden Selbstverständnis einer substanziellen „Unterhaltung“ . Trotzdem stellt sich die Frage: woher stammt die Vorstellung vom Menschen, in der sich der spielende und mit-spielende Mensch selbst zur Geltung bringen kann und ganz unwillkürlich will?
Finscher stellt (S. 117) an den als Quartett-Divertimenti bezeichneten und ihrer „Herkunft“ von ausdrücklicher „Unterhaltung“ herrührenden fünfsätzigen Entwürfen für Streichquartett (dem sog. Op. 1 und 2) einen gewissen Widerspruch zwischen „Material“ und „Ausarbeitung“ fest. „Fast durchweg“ scheint ihm „der Komplexitätsgrad der Ausarbeitung höher“ (als in den anderen Kompositionen der frühen Jahre), während er dem thematischen Material „Simplizität“ und Konventionalität zuspricht. Aber vielleicht ist genau dies der entscheidende Beginn Haydns: dem Spielenden ein ihm gewohntes („eigenes“ und „galantes“) thematisches Material anzubieten, mit dem er sich gleichsam selber äußert, um ihm gleichzeitig mit der Ausarbeitung die Möglichkeit zu eröffnen, sich in Ernsthaftigkeit als „denkend“ darzustellen, sich als Mensch ernst zu nehmen. Es ist ein Sich-unterhalten-Machen, das gleichsam eine Haltung verleiht, ohne den Agierenden ihren „Spaß“ zu nehmen. (Haydn nimmt den Anderen als Menschen ernst!)
Und was sind die Mittel? In dem von Finscher wiedergegebenen Beispiel-Divertimento (S. 118 f.; Divertimento in Es, Hob. II:6, I. Satz8) entwirft Haydn einen Prozess der Aneignung; was da musikalisch vor sich geht, das ist „Äußerung“ mittels einer gestischen Figur, von dem einen begonnen, dem zweiten mitgetragen, vom ersten gleichsam in eine Art Bestätigung weitergeführt, worunter zwei die Äußerung wiederholen, worauf nun drei sie gemeinsam erst einmal zu einem Höhepunkt u. d. h. zu einer ausdrücklich bewussten Formulierung hin abschließen. Der lapidare Gang vom Grundton zur Terz, er erscheint als er selbst, als sich aufmachende und hinzielende Geste, die „darzulegen“ scheint, die aber durch die Gestaltung mit dem Triller in der Mitte eine Art Festigkeit bekommt; nicht nur Anfang, Mitte, Ende, sondern wie eine Art besondere Inhaltlichkeit. (Seine Umkehrung im zweiten Teil, im Zuge einer Verdichtung gereiht, gibt sich wie ein „Bedenken“.) Alles scheint auf das je satzmäßige Formulieren einer je besonderen Äußerungsweise gerichtet.
Den Menschen ermächtigen, „sich“ zu äußern, in einzelnen Äußerungsgesten, besser Äußerungsmotiven – ja, es sind nicht mehr „Gesten“, sondern „Motive“, die Bewegung und eine gewisse Inhaltlichkeit miteinander verbinden –, in je kadenziell geschlossenen Äußerungseinheiten (von vorzugsweise 8 Takten). Wichtig erscheint, dass die Äußerung als menschliches In-Aktion-Treten erfasst werden kann und dass solche Aktion je als einzelne und einmalige angeeignet wird. In der Reprise erscheint die „Signalmotivik“ (Finscher?) wie ein Bestätigen der „Äußerung“ der den Beginn aufnehmenden Stimmen, wie ein „sag ich doch“ oder „ja, so ist es“. Da ist etwas Bejahendes am Werk, anderseits verlöscht der Satz; er bleibt relativ offen… Jede Geste als Äußerung transportiert eine mit ihr subjektiv gemeinte Absicht: der in Aktion Tretende „meint“ etwas, er „fragt“, er „bestätigt“ o. ä. Die 1. Violine „bestätigt“ sozusagen mit ihrer „Signalfigur“ das thematisch Geäußerte; und sie führt es auch von sich aus „zu Ende“ (Takte 60-67). Dabei gelangt der Satz in die Dominante, um von da bruchlos in der Tonika weiterzufahren. Harmonisch dreht Haydn auch die Verhältnisse zwischen den Takten um.
Dann das Menuett I: 7-taktig…; Finscher urteilt: „aus einem einzigen Element, dem lombardischen Rhythmus des Anfangs entwickelt, der melodisch erweitert, verkürzt, umgekehrt und dialogisch zwischen den Violinen durchgespielt wird“ (121). Aber was ist sein Sinn?, was ist der Sinn solchen Spielens? Der Rhythmus ist wohl nur äußere „Kleidung“, die das musikalische Vorangehen in besonderer Weise (wie ein „Hinken“) einkleidet. Der Dreitakter am Beginn erscheint wie ein apodiktisches Äußern, das folgerichtig in der Dominante „bestätigt“ und durch einen vierten Takt wie zur „Endgültigkeit“ formuliert erscheint. Zu solcher Apodiktik „gehört“ hier der lombardische Rhythmus; er ist „Folge“ nicht „Ausgang“ der Erfindung. Die Weise des Spielens eröffnet den Spielenden, ihrem Spielen einen vergleichsweise menschlichen Sinn (ein menschliches Als-ob) zuzumessen. Aber da muss noch eine spezifische Inhaltlichkeit sein: dieses seltsame Zurück zur Tonika im zweiten Takt (das Hummel in einem Frühdruck veranlasste, den ersten Takt zu wiederholen – vgl. Finscher 121 –, was aus periodischer Sicht gerechtfertigt scheint). Und diese plötzliche Umkehr des Achtelmotivs zum Schluss des ersten Siebentakters! Beides signalisiert eine Art unentschlossene Entschlossenheit?
Und was „sagt“ das Trio? Spätestens dieses ist der deutlichste Hinweis auf ein mögliches Selbstverständnis und auf die „Quelle“ Haydns. Spätestens hier wird man gewahr, dass die einzelnen Sätze gleichsam ein „Auftreten“ von Menschen als Personen betreffen, aus dem sie die Intentionalität ihrer Bildungen beziehen. Der Satz I wie ein theatermäßiges Auftreten, ein Sich-Umblicken und Mit-den-Augen-Abtasten der Situation, dann das typische Sich-Äußern auf eine bestimmte Art (Takte 15 ff.); die Durchführung wie ein Sichrecht-sicher-Fühlen in der Lokalität und die Reprise als Bestätigen des eingangs Geäußerten, mit einem verlöschenden Schluss als Abgang: „ihr werdet sehen…“ Wer die frühen Quartett-Divertimenti hört, dem drängt sich immer wieder der gleiche Eindruck auf: hinter jedem Satz scheint eine Art Vorstellung vom Auftreten einer Person zu stehen; und deren Typika scheinen beim frühen Haydn (noch) von Theaterfiguren her genommen, wohl von denen der Commedia dell’Arte oder von einer entsprechenden Wiener Spielart. Denn der zweite Satz, das erste Menuett, er erscheint wie das Auftreten nun eines „Alten“, etwas umständlich, mit erwartungsvollem Herzen sich in die Brust werfend. Während das Trio ihn in eine Melancholie (der Erinnerung oder der Hoffung oder der Furcht, sein Ziel nicht zu erreichen…?) versinken lässt, führt das Menuett-Da-capo gleichsam „umso mehr“ auf die Besinnung auf sich selbst zurück. Gerade das Trio erscheint wie eine Pantomime und doch gleichzeitig in ein motivischfigürliches Geschehen transferiert, als ob das musikalische Material selbst es wäre, das ein Fortschreiten gestaltete.
Hinzu kommt das Adagio: „ein Konzert- oder Serenadensatz mit weit ausschwingender Violinkantilene“ (Finscher, 121); ja, mit einer Art Lautenbegleitung. Der Ausdruck der Kantilene ist sentimental, die Begleitfigur signalisiert mit der Klangzerlegung nach oben eine sehnende oder versichernde Art Zuwendung. Auch hier erscheint der Schluss „offen“, wie ein Abtreten in die Kulissen, um der folgenden Szene die Bühne zu überlassen.
Wenn nun das zweite Menuett eher (als das erste) „Tanz“ ist und das Finale sozusagen sich „auf den Kopfsatz ex negativo“ bezieht – das ist wieder Finschers unbedingtes Formdenken! – , dann hätten wir mit den fünf Sätzen durchaus fünf Stationen im Sinne von fünf Auftritten vorliegen. Denn das zweite Menuett, es bezeichnet ein bestimmendes, wie „rechthabendes“ Auftreten; und sein Trio verstärkt hier; es hält die Tonart bei, bildet keinen wirklichen Gegensatz, sondern bejaht das vorher Geäußerte, das die Reprise des Menuetts bestätigt. Dem hängt sich das Finale wie ein Miteinander-Feiern der Akteure an: alles hat ein gutes Ende angesichts eines „Beschwichtigens“ und „Einsehens“; es ist ein Ende ohne Pomp; und das Ende des Satzes ist einfach ein „und damit Schluss!“.
Die Sätze formulieren keine Unterhaltung (im Sinne letztlich eines Sinnlosen) zwischen Menschen, auch keinen Konflikt. Hier treten Menschen auf, sie tun etwas, sie verhalten sich in typischer Weise. Nur: diese Menschen sind hier noch aus „Figuren“ des Theaters bezogen. Und die Folge ihres Auftretens bildet eine angedeutete Konsequenz von Szenen. Aber die Auftretenden kommen nicht zusammen; es geht hier nicht um Kommunikation oder um ein Handeln zwischen mehreren. Der einzelne musikalische Satz steht wohl für den Auftritt eines Einzelnen, den Haydn uns als Verlauf seines Verhaltens und (Sich-)Äußerns vergegenwärtigt. Figur und Prozess erscheinen charakteristisch bezeichnet, ohne dass wir diese konkret machen könnten (und sollten). Denn ist es so, dass Haydn es gelungen ist, „das Auftreten des Menschen“ in einen Vorgang motiv-gestützten Spielens mit einer latenten Intentionalität der tonlichen Bildungen und ihrer Konsequenzen zu fassen, dann hätten wir – ungeachtet der Frage, ob die Zeitgenossen dies „verstehen“ sollten oder gar „verstanden haben“ – eine Erklärung für Erfolg und Wirkung bereits dieser frühen Kompositionen, wie sie Finscher (122 ff.) auch andeutet. Nicht allein das „Konzept“, sondern wesentlich erscheint ebenso der Transfer in die musikalische Abstraktion, das „Erfüllen“ mit einer Art Identität der zeitgenössischen musikalischen (Figur → Motiv) und auch formalen Mittel (→ „Andante“ und „Menuett“ als charakteristische Aktionen) für ein solches Spielen.
Es ist die originelle Idee, sich zu „orientieren an…“, die den lebensbestimmenden Schritt ausmacht. Dabei geht es nicht um eine Orientierung an dem, was und wie (es) andere Komponisten machen, sondern um die eigene, persönliche Begründung des So-Machens. Haydn ist hier tatsächlich ein Schritt gelungen, menschliche „Handlung“ in ein musikalisches Handeln zu transferieren und in die Sinnperspektive der (Mit-)Spielenden zu stellen; zwar leitet sich der Sinn aus der bereits eingeführten Usance gehobener Unterhaltung ab; doch zeigt nicht nur der einzelne Satz bereits Ansätze zu einer „Ermächtigung“, auch das Ganze als in sich geschlossener Zyklus entwirft darin eine in nuce neue Situation, in der die Spielenden und Mit-Spielenden selbst Sinn eines inneren Erlebens des „Menschen“ generieren. Auch Reichardt schildert in seiner Autobiographie das außerordentliche Erlebnis, das der damals 10-Jährige als Geiger mit den „Quatros“ hatte; er beschreibt, wie die „an innerem Gehalt und Charakter immer wachsenden Quartette mir die beste Nahrung und Bildung und zugleich das entzückendste Vergnügen“ gewährt hätten. Dies eben, Vergnügen und Gehalt, sich unterhalten und gleichzeitig als geistig ernstgenommen erleben, dies ist ein Entscheidendes. (Ein wenig ist solches Komponieren auch in die Baryton-Trios eingegangen.)
Machen wir uns klar: Sinngebung ist etwas, was man (im Sinne Kegans) „ist“, nicht etwas, was man „hat“ (also etwa bewusst sich vornehmen könnte)! Man existiert als jemand – auch so ist nun die Zeit der Aufklärung einzuschätzen –, der sich und seinem Leben ständig selbst einen Sinn zu geben sich bemüht. Im Spielen dieser Quartette und im Erleben einer gleichsam menschlichen Ereignishaftigkeit wird das Spielen zu einer per se sinn-vollen Tätigkeit für die musikalisch Tätigen, ohne dass sie letztlich „verstehen“ müssten, was sie dermaßen erfüllte. Wenn es stimmt, dass Haydns erste Quartette „kompositionsgeschichtlich[…] ihrer Zeit voraus“ waren (Finscher, 124), weil sie bei anderen Komponisten kaum Spuren hinterlassen hätten und niemand den vierstimmigen solistischen Streichersatz in einer fünfsätzigen Form aufgenommen habe9, obwohl diese Entwürfe offensichtlich über (unautorisierte?) Abschriften sofort weit verbreitet worden waren, dann kann man hier die besondere Gabe Haydns angedeutet finden, die seine weitere Entwicklung bestimmte: die zur situativen Empathie, die er geistvoll und kompositionstechnisch umsetzte.
8 Von Hoboken wohl versehentlich in seine Gruppe II (Vier- bis neunstimmige Divertimenti…) eingeordnet, wie es heißt.
9 Erst mit dem sog. Op. 9 beginne – so Finscher – um 1770 die eigentliche Auseinandersetzung mit Haydns Quartetten durch andere Komponisten.
III. Komponieren als Bearbeitung einer sich stellenden Aufgabe in eigener Interpretation. Die Streichquartett-Opera 9 und 17
Das ist möglicherweise noch nicht unbedingt ein einzigartiges Konzept zum Selberspielen, aber doch eines, das vorläufig sich in einen Gegensatz zur Sinfonie begibt. Denn die ersten Sätze – vgl. Finscher, S. 401 – sind differenziert und lang und weisen (gem. ihm) keine Ähnlichkeit mit Kopfsätzen der Sinfonien auf. In den Zyklen Op. 9 und 17 steht stets das Menuet oder Menuetto (in Op. 20 auch „Minuet