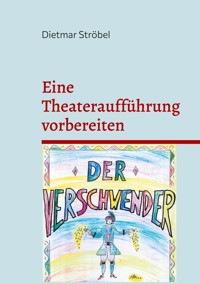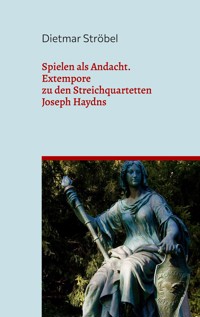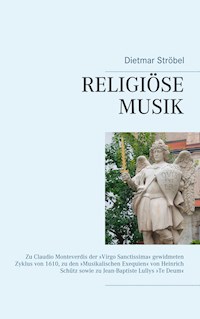Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ich höre Haydn" ist unmittelbar aus dem Hören der Sinfonien Joseph Haydns anhand von CD-Einspielungen (Austro-Hungarian Haydn Orchestra; Adam Fischer) und auf der Basis von Hörprotokollen formuliert. Haydns Sinfonien allein vom Hören her und ohne die überlieferten Partituren anzugehen, entspricht einem Bemühen, die persönliche Vorstellung von diesem Komponisten in Richtung einer annähernd kontemporären hin zu vertiefen. Aus einer eher tätigkeitsorientierten Musikauffassung heraus wird dabei versucht, in spekulativer Weise möglichen Sujets von knapp 60 Sinfonien nachzugehen, die Haydns Komponieren geleitet haben könnten und die für die Singularität der einzelnen Zyklen verantwortlich wären. Eine solche Annäherung an Sinfonien Haydns folgt Giuseppe Carpanis Bericht von 1812, dass Haydn sich "eine Art von Rahmen oder Programm ausdachte, worauf er seine musikalischen Ideen und Farben anbringen konnte"; er habe sich so seine Phantasie erhitzt und sie auf ein vorgegebenes Ziel hingelenkt. Überhaupt scheint ein Hören von vorgestellten Sujets her nahezulegen, dass der Komponist öfters mehrere Sinfonien unter einen gemeinsamen thematischen Rahmen gestellt haben dürfte, so z. B. die Sinfonien 66 bis 68 unter den des Patroziniums "Mariä Empfängnis" der Bergkirche in Eisenstadt. Den Abschluss des Extempores bilden Notizen zu den sechs Späten Messen, die sich einem sujetbegleiteten Hören als "Vokalsinfonien" erschließen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
(Zwischentexte 5/5)
Singen → Spielen → Hören Zur »erwachsenen Musik« der Frühen Neuzeit (1500-1800) Materialien zu Teilband (5): FINALE
Zum Verständnis
Der folgende Text wurde im Wesentlichen beim Hören (u. a.) der Sinfonien Joseph Haydns inform von Hörprotokollen entworfen. Solches Hören geschah per CD (Austro-Hungarian Haydn Orchestra; Adam Fischer) in der Zeit der Pandemie und der verschlossenen Bibliotheken. Zur harmonischen Orientierung diente oft nur eine Stimmgabel. Für einige der Späten Sinfonien lag gleichzeitig die Klavierbearbeitung von August Horn (Peters) als Orientierungshilfe vor.
Joseph Haydn vom eigenen Hören her und nicht (nach wissenschaftlichem Brauch) von den überlieferten Partituren her anzugehen, entsprang dem Bemühen, meine persönliche Vorstellung von diesem Komponisten in Richtung einer annähernd „kontemporären“ hin zu vertiefen. Und solches gliederte sich in ein größeres Arbeitsvorhaben zur europäischen Musik der Frühen Neuzeit ein. Gleichzeitig entstand der Text aber auch in Auseinandersetzung mit Ludwig Finschers überaus lesenswerter Monographie »Haydn und seine Zeit«. Zur Formulierung hinzugezogen wurden, neben älteren Exzerpten und Notizen, nur solche Schriften, auf die ich in meinem Hausapparat zugreifen konnte.
Joseph Haydn war über einige Monate mein Gast; ich glaube, ich habe ihn ein Stück weit tiefer schätzen und zu würdigen gelernt.
Dietmar Ströbel, 2021/2022
„So soll Haydn etwa Carpani verraten haben, er helfe seiner Inspiration dadurch auf die Sprünge, dass er sich »…eine Art von Rahmen oder Programm ausdachte, worauf er seine musikalischen Ideen und Farben anbringen konnte. Er erhitzte also seine Phantasie und lenkte sie auf ein vorgegebenes Ziel hin. «“
(Jak. Joh. Koch 2009, S. 208)
Inhalt
Haydns Wertschätzung und unsere Schuldigkeit. Oder: »
Ich
höre
Haydn«
Zur Gestaltung orchestralen Spielens als Gestaltung einer Situation (und umgekehrt) im Dienst am Menschen
Zu den Sinfonien 1, 2, 4, 5, 18, 10 und 11
Spielen und Mit-Spielen
Spielen und Situation
Zur Steigerung der Ausdrücklichkeit durch den Einbau solistischen Spielens
Die sog. Tageszeiten-Sinfonien 6, 7 und 8,
Le Matin, Le Midi
und
Le Soir
Sinfonien 15, 36 und 33
Die Erweiterung des Ton[arten]- und Spielraumes. Zu den Sinfonien zwischen 1763 und 1772
Sinfonien 58 und 35
Sinfonien 26 (
Lamentatione
) und 49 (
La Passione
)
Sinfonien 43 und 52
Sinfonien 45 („Abschied“) und 44
Sinfonien 46 und 47
»Vier Sätze«
Qualitativer Ausbau und interne Differenzierung. Haydns Sinfonien zwischen 1773 und 1781 auf dem Weg zu einer festen »Gattung«
Zu den sog. Neuerungen
Sinfonien 54 – 55 – 56 – 57
Sinfonien 66 bis 68
»Ich bestärke mICH, indem ich höre.« Zu einigen Sinfonien ab 1782
Sinfonien 76 bis 78
„Die sieben Worte“
Sinfonien 79 bis 81
Der große Schritt zur Abstraktion. Die sog. Pariser Sinfonien
Sinfonien 85, 83 und 84 (incl. 87, 86 und 82)
Sinfonien 88 und 89
Sinfonien 90 bis 92
Haydns persönliche »Revolution«. Vier Sinfonien aus dem ersten Londoner Aufenthalt
Sinfonien 96, 95 und 93
Sinfonie 97
Zwei Londoner Sinfonien »ad hominem«? Zum Gedenken Mozarts und zum Bedenken seiner selbst
Sinfonie 98
Sinfonie 94
Der Mensch, sich spiegelnd in »seiner« Gesellschaft. Zu den Sinfonien 99 und 101
Sinfonien 99
und 101
»Politik als vermintes Terrain«? – Zur Sinfonie Nr. 100
Der altersbedingte Blick des schöpferischen Menschen auf sich selbst. Zu den drei Sinfonien 102 bis 104
Sinfonien 102
und 103
Sinfonie 104
Der Zyklus der sechs Späten Messen als »Vokalsinfonien«, – ein krönender Abschluss der Epoche
Missa in tempore belli (
Paukenmesse
)
Missa S.i Bernardi von Offida (
Heiligmesse
)
Missa in angustiis (
Nelsonmesse
) und
Theresienmesse
Schöpfungsmesse
Harmoniemesse
Kleines Resümee
Wichtigste angesprochene Schriften
1. Haydns Wertschätzung und unsere Schuldigkeit. Oder: »Ich höre Haydn.«
Mit unserem Bewusstsein von Joseph Haydn und seiner Musik geht es seltsam zu. Kaum einen Komponisten ordnen wir selbstverständlicher (s)einem Amt, hier in Eisenstadt bei den Fürsten Eszterházy, zu, und bei kaum einem Komponisten abstrahieren wir dann, wenn wir eine seiner Sinfonien oder Streichquartette hören bzw. eine seiner Klaviersonaten spielen, mehr von der Situation, in der bzw. für die die meisten von ihnen entstanden. Haydn erscheint uns biographisch als Musikbeamter, künstlerisch aber als eine Art autonomer Komponist. Es hat den Anschein, als verberge sich in diesem Widerstreit ein wesentliches Stück Entwicklung Haydns selbst: ein Wille, sich in seiner Situation je optimal gerecht zu werden, einer Situation allerdings, die sich ihm und die er sich, je älter er wurde, zu einer Allgemeingültigkeit veränderte (ohne dass die Welt um ihn in gleicher Weise sich verändert hätte). Während Haydn in eine bürgerliche Öffentlichkeit hineinwuchs, als er diese selbst mit definierte, sozusagen ihr Teil wurde, blieb er für seine Dienstherren in Eisenstadt der Domestik, der auf Befehl zu fungieren hatte. Die Tatsache, dass Haydn dies u. a. mit seinen letzten Messen für Eisenstadt auch konnte, hebt ihn umso mehr aus der Vielzahl der zeitgenössischen Wiener Komponisten heraus.
Haydn hat den Widerspruch in seiner Wertschätzung durch die Umwelt (gegenüber seinem Selbstwertgefühl?) einmal in einem sehr launigen (und oft zitierten) Brief vom 9. Februar 17901 an seine Wiener Freundin und Gönnerin Marianne von Genzinger ausgedrückt, in welchem er den typischen Ortswechsel vom Esterhazyschen Winterquartier in Wien zurück nach Eisenstadt thematisierte:
"Wohl Edl gebohrne
Sonders Hochschätzbarste - allerbeste Frau von Gennzinger
Nun - da siz ich in meiner Einöde - verlassen - wie ein armer waiß - fast ohne menschlicher Gesellschaft - traurig - voll der Errinerung vergangener Edlen täge - ja leyder vergangen - und wer weis, wan diese angenehme täge wider komen werden? diese schöne gesellschaften? wo ein ganzer Kreiß Ein herz, Eine Seele ist - alle diese schöne Musicalische Abende - welche sich nur dencken, und nicht beschreiben lassen - wo sind alle diese begeisterungen? - weg sind Sie - und auf lange sind Sie weg. wundern sich Euer Gnaden nicht, daß ich so lange von meiner Danksagung nicht geschrieben habe! ich fande zu Hauß alles verwürt, 3 Tag wust ich nicht, ob ich CapellMeister oder Capelldiener war, nichts konte mich trösten, mein ganzes quartier war in unordnung, mein Forte piano, das ich sonst liebte, war unbeständig, ungehorsam, es reitzte mich mehr zum ärgern, als zur beruhigung, ich konte wenig schlafen, sogar die Traume verfolgten mich, dan, da ich an besten die Opera le Nozze di Figaro zu hören traumte, wegte mich der Fatale Nordwind auf, und blies mir fast die schlafhauben von Kopf; ich wurde in 3 tagen um 20 Pfd. mägerer, dan die guten wienner bisserl verlohren sich schon unterwegs, ja ja, dacht ich bey mir selbst, als ich in mein. Kost Hauß stat den kostbahren Rindfleisch, ein stuck von einer 50 Jährigen Kuhe, stat den Ragou mit kleinen Knöderln, ein ledernes Rostbrätl, stat den so guten und delicaten Pomeranzen, einen dschabl oder so genanten graß Sallat, stat der backerey, düre Äpflspältl und Haslnuß - und so weiter speisen muste, - ja ja dacht ich bey mir selbst, hätte ich jezo manches bisserl, was ich in wienn nicht habe verzöhren können - hier in Estoras fragt mich niemand, schaffen Sie Cioccolate - mit, oder ohne milch, befehlen Sie Caffe, schwarz, oder mit Obers, mit was kan ich Sie bedienen bester Haydn, wollen Sie gefrornes mit Vanillie oder mit Ananas? hätte ich jez nur ein stück guten Parmesan Käß, besonders in der Fasten, um die schwarzen Nocken und Nudln leichter hinab zu tauchen; ich gabe eben heute unsern Portier Commission mir ein baar Pfund herabzuschücken.
Verzeihen Sie allerbeste gnädige Frau, daß ich Ihnen das allererstemahl mit so ungereimt. gezeug, und der Elenden schmirerey die Zeit abstehle, verzeihen Sie es ein. Mann, welchen die Wienner zu viel gutes erwisen haben, ich fange aber schon an, mich nach und nach an das ländliche zugewöhnen, gestern studirte ich zum Erstenmahl, und So zimlich Haydnisch..."
In der Wertschätzung post mortem hat Haydn sehr unterschiedliche Phasen durchlaufen müssen. In der Konzert-Kultur bald durch Mozart und vor allem Beethoven in einen Schatten als sog. Vorläufer gestellt, galt er noch nach dem zweiten Weltkrieg als der „alte Papa“, als der gewissermaßen noch nicht ganz gleichberechtigte Klassiker. Erst nach und nach setzte sich – vermittelt nicht zuletzt durch Platteneinspielungen des gesamten Sinfonie-Werkes – wieder ein breites Wissen von ihm und eine Einsicht in seine Funktion durch, nicht nur als Wegbreiter, sondern als „großer“ Formulierer der europäischen klassischen Musik. So steht Haydn heute wieder neben Mozart; und er wird wieder unabhängig von Beethoven gewürdigt.
*
Im folgenden ist über Sinfonien2 Joseph Haydns zu sprechen; nicht über alle 108, aber doch über eine solche Auswahl, dass Lesern (des Essays) und gleichzeitig Hörern der Sinfonien ihr „Verhältnis“ zu Haydns sinfonischem Schaffen einsichtiger werden könnte.
Die folgenden Notizen zu den Sinfonien Joseph Haydns entstanden im Zusammenhang der Bemühungen, die eigenen Aufzeichnungen zur Lebensgeschichte dieses Komponisten zu einer biographischen Darstellung zusammenzufassen; und sie entstanden in der Zeit der Pandemie und der Sperrung öffentlicher Einrichtungen. Und dabei fiel mir – gerade aus der Konzentration auf die im häuslichen Handapparat mir vorliegende Literatur (incl. einiger älterer Exzerpte) und im Besonderen auf Ludwig Finschers hervorragendes Haydn-Buch3 – die Leere und Kahlheit der Erfahrung mit diesem Komponisten auf. Einerseits notieren wir, wann Haydn welche Opern, welche Sinfonien oder Streichquartette entwarf, dass er zu bestimmter Zeit Baryton-Trios schrieb oder schottische Lieder komponierte… Anderseits aber bleibt solche Angabe in sich Täuschung; wir wissen gar nicht (genau), wovon wir reden. Es mangelt uns nicht nur an konkreten Daten aus dem Leben und d. h. zu den konkreten (musikalischen) Ereignissen, sondern in der Regel auch schlicht an eigener Spiel- und Hörerfahrung mit jenen „Sachen“, mit denen wir üblicherweise sein Gelebthaben zur Kenntnis nehmen. Eine Bachbiographie verbinden wir (in einem gewissen Alter selbstverständlich) mit der fraglosen Kenntnis der großen Vokalwerke und Orchestermusik, mit der eigenen Spielerfahrung im Bezug zur Klavier- und/oder Orgelmusik sowie – wenn man Jahrzehnte seines Lebens z. B. regelmäßiger Sonntagsradiohörer war – mit wiederholter Hörerfahrung der meisten seiner Kantaten. Und unser Bild von Beethoven verbindet sich selbstverständlich mit der Kenntnis seiner Sinfonien, seiner Klaviersonaten und Streichquartette, vielleicht auch einiger sonstiger Kammermusik (wie der Violin- und Cellosonaten); auch sein Fidelio oder seine Musik zu Egmont gehören fast selbstverständlich zu unserem „Besitz“. In der Regel fehlt uns aber solche Erfahrung in Bezug zu Haydn. Daran ändert auch die Auseinandersetzung etwa mit Finschers großer Haydn-Darstellung nichts, im Gegenteil. Eine solche Lektüre macht uns bewusst, wie abstrakt unser Bild von Haydn sich gestaltet: einerseits zentral auf sein „Werk“ bezogen und damit vom Lebensgang weitgehend abstrahiert; anderseits werden wir uns dessen bewusst, wie wenig Erfahrung mit und bleibenden Eindruck von Haydns Sinfonien, Streichquartetten oder Klaviersonaten wir wirklich haben, von seinen Opern ganz zu schweigen. Auch eine aktive Erfahrung mit Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ dürfte heute die Ausnahme sein.4
Da bleibt eigentlich nur: solche Erfahrung als kulturell Erwachsener möglicherweise unter dem Vorzeichen einer Musik der Frühen Neuzeit und z. T. privat medial nachzuholen; und dies nicht (nur), um pflichtgemäß auch Haydns Sinfonien (und anderes von ihm) zur Kenntnis zu nehmen, sondern um das, was uns Literatur von ihm übermittelt, (1.) näher an das Subjekt heranzubringen, um dann auch (2.) das Bild, das wir von ihm haben, lebendig werden zu lassen, als das es uns dann (3.) die Möglichkeit einer Beziehung zu ihm eröffnet, um (4.) ihn dann „seine“ Epoche abschließen zu sehen.
Denn Haydn können wir als einen „Vollender“ der Epoche der Frühen Neuzeit betrachten; seine Musik ist damit aber viel weitergehend vergangen, als etwa die Beethovens. Gerade weil wir Haydn, Mozart und Beethoven gewöhnlich zur Einheit deklarieren, fällt Haydn in dieser Dreiheit ab: als der Vorläufer dessen, was vermeintlich Beethoven „vollendet“ habe, das klassische Komponieren. Mozart hatte das Glück, als ein etwas später Geborener, von Haydn zwar „gelernt“ zu haben, gleichzeitig aber als ein Mit-Vollender der Epoche eine eigene Konzeption verfolgt zu haben, die in ihrer der folgenden Generation möglichen Umdeutung auf das Subjekt als ein Individuum hin zäsurlos in die Neuzeit hinüber gerettet werden konnte, obwohl auch er ihr (noch) nicht angehörte. Mit Haydn ging das nicht; seine Opern sind heute so wenig bekannt, wie die Hasses. Seine Sinfonien zählen noch im halben oder ganzen Dutzend, als „Vorlage“ für eine scheinbar nur höfische und dann auch bürgerliche „Unterhaltung“. Es ist nicht zuletzt die Vereinnahmung Haydns als „Klassiker“, die ihm das Unrecht angetan hat!
Der Titel mit dem betonten „Ich“ versteht sich aber auch als eine Art „Entgegnung“. Er widerspricht der geltenden Richtung eines Hörens, das seine Weisungen primär aus einem Zu-Hörenden bezieht. „Ich“ und „Haydn“ halten sich in ihm in etwa die Waage; der Hörende bestimmt über sein Hören, zumindest in der Weise, dass er es aus einer besonderen historischen Einsicht heraus in seinem Selbstverständnis (mit-)bestimmt. Aber selbstverständlich ist es Haydn, der je mit seinen Sinfonien eine Daseinsform orchestralen Mit-Spielens entworfen hat. Und seinen Vorgaben, die diese Lebensform (auch hier und jetzt) im weitesten Sinn formal und vor allem inhaltlich bestimmen, diesen kann und will ich mich nicht entziehen. Es ist sicher eine große historische Leistung, eine solche im Laufe seines Lebens auf eine bestimmte Art entworfen und zur Vollkommenheit entwickelt zu haben. Es wäre aber auch eine Leistung, diese im Laufe seines Lebens auf eine eigene Art mitvollziehen gelernt zu haben… Und auf diese muss ich mich einlassen. Doch kann es nicht Sinn meines Hörens sein, sich diesen von einer Wissenschaft bestimmen zu lassen u. d. h. Themen, Formulierungen, thematisches Arbeiten als sie/ es selbst wahrzunehmen. (Von ihnen aber spricht die Haydn-Literatur fast ausschließlich.) In der Frage des Verfügens über mein Hören u. d. h. hier: über mich als Mit-Spielenden (also Hörenden) bin ich selbst gefordert; hier muss ich investieren, mich in ein zweckrationales Verhältnis setzen „zu“: „Ich höre Haydn“ heißt: Ich suche meinem Wahrnehmen jenes orchestralen Spielens, das Haydn einst entworfen hat (und das mir die heutige Orchesterpraxis und die Schallplattenindustrie vermittelt!) selbst einen Grund zu geben, selbst einen Sinn zu generieren. Dieser ist keinesfalls beliebig, sondern (auch) aus den mir je verfügbaren Informationen (durchaus auch wissenschaftlicher Art) zu unterstützen und in aller Offenheit für Entwicklung und Veränderung zu formulieren. Auf Haydn bezogen hieße dies vor allem dem sog. „Menschlichen“ seiner Musik (für mich selbst) auf die Spur zu kommen und letztlich darin ein Stück meiner selbst zu erleben. Genauer: Vielleicht ein Stück meiner eigenen Geschichte und Entwicklung, sprich: meiner Genese als Mensch im emphatischen Sinn. „Ich höre Haydn“ heißt soviel wie: das gleichsam menschliche „Ich“ in mir bestimmt über mein Hören mit, heute und hier in klarem Bewusstsein; und es erlebt sich in der Ausfächerung seiner möglichen Rollen.5
Aus der Einsicht der Zugehörigkeit zu einer Musik der Frühen Neuzeit ist dem Komponieren Haydns noch selbstverständlich eine Intentionalität zu unterstellen, eine „Intentionalität“, nicht des Komponisten6, sondern des jeweiligen musikalischen Tätigseins! Hinstellen, Aufnehmen, Wiederholen als Verstärken, Entgegnen … d. h. mit dem „Aussprechen“ etwas intendieren. Haydns Sinfonien liegt, meiner Auffassung nach – vgl. u. –, je eine allgemeine menschliche Handlung zugrunde. Dies wurde, um die Theorie einer „Absoluten Musik“ zu retten, als „Gehalt“ angesprochen. Doch solche Abstraktion (von vornherein) hilft uns nicht, unser Spielen und Hören mit Sinn zu versehen, mit einem Sinn, der das intuitive (weil gelernte und gewohnte) Wahrnehmen der „Form“ und „Technik“ für uns sinnvoll machte. So, wie Haydn Spielen entworfen hat, bildet es die Aufforderung für uns, unser Mit-Spielen je mit einer handlungsartigen Intention zu verbinden. Dabei bilden nicht nur die Gestik und die sog. „Affekte“ thematischer Bildungen die Vorgaben für eine („unsere“!) Ausdrücklichkeit, sondern vor allem die Art und Weise (→ Richtung, Dynamik, Tempo, Struktur) des Fortspinnens einschließlich eines plötzlichen Innehaltens oder des „Einwerfens“ eines Gegengedankens. Sie eröffnen uns die Möglichkeit, dass wir uns als intentional handelnde Wesen erleben, ohne dass wir den „Inhalt“ des Handelns kennten! Aber wir können ihn ein wenig mittels Investition einer begründeten Vorstellung zu konkretisieren versuchen. Dazu bedarf es wohl der Investition je eines möglichen Sujets, um dem Hören jeweils Sinn generieren zu können, den die Zeit ihm aus den kontemporären Bedingungen selbstverständlich zumessen konnte. Peter Gülke schrieb einmal in einem Haydn-Aufsatz7:
»[…]die – ohnehin problematische – Antinomie von wortgebundener und instrumentaler oder „absoluter“ Musik war Haydn fremd, die letztere zu seiner Zeit als Kategorie überhaupt unbekannt. Dennoch wird er, da er ihr den Weg bereitet hat, nur zu gern für sie reklamiert. / Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang eine Frage bislang allzusehr vernachlässigt worden – diejenige, ob das für Haydn postume Denkmodell „absolute Musik“ nicht ältere, angemessenere Maßgaben verdrängt haben könnte, die, von der präzis bestimmten Bildlichkeit der „Affekten“ herkommend, das Hören klarer, exakter und rationeller jeweils auf bestimmte Typologien, Bedeutungsfelder und dergleichen orientierten.“
Der Sinn unseres Hörens wird kaum durch musikalische Analyse vermittelt, sondern als mögliche und unmittelbare Investition einer auf Menschen und ihr Handeln je bezogenen Inhaltlichkeit. Darin geht es nicht um „Wahrheit“ oder „Richtigkeit“, sondern um das („uns“!) begründet Mögliche und um ein unter Berücksichtigung des musikalisch Sich-Ereignenden bzw. Aufzufassenden („uns“!) Plausible. Zu investieren sind letztlich konkrete Inhalte, die wir im Bezug zu unserer Lebenserfahrung selbst verallgemeinern, abstrahieren und gleichzeitig im Hören auf uns bezogen erleben können. Durch die Investition von Vorstellungen möglicher Sujets der Sinfonien wird uns auch Haydn ein Stück weit lebendig: wir sehen ihn vielleicht tatsächlich in seinem Londoner Aufenthalt, gewinnen einen Eindruck, wie es ihm bei der Rückkehr nach Wien ergangen sein mag, was der Verlust Mozarts für seine Lebenswelt bedeutete; wir erleben ihn im möglichen Reflex auf Ereignisse in Eisenstadt oder Eszterháza oder in der Entscheidung, ein zweites Mal nach London aufzubrechen…
Durch die (Investition unserer) Vorstellung von Anlass und möglichem Sujet integrieren wir die Sinfonien wenigstens ein kleines Stück und gedacht „zurück“ in die Lebenswelt Haydns. Auf diese Weise gewinnen wir eine konkretere, lebendigere Vorstellung von ihm. Das Komponieren wird sozusagen vom einseitigen Blick auf das (scheinbar vor allem technische Ergebnis) zurück in sein Leben verlagert, ohne der Musik/ dem Spielen ihre/ seine Kunstwerklichkeit zu nehmen. Anderseits integrieren wir unser Hören durch die Investition eines (möglichen) Sujets in unser Leben, indem wir unserem Hören einen auf uns bezogenen Sinn generieren und so auch ein Verhältnis zur Persönlichkeit Haydns aufbauen: »Ich höre Haydn« – und nicht nur eine Sinfonie mit der Etikettierung „Haydn“.
Indem wir heute (als über das Erwachsenenalter Hinausgelangte) dem Hören dieser Sinfonien je mit einem zwar begründeten, aber letztlich von uns selbst verantworteten Sujet Sinn zumessen, kann uns aber klarwerden, dass solches Hören letztlich auf der Fähigkeit beruht, instrumentales Spielen als strukturiertes Äußern wahrzunehmen. Das Identifizieren des Spielens und Mit-Spielens als intentional bedingtes So-Bewegen setzt das selbstverständliche Verfolgen der strukturellen Momente eines musikalischen Satzes und ein zum Vergleichen notwendiges Erfahrungsgedächtnis voraus. Letztlich erscheint es unumgänglich, Jugendlichen Hörerfahrungen und strukturelle Einsicht, ja durchaus „Form“ (wie z. B. „Sonatenhauptsatzform“) als ein mitverfolgendes Hören zu vermitteln. Was aber nicht sinnvoll scheint: ihnen etwa Sujets (als Quasi-Programme) vermitteln zu wollen. Diese sind Sache der kulturell Erwachsenen. Nur sie können diese aufgrund ihrer Lebenserfahrung, ihrer Bildung und vor allem musikalischen Bildung nachvollziehen. Letztlich: was Haydns Sinfonien „bedeuten“ und wie man sie hören „soll“, das steht nicht fest; über sein Hören zu entscheiden, das ist eine Sache des mitspielenden, also hörenden Subjekts.
Wir sollten also tendenziell bei allen Sinfonien auch eine mögliche und nur dieser einen Sinfonie zugehörige Inhaltlichkeit ins Auge fassen. Demgemäß geht es uns im Ansprechen der Sinfonien nicht um „Wahrheiten“, sondern um Möglichkeiten des Hörens, die aber den lebenserfahrenen Hörer voraussetzen. Es wäre – wie gesagt – vollkommen verfehlt, Sinfonie 104 etwa Jugendliche oder noch jungen Erwachsene als Haydns „Abschiedssinfonie“ hören zu lassen. Das gibt das Spielen von sich aus nicht her! Haydns Entwurf orchestralen Spielens „ist“ Sinfonie, entworfen aus einem zeitgenössischen musikalischen Selbstverständnis. „Abschied“ aber ist ein Moment der Investition der Hörenden, die solchen (1.) aus ihrer Lebenserfahrung und (2.) auch aus ihrer kulturellen und musikalischen Reife investieren können. Das Miterleben aus einer investierten Vorstellung setzt aber voraus, sich in Sinfonie im Prinzip auszukennen, über ein Buchstabieren der formalen und instrumentalen Voraussetzungen hinausgelangt zu sein, weil diese von Jugend an vertraut und durch eigenes lebenslanges Spielen und Hören verinnerlicht sind.
Für ein solches Vorhaben kann man von (musikwissenschaftlichen) Kollegen Prügel beziehen. Handelt es doch um ein Schlachtfest: geschlachtet wird die Heilige Kuh „Absolute Musik“, welcher Begriff gerne mit Haydns Sinfonien in Verbindung gebracht erscheint.
Aber das vorliegende Extempore stammt von einem (wissenschaftlichen) Musikpädagogen; und als Musikpädagogen können, ja dürfen wir uns diese Freiheit nehmen. Denn letztlich sind wir uns selbst verantwortlich und nicht einer sog. Wissenschaft. Vor allem aber sind wir den uns anvertrauten Subjekten verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, ihnen „Musik“ zu vermitteln, aber auch nicht darin, sie, also „die Subjekte, an die Musik zu bringen“. Vielmehr erscheint es zentral, sie dazu zu ermuntern, ihr Leben für eine (kulturell bestimmte) Musik als ein eigenes und ihnen alltägliches Tätigsein zu öffnen, also von sich aus auch mit einer „ernsten“ Musik zu leben. „Musik“ als eine selbstbestimmte Lebensform, diese gilt es anzuregen, damit die uns anvertrauten Subjekte sie ein Leben lang gleichsam ausbauen. Das gilt auch für die „Sinfonie“; auch sie stellt die Möglichkeit einer spezifischen Form dar, eine (auf 20 oder – wie wir sehen werden – bis zu mindestens dreimal 20 Minuten) begrenzte Zeit lang sein Leben „so“ u. d. h. als ernsthaft musikalisch Tätiger zu vollziehen, dass es sowohl in einen selbstbestimmten Rahmen passt, als auch über diesen hinausstrahlt in ein Leben außerhalb/jenseits musikalischen Tätigseins. Denn Haydn – so meine Überzeugung – hat „seine“ Sinfonie nicht als „Form“ entwickelt, sondern als Ausdruck einer je spezifischen „menschlichen“ Inhaltlichkeit. Ihr nachgehend können wir uns in der Rezeption „erleben als…“, im Besonderen als Mitglied einer gedacht aufgeklärten Menschheit.
1 Vgl.: Joseph Haydn. Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen, ...hrsg. von D. Bartha, Kassel 1965, S. 228 f.
2 Im folgenden verwende ich durchgehend die Schreibweise „Sinfonie“ statt „Symphonie“.
3 Der vorliegende Essay versteht sich auch als rezeptive Auseinandersetzung mit: Ludwig Finscher, Joseph Haydn und seine Zeit, Laaber 32017.
4 Zwar erscheint „Haydn“ heute medial präsent; doch verschiebt sich solche Präsenz z. Zt. eher auf das „Nachtkonzert“ der ARD; kaum eine Nacht ohne „Füllung“ durch Haydn!
5 Die folgenden Anmerkungen, die – wie angemerkt – tatsächlich über ein Hören größtenteils ohne Noten entstanden, zwangen zur Konzentration aufs „eigene“ Hören und Protokollieren.
6 Wie in allen Schriften zu einer »Musikgeschichte für Musikpädagogen« verfolge ich auch hier kein Kommunikationsmodell (der Musik), sondern eines der »parallelen Vollzüge«. Nicht Haydn oder „Die Musik“ „will“ uns etwas sagen, sondern Haydns Entwurf ermächtigt die Spielenden und eben parallel die Mit-Spielenden (= Hörenden), sich in eine Zeit einer besonderen Ausdrücklichkeit (sozusagen ihres „Mit-Sagens“) zu begeben.
7 Peter Gülke, Nahezu ein Kant der Musik (revidierte Fassung), in: Joseph Haydn (= Musik-Konzepte 41), München 1985, S. 73.
2. Zum Gestalten orchestralen Spielens als Gestaltung einer Situation (und umgekehrt) im Dienst am Menschen
Hört man in die ersten Sinfonien hinein, die Haydn wohl noch im Dienste des Grafen Morzin zwischen 1758/59 und 61 entwarf, dann wird sofort klar, dass sie, im Vergleich zu den Klaviersonaten oder Streichquartetten, aus einem etwas anderen Selbstverständnis heraus entworfen wurden. An ihnen wird deutlich, dass Haydn von Anfang an (auch!) orchestrales Spielen in Abhängigkeit der Gestaltung einer spezifischen Situation der sog. Adressaten8 zu entwerfen versteht. Auch Finscher betont in diesem Zusammenhang einen anderen Kompositionsbeginn als im Zusammenhang von Streichquartett oder Klaviersonate. Dieser schlägt sich u. a. in der Satzfolge und in der Art der thematischen Ausrichtung vor allem der Ersten Sätze nieder. Doch sollte man Haydn hier nicht unbedingt ein „Experimentieren“ unterstellen: Haydn ist nicht allein auf der Welt, er komponiert im Auftrag und für bestimmte Situationen (hier des Grafen Morzin), die wir nicht mehr kennen, die wir aber als gesellschaftliche Veranstaltung (im Vorlauf des späteren „Konzerts“) vermuten können. Dass Haydns Sinfonien von der Rezeption (selbst noch im London der 90-er Jahre) als „Ouvertüren“ bezeichnet wurden, weist auf eine ihrer möglichen Funktionen im Rahmen einer relativ feststehenden Situation.
Für Morzin entwirft Haydn Sinfonien mit minimaler Bläserbesetzung, wie sie später Standart werden9; es sind dies (in der Zählung Hobokens) zumindest die folgenden Sinfonien: 1 (u. d. i. die wahrscheinlich tatsächlich erste!), 37, 2, 4, 5, 10, 11, 18, 27, 32 und 107; vielleicht auch 17 und 19. Sie sind z. T. dreisätzig, aber auch viersätzig, z. T. mit abweichenden Satzfolgen. Finscher versucht die Formen als in sich begründet auszuweisen. Im Prinzip sieht er Haydn als Experimentator in einer neuen Gattung, so, als ginge es (in erster Linie!)) letztlich um die Schöpfung eben dieser.10 Doch geht es um das Spielen und spezifisches Mit-Spielen in vergleichsweise (noch) höfischen Situationen des Zusammenkommens, die je anlassbezogen zu gestalten sind. Die Vielförmigkeit dokumentiert (auch hier) die besondere Fähigkeit Haydns, auf die situativen Erwartungen der Adressaten einzugehen.
Und dies gilt wohl in noch größerem Maße für die einzelnen Sätze. Zwar weder „witzig“ wie die Divertimenti noch ernst wie die Klavier- und Kammermusik – vgl. Finscher, S. 132 f. – und in den Details noch eher „kaleidoskopisch“ und „nicht zur Synthese gebracht“. Doch wenn Finscher auf „Elemente des Musiktheaters“ hinweist, dann weist das unserer Meinung nach nicht auf ein Gattungsdenken, sondern genau auf die Fähigkeit, auf personale und situative Belange der Menschen spezifisch innerhalb besonderer gesellschaftlicher Situationen einzugehen. Dass Haydn dabei am Beginn seines Komponierens motivische „Anleihen“ (z. B. bei den „Mannheimern“) macht, das erscheint uns weniger wesentlich als eben die von diesen originär betriebene Ausrichtung des Komponierens auf ein Ziel hin, zu welchem er alle Mittel kalkuliert einsetzt, über die er (auch aus der Anschauung der Musik um ihn) verfügt. Das ist (zumal noch im 18. Jahrhundert) legitim. Die große Kunst liegt wohl darin, allen Kompositionen einen „eigenen“ Sinn zu implementieren und gleichzeitig sie in ihrer „Form“ dem einzelnen Zweck angepasst zu belassen.
Hören wir uns einige der frühen Sinfonien durch! Sinfonie Nr. 1 beginnt formal mit einem Sonatensatz mit kurzer Durchführung, mit einem typischen „Eröffnen“ und „Fortfahren“ und sozusagen geheimnisvoller (wie bukolischer) Ereignishaftigkeit. Der zweite Satz, das Andante, scheint bewusst keine „Aktion“, sondern eher wie „Aussage“ und argumentatives (denkendes) Vorangehen, gleichwohl auf eine Art (innere) Bewegung gegründet („Tanz“). Und der dritte Satz markiert sozusagen einen Szenenwechsel; er besteht selbst darin, Vorstellungen von Szenerie mit Gesten einer gemeinsamen Freude in eine Folge zu bringen. Tatsächlich vermittelt er das Empfinden einer „Schluss“-Szene. Damit bilden die drei Sätze dieser vermutlich tatsächlich „ersten“ Sinfonie Haydns gleich ein Muster nicht nur eines Zyklus, sondern eben auch einer gewissen Inhaltlichkeit: mit einem „Sich-Aufmachen“, einem „Sich-Bedenken“ und einem scheinbar glücklichen „Erreichthaben“ (eines Zieles) den Prototyp einer Art Handlungs-Situation des Menschen selbst.
Eine solche ist nun in unterschiedlicher Vielfalt zu entwerfen. Gleich die Sinfonie Nr. 2 (C-Dur) verfährt „ähnlich“, beginnt gleichsam überschriftartig und verlagert das argumentative Fortschreiten teilweise in ein quasi solistisches Teilensemble. Dadurch entsteht ein Vorangehen und Folgen wie ein „Fragen“ und „Antworten“ in architektonischer Manier. Besonders im zweiten Satz, einer Streicher-Kantilene über einem General-Bass, fällt Haydns Fortspinnungsarbeit auf, die ein „quadratisches“ (= in sich zu vollendendes!) Vorgehen andeutet, um dann je die „Beantwortung“ überraschend in eine neue Figur (als quasi neue Aufstellung) fortzuführen. Dies ruft eine unendliche Kette hervor, wie ein beständiges Verknüpfen neuer aufregender Gedanken: im Verhältnis zum ersten Satz, – ginge es hier um den selbstdenkenden Menschen? Und der dritte Satz, rondoartig, er bindet Disparates zusammen…
Sinfonie Nr. 4 erscheint von Anfang an sehr thematisch, wobei die Themenfolge im Satz durchaus eine Art Gesetzmäßigkeit spiegelt. Ihr zweiter Satz, geheimnisvoll, mit seiner Dreistimmigkeit z. T. in rhythmischen Verschiebungen und einem verstörenden Insistieren, bestätigt vielleicht unsere Annahme des Erlebens einer Daseins-Situation im Vollzug eines Diskurses unter Mehreren. Ist dies eine Art Trauermusik? Zumindest demonstriert der Satz Haydns Fähigkeit, ein quasi vorgegebenes formales Muster auf ganz eigene Weise zu „füllen“. Folgerichtig erschiene das Menuett als dritter Satz wie eine Art Tröstung.
Die viersätzige Sinfonie 5 (A-dur) beginnt mit einem Adagio. Es ist ein Satz, der eine besondere Feierlichkeit verbreitet, welche durch die in der ganzen Sinfonie hervortretenden Hörner noch verstärkt wird. Demgegenüber erscheint der Allegrosatz (im 3/4-Takt) wie ein Einbrechen eines lebendigen Geschehens in die feierliche Anschauung davor. Zusätzlich tritt die erste Violine zu den Hörnern hervor. Den abrupten Schluss nimmt der dritte Satz nun gleichsam als Tanz (Menuett) auf, als eine reale Vorstellung von menschlicher Bewegung. Erst danach beendet der kurze und wieder vertrackte Schlusssatz, gleich einem fröhlichen Gewusel und „Rausschmeißer“, den Zyklus. Auch hier drängt sich (mir) der Eindruck einer gewissen Daseinssituation des Menschen auf, deren ausgewählte Phasen wir durchlaufen. Geht es hier um einen besonderen Anlass, der die Viersätzigkeit mitbegründete? Einem solchen im Sinne eines allgemeinen Festes entspricht aber wohl eher die Sinfonie Nr. 37, eine typische Fest-Musik mit Pauken.
Überraschend gibt sich die Sinfonie Nr. 18; sie beginnt mit einem Andante-moderato-Satz, im ersten Moment wie eine Serenade, aber dann doch nicht: im Fortspinnen des Gedankens entfaltet sich eher eine Szenerie, durch die man schreitet, in der man erschrickt, sich wieder beruhigt, in deren zweitem Teil die „Wege“ sich zerfasern, um dann eben doch weiterzuführen; wesentlich erscheinen dabei die insulären „Einbrüche“ (verstärkt durch die Hörner). Das Hindurchgehen, das ein Fortspinnen des Ausgangsgedankens mit je neuen Einsprengseln verknüpft, gewinnt Ereignishaftigkeit. Seine Einheitlichkeit resultiert aus einer gewissen Ordnung, die durch Zwischenkadenzen erstellt wird, welche in der Regel aber Erwartung eines Fortgehens produzieren. Der zweite Satz, Allegro molto, knüpft darin in gewisser Weise konsequent an, als der Eindruck entsteht, als fülle sich nun die Szenerie. Das „Zusammenkommen“ entwickelt sich aber (wesentlich deutlicher als im Satz vorher) zu einer konsequenten Folge unterschiedlicher motivischer Gedanken in je unterschiedlicher instrumentaler Klanglichkeit, sodass der Eindruck eher eines Disputs entsteht, in welchem die Argumentationen von unterschiedlichen Seiten das Vorangehen bestimmen. Hierzu passt auch die fast dramatische sequenzielle Steigerung im zweiten Teil des Satzes, die schließlich in den „Schlusssatz“ des ersten Teils zurückmündet. Wesentlich scheint aber auch die gewissermaßen von einem schweren „ersten“ Takt ausgehende Metrik, die Kraft ausstrahlt und mittels oft unquadratischer Abschnitte für ein Vorwärtsagieren verantwortlich ist, innerhalb dessen die unterschiedlichen Satzteile sich in der Konsequenz zu einem Ganzen fügen.11 Der dritte Satz, ein „Tempo di menuet“, erscheint wie eine bewusste Konsequenz auf den „Disput“ des schnellen Satzes, den sie in ein gleichsam resümierendes Argumentieren der Einsicht führt. Auffallend das Trio, aus der „sehnsüchtigen“ Kantilene der Solovioline (in Moll) in einen „versöhnlichen“ Durteil führend.
Wollte man zusammenfassen, was das Spielen hier an „Inhalt“ transportiert, der sich den Hörenden gleichsam „unbewusst“ mitteilt und aus dem sie letztlich einen wesentlichen Sinn ihres Mit-Spielens beziehen, dann wäre dies: sich als den in die Welt tretenden staunenden, entdeckenden und auch erschreckenden Menschen (I) zu erleben, dem sich die Szenerie mit Leben und Er-Leben und dem Eindruck erlebter Unterschiedlichkeit füllt (II) und der schließlich sich als mit versöhnlicher Einsicht ausgestattet erfährt (III), die sowohl Sehnsucht als auch optimistischen Ausblick beinhaltet (Trio).
Haydns (wahrscheinlich nicht aus einem eigenen Gutdünken resultierendes) vorläufiges Festhalten vor allem an der dreisätzigen Form der Sinfonie bedeutet ein Festhalten (auch) an einer funktionalen Dreiheit, wie sie die italienische Opern-Sinfonia darstellte. Auch in Sinfonie 10 (D) finden wir die aus dem Setzen eines betonten Akkordes herausentwickelte Fortspinnung, die Disparates (einschließlich einer Art Trio-Episode) einbindet, ein oberstimmenbestimmtes Andante voller Seufzerfiguren, die aber im Zusammenhang einen eher tröstenden Eindruck hervorrufen. Dazu ein Presto-Finale, in welchem gleichsam ein deus ex machina alles zum Guten wendete, doch mit kammermusikalischen Einsprengseln, die einem von Innen kommenden Beiseitereden Einzelner gleichen. Die Dreiheit betrifft also eine Art Ausbreitung einer Szenerie (oder das Auftreten einer „Menge“) (I), den Auftritt oder Gang des Menschen als Sich-Bedenkender (II) und seine wie feiernde Einbindung in die Sozietät (III).
Ob man aus der viersätzigen Sinfonie Nr. 11 eine Art Gegenposition ableiten könnte? Zu deutlich weisen ihre Sätze in Struktur, Reihenfolge und Zusammenstellung auf eine außerordentliche (mit dem Theater verbundene?) Situation. Aber deutlich weist anderseits das einleitende Adagio cantabile mit zehneinhalb Minuten Spielzeit (kaum kürzer als die folgenden drei Sätze zusammengenommen) auf eine geheimnisvolle Feierlichkeit, wie sie thematisch mit der Charakteristik der Tonart Es-dur zusammenhängen könnte.12 Dazu „antworten“ die drei folgenden Sätze: der schnelle Satz im Sinne einer „Aufforderung“, z. T. choralartig und mit fugenmäßigen Zwischengedanken sowie einem hervortretenden quasi „sprechenden“ Motiv, das Minuet mit vor allem im Trio „sprechender“ Thematik und ein eher beruhigend und versöhnlich wirkendes Prestofinale. Das Selbstverständnis weist hier vielleicht auf eine konkrete Szene und auf aus ihr folgende Handlungskonsequenzen.
Der Zyklus steht für eine situative Gefasstheit, die der Mensch gleichsam wie argumentativ durchlebt, dabei durchaus äußere Kennzeichen seiner möglichen Daseins-Situation – Finscher weist, S. 156, auf das Beispiel der „Jagd“ hin – figurhaft andeutend. Aber im Grunde können wir das nicht mehr so mitvollziehen, weil wir nicht mehr die Menschen des ausgehenden 18. Jahrhunderts sind. Beim Hören bleibt uns (aus einem eigenen „Vorurteil“ heraus!) eigentlich nur eine vorsichtige Empfindung für das, was die Zeitgenossen einst erlebten.13
*
Haydn macht Musiker spielen (auch wohl in ihrem Interesse, durch ein So-Spielen an einem qualitätvollen Spielen und vielleicht sogar dadurch an einem „Inhalt“ teilzuhaben?) zum Zwecke von: vor allem eines Mit-Spielens einer Adressatengruppe. Diese soll sich, durch die Teilhabe an jener Aktivität des Spielens und mehr noch dessen, was sich in diesem musikalisch zuträgt, in eine Art Aktivität versetzt fühlen, in der sie („etwas“?) erlebt, im Grunde „sich selbst als…“. Die Teilhabe am Spielen als Mit-Spielen geschieht zwar bewusst, als geplante Veranstaltung und bei Kennern sicher als Wahrnehmung dessen, was musikalisch bzw. „inhaltlich“ vorgeht. Doch das Wesentliche geschieht gewissermaßen im Untergrund, in Bestätigung dessen, wer/was sie [im Kegan’schen Sinne14] „sind“: als ein Sich-Erleben-als, das die Teilhabe hervorruft und das wir hypothetisch als ein Einbezogensein in eine menschliche Daseins-Situation (allgemeiner und typischer Art) umschreiben (können/müssen). Diese wird weder konkret noch als konkrete von den Spielenden und von den Adressaten als solche wahrgenommen. Was sie bemerken, das ist evtl. eine Art Selbstbestätigung, ein Erhobensein in der und durch die aktive Teilhabe am so-gearteten Spielen. (Dabei ist jene des Spielens der Musiker begrenzt, da sie – im Gegensatz etwa zum Streichquartett – im sich hiermit bildenden „Orchester“ ja nur als „Bestandteil“ fungieren können, ohne Eindruck eines Ganzen.)
Man könnte hier mit dem Begriff des „Gehalts“ von Musik argumentieren, wie ihn Eggebrecht im Zusammenhang des Mannheimer „Vorspiels“ klassischen Komponierens bestimmt hat.15 Doch sieht Eggebrecht den entscheidenden Punkt darin, dass Gehalt sich durch eine bestimmte Norm des musikalischen Materials als „das Menschliche“ in das musikalische Gefüge intendiert und Musik damit autonom macht. Wir dagegen sehen „das Menschliche“ in der besonderen Herrichtung von Material und Satzfolge dazu intendiert, dass solcher Gehalt den Menschen gleichsam dazu ermächtigt, im Mitvollzug sich als Menschen im ausdrücklichen und tendenziell einmaligen Sinn wahrzunehmen. Solche „Selbstwahrnehmung als…“ ist es, aus dem der Hörer seinem Mit-Spielen Sinn verleiht, was Musik als eine menschliche Tätigkeit also hier sinn-voll macht. Solcher Sinn aber ist eine Maßnahme des Menschen aufgrund der besonderen Qualität jenes Entwurfs, der hier vom Menschen als Mit-Spielen (= Hören) aktualisiert wird. Letztlich ist es das Streben des Menschen nach „Selbstwahrnehmung als… [Mensch im ausdrücklichen Sinn]“, das das neue Material (also die neue „Norm“ in der Eggebrechtschen Formulierung) erst hervorruft.
Im Mittelpunkt steht offensichtlich der „Sonatensatz“; er ist (nach Finscher) durch Zielstrebigkeit besonders ausgezeichnet. Dabei, so scheint es mir, spielt eine Unterscheidung von zweiteiliger Sonate (im Sinne des Suitensatzes) und sog. Sonatenhauptsatzform noch keine wesentliche Rolle. Denn grundsätzlich erscheinen je die beiden Teile wiederholt; und jener Abschnitt, der rückblickend im 19. Jahrhundert als sog. „Durchführung“ klassifiziert wird, ist in der Regel vorerst einmal kurz und bedeutet ein diskursives Zurücklenken zur Ausgangstonart und -thematik. Wesentlicher erscheint eine Art unbedingter „Konsequenz“ aus unterschiedlichen motivischen und satzmäßigen Abschnitten, die „sich“ gleichsam „von selbst“ zu einer dynamischen Ganzheit zusammenschließen. Im Gegensatz dazu stehen möglicherweise einige langsame Sätze, die thematisch in sich kreisen, mit langer sich fortsetzender Kantilene; sie deuten auf ein „Verweilen“, sozusagen im Gegensatz zum dynamischen Fortschreiten des Sonatensatzes. Dass solches „in der Mitte“ geschieht, das erscheint denn auch schlüssig!
Machen wir uns zumindest klar, dass in solchen Veranstaltungen, vielleicht „Akademien“, in denen das entsprechende Spielen und Mit-Spielen sich vollzog, zwei Tendenzen aufeinanderstoßen: zum einen die der Versammlung gesellschaftlich Gleicher, mit zunehmender Emanzipation eben auch Gleichgesinnter, zum „Zwecke von…“. U. d. h.: sich aus einem nicht-musikalischen Grund zu treffen und auszutauschen, um sich seiner Zusammengehörigkeit im Besonderen zu versichern, solches Zusammenkommen aber wesentlich durch solches Singen und Spielen gestalten zu lassen, das dem Zweck (fortschreitend mehr und nicht nur dem Anlass) dient. Auch dort, wo solcher Zweck wesentlich durch ein Singen und/ oder Spielen verwirklicht wird, besteht der Zweck aber noch nicht darin, „die Musik“ mitzuvollziehen, sie als sie selbst anzuhören. Diese bleibt noch lange, auch nach 1800, ein Mittel der situativen Gestaltung, eine Funktion der Situation. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass es von Seiten der Musiker die Tendenz gab, sich mit dem, was sie entwarfen, „vorzuführen als…“. Doch wurden sie darin fortschreitend entpersonalisiert und zum Diener am „Werk“, je fortschreitend substanzieller die Entwürfe dem Mit-Spielen gestaltet erschienen. Und beide Tendenzen trafen sich in einer (gegenseitigen) Funktionalisierung: die Realisation dessen in den Mittelpunkt zu stellen, was alle „einte“ und was u. a. im Singen und Spielen, vor allem aber (hier) im Mit-Spielen, zusätzlich erlebbar zu machen war.
Solches Sich-Treffen (als tendenziell regelmäßige Veranstaltung) im Bewusstsein einer (wenn auch noch so losen) Zusammengehörigkeit sollten wir auch den Veranstaltungen unterstellen, für die Haydns Sinfonien entworfen wurden; gleichzeitig können wir eine Vielzahl unterschiedlicher Anlässe annehmen, Einladungen, Feste, themenbezogene Akademien, Gartenfeste, aber auch kirchliche bzw. religiöse Anlässe, unter je besonderen Themenstellungen u. a. m., schließlich selbstverständlich Theater in jeder Form, besonders in der des Theaters mit Musik und schließlich in der des Musiktheaters (Oper). Solche Anlässe können und werden für die unterschiedlichen Formen der einzelnen Sinfonien mitverantwortlich sein.
W