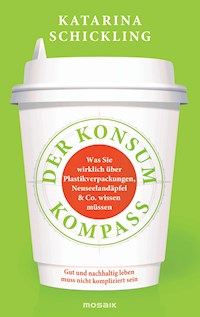
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mosaik
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie viel »Öko« steckt im Bio-Apfel aus Neuseeland im Vergleich zum konventionellen Apfel vom Bodensee? Welche Kaffeepads kann man guten Gewissens kaufen und genießen? Sind waschbare Windeln mit Abhol- und Bringservice nachhaltiger als Öko-Wegwerfwindeln? Und wie viele Reisen mit dem Flieger kann sich unser Planet noch leisten? Jeden Tag stehen wir vor Konsum-Fragen wie diesen und finden statt klaren Antworten nur ein schlechtes Gewissen. Den Politikern beim Streiten zuhören, Studien wälzen, Recyclinghöfe besuchen – das alles können (und wollen) wir als Konsumenten gar nicht leisten und überblicken. Nun gibt es endlich Orientierung im alltäglichen Konsumdschungel. Wohnen, Körperpflege, Kleidung, Essen, Verkehr und Reisen – Katarina Schickling ist renommierte Expertin auf dem Gebiet ökologischer Ressourcennutzung und hat alle wichtigen Informationen für ein umweltbewusstes Leben ausgewertet und einen praktischen Leitfaden formuliert – klar, fundiert und nachvollziehbar. Das Buch der Stunde für alle, die im Alltag unkompliziert und ohne schlechtes Gewissen konsumieren möchten. Nachmachen unbedingt erwünscht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
KATARINA SCHICKLING
DER KONSUM-KOMPASS
Was Sie wirklich über Plastikverpackungen, Neuseelandäpfel & Co. wissen müssen
Gut und nachhaltig leben muss nicht kompliziert sein
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe April 2020
Copyright © 2020: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © shutterstock / EllenM und Nadezhda Shuparskaia
Redaktion: Antje Steinhäuser
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
GS ∙ CB
ISBN 978-3-641-25503-9V003
www.mosaik-verlag.deBesuchen Sie den Mosaik Verlag im Netz
Inhalt
Einleitung
Glossar
Die Sache mit dem Müll
Getränke to go
Die Gurke in der Plastikhülle
Die beste Einkaufstüte der Welt
Wie sinnvoll ist Müll-Recycling?
Was gehört ins Altpapier?
Die richtige Verpackung
Getränke – Einweg oder Mehrweg?
Der Kaffee aus der Kapsel
Auf der Suche nach dem ökologischsten Verkehrsmittel
Mein Öko-Auto
Mit Flugscham leben
Wie reise ich richtig?
Traumschiff oder Albtraum?
Unterwegs im Nahverkehr
Strom und andere Energieprobleme
Energiequellen auf dem Prüfstand
Wir Stromverschwender
Weg mit dem alten Kühlschrank?
Mobiler Strom: Batterien, Akkus & Co.
Geht Smartphone auch in Grün?
Ich google das mal schnell
Richtig essen
Der Apfel aus Übersee
Sind Veganer die besseren Menschen?
Wildfang oder Zuchtfisch?
Wie unser Caesar’s Salad Flüchtlingsboote füllt
Das Palmöl-Problem
Kann Wasser Sünde sein?
Ist bio wirklich besser?
Wer ist der schlimmste Lebensmittelverschwender?
Politisch korrekter Konsum
Einkaufen im Internet
Das abfallfreie Bad
Ist putzen böse?
Wie man sich glücklich repariert
Mein Lieblings-T-Shirt als Klimasünder
Windeln waschen oder wegwerfen?
Grillen mit gutem Gewissen
Energiesparen mit dem E-Book-Reader
Mit gutem Gewissen durch die Weihnachtszeit
Besser Konsumieren – und alles wird gut?
10 goldene Regeln für ein nachhaltiges Leben
Dank
Hilfreiche Links und Literatur für bewussteren Konsum
Der Saisonkalender
Register
Bildnachweis
Anmerkungen
Einleitung
» Wie zahlreichsind doch die Dinge,derer ich nicht bedarf. «
Sokrates (469–399 v. Chr.)
Wo er recht hat … nicht konsumieren, keinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und entsprechend sorgenfrei durchs Leben gehen – das klingt überzeugend. Griechischer Philosoph müsste man sein!
Auch Sokrates musste allerdings etwas essen, und er stand, anders als ich, im Laden nicht vor 15 Apfelsorten aus vier Ländern. Nur der erste Punkt auf meinem Einkaufszettel – und schon habe ich viele Fragen: Kaufe ich lieber den Bioapfel aus Neuseeland oder den konventionell angebauten vom Bodensee? Packe ich die Äpfel anschließend in eine Papier- oder Plastiktüte? Bin ich ein schlimmer Ökosünder, weil ich den praktischen, wiederverwertbaren Synthetik-Beutel zwar gekauft, aber dann zu Hause auf dem Küchentisch liegen gelassen habe? Und fahre ich vom Supermarkt lieber mit dem E-Bike nach Hause oder mit dem Bus, weil es zu Fuß doch ganz schön weit ist, wenn man den Wocheneinkauf für die Familie im Gepäck hat. Oder wäre ich nicht noch besser gleich zum Hofladen des netten Biobauern gegangen? Wobei, da hätte ich dann das Auto nehmen müssen, weil da gar kein Bus hinfährt, und ich wohne in der Großstadt, da gibt es keine Bauern …
Wir modernen Menschen treffen den lieben langen Tag Konsumentscheidungen. Und immer öfter spielt für uns das Thema Nachhaltigkeit dabei eine wichtige Rolle. Im Herbst 2018 hat das Meinungsforschungsinstitut Emnid im Auftrag der Zeitung Bild am Sonntag deutsche Verbraucher befragt, ob sie zu einem bescheideneren Lebensstil bereit wären, wenn sie dadurch einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung leisten könnten. Stolze 81 Prozent sagten schon damals Ja.
Es wurde auch gefragt, wo die Befragten Abstriche machen wollten:
84 Prozent würden vermehrt regionale und saisonale Lebensmittel kaufen
70 Prozent würden ältere Hausgeräte durch umweltfreundlichere Geräte ersetzen
67 Prozent würden öfter mal das eigene Auto stehen lassen und stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad fahren
64 Prozent würden auf Flugreisen komplett verzichten
63 Prozent würden zu Ökostrom wechseln, auch wenn er teurer wäre
Immerhin noch 62 Prozent können sich laut der Umfrage vorstellen, im Winter selbst dann weniger zu heizen, wenn darunter das eigene Wohlbefinden leiden würde
Mittlerweile würden diese Zahlen vermutlich noch eindrucksvoller ausfallen – seit unsere Kinder uns bei ihren »Fridays for Future«-Demos eindrucksvoll daran erinnern, wie dringend ein Umdenken in Sachen Konsum und Nachhaltigkeit angesagt wäre, ist das Thema ungeheuer »in«. Die Versuche, irgendwie nachhaltiger zu leben, sind im Mainstream angekommen. Als mein 19-jähriger Sohn ein Baby war, verwendeten nur besonders grüne Ökoapostel Stoffwindeln – mittlerweile gibt es Dienstleister, die die schmutzigen Höschen aus Biobaumwolle abholen, zentral waschen und wieder ausliefern. Mehrere Freundinnen von mir ersetzen ihre Wattepads zum Abschminken durch waschbare Häkelpads. Und die EU geht mit gutem Beispiel voran und verbietet ab 2021 zahlreiche Einwegplastik-Produkte.
Aber sind diese Maßnahmen überhaupt zielführend? Ist es schlimm, dass nur 10 Prozent der für die oben zitierte Umfrage erfassten Deutschen komplett auf tierische Lebensmittel verzichten würden, oder ist ein veganer Lebensstil womöglich gar nicht so viel nachhaltiger? Wie gut ist die Ökobilanz des schon erwähnten Bodenseeapfels nach zehn Monaten Lagerung im Kühlhaus noch im Vergleich zum neuseeländischen Apfel, frisch vom Riesenfrachtschiff, das so viele Äpfel auf einmal transportieren kann, dass der CO2-Abdruck des einzelnen Apfels nicht mehr so wild sein dürfte?
Fragen über Fragen, und selbst hochangesehene Experten streiten über die richtigen Antworten. Auch wenn es manchmal auf den ersten Blick so einfach scheint. Zum Beispiel im Sommer 2019. Plötzlich scheint es ein ganz einfaches Mittel gegen den Klimawandel zu geben. Ein Forscherteam der ETH Zürich macht weltweit Schlagzeilen mit einem Vorschlag, wie sich das CO2-Problem lösen lasse: durch Aufforstung. Von dem bis heute in der Atmosphäre abgeladenen CO2 ließen sich rund zwei Drittel gewissermaßen wieder einfangen, wenn einfach nur umgehend genug Bäume gepflanzt würden. Anhand von Satellitenbildern haben die Wissenschaftler auch schon ausreichend unbewohnte Flächen gefunden, wo sich diese Bäume pflanzen ließen, ohne irgendeiner Wohnsiedlung, Ackerbaufläche oder Industrieanlage im Weg zu sein. Insgesamt rund 900 Millionen Hektar, die 205 Gigatonnen zusätzlichen Kohlenstoff speichern könnten. Seit Beginn der Industrialisierung habe wir rund 300 Gigatonnen in die Atmosphäre geblasen, gut zwei Drittel davon wären damit neutralisiert – klingt cool!
Leider ist es doch nicht ganz so einfach. Die Forscher der ETH Zürich haben bei ihrer Rechnung etwa um den Faktor zwei übertrieben, was zu tun hat mit dem natürlichen Kreislauf von CO2 zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Erde. Allerdings wären 100 Gigatonnen weggeschafftes CO2 ja immer noch schön. Aber wir reden hier nur von dem CO2, das in der Vergangenheit angefallen ist. Die 200 Gigatonnen aus der Studie entsprechen etwa dem, was wir bei unserem heutigen Konsum in 20 Jahren neu erzeugen. Auch mit 900 Millionen Hektar Wald ist unser CO2-Problem also nicht mal ansatzweise gelöst, ganz zu schweigen davon, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich die Nationen dieser Welt mal eben auf ein gigantisches Aufforstungsprojekt einigen würden.
Mir geht es wie vielen: Ich finde mich in der eingangs zitierten Umfrage wieder. Ich bin bereit, Dinge anders zu machen, wenn ich damit die Welt retten oder wenigstens meinen Alltag etwas nachhaltiger gestalten kann. Ich wohne in München. Die Landshuter Allee, die neben dem Stuttgarter Neckartor am häufigsten Schlagzeilen in Sachen Feinstaubalarm macht, liegt nur fünf Autominuten von meiner Wohnung entfernt. Ich sehe immer mit leichtem Schaudern, wie die Farbe frisch gefallenen Schnees dank der Abgase innerhalb von 24 Stunden von Weiß zu Dunkelgrau wechselt.
Aber ich möchte auch, dass mein Verzicht – denn ökologisch korrekter leben geht fast nie zum Nulltarif – tatsächlich etwas bewirkt. Wie viel Gutes tue ich also tatsächlich der Umwelt, wenn ich Zug statt Auto fahre? Welchen Unterschied macht es, wenn ich mich mit einem waschbaren Läppchen abschminke? Verbraucht das Herstellen und Waschen womöglich ähnlich viel Energie wie das Produzieren und Wegwerfen von ein bisschen Watte?
In diesem Buch will ich diese und andere Fragen in Sachen nachhaltiger Konsum klären. Nicht mit gefühlten Wahrheiten, etwa zu Plastik und Co., sondern mit Fakten. Mit starkem Eigeninteresse: Als berufstätige Mutter kenne ich die Zwänge des Alltags nur allzu gut. Und gleichzeitig möchte ich gerade als Journalistin in Sachen ökologischer Fußabdruck natürlich möglichst vorbildlich handeln. Ich mache seit Jahren Filme für die großen öffentlich-rechtlichen Sender zu Verbraucherthemen und recherchiere die Hintergründe von vermeintlichen Tatsachen. Ich habe für dieses Buch nach seriösen Studien gesucht, die umfassende Ökobilanzen erstellt haben, und mit den verantwortlichen Forschern gesprochen. Habe fundierte Untersuchungen zum Fußabdruck einzelner Produkte genau unter die Lupe genommen. Habe durchgerechnet, was es bedeutet, wenn mein wiederverwertbarer Kaffeebecher in meiner heimischen Geschirrspülmaschine, von Hand unter fließendem Wasser oder im Profigerät im Café gereinigt wird, und wie oft das passieren muss, bis seine Herstellung weniger Ressourcen verbraucht hat, als die gleiche Menge Wegwerfbecher. Eine große Herausforderung – denn viele dieser Fragen sind bisher nicht seriös durchrecherchiert worden. Viele der Artikel, die sich zu diesen Themen im Internet finden, basieren auf interessengesteuerten Informationen – die Studie etwa, die Pappbecher für ökologisch unbedenklicher hält als Porzellantassen, ist ausgerechnet vom Einweg-Industrieverband der Benelux-Länder bezahlt worden.
Diese Recherchen finden Sie in diesem Buch, Punkt für Punkt. Ich habe Autoren der Originalstudien befragt. Ich habe nach Zahlen gesucht, die tatsächlich vergleichbar sind. Ich stelle das, was alle immer wieder voneinander abschreiben, auf den Prüfstand und entlarve Ökomythen. Sie können dieses Buch als Nachschlagewerk nutzen – zu allen Kapiteln gibt es Kurzzusammenfassungen mit den wichtigsten Tipps für ein nachhaltiges Konsumverhalten. Wenn Sie sich noch gründlicher ins Thema vertiefen möchten, finden Sie Links zu relevanten Studien und Quellen, zum Nach- und Weiterlesen. Die Informationen und Internetverweise sind auf dem Stand von Dezember 2019. Alles, was Sie im Text an Informationen finden, ist gründlich überprüft und gegengecheckt. Damit Sie, wie es auch mir ein Anliegen ist, Ihre Konsumentscheidungen künftig auf der Grundlage von Tatsachen treffen können.
Glossar
In der Debatte um die Rettung unseres Planeten kursieren ein paar Begriffe, die mir, als Nicht-Naturwissenschaftlerin, zunächst nicht immer ganz klar waren. Deshalb vorneweg ein kleiner Überblick über die wichtigsten Schlagwörter und was sich dahinter verbirgt. Sollten Sie in der Schule einst besser aufgepasst haben, als ich: einfach weiterblättern!
Treibhausgase
Gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, die den sogenannten Treibhauseffekt verursachen. Dabei absorbieren sie langwellige Strahlung, die von der Erdoberfläche, den Wolken und der Atmosphäre selbst ausgestrahlt wird, und strahlen sie wieder ab. Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Distickstoffoxid (Lachgas), Methan und Ozon. In ihrer Gesamtwirkung erhöhen sie den Wärmegehalt des Klimasystems.
CO2-Äquivalent
Kohlendioxid (CO2) ist das bekannteste, aber, siehe oben, eben nicht das einzige Treibhausgas in der Atmosphäre. Wird im Zusammenhang mit dem Klimawandel über Mengen dieser Gase gesprochen, werden sie in jene Mengen Kohlendioxid umgerechnet, die die gleiche Klimawirkung entfalten würden. So verstärkt beispielsweise eine Tonne Methan über einen Zeitraum von 100 Jahren gerechnet den Treibhauseffekt im gleichen Ausmaß wie 28 bis 34 Tonnen CO2.
Erneuerbare Energien
Darunter versteht man alle Energiequellen, die sich durch natürliche Prozesse mit einer Geschwindigkeit erneuern, die der Nutzungsrate entspricht oder diese sogar übertrifft. Windkraft, zum Beispiel, Sonnenstrahlung, Erdwärme oder biologische Ressourcen.
Seltene Erden
Scandium, Yttrium, Lanthan, Gadolinium, Cer, Terbium, Praseodym, Dysprosium, Neodym, Holmium, Promethium, Erbium, Samarium, Thulium, Europium, Ytterbium, Lutetium. Auch wenn Sie von den meisten dieser 17 Elemente eventuell noch nie den Namen gehört haben, kommt Ihr Haushalt nicht ohne aus: In Akkus, LEDs, Bildschirmen, Leuchtziffern oder Glasfaserkabeln. Die meisten sind, anders als der Name suggeriert, gar nicht sonderlich selten. Aber dafür sind es die wirtschaftlich ausbeutbaren Lagerstätten. Die Elemente kommen zumeist nur in jeweils kleinsten Mengen oder als Beimischungen in anderen Mineralien vor; ihre Gewinnung verursacht deshalb oft große Umweltschäden.
Die Sachemit dem Müll
Ende der Achtzigerjahre legte mein Großvater sich ein neues Hobby zu: Mit 76 Jahren wurde er zum leidenschaftlichen Mülltrenner. Dabei war er bis dahin nie mit besonderen Sympathien für grüne Ideen aufgefallen. Im Gegenteil: Als langjähriger Mitarbeiter der Farbwerke Höchst pflegte er ein höchst unbekümmertes Verhältnis etwa zu Pflanzenschutzmitteln, und wenn es nach Zwischenfällen im Werk in seiner nahe gelegenen Heimatgemeinde gelb oder orange regnete, dann brummte er höchstens, dass es früher einmal die Woche bunt geregnet habe, und das habe schließlich auch niemandem geschadet.
Doch nachdem in Hessen seit 1985 zum ersten Mal in Deutschland die Grünen mitregierten, änderte sich das politische Klima und im Zuge dessen auch die Müllsatzung der Gemeinde Kriftel im Taunus: Wer besonders wenig Restmüll produzierte und seine Tonne seltener leeren ließ, weil er einen Großteil der Abfälle anderweitig recycelte, bekam am Ende des Jahres einen Teil der Müllgebühren zurück. Damit wurde Restmüllreduktion für meinen Großvater zur Aufgabe …
Wegen eines Praktikums in Frankfurt verbrachte ich zu dieser Zeit einige Wochen bei meinen Großeltern. Schon beim Zubereiten des Frühstücks musste ich immer damit rechnen, dass mein Großvater plötzlich hinter mir auftauchte, um zu verhindern, dass ich womöglich einen Joghurtbecher in den Restmülleimer warf. Familienmitglieder alleine in der Küche waren ihm suspekt – bestand doch stets das Risiko, dass irgendein Wertstoff unsachgemäß entsorgt wurde. Weil meine Großmutter sich standhaft weigerte, sich die komplexen Regeln des Recyclings anzueignen, bürgerte es sich ein, dass der während des Kochens anfallende Müll zunächst in Plastikschüsseln zwischengelagert wurde. Nach dem Essen stand dann mein Großvater in der Küche und sortierte Aludeckel, Verbundkartons und Kompostierbares in verschiedene Tüten. Er schaffte es mehrere Jahre lang, die höchstmögliche Rückzahlung der Müllgebühren zu erreichen und war tiefbetrübt, als die Gemeinde ihr System eines Tages wieder änderte.
Irgendwie fand ich meinen Opa damals ziemlich cool. Und gleichzeitig stellte ich mir zum ersten Mal die Frage, was die Mülltrennerei wirklich bringt. Wurde all das wirklich sinnvoll wiederverwertet? Oder landete der liebevoll sortierte und getrennt transportierte Müll am Ende doch wieder auf der gleichen Deponie?
In diesem Kapitel geht es um die Hinterlassenschaften unseres Konsums: Wo ist Recycling und der Einsatz von Mehrwegsystemen wirklich sinnvoll? Und wo beruhigen wir damit lediglich unser Gewissen?
Getränke to go
Als Studentin hatte ich ein Stipendium, um für meine Magisterarbeit in Rom zu forschen. Wie habe ich dort die italienische Sitte geliebt, jede Verabredung, jeden Termin mit einem schnellen caffè zu beginnen, zu unterbrechen, zu beenden – oder noch besser: alles davon. Seitdem ist ein schneller Kaffee zwischendurch für mich eine Art Denk-Treibstoff. Und so gefiel es mir gut, als auch bei uns überall die Kaffeebars aus dem Boden sprossen.
Die deutsche Version des schnellen Kaffees finden die meisten Italiener allerdings sehr seltsam: In Rom gab es den Espresso immer aus einer Porzellantasse, an der Bar, im Stehen. Bei uns ist es üblich geworden, den Kaffee mitzunehmen und unterwegs zu schlürfen. 162 Liter Kaffee haben wir Deutschen 2014 durchschnittlich pro Jahr getrunken, immerhin 5 Prozent davon aus Einwegbechern.1 Der Kaffeebecher in der Hand gehört zum modernen Städter wie das Smartphone – ein unverzichtbares Accessoire, um sich damit durch den Großstadtdschungel zu kämpfen.
Bis die Deutsche Umwelthilfe mal ausgerechnet hat, welche Müllberge wir Kaffeefans dabei hinterlassen: 7,6 Millionen Kaffeebecher am Tag stapeln sich zu der schier unvorstellbaren Höhe von 255000 Kilometern – das wären etwa zwei Drittel der Strecke von der Erde bis zum Mond oder mehr als sechs Mal um den Äquator herum. Und wie gesagt, das sind nur die deutschen Kaffeebecher, und nur, wenn wir von 0,2-Liter-Portionen ausgehen. Hinzu kommen noch die Plastikdeckel, die kleinen Plastiklöffelchen zum Umrühren, und – worst case – womöglich auch noch ein Strohhalm. Zudem handelt es sich bei dem typischen Kaffeebecher auch noch um ein recyclingtechnisch besonders ungünstiges Produkt: Der Becher selbst, aus Pappe, ist verantwortlich für das Abholzen der Wälder, darf aber wegen seiner Beschichtung nicht ins Altpapier. Es gibt hochspezialisierte Firmen, die diese Becher theoretisch verwerten könnten, dort kommen die Becher aber praktisch nie an, weil sich uns meist gerade kein geeigneter Spezialabfalleimer in den Weg stellt, wenn wir mit unserem Wegzehrungs-Kaffee fertig sind.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Mir hat das den Spaß am coolen Lifestyle-Kaffee verdorben! Seit dies alles breit durch die Presse gegangen ist, schaffe ich es nicht mehr, einfach einen Pappbecher mitzunehmen, ohne dass mich das Gewissen plagt. Hätte ich nicht heute Morgen vorausschauend einen Thermobecher einpacken sollen? Der dann allerdings den Rest des Tages meine Handtasche vollkleckert, weil die Dinger ja selten wirklich dicht schließen … Und wäre es nicht eh noch besser gewesen, wenn ich mich damals stattdessen für einen Becher aus Porzellan entschieden hätte? Oder aus Kunststoff, weil mir der sicher nicht beim zehnten oder elften Benutzen kaputtgeht? Oder wäre es noch politisch korrekter, wenn ich zu meinem Brauch aus der Studentenzeit zurückkehren würde, meinen Kaffee an der Theke zu trinken und das Abspülen den Profis zu überlassen?
Zahlreiche Städte entwickeln mittlerweile Mehrwegbecher-Konzepte – das Münchner Start-up Recup, zum Beispiel, hat deutschlandweit ein Pfandsystem etabliert und wirbt damit, dass seine Becher aus recyclebarem Kunststoff mindestens 500 Spülgänge überleben würden. Die Becher kosten einen Euro Pfand und dürfen bundesweit bei Recup-Partnern zurückgegeben werden. In Freiburg gibt es seit 2016 den FreiburgCup, der immerhin 400-mal wieder benutzbar sein soll.
Damit liegen sie im Trend: Im November 2018 hat der »Verbraucherzentrale Bundesverband« eine Umfrage durchführen lassen. Dabei sprachen sich 71 Prozent der Befragten für einen Preisnachlass für Konsumenten aus, die eigene Behälter mitbringen. Jeweils mehr als jeder Zweite war für ein Verbot von Einweg-to-go-Verpackungen (57 Prozent) und die Einführung eines Pfandsystems (55 Prozent).2
Auch für mich klang das alles total plausibel, bis mich diverse Zeitungsartikel aufschreckten: Unter griffigen Titeln wie »Verschlimmbechert«3 berichteten seriöse Zeitungen wie die Süddeutsche, Die Welt oder die FAZ von Studien, die angeblich belegt hätten, dass in Wahrheit der Pappbecher die viel ökologischere Lösung sei, als die hochgelobten Mehrwegsysteme. Tatsächlich? Sind wir hier Opfer unserer eigenen Vorurteile geworden?
Die Studie, auf die sich alle diese Artikel zunächst beziehen, ist schon relativ alt: 2007 vergleicht die niederländische Organisation für angewandte naturwissenschaftliche Forschung Einweg- und Mehrwegkaffeebecher unter dem Aspekt der Umweltfolgen – Herstellungsaufwand von Porzellantassen, Plastik- und Pappbechern, der Energieaufwand beim Spülen, die Entsorgung …4 Und kommt damals tatsächlich zu dem überraschenden Ergebnis, dass Wegwerfbecher für die Umwelt am wenigsten schädlich seien.
Nun hat diese Studie allerdings mehrere Haken. Zunächst sind zehn Jahre eine lange Zeit – Herstellungsmethoden, die Arbeitsweise von Geschirrspülern, das Material der verschiedenen Becher … all das hat sich seitdem weiterentwickelt, sodass sich schon deshalb die Frage stellt, welchen Wert diese Studie für uns heute noch haben kann. Zum zweiten Mal gestutzt habe ich, als ich gleich auf Seite eins den Auftraggeber der Studie fand: Die »Benelux Disposables Foundation« – das ist der Industrieverband der Einweghersteller in den Benelux-Ländern. Noch wichtiger jedoch ist, was da eigentlich untersucht wurde: Es geht in dem Papier um sehr spezielle Selbstbedienungsautomaten, die in Büros oder Fabriken zum Einsatz kommen. Auf Nachfrage bestätigen mir die Autoren der Studie dann auch, dass ihre Erkenntnisse auf den typischen To-go-Kaffee nicht wirklich anwendbar sind.
Als der Deutsche Kaffeeverband im September 2015 versucht, mit dieser Studie die wachsenden Bedenken gegen Pappbecher zu entkräften, meldet sich die Deutsche Umwelthilfe mit methodischer Kritik zu Wort: »Der Deutsche Kaffeeverband versucht Bürgern das Umweltproblem von Coffee to go-Bechern mit einer veralteten Studie als umweltfreundlich zu verkaufen. Die gewählte Füllgröße des Einwegbechers ist zu klein, sein angenommenes Gewicht zu leicht und dieCO2-Emissionen sind zu gering. Für Mehrwegbecher wurden dagegen veraltete und deutlich zu hohe Energiewerte für die Warmwasserbereitstellung beziehungsweise die automatische Spülung angenommen«, erklärt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.5
Auch die zweite Studie zu diesem Thema ist eher speziell: Nach der Fussball-EM in Österreich und der Schweiz untersuchten im September 2008 drei Forschungseinrichtungen im Auftrag des Österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Schweizer Bundesamtes für Umwelt verschiedene Bechersysteme bei Großveranstaltungen rund um das Sportereignis und im deutschen Fußball-Bundeliga-Betrieb. Eine Besonderheit hier ist die beschränkte Wiederverwertbarkeit einiger Mehrwegbecher wegen des Brandings – Fußballverbände sind mit Lizenzprodukten, die ihre geschützten Logos tragen, sehr streng … Dennoch kommen die Autoren der Studie zu einem eindeutigen Ergebnis: »Alle Mehrwegbecherszenarien weisen gegenüber den betrachteten Einwegszenarien geringere Umweltbelastungen auf. Wobei die Unterschiede bei allen untersuchten Bechern signifikant sind, mit Ausnahme des Kartonbechers, bei dem die Unterschiede nur beschränkt signifikant sind. Für das beste Einwegbecher-Szenario werden doppelt so viele Umweltbelastungspunkte ausgewiesen wie für das ungünstigste Mehrwegbecher-Szenario, bei dem aufgrund des Brandings eine Nachnutzung nicht möglich ist.«6
Das klingt schon ganz anders als die niederländischen Erkenntnisse, lässt sich auf die typische Coffee-to-go-Situation aber wieder nicht unmittelbar anwenden – dafür ist auch hier der Untersuchungsgegenstand zu unterschiedlich. Das schreiben auch die Autoren der Studie selbst in ihrer Schlussfolgerung: »Wie bei allen Ökobilanzen gelten die Ergebnisse nur für die untersuchten Systeme beziehungsweise Produkte. Es ist nur beschränkt zulässig, Rückschlüsse auf andere Anwendungen zu machen, auch wenn sie ähnlich gelagert sind.«7
Nach der Lektüre beider Studien bin ich etwas verwirrt. Wie soll man aus Untersuchungen, die dermaßen spezielle Szenarien erfassen, etwas über den Kaffeebecher aus der Bäckerei auf dem Weg zur Arbeit lernen? Ich finde schließlich eine neuere Studie aus Deutschland, aus dem Juni 2017, die sich konkret mit der Kaffeebecher-Frage befasst. Unter der Leitung von Prof. Stefan Pauliuk haben sich Johannes Althammer und Kaja Weldner an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Uni Freiburg für ihre Masterarbeit mit dem weiter oben schon erwähnten FreiburgCup beschäftigt. Ein Pfandsystem, an dem mittlerweile über 100 Ausgabestellen beteiligt sind. Damit wird man den leeren Becher im Stadtgebiet relativ zuverlässig wieder los, bevor er die Handtasche vollkleckert.
Die Veröffentlichung dieses Papiers war der Anlass dafür, dass so viele Zeitungen im Sommer 2017 plötzlich Schlagzeilen dazu fabrizierten, dass Einwegbecher gar nicht so schlimm seien. Als Journalistin verstehe ich gut, warum sich so viele Medien so begeistert auf das Thema stürzten: Überraschende Meldungen werden immer gerne genommen … »Es stimmt: Mehrweg ist besser als Einweg« – da fällt der Chefredakteur sofort in Tiefschlaf. »Alles falsch: Pappbecher sind die beste Lösung!« – mit diesem Rechercheergebnis bekommen Sie als Autorin sofort eine halbe Seite …
Dabei gibt die Schlussfolgerung der Studie das nicht wirklich her. Darin heißt es: »Bei der Bewertung der FreiburgCup wurde festgestellt, dass das Mehrwegsystem aus der Sicht der Müllvermeidung einen positiven Effekt gegenüber einem Papierbechersystem mit sich bringt.« Die Autoren schreiben allerdings auch: »Aus der Sicht von Ökologie und menschlicher Gesundheit ist die Bilanz der FreiburgCup in den meisten betrachteten Szenarien und Kategorien mit der einer Papiertasse vergleichbar.« Denn es stellte sich heraus, dass die FreiburgCup-Benutzer offenkundig ihre Becher als Souvenir mit nach Hause nahmen, anstatt ihn zurückzugeben – das führt dann natürlich ein Pfandsystem schnell ad absurdum.
Damit liegt der Ball im Feld von uns Verbrauchern. Der Mehrwegbecher ist sehr wohl sinnvoll, er muss nur regelmäßig zum Einsatz kommen. Das schreiben die Forscher auch gleich im nächsten Satz: »Aus ökologischer Sicht ist allerdings eine enorme Verbesserung zu erreichen, wenn
1. der FreiburgCup häufig ausgegeben, verwendet und auch wieder zurückgegeben wird.
2. der FreiburgCup mit einem hohen Anteil an Ökostrom gespült wird.
3. der FreiburgCup ohne einen Polystyrol-Deckel genutzt wird.«8
Auf einen Punkt hat die Stadt Freiburg mittlerweile reagiert: Es gibt nun auch Mehrwegdeckel für den Becher, die jeder Kunde kauft und wiederverwendet – aus Hygienegründen scheidet da ein Pfandsystem aus, weil die Deckel zu kompliziert zu spülen sind. Generell scheinen die Deckel beim To-go-Becher immer der Knackpunkt zu sein – auch beim Pappbecher war gemäß der Freiburger Studie der Plastikdeckel das größte Problem, bei der Herstellung ebenso wie bei der Entsorgung.
Noch etwas stellte sich in der Studie heraus: Es hing viel davon ab, wie die teilnehmenden Kaffeeverkaufsstellen den Mehrwegbecher vermarkteten: Wurde er immer direkt mit angeboten oder gab es ihn nur auf ausdrücklichen Wunsch der Kundschaft? Lagen Deckel neben Zucker und Milch zum Mitnehmen bereit, oder gab es die nur auf Nachfrage? Je selbstverständlicher der Mensch hinterm Tresen den Pfandbecher ausgab, umso häufiger wurde er auch genutzt.
Der Geschäftsführer des Anbieters Recup ist davon überzeugt, dass er mit seinem Konzept richtigliegt. Sein Unternehmen macht weiter und startet jetzt mit »Rebowl« – denn auch beim schnellen Essen in der Mittagspause ist der Müllberg enorm: Über 281000 Tonnen waren es 2017, 58 Prozent davon Teller, Boxen und Schalen.9
Ein nicht ganz unwichtiger Punkt ist der Energieaufwand beim Spülen der Becher. Die Geschirrspülmaschinen, die in unseren heimischen Küchen stehen, unterscheiden sich drastisch von denen, die in Cafés oder Geschäften eingesetzt werden. Wo die Geräte für den Privatgebrauch heutzutage vor allem auf Energiesparen und geringen Wasserverbrauch hin konstruiert sind und im Gegenzug mehrere Stunden für einen Spülgang benötigen, arbeitet die klassische Gastro-Spülmaschine mit sehr viel höheren Temperaturen und aggressiveren Spülmitteln.
Es gibt keine Studien dazu, welche Spülmaschine umweltfreundlicher spült, die zu Hause oder die im Café. Ich suche Rat bei Rainer Stamminger. Der Professor für Haushalts- und Verfahrenstechnik am Institut für Landtechnik der Universität Bonn ist gewissermaßen der Papst der Wasch- und Spülmaschinenforschung. Allerdings kann auch er dazu keine eindeutige Aussage machen. Gastro-Spülmaschinen arbeiten mit vorgeheiztem Wasser – ist die Maschine im Dauerbetrieb, weil das Café so viele Gäste hat, dass fortwährend schmutzige Tassen anfallen, ist das eher gut für die Ökobilanz: Das Wasser muss dann nicht für jeden Spülgang neu aufgeheizt werden. Außerdem haben die Profi-Maschinen meist keine Trocknung. Wenn die Maschine jedoch nur fünfmal am Tag läuft, gewinnt unsere Maschine zu Hause, vorausgesetzt sie ist wirklich vollgeräumt. Definitiv am ungünstigsten ist es, den Becher unter fließendem Wasser abzuspülen.10
Schlussendlich sind Pfandbecher also eine gute Idee. Und wo solche Systeme nicht angeboten werden, ist der eigene Mehrwegbecher sinnvoller als der tägliche Griff zum Pappbecher. Zumal wir Bürger die indirekt an anderer Stelle teuer bezahlen: Allein in Berlin sind bis zu 15 Prozent der öffentlichen Mülleimer mit To-go-Bechern vollgemüllt. Was nicht mehr reinpasst, landet auf der Wiese – und hat in den Augen der Berliner Stadtbevölkerung laut einer Umfrage mittlerweile sogar Hundehaufen abgelöst als größtes Ärgernis in der Stadt.
Kaffeebecher sind als Müll schwierig: Durch die Beschichtung zählen sie verwertungstechnisch zu den sogenannten Verbundstoffen. Die Materialien sind nur mit großem Aufwand zu trennen. Das würde sich lohnen, wenn es große Mengen sortenreinen Bechermüll gäbe. An der Universität im niederländischen Leiden werden die Pappbecher seit Februar 2019 separat gesammelt und von einer Spezialfirma zu Toilettenpapier verarbeitet – eine mögliche Alternative zu Mehrweg.
So eindrucksvoll indes die eingangs erwähnten Müllmengen klingen – unterm Strich ist der Kaffeebecher zwar ein plakatives Beispiel, jedoch kein besonders schwerwiegendes für die generelle Klimabilanz. Die Studie der Freiburger Universität schreibt zur Einordnung des Problems: »Bezogen auf die CO2-Emissionen sind die Auswirkungen der FreiburgCup mit etwa 30 g deutlich geringer als die Emissionen des Kaffees, den sie beinhaltet (etwa 1 kg). Auch im Vergleich mit anderen Aktivitäten sind die Emissionen der FreiburgCup gering: Um dieselben Emissionen zu erzeugen, wie beispielsweise für einen Urlaubsflug (hin und zurück) nach Barcelona, könnte man 7100 Mal die FreiburgCup benutzen.«11
Man könnte aber auch, wie die Italiener, öfter fünf Minuten investieren und den Kaffee einfach vor Ort trinken, bewusst und mit Genuss. Entschleunigung kann ziemlich nachhaltig wirken!
Fazit:
• Die beste Lösung unter ökologischen Aspekten ist ein Pfandsystem, das funktioniert – mit möglichst vielen Ausgabestellen und einer großen Zahl von Einsätzen pro Becher – so fällt der Aufwand bei der Herstellung des Bechers kaum ins Gewicht.
• Wo es ein solches System nicht gibt, ist der eigene Mehrwegbecher eine sinnvolle Alternative. Der wird am ökologischsten sauber in einer vollgeräumten Geschirrspülmaschine, die mit Ökostrom arbeitet.
• Sollten Sie Zugang zu separaten Sammelsystemen für gebrauchte Becher haben – unbedingt nutzen!
• Ein wirklich großes Problem sind Wegwerfdeckel und Plastikumrührer – ab 2021 EU-weit zwar verboten. Aber bis dahin tun Sie der Umwelt einen großen Gefallen, wenn Sie darauf so oft wie möglich verzichten.
Die Gurke in der Plastikhülle
Manchmal ist es gar nicht so einfach, ein guter Mensch zu sein. Zum Beispiel, wenn man gerne Gurken isst. Zwei Sorten hat mein Supermarkt um die Ecke im Angebot: gleich am Eingang eine ganze Kiste loser, konventioneller Salatgurken aus Holland, einen Gang weiter dann bayerische Biogurken, eingeschweißt in Plastik. Und schon habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich möchte gerne nachhaltige Landwirtschaft unterstützen und würde deshalb gern zur Ökogurke greifen, und Gemüse aus der Region finde ich eh besser. Andererseits will ich möglichst wenig Plastikmüll verursachen. Was also tun?
Der Grund, warum ausgerechnet Bioware im Supermarkt oft so unbiologisch eingeschweißt wird: Die Händler trauen uns nicht! Damit wir die teurere Biogurke nicht an der Kasse als konventionelle Gurke durchschmuggeln, muss sie sich unveränderbar unterscheiden. Und weil es im Supermarkt normalerweise mehr konventionelle als Bioware gibt, wird letztere im Plastikkondom gereicht. Immerhin reagiert der Handel hier zunehmend auf den Wunsch der Kunden nach Einkaufen ohne Müll. REWE lasert seit Anfang 2018 Bioavocados und -süßkartoffeln, Netto Bioingwer und Biogurken. Edeka beschriftet Mango, Ingwer, Süßkartoffel und Kokosnuss aus ökologischer Erzeugung mit Laser, und künftig auch Avocados, Kiwis, Wassermelonen, Kürbisse, Zitrusfrüchte und Gurken. »Perspektivisch können somit 50 Millionen Etiketten und Folien pro Jahr eingespart werden – das entspricht rund 50 Tonnen Verpackungsmaterial«, so der Handelsriese in einer Pressemitteilung im Juli 2018.12 Die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) will durch den Verzicht von Plastikhüllen bei Gurken in ihren Kauflandmärkten künftig jährlich sogar 175 Tonnen weniger Müll verursachen und hat zudem eine Recyclingfirma für Plastikabfälle gekauft.
Ein weiteres Argument mancher Händler, neben der Warenauszeichnung, ist das Thema Frische. Gerade Gurken und Brokkoli, die zum Zeitpunkt der Ernte noch eine aktive Zellatmung besitzen, verlieren ohne Verpackung extrem schnell viel Feuchtigkeit. Eine Gurke besteht zu etwa 96 Prozent aus Wasser. Unter Schutzatmosphäre eingeschweißt wird ihre Haltbarkeit etwa verdoppelt. Eine unverpackte Gurke, die im Supermarkt vergammelt und dort im Müll landet, hätte eine deutlich schlechtere Umweltbilanz als eine eingepackte Gurke, die verzehrt wird. Wasser und Energie, die bei der Produktion und dem Transport des Gemüses eingesetzt wurden, wären bei verdorbener Ware schließlich umsonst verbraucht worden.
Das Problem mit den Plastikverpackungen in der Gemüseabteilung ist ein großes: Die Verbraucherzentrale Hamburg und der Verbraucherzentrale Bundesverband haben im Mai 2019 einen Marktcheck gemacht und in insgesamt 42 Filialen der wichtigsten acht Lebensmittelketten nachgesehen. Zu fast zwei Dritteln wurde dabei Obst und Gemüse in Plastikverpackungen angeboten. Tomaten, Möhren, Paprika, Gurken, Äpfel – mit massenhaft Plastikmüll frei Haus. Bei Penny und Aldi war die durchschnittliche Plastikquote dabei mit 81 und 74 Prozent besonders hoch, besser schnitt Edeka ab, mit immer noch 48 Prozent. Und wir Kunden werden auch nicht wirklich gelockt, Plastikmüll zu meiden: Bei zwei Dritteln der Testkäufe war unverpackte Ware teurer.
Dabei haben deutsche Handelsketten den müllvermeidenden Verbraucher durchaus als interessanten Kunden entdeckt: Manche Händler bieten mittlerweile wiederverwendbare Säckchen an, zum Kaufen natürlich, auf die sogar die Waagen geeicht sind – wodurch man übrigens gleichzeitig an die jeweilige Kette gebunden ist, weil andere Händler wieder andere Säckchen haben. Außer man beschließt, die paar Cent, die man möglicherweise für das Gewicht des ökologisch korrekten Beutels bezahlt, als eine Art Umweltabgabe zu begreifen. Dumm nur, wenn es dafür dann kaum Ware gibt, und die obendrein noch teurer ist!
Und dann bleibt noch die Frage, ob mein wiederverwendbarer Beutel tatsächlich umweltfreundlicher ist … Zu Obstverpackungen gibt es noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, das Thema ist wohl noch zu frisch … aber dafür zu den Einkaufstüten, mit denen wir unsere Einkäufe aus dem Supermarkt nach Hause tragen. Dazu mehr im nächsten Kapitel. Unterdessen ist die Hobby-Handarbeitsszene hier ebenfalls aktiv geworden und näht aus alten Gardinen Obstbeutel. Auf Neudeutsch heißt das »Upcycling«. Das Internet wimmelt von Anleitungen für den ultimativ ökologisch korrekten Einkauf. Und das Münchner Start-up »Rebeutel« vertreibt seine Gardinenbeutel über zahlreiche Lebensmitteleinzelhändler und nimmt gerne Stoffspenden entgegen – eine sinnvolle Alternative zu gewerblichen Altkleidersammlungen.
Fazit:
• Ich werde bei Lesungen oft gefragt, was besser ist: konventionell und unverpackt oder bio in der Plastikhülle. Ganz ehrlich? Weder noch! Wenn Sie Ihr Biogemüse in einem Laden kaufen, der ausschließlich Erzeugnisse aus ökologischer Landwirtschaft vermarktet, braucht der Händler keine Plastikhüllen, um Schummelei an der Kasse zu unterbinden.
• Kaufen Sie Obst und Gemüse möglichst oft regional ein, und zwar dann, wenn es Saison hat. Die Gurke aus dem Nürnberger Knoblauchsland, die ich auf dem Wochenmarkt bei mir im Viertel kaufe, hat auch ohne schützende Plastikhülle deutlich weniger Gelegenheit, zu Biomüll zu werden, als die spanische Gurke, die schon auf ihrer langen Reise anfängt zu schrumpeln.
• Machen Sie Ihren Händlern Dampf! Wir Kunden haben viel mehr Macht, als uns oft bewusst ist. Was glauben Sie, warum die großen Ketten plötzlich Geld für die Erforschung von Laserkennzeichnung ausgeben? Weil sie oft genug von ihrer Kundschaft für die Plastikfluten gebasht worden sind. Also dranbleiben!
Die beste Einkaufstüte der Welt
Meine Großmutter wäre niemals ohne Korb einkaufen gegangen. Allerdings war sie auch nicht berufstätig. Der Gang zum Supermarkt fand bei ihr immer geplant statt, nicht spontan zwischen Job und Kindergartenabholung oder während einer sich plötzlich bietenden Lücke im Terminkalender. Für moderne doppelt bis dreifach belastete Menschen wie mich ist es deshalb durchaus praktisch, wenn man im Supermarkt Tüten und Taschen in allen Größen dazubekommt. Als ich das erste Mal in den USA war, habe ich gestaunt über die freundlichen Packhelfer, die meine Einkäufe in eine Unmenge von bereitliegenden Plastiktüten packten. In deutschen Supermärkten kosten Tüten seit ich mich erinnern kann Geld – allerdings so wenig, dass sich das prophylaktische Herumtragen eines Korbes nicht so richtig im Geldbeutel bemerkbar macht. Aber doch immerhin genug, um uns schon vor den jüngsten Aktivitäten der EU zu Europas sparsamsten Tütenverbrauchern zu machen: 71 Plastiktüten pro Kopf und Jahr – in Polen, Ungarn oder der Slowakei waren es 450.
Das mag damit zu tun haben, dass es in den Mangelgesellschaften hinter dem Eisernen Vorhang nicht nur keine Bananen, sondern auch keine Tüten gab und deshalb ein gewisser Nachholbedarf bestand. Dabei waren die Ostblockbewohner in Sachen nachhaltige Einkaufstransportmedien aus heutiger Sicht wegweisend … Die Schauspielerin Gerit Kling, ein Kind der DDR, hat mir in einem Interview vor ein paar Jahren erzählt, dass sie immer einen sogenannten Dederonbeutel einstecken hatte, für den Fall, dass es plötzlich unerwartet etwas Besonderes zu kaufen gab. Nicht auszudenken, wenn der Kauf von zwei Kilo Orangen am fehlenden Behältnis gescheitert wäre …
Auf der anderen Seite der Mauer galten die »Ich hab immer meine Plastikalternative dabei«-Typen eher als etwas skurril: Der »Jute statt Plastik«-Beutel gehört für mich genauso zur Folklore einer bundesrepublikanischen Kindheit in den Siebzigerjahren wie Bonanza-Räder oder Dolomiti-Eis. Ab 1978 wurden die Taschen für 1,50 DM in Dritte-Welt-Läden vertrieben und wurden zum unverzichtbaren Accessoire für Menschen, die ihre Schafwollpullover selbst strickten und für ihr Müsli morgens eigenhändig Haferflocken quetschten. Sie wurden dafür gerne belächelt. Doch der Lauf der Zeit gibt ihnen recht: Heute gibt es handliche, wiederverwertbare Einkaufstaschen sogar in Museumsshops und Duty-Free-Läden – so etwas nicht dabeizuhaben, outet einen sofort als Klimasünder.
Denn ehrlich gesagt: Jede Tüte, ob Plastik, Papier oder Stoff, die wir beim Einkaufen dazuerwerben, ist ein Ökoproblem. Ende April 2015 hat die EU-Kommission deshalb eine Richtlinie verabschiedet mit dem Ziel, dass der Verbrauch von Einwegtüten bis Ende 2019 auf 90 Stück pro Kopf reduziert werden soll. Bis 2025 soll der Verbrauch in der EU sogar auf 40 Stück pro Kopf und Jahr zurückgehen. Grundsätzlich können die EU-Länder im Rahmen der Richtlinie eine verpflichtende Abgabe für die Tüte einführen. Irland etwa hat dies vor einigen Jahren getan – mit Erfolg. Dort sank der Verbrauch von über 300 Tüten pro Person und Jahr auf nur noch 14 Tüten. Und auch bei uns in Deutschland hat sich noch mal etwas bewegt, seit Plastiktüten fast überall kostenpflichtig sind: 2018 lagen wir pro Person nur noch bei 24 Tüten jährlich – das ist etwa eine Tüte alle zwei Wochen.
Interessanterweise geht es uns dabei offenkundig wirklich mehr um die paar gesparten Cent als um unser reines Umweltgewissen. Gegenläufig zum sinkenden Tütenverbrauch ist nämlich unser Verbrauch an sogenannten »Hemdchenbeuteln« gestiegen – das sind die dünnen Plastiktüten, die in der Obstabteilung hängen … Die sind eigentümlicherweise von der EU-Richtlinie ausgenommen. Das Bundesumweltministerium erklärte auf eine Anfrage der FDP, dass wir Bundesbürger 2018 37 solcher Tüten pro Kopf verwendet hätten, eine mehr als 2015. Während also die Ökostreber unter uns brav unverpackt einkaufen und aus alten Gardinen Obstbeutel schneidern, nutzen die Sparfüchse offenkundig die Hemdchenbeutel als Tütenalternative …
Aldi plant deshalb, künftig auch für diese Tütchen den – eher symbolischen – Betrag von einem Cent zu kassieren. Ob das abschreckend genug ist, wird sich zeigen. Einen anderen Weg geht die Handelskette Real: Dort sollen künftig in der Gemüseabteilung nur noch Papiertüten ausliegen. Mein Bauchgefühl mag das: Papiertüten fühlen sich eindeutig ökologischer an. Aber sind sie es auch?
Also zurück zur ökologischsten Plastiktüten-Alternative – irgendwie müssen die Einkäufe ja nach Hause … Die Stoff- oder Papiertasche im Supermarkt ist zwar deutlich teurer als Plastik, trotzdem habe ich sie auch früher stets lieber gekauft, in dem Gefühl, damit irgendwie die kleinere Ökosauerei zu begehen. Doch dann macht im Frühjahr 2018 eine Studie des dänischen Umweltministeriums Schlagzeilen. Demnach müsse man eine Tasche aus ungebleichter Biobaumwolle gleich 20000 (ja, Sie haben sich nicht verlesen: Zwanzig! Tausend!) Mal verwenden, damit sie auf die gleiche Ökobilanz komme wie eine Plastiktüte aus Polyethylen, die nach einmaliger Verwendung im Müll endet.13 Ich überschlage das mal: Eine Familie, die etwa dreimal wöchentlich einkauft, müsste das demnach – wie bei einem Erbstück über Generationen hinweg – 128 Jahre lang mit der Baumwolltasche tun, bis sie in Sachen Ökobilanz besser dastünde, als wenn sie bei jedem einzelnen Einkauf während dieser unglaublich langen Zeit eine Plastiktüte gekauft und anschließend weggeworfen hätte … Damit wäre die Baumwollalternative eindeutig raus. Kann das stimmen?
Ich mache mich auf die Suche nach weiteren Studien. Der Schweizer Forscher Roland Hischier hat 2014 für die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, kurz EMPA, ebenfalls eine Studie zur Ökobilanz von Tragetaschen verfasst. Auch hier schneidet die Baumwolltasche am schlechtesten ab, ist allerdings immerhin schon nach 20 Durchgängen gleichauf mit der Plastiktüte. Der Sieger in dieser Studie ist eine Tüte aus 80 Prozent recyceltem Plastik.14
Wohin mit dem Hundekot?
Kennen Sie die Geschichte? Eine junge Schwedin engagiert sich für die Umwelt. Ihr Protestfoto teilt sie über soziale Medien. Auf der ganzen Welt klicken Menschen ihr Foto an. Ihr Name ist … nein, nicht Greta. Ich spreche von Sanna Lagerwall, die 2015 für ein Schulprojekt 172 volle Hundekotbeutel in einem Wald bei Göteborg einsammelte und anprangern wollte, dass die Besitzer der Hunde die Tüten nicht ordnungsgemäß in den Müll geworfen hatten.
Hundebesitzer sind in den vergangenen Jahren dazu erzogen worden, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner stets aufzusammeln. In München stehen in jedem Park Tütenspender. Und tatsächlich tritt man seitdem viel seltener in Hündehäufchen. Das ist gut für die neuen Sneakers, aber nicht gut für die Umwelt. In Deutschland gibt es mehr als neun Millionen Hunde – geht man von zwei »großen Geschäften« am Tag aus, macht das die kaum vorstellbare Menge von 6,57 Milliarden Tüten im Jahr.





























