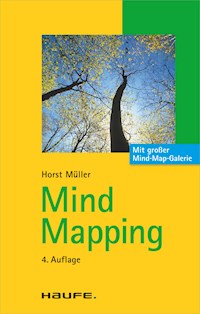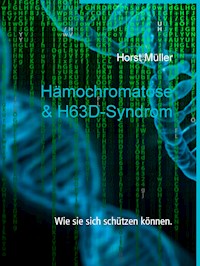Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor Horst Müller, Jahrgang 1929, wird in seinen späten Lebensjahren von Erinnerungen an die Notzeit, die Zeit als Heranwachsender eingeholt. Die Texte beschreiben zunächst, in „Heimatfront“, seine frühe Prägung durch Hitlers „Jungvolk“, die Zerstörung der Heimat, den Verlust von Vater und Schwester durch den Krieg. Es folgt die Liebesgeschichte von Inge und Hilmar, die von den emotionalen Turbulenzen der frühen Nachkriegszeit verstört werden und daran zugrunde gehen. Danach Erlebnisse als „Ausgebombte“, in der Enge einer Behelfswohnung, mit den kleinbürgerlichen Vermietern. Es folgt die Rechenschaft über den in der Jugendzeit erfahrenen Antisemitismus. Schließlich eine lange, nach der eigentlichen Kriegs- und Krisenzeit geschehene Selbstzerstörung eines ehemaligen Mitschülers, der die atomare Aufrüstung nicht erträgt. Alle fünf Texte sind vom Stigma nicht enden wollender kriegerischer Bedrohung gezeichnet, deshalb tragen sie als Titel eine Zeile aus dem Lied der „Mutter Courage“: DER KRIEG, ER ZIEHT SICH ETWAS HIN.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Große Dankbarkeit schulde ich Norbert Reitz, ohne dessen Mitarbeit und energischen Einsatz das Buch nicht hätte entstehen können.
Inhalt
Der Krieg, er zieht sich etwas hin
Ein paar Kapitel von der Heimatfront
Lieder
Böhnchen
Die Schwester
Luftschutz
Eine kleine Straße
Das Lager
Tiefster Frieden - oder: Du holde Kunst
Tiefster Schrecken
Auf dem Herzen zu tragen
Mielchen und August
Der ganz gewöhnliche Antisemitismus
Nebenrolle
Der Krieg, er zieht sich etwas hin
Mit seiner Not, seiner Gefahre,
der Krieg, er zieht sich etwas hin.
Der Krieg, der dauert hundert Jahre ...
Es ist das Lied der Mutter Courage in Bertolt Brechts gleichnamigen Stück; so beginnt die letzte Strophe. Und deren zweite Zeile soll mein Titel sein. Die Handlung spielt im Dreißigjährigen Krieg. Die Untertreibung “etwas” zeigt die Trostlosigkeit des nicht enden wollenden Kriegsgeschehens an.
Wenn ich zurückdenke an die Jahre 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, meine Jungend damals, im Alter von 14 bis 18, dann sehe ich, wie alles vom Krieg durchdrungen war. Er fing schon 1914 an, als die großen Staaten wie Schlafwandler handelten und ihre jungen Männer auf die Schlachtfelder schickten.
Der Ausdruck “Schlafwandler” wird von einem heutigen Historiker verwendet für seine Beschreibung des Gesehenes von 1914. Es ließ ein Europa entstehen, das nicht mehr zur Ruhe kommen sollte bis zu der noch größeren Katastrophe von 1939 bis 1945 - und weit darüber hinaus.
Mein Glück war zunächst, dass ich knapp davonkommen konnte. In den späteren Jahren habe ich noch viel Glück verbraucht. “Ich kann nicht klagen”, so sagt man dazu. Aber da ist bis heute ein Gefühl geblieben, genährt auch von den unzähligen immer neuen Konflikten in der ganzen Welt, das bedeutet mir:
Es ist immer noch Nachkriegs-Zeit.
Ein paar Kapitel von der Heimatfront
Lieder
Die Landgrafenstraße ist eine Hauptstraße in unserer Stadt. Sie führt vorbei am Kastellplatz, und diesem gegenüber stand das Hotel Regenbogen. Im Frühsommer 1939 kam Hitler. Ich war zehn und eben ins Jungvolk aufgenommen worden. Wir Pimpfe standen in Uniform die Straße entlang, vor den Reihen der vielen, die am Abend den großen Fackelzug und natürlich den Führer sehen wollten. Auch die BDM-Mädchen in ihren weißen Blusen mit Schartuch und Knoten standen überall zwischen und vor den Erwachsenen. Eigentlich war es zu spät für uns, jetzt im Sommer wurde es spät dunkel, und dunkel musste es ja sein bei einem Fackelzug. Aber uns, den Zehn- bis Vierzehnjährigen, war befohlen worden, Spalier zu stehen, während die eigentliche HJ marschierte. In Sechserreihen, das hatte ich noch nie erlebt!
Der Zug näherte sich aus der Bremer Straße, so heißt die Verlängerung der Landgrafenstraße nach unten, nach Norden. Vorerst war noch nichts zu sehen, aber Trommeln und Pfeifen waren zu hören. Als der Zug aus einer leichten Biegung auftauchte, setzten die Fanfaren ein. Sie "schmetterten hell", wie es in dem sehr bekannten Lied hieß, der Schall kam von den Hauswänden gegenüber laut zurück, die Fanfaren glänzten, von hinten, vom Schein der ersten Fackelreihen angeleuchtet. Sie wurden von den Bläsern schräg nach oben gehalten, alle im gleichen Winkel, bei jedem lag die linke Hand auf der linken Hüfte. An den Instrumenten hingen Hakenkreuzwimpel herunter. Sie spielten nur kurz. Jetzt erschienen die Fackeln, in Sechserreihen getragen, wie schon gesagt.
Die Reihen waren auseinandergezogen, damit das abschmelzende Pech nicht auf die Träger tropfte, dadurch nahmen sie fast die ganze Straßenbreite ein. Eine gewaltige Kolonne. Erst mal hörte man jetzt nur den Marschtritt, und 20, 25 Reihen zogen vorüber, dann kam ein Block mit riesengroßen Hakenkreuzfahnen, wieder mehrere Reihen, und nun schlugen die Trommler los, auf großen hohen Trommeln, die eher Pauken waren, an ihren Wänden rot-weiß geflammt. Ohrenbetäubend laut, in ganz gleichmäßigem Takt, jeder Schlag von allen Trommeln nur ein einziger. Sie kamen jetzt zu der Stelle, wo ich stand, noch ein ganzes Stück weg vom Hotel Regenbogen. Dort, gegenüber, hatten natürlich alle hin gewollt, das Gedränge der Zuschauer war also da am größten, denn drüben würde sich ja der Führer zeigen, vom Balkon herab. Auch die Pfeifer zogen vorbei, schrill und laut, dann nur noch Fackeln. Und der Zug stand. Noch einmal ein Fanfarensignal, noch einmal ein langer Trommelwirbel, und jetzt leuchteten Scheinwerfer auf, sie tauchten den Balkon über dem Hotel-Portal in helles Licht, und der Führer, der verehrte, vergötterte, sofort bejubelte trat heraus. Links und rechts von ihm, aber weiter hinten, zwei Uniformierte.
Ich konnte ihn nur ab und zu sehen, wenn ich auf die Zehenspitzen stieg, was nicht lange auszuhalten war. Er hob die Hand, nicht in derselben Art, wie es jedermann befohlen war, nicht mit gerade nach vorn gestrecktem Arm, sondern nach hinten gebogen, den Arm gekrümmt. Ungeheurer Beifall brach aus allen hervor, die da standen und ihn sehen wollten, den Vergötterten und so weiter, und der Beifall wurde nicht geklatscht, sondern geschrien, mit dem Wort "Heil", immerfort, immerzu "Heil, Heil!" Die Gesichter leuchteten im Fackelschein. Der Brandgeruch breitete sich aus. Die Fackeln haltenden Jungen starrten hinauf zu demjenigen, dem sie das Feuer, die Fahnen, die Fanfaren und die Herzen entgegenbrachten. Ein Kommando war zu hören, die Füße wurden auf einen Schlag wieder zum Gleichschritt gesetzt, der Zug marschierte weiter, Hitler da oben stand als sein eigenes Denkmal. Der große Marsch in den leuchtenden Sechserreihen war es, was mich ansaugte und in Aufregung versetzte. Sehr weit ist der Abstand zu meinem zehnjährigen Ich von damals, ich muss mir ein Zitat ausleihen, um jenen Gefühlszustand zu bezeichnen: "Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll...". Ich wollte da mittendrin sein in dem Rausch des Marschierens, Fackeltragens, einem Rausch, der auch, seltsam genug, von der Disziplin ausging, vom Funktionieren des machtvollen Schauspiels. Und jetzt setzte das erste Lied ein:
Wir Jungen tragen die Fahne
zum Sturme der Jugend vor,
sie stehe und steige und lohe
wie Feuer zum Himmel empor.
Wir sind auf die Fahne vereidigt
für immer und alle Zeit.
Wer die Fahne, die Fahne beleidigt,
der sei vermaledeit!
Noch zwei Strophen folgten, und weitere Lieder. Von beiden Seiten, von vorn und hinten also, hörte man den verschleppten, sich verschiebenden Schall, es ist ja nicht anders möglich, wenn dieselben Töne auf so langer Strecke zugleich gesungen werden. Ich aber war gerade davon in Bann geschlagen, von diesem endlos weit hingezogenen, in Wellen widerhallenden Singen. Neidisch waren wir alle, die Kleinen, die für diesmal noch nicht mitmachen durften in dem gewaltigen breiten und langen Strom aus brennenden Lichtern, blutroten Fahnen, krachendem Marschtritt und schallenden Liedern.
Mein Freund und Schulkamerad Limmi stand neben mir. Er fragte eine Frau nach der Uhrzeit, dann zog er mich mit sich: "Komm, mein Vater wird schon längst da sein!" Der Zug war noch nicht ganz vorbei, aber jetzt marschierten nur noch Jungen ohne Fackeln. Wir schlängelten uns durch bis zur großen Reklame-Uhr, dort stand Limmis Vater; er sah uns und rief: "Los, los, es ist schon spät!" Komischerweise setzte er noch hinzu: "Der Zirkus ist aus", dann ging er schnell vor uns her. Tatsächlich waren wir todmüde. Den langen Heimweg mussten wir laufen; auf eine Straßenbahn zu warten hatte bei der Menschenmenge, die sich jetzt auflöste und zu den Haltestellen drängte, keinen Sinn. Zum Glück war Samstag, wir konnten am anderen Morgen ausschlafen. Das Lied "Wir Jungen tragen die Fahne" summte mir unterwegs durch den Kopf, vielleicht, weil es etwas "getragener" im Takt ist als die "zackigen" anderen, mehr zum Schreiten als zum Marschieren. Schreiten ist feierlicher, deshalb war es wohl das erste, das gesungen worden war, als der Gefeierte noch da oben stand.
Die Lieder: Einmal habe ich sie alle, die damals gelernten, an den Fingern abgezählt. Im Nu hatte ich fast 30 aus dem Gedächtnis zusammen Nationalsozialistisches "Liedgut". Die Melodien kenne ich sowieso noch, von den Texten manchmal mehrere Strophen, manchmal eine, manchmal nur ein paar Zeilen. Es ging so zu, dass beim Jungvolk mittwochs und samstags "Dienst" war, obendrein jeden Sonntagvormittag. Antreten, Kommandos lernen und befolgen, stillgestanden - rührt euch!, links um, rechts um, Augen links - rechts - geradeaus!, das alles bei jedem Dienst, also endlos oft. Dann lange Märsche.
Aber ausschließlich exerzieren und marschieren, das war nicht Dienst genug. Die Führer hatten den Auftrag, uns nach und nach alle die Lieder beizubringen, geduldig, in endloser Wiederholung Zeile für Zeile, Strophe für Strophe, draußen an einer ruhigen Ecke, wir saßen als Jungenschaft zu 12 bis 15 auf dem Bordstein, der Jungenschaftsführer sprach vor, sang vor, es ging auch ohne tongebendes Instrument, schließlich hatten es die Ersten intus, dann ein paar mehr, wir konnten beim Marschieren das neu Gelernte singen, immer wieder ging der Ton bei einigen daneben, auch der Text da und dort, aber in dem Alter lernt man schnell auswendig (und merkt es sich über Jahrzehnte), nach und nach sammelten sich immer mehr Lieder in unseren Köpfen an. Worauf ich aber hinauswill, das ist der Inhalt. Der Inhalt war: Kampf. Wir haben gekämpft, wir kämpfen, wir kämpfen gern, wir werden kämpfen müssen, wir wollen kämpfen, wir werden also kämpfen.
Es gab die Lieder, die noch vom ersten Weltkrieg herrührten, in dem die Väter gekämpft hatten, zum Beispiel "Graue Kolonnen ..." oder "Es klappert der Huf am Stege". Dann diejenigen aus der wörtlich so genannten Kampfzeit, in der die SA, die Hitlerjugend, die militant organisierte nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, die NSDAP also, erst noch zum Siege hatte geführt werden müssen, allen voran das Lied vom Märtyrer Horst Wessel, geheiligt und zu allen feierlichen Anlässen, auch zum Schuljahrsbeginn und -ende, gleich nach dem Deutschlandlied zu singen: "Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!". Außerdem: "Ein junges Volk steht auf, zum Sturm bereit" oder das drohende "Es zittern die morschen Knochen ..." und nicht zuletzt das mitreißende "Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren Dann noch Marschlieder für die Wehrmachtsoldaten, in denen überall Mädchennamen vorkamen, ich kann sie abzählen, es sind mindestens neun, einige, zum Beispiel Lore, kommen mehrmals vor.
Und als der Krieg endlich da war, mussten nacheinander auch die Waffengattungen und die Feldzüge besungen werden, das ältere "Denn wir fahren gegen Engelland ..." kam von neuem zu Ehren, immer wurde es im Radio gebracht, wenn wieder englische Tonnage versenkt worden war; es gab das Frankreichlied, das Russlandlied, das Lied des Afrika- oder Panzerkorps; die Flieger sangen: "Rot scheint die Sonne: Fertiggemacht!", und auch die sehr ruhmreiche Legion Condor, mit der Hitler im spanischen Bürgerkrieg dem Caudillo Franco zu Hilfe gekommen war, hatte ihr Lied, das war mit in unseren großen Vorrat aufgenommen worden.
Wir sangen, wir plärrten, wir brüllten. Manche Führer hatten empfindliche Ohren und befahlen eine möglichst saubere Intonation. Und Molli, unser Musiklehrer, dessen Lehrplan ihn ebenfalls verpflichtete, seinen Schülern nationales und Soldaten-Liedgut zu vermitteln, hatte unter unseren eher geschrieenen als gesungenen Tönen Schreckliches auszustehen. Wenn er 1940, als ich in der Quinta war, zum Frankreichfeldzug das nagelneue "Kamerad, wir marschieren im We-esten ..." anstimmen lassen wollte, es am Klavier anschlug und selber sanft modulierend die ersten Takte vorsang, wurde er einfach ausgelacht und reagierte cholerisch, indem er beispielsweise einen von uns, den er für den Brüll-Anstifter hielt, mit dem Stock in der Hand - er leistete sich noch den eigentlich verbotenen Rohrstock - durch die lange Bankreihe und noch weiter durch den Musiksaal jagte, vergeblich natürlich.
Molli war für die neue Zeit nicht geschaffen, er hieß mit richtigem Namen Heinrich Möller und war eigentlich Kirchenmusiker, mit dem Titel Oberkirchenmusikdirektor. An eine der Kirchen-Musikschulen hätte er gehört, aber die hatten alle schließen müssen. Kampfgebrüll, Kriegs- und Siegesgesänge. Als wäre man ständig mittendrin im Kampfgeschehen. Und so war es ja auch beinahe. In den Grundschulklassen warb unser Lehrer Reinhard für ein kämpferisches Leben. Er zeigte uns auf dem Sportplatz seine tiefe Narbe am Schienbein entlang, von 1916, von einem Granatsplitter in Flandern herrührend. Er zeigte uns im Herbst 1938 die Landkarte der Tschechoslowakei mit ihrer buntfarbigen Einteilung, mit den leuchtend roten Randgebieten der Sudetendeutschen, die heim ins Reich gebracht werden mussten: ein Vielvölkerstaat ohne Existenzberechtigung, eine deutsche Aufgabe, das zu korrigieren. Er war ein guter Lehrer, ein Klarmacher, ein Lernenlasser mit Augenmaß, und alles ging uns Kleinen nur allzu gut ein. Im Klassenzimmer hatte er zwei große Bilder aufhängen lassen. Vom Feldmarschall von Mackensen mit Riesenschnauzbart, buschigen Brauen und Pelzmütze, worauf ein Totenkopf saß, und von Ludendorff. Über beide wusste er Spannendes zu erzählen.
Und als wir neun waren und in die vierte Klasse gingen, wünschte er dringend, dass wir uns etwas wünschten, nämlich zu Weihnachten von unseren Eltern "Die Geschichte von Adolf Hitler". Das war die Jugendfassung des Buches "Mein Kampf", Preis 80 Pfennige. Von meiner Mutter, die nicht wagte, sich gegen etwas dringend Empfohlenes, also quasi Verordnetes aufzulehnen, wurde der Wunsch natürlich erfüllt oder befolgt. Nein, gänzlich folgsam gegenüber solchen politisch gefärbten Empfehlungen war sie nun doch nicht. Als sie sich nämlich entschlossen hatte, ihren Sohn auf eine Oberschule zu schicken, musste sie erst einmal standhalten gegenüber einer anderen dringenden Empfehlung des Lehrers Reinhard. Dieser wollte sie nämlich davon überzeugen, dass es für sie als Witwe doch vorteilhaft sei, wenn ihr der Staat alle Fürsorge für den Jungen abnähme, sie auch das Schulgeld sparen könnte, das der Besuch einer Höheren Schule kostete, immerhin 20 Reichsmark im Monat. Das hieß, sie sollte mich auf eine Napola, eine nationalpolitische Lehranstalt geben. Das wollte sie nicht. Später erzählte sie mir, der Reinhard habe sie erstaunt angesehen, als sie ihrer Ablehnung noch hinzugefügt habe: "Ach, ich weiß nicht, es kann ja auch mal wieder anders kommen". Das glaube er aber nicht, habe er mit entschiedenem Kopfschütteln entgegnet. (Seine Söhne, Wolfram und Ulli, sind alle beide noch 1945 gefallen, der eine 18, der andere 16 Jahre alt.)
Zum Dienst beim Jungvolk gehörten im Sommer auch Sportnachmittage und Geländespiele. Zwei von diesen Nachmittagen sind mir in scharfer Erinnerung geblieben, wegen der Blessuren, die ich dabei abkriegte. Auf dem Sportplatzrasen saßen wir in einer Runde, und der Jungzugführer Mailing erklärte, heute sei das Boxen dran. Er zeigte uns keine Haltung, keine Stellung, keine Deckung und keine Technik. Er wusste wohl gar nichts davon, und es kam auch nur darauf an, so draufgängerisch wie möglich sich zu schlagen, allerdings mit richtigen Boxhandschuhen, die, reihum weitergegeben, angeschnallt werden mussten. Die einzige Anweisung lautete: Immer feste druff! Als einzige Kampfregel wurde angesagt: Sobald einer blutet, ist der Kampf zuende, der andere hat gewonnen.
Bei mir ging es schnell. Die Tränen flossen, ich konnte sie nicht zurückhalten, als meine Nase und meine Unterlippe bluteten. Blind vor Wut, vor allem wegen der Tränen-Schmach, stürzte ich noch einmal auf meinen Gegner zu. Der hatte sich schon abgewandt und wollte sich die Handschuhe abschnallen lassen, er war ja der Sieger. Ich traf ihn über dem Ohr, er fiel um und blieb bewusstlos liegen. Einer von den anderen rief: "Hej, Old Shatterhands Jagdhieb!" Der Jungzugführer schrie mich an und verurteilte mich zu drei Runden um den ganzen Platz wegen unsportlichen Verhaltens. Jedesmal, wenn ich an der Gruppe vorbeilief, grölten sie: "Old Shatter-hand!" Der andere stand wieder auf, der Mailing verlangte, dass wir uns die Hand gaben. Umständliche Entschuldigungen waren unbekannt.
Das Geländespiel war groß angelegt, mit dem ganzen Fähnlein, aufgeteilt in zwei Parteien, die Roten und die Blauen. Jeder bekam entweder ein rotes oder ein blaues Band ums linke Handgelenk gebunden. Wer sein Band im Kampf verlor, war "tot" und musste ausscheiden. Zu jeder Partei gehörten Ältere und Jüngere in etwa gleicher Verteilung. Die Roten hatten eine Festung in einem sehr steilen Waldstück zu verteidigen. Ich gehörte zu den blauen Angreifern. Aber dem Angriff ging erst noch ein langes Suchen und Aufspüren des Gegners voraus. In der Zwischenzeit hatten sich die Verteidiger aus Ästen eine Burg gebaut, die von unten, über den steilen Hang, kaum zu erstürmen war. Sie hatten sich eine Taktik überlegt, die uns, den "Eroberern", schwere Verluste brachte und sich eigentlich mit der Spielregel, nämlich dem Kampf um die farbigen Lebensbändchen, gar nicht vertrug: Die meisten von ihrer Gruppe lauerten weiter oben links und rechts im Dickicht, damit niemand von uns die Festung umging und von oben und hinten angreifen konnte. Die vier größten und stärksten Jungen aber standen bereit, um einen nach dem anderen von den mühsam heraufsteigenden Gegnern an Armen und Beinen zu packen und den steilen, dicht mit Fichten bestandenen Hang hinunterzuwerfen. Die Bäume hatten unten harte kurze abstehende Äste, die schlimme Kratzer verursachten.
Es nützte nichts, sich in gedrängten Grüppchen zu nähern, um die Feinde so gewissermaßen zu erdrücken, sie waren zu stark, das Herankommen war viel zu schwer, und einer nach dem anderen flogen wir den Abhang hinunter. Einer verlor ein Auge dabei. Ich hatte zerschundene nackte Beine, blutete an einem Ohr und ziemlich stark aus einer Risswunde über dem linken Fußknöchel. Gelobt sei, was hart macht! Das war die Parole. Es ist klar, dass es weniger um wirkliche sportliche Leistungen ging. Darum ging es zwar auch, der Sport stand ja hoch im Kurs, eine Nation von Kämpfern musste auch eine Sportlernation sein. Die 1936er Olympiade hatte den deutschen Teilnehmern eine Menge Medaillen gebracht und dem neuen deutschen Reich großen Ruhm. Aber die Beispiele, die hier beschrieben worden sind, fallen schon in die Kriegszeit, es konnte nur nützen, auch schon mal ein wenig Blutvergießen einzuüben. Wir Jungen waren die Spartiaten, Kampf und Sieg galten als unser Lebens-Sinn, der Tod gehörte als Drittes dazu, der Tod fürs Vaterland, fürs eigene Volk. Er findet sich auch in den Liedern, von denen die Rede war, die Todesbereitschaft darf nicht vergessen werden.
Die meisten Lieder führten sie mit sich, nirgendwo erscheint sie so inbrünstig wie in den Zeilen: "Deutschland, sieh uns, wir weihen /dir den Tod als kleinste Tat, / trifft er einst unsre Reihen / werden wir die große Saat." - Doch, ein Lied ging wohl noch darüber hinaus. Man muss es durchschauen. Das war uns Zehnjährigen, als wir es lernten, noch nicht möglich. Unser Jungstamm trug den Namen "Langemarck". Der "Stamm" war eine höhere Organisationseinheit der Hitlerjugend und des Jungvolks, oberhalb von Jungenschaft, Jungzug und Fähnlein. Der Jungstamm hatte auch ein eigenes Lied, das wir bei Feiern und bei Sportfesten singen mussten: "Heißa, junge Mannschaft, / Jungstamm Langemarck, / nie lass dich besiegen, / bleibe fest und stark!" Es ist bekannt, dass der Massenselbstmord bei Langemarck damals ohne weiteres im Sinne eines Jugend-Ideals gebraucht und gepriesen wurde, der Ort in Flandern, wo gleich 1914 die kriegsfreiwilligen Studenten und Gymnasiasten mit Hurrageschrei begeistert und ohne Deckung ins MG-Feuer der gut verschanzten Engländer rannten und hingemäht wurden. Man hatte sie zum Sterben erzogen. Bei uns wurde es aufs neue versucht.
Wir sangen, wir sangen und wir marschierten, aber das schien trotz allem nur ein großes Spiel zu sein, es drang wohl alles Gehörte und Gelernte in uns ein, aber unsere Kinderfröhlichkeit nahm erst einmal keinen Schaden. Vielleicht lag das an den Lehrern. Sie begannen zwar jede Unterrichtsstunde mit dem Hitlergruß, dem befohlenen. Wir hatten ihn zu erwidern. Der Engelmann, der uns in der Sexta ins Englische einführte, schaffte es sogar, sich bei dem fatalen Gruß ein wenig Distanz zu verschaffen. Er sprach nämlich, wenn wir aufgesprungen waren, mit einem ganz und gar gemütlichen Tonfall: "Heil Hitler, ihr Männer!" In die Partei hatten sie alle eintreten müssen. Ihren Unterricht hielten sie ganz ohne ideologische Einfärbung.
Mit dem Direktor allerdings verhielt es sich anders. Er liebte es, an nationalen Feiertagen fanatische Reden in der Aula zu halten, auch zuweilen Kriegsberichterstatter für seine älteren Schüler zu Vorträgen einzuladen, durchaus auf Kosten von Unterrichtsstunden. Bei den Feiern gehörte es unbedingt dazu, dass Schüler patriotische Gedichte aufzusagen hatten. Einmal, im Frühjahr 1941, traf es Herbert O. aus meiner Klasse. Er war untersetzt, stark, gutmütig und beliebt. Nun stand er mit "Deutscher Glaube" von Karl Bröger allein vor den Hunderten von Schülern und Lehrern, in heller kurzer Hose und Braunhemd, und da ging das Lampenfieber mit ihm durch, seine Blase versagte. Wir, die Jüngeren, saßen weit vorne. Ich sah, wie er stand und mit leerem Blick starrte, und ich sah, als er die Überschrift sprach, vorn an seiner Hose einen dunklen Fleck, der wurde immer größer, während er anfing: "Nichts kann uns rauben Er brach ab, sah zur Seite, ob nicht die Aulawand sich für ihn öffnen wollte, dann rannte er durch den Mittelgang weg. Ein Lehrer ging ihm nach. Niemand lachte. Wir litten alle stellvertretend an der furchtbaren Blamage. Aber Dr. Küster, der Direktor, dieser Idiot, hat den Herbert dann noch zusammengestaucht, auch den Eltern einen Brief geschrieben. Es sickerte durch, dass der Vater diesen Brief erbost und mit politisch waghalsigen Vorwürfen erwidert habe.
Der Schulleiter Küster, von den Schülern furchtsam respektiert, wurde doch zugleich als komische Figur gesehen, wofür sich sein Habitus - dicker Bauch, spiegelblanke Glatze - anbot. Also hieß er bei uns "die Mauke". Sein politischer Übereifer wirkte grotesk. Es hieß, er habe sich einmal am Telefon versprochen und ein Gespräch eröffnet mit "Heil Küster, hier Hitler!" Und später, 1942, als wir mit den Mittelstufenklassen von mehreren anderen Schulen in ein großes Kino befohlen worden waren, um dort von einem Propagandaoffizier einen ganz und gar nicht zündenden, sondern elend trockenen Frontbericht anzuhören, wurde der Ober- oder besser Übernazi mitsamt dem Redner grausam bloßgestellt. Nach dem Vortrag nämlich eilte er nach vorn und hub an: "Liebe Schüler, mit atemloser Spannung...". Weiter kam er nicht, die ganze vorher eingeschläferte Schülerversammlung lachte laut und schallend. Dass er mit den Augen Blitze schoss, nützte ihm nichts, die Anonymität in der Masse schützte uns. Nicht einmal sein Freitod am Kriegsende verschaffte ihm posthum Respekt, rief nur Kopfschütteln und Achselzucken hervor.
Zum Jungvolk gehörten auch Heimnachmittage, die zum Beispiel in größeren Schulräumen abgehalten wurden. Auch dabei wurde gesungen. Außerdem gab es eine Art von Unterricht, für den unsere Führer in Schulungskursen vorbereitet worden waren. Wir hörten von Waffengattungen, militärischen Diensträngen, Schiffs- und Flugzeugtypen, und dass die Deutschen ein Volk ohne Raum seien, in Osteuropa aber genügend Raum zum Erobern bereit liege, denn dort sei einmal Germanenland gewesen, das sollte heißen: deutsches Land. Und als der Krieg im September angefangen hatte, da mussten wir begreifen, dass er durch furchtbare Verbrechen an deutschen Menschen in Polen ausgelöst worden sei.
An einem solchen Heimnachmittag wurde ein Junge aus unserer Runde aufgefordert, etwas neu Gelerntes aufzusagen. Er konnte nur eins von sich geben. Vom Abschneiden konnte er sprechen. Polen hätten in deutschen Dörfern den Bewohnern "die Nasen abgeschnitten, die Ohren abgeschnitten, die Finger abgeschnitten, das Geschlecht abgeschnitten" (Er sagte "Geschlescht"). Es folgte kein Einwand, es genügte. Das konnten sich deutsche Menschen ja auch nicht gefallen lassen, dann musste eben Krieg sein, und es war ein Glück, aber eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass unsere tapferen Soldaten jetzt ungeheuer schnell und überall siegreich in dieses Polen hineinstürmten.
Man musste sich aber vorsehen. Wir standen nun auch mit den alten Feinden von 1914 im Krieg, jedenfalls erst einmal im Westen. Niemand konnte wissen, ob wir, wie damals, nur auf dem Boden des Feindes zu kämpfen hätten, wir mussten auch das eigene Land zur Festung machen, den Westwall fertig stellen, die Keller der Häuser befestigen und Bunker bauen, weil der Himmel über uns jetzt nicht mehr sicher war. Es gab ja die Flieger, der Krieg aus der Luft stand bevor, eine spezielle Artillerie musste die Heimat dagegen schützen, das waren die Flieger-Abwehr-Kanonen, das war die Flak. Weil wir uns aber auch gegen Verräter, gegen die inneren Feinde schützen mussten, hatte man auf seine Worte zu achten, und man wurde ermahnt durch Plakate, auf denen jemand den Finger auf den Mund legte und der Text zu lesen war: "Achtung! Feind hört mit!" Zwei weitere Plakate tauchten auf und wurden verbreitet. Das eine mahnte zur Energie-Ersparnis, damit die Rüstungs- und vor allem die Stahlindustrie jederzeit genügend Kohle für ihre Schmiedefeuer hatte, und die - alsbald populäre - Gestalt, die da als Schädling angeprangert wurde, war der düstere Kohlenklau, gekrümmt unter einem schweren Sack. Das dritte Plakat sollte die Bürger vom Reisen abhalten, damit der Schienenweg frei war für die Güterzüge und den Transport von Rohstoffen und kriegswichtigem Material. Hier lautete der Text: "Räder müssen rollen für den Sieg", und manchmal stand noch die Reimzeile dabei: "Unnütze Reisen verlängern den Krieg".
Alle Übungen der Jugend, alle Vorkehrungen gegen mögliche Kriegsgewalt, vor allem aber das jahrelang schon erzeugte Empfinden: Wir sind bedroht, wir stehen im Kampf, wir müssen siegen, wir müssen auch unser Leben einsetzen - all das beschwor schon frühzeitig eine Vorstellung herauf, für die es später, mitten im Kriege, der schon ganz Europa ergriffen hatte, einen neuen Namen gab: Heimatfront.
Und trotz allem - die Lieder und die Parolen drangen zwar in unser Gedächtnis ein, nicht aber so ganz ins Bewusstsein, ins Nachdenken. Wir blieben vorerst spielende Kinder, auf Bücherlesen, Basteleien, Straßenspiele und nach der Notwendigkeit auf Hausaufgaben ausgerichtet. So lange, wie uns die Mordmaschinen aus der Luft noch gewähren ließen.
Böhnchen
Wolf-Heinrich Bartels war mein Klassenkamerad vom ersten Schuljahr an. Er wurde nur Böhnchen genannt, den Grund weiß ich nicht. Das große Vorstadtviertel, in dem wir beide wohnten, heißt Fasanenhof und liegt am Nordrand der Stadt. Es wird geteilt durch eine breite Straße, die weit hinausführt. Auf meiner Seite sah es einfacher aus, es gab viele Doppel- und Reihenhäuser. Jenseits der Achse waren die Gärten größer, darin standen vielfach villenähnliche Häuser, in denen feinere Leute wohnten. Dort wohnte auch Böhnchen. Sein Vater arbeitete als ein leitender Ingenieur und Konstrukteur in der sehr renommierten Lokomotivenfabrik, die bis zum Kriege in alle Welt lieferte, dann, 1940, auch Panzer und Geschütze in die Produktion aufnahm. Dieses riesige Werk in der Nordstadt sollte später ein Ziel für mehrere schwere Bombardements werden, die unser Wohngebiet in Mitleidenschaft zogen.
Freundschaft mit Böhnchen schloss ich erst in der Untertertia, als wir dreizehn waren. Aufgefallen war er uns, seinen Mitschülern, schon in der Volksschule, wo er, vom Lehrer dazu ermuntert, mehrmals großmächtige Konstruktionen mitbrachte und vorführte: aus einer großen Menge von Trix-Baukästen errichtete Maschinen, die richtig liefen oder arbeiteten, batteriegetrieben, ein großer Lastwagen zum Beispiel, ein Kran, sogar ein Riesenrad mit vielen schaukelnden Gondeln, die mit Hilfe seiner Schwester durch bunte Plättchen verkleidet worden waren. So etwas gab es sonst nur in Spielzeugläden oder im Warenhaus zu bestaunen. Später ging er zu Stäbchenkonstruktionen über, alle einzelnen Teile dazu hatte er selbst hergestellt, bis auf die Energiequelle natürlich. Seine Hände, die das alles hervorbrachten, waren lang, dünn, vor allem rot und kalt. Sie ragten immer weit aus allen Hemden-, Pullover- und Jackenärmeln hervor. Er kümmerte sich nicht um Spielkameraden, er saß zu Hause, fummelte und konstruierte. Als er sein erstes Radio fertig hatte, lud er mich ein, es zu sehen und zu hören. Ich muss sagen, dass ich zunächst einmal enttäuscht war von dem Gebilde aus Drähten, birnenähnlichen Glaskörpern und einer flachen Trichterschale, das da auf einem Sperrholzbrett montiert war. Nach meiner gewohnten Anschauung musste ein Radio wie ein kleines Möbel aussehen. Die Musik und das Sprechen aus dem unscheinbaren Ding, das nur durch zwei Knöpfe mit unserem Apparat zu Hause verwandt zu sein schien, offenbarten mir dann doch die Funktionen, auf die es ankam.
Und Böhnchen unterrichtete mich in seiner bedächtigen Sprechweise über Radiowellen. Sein kleiner Arbeitsraum im Keller war unüberschaubar angefüllt mit Werkzeug, fertigen und unfertigen Geräten, älteren Baukonstruktionen aus früheren Jahren und Skizzenblättern auf einem gleichfalls überhäuften alten Tisch. Er zeigte und erklärte mir vieles. Danach sollte ich morsen mit ihm. Er wollte mir auch ein Gerät dafür mit nach Hause geben, aber wir kamen wieder davon ab. Fürs nächste Mal lud er mich ein, auch sein Chemielabor anzusehen. Das sollte bei mir eine starke Wirkung zeitigen.
In der Klasse wirkte er desinteressiert, fast schläfrig, er meldete sich fast nie - und wusste doch immer eine Antwort, wenn er aufgerufen wurde. Er schien aber zumeist auf irgendeiner Gedankenbahn zu sein, die um seine eigenen Pläne und Entwürfe kreiste. Er war eben der geborene Erfinder. Er lief schlenkrig, mit zu langen Armen, er stand mit hängenden Schultern, und in den Turn- und Sportstunden machten ihm die Übungen trotzdem keine Schwierigkeiten. Einmal wurde ihm durch einen Lehrer eine besondere Ehre zuteil, auf sehr seltsame Weise. Die Umstände dabei sind im weiteren Sinne kriegsbedingt.
Das längst besetzte Luxemburg wurde zwar erst 1942 ins Deutsche Reich eingegliedert, aber schon seit 1940 wie eine deutsche Provinz behandelt. Die Männer dort waren nicht zum Militär verpflichtet, mussten aber Dienste leisten, durch die eingezogene Deutsche ersetzt werden konnten. So bekamen wir, vielleicht auf Antrag unseres Direktors, luxemburgische Lehrer an unsere Schule, und gleich drei von ihnen hatte unsere Klasse im Unterricht. Der erste, Krumme, der immer Knickerbocker-Hosen trug und ein kräftiger blonder Mann ganz nach dem nordischen Musterkatalog war, wurde sogar in der Quinta unser Klassenlehrer. Er war sehr streng, bestellte mich einmal mit einer nachzuliefernden schriftlichen Aufgabe zu sich in die Wohnung, wo ich zaghaft antrat; seine hübsche Frau beruhigte mich mit Liebenswürdigkeit und einem Gebäckstück. Schleimer, den zweiten, hatten wir in der Quarta als Mathematik- und Physiklehrer. Sein Äußeres, er war bleich und ziemlich fett, schien zu seinem unschönen Namen zu passen, er erwies sich aber als scharfer Hund, verlangte viel und brachte uns auch viel bei.
Danach kriegten wir den Selm, ebenfalls in Mathe und Physik. Der war wieder anders. Großer Kopf mit krausen schwarzen Haaren, rotes Gesicht. Er sprach, wie es uns schien, mit französischem Akzent, hatte seltsame Ausdrücke an sich, zum Beispiel den Ausruf "dajeh!", was soviel wie "nun also" oder "alors" bedeutete, oder den Namen "die Apparate" für Lineal, Dreieck, Winkelmesser und großen Zirkel, womit an der Tafel die Geometrie zu veranschaulichen war. Er kam nicht richtig durch bei uns, er wirkte einfach zu komisch und rief immer wieder respektloses Lachen hervor. Als er uns zu einem Wandertag führte, war er eher auf unsere Führung angewiesen, denn er kannte sich ja in der Gegend nicht aus, wir doch schon einigermaßen, von früheren Wandertagen her.
Nun ging es aber nicht nur ums Herumspazieren, sondern um eine kriegswichtige Verpflichtung: Wir sollten möglichst große Mengen Heilkräuter und vor allem Beeren sammeln, zur Versorgung von Soldaten, Lazaretten oder für die Volksgesundheit. Es war im Frühherbst, Kamille gab es nicht, Schafgarbe fanden wir nicht, mit Kräutern kannte sich niemand aus. Aber Schlehen und Hagebutten saßen in Mengen an Büschen und Hecken. Wir, die Mehrzahl, die Meute, hatten aber keine Lust und keinen Respekt vor dem Lehrer. Als Schabernack zeigten ihm einige von uns immer wieder mal eine Handvoll jener anderen roten Beeren, die man Mehlsäcke nennt und die nicht zu brauchen waren. Er blickte betrübt darauf und sagte: "Dajeh -Mehlsäcke sind nicht gefragt".
Wir forderten ein Ballspiel auf der Waldwiese, das duldete er aber nicht. Er hatte sogar eine Verlockung parat: Den dreien, die die beste Ausbeute vorweisen könnten, versprach er ein Bier, wenn wir rasten würden. Aber wir mochten alle kein Bier. Am Ende der boykottierten Unternehmung jedoch gab es eine Überraschung. Der Selm fragte, wieviel wir denn nun gesammelt hätten, wir schrieen alle, wir würden uns nicht auskennen, aber Böhnchen, der habe viel gefunden. "Dajeh - wo ist Böhnchen?" fragte der Lehrer. Und da wurde ihm eine Milchkanne fast voll mit Schlehen und ein großer Beutel mit sauber abgeknipsten Hagebutten vorgezeigt. Böhnchen hatte mit Eifer, und weil er unsere Aufsässigkeit blöd und auch gemein fand, drauflos gesammelt, und nun hatte er Selms Ansehen bei der Schulleitung gerettet und sich große Dankbarkeit erworben. Er war kein Streber, er war sehr beliebt bei uns, und jetzt hatte er uns beschämt. Am nächsten Tag überreichte ihm der Selm eine Flasche Rotwein für seinen Vater und bat ihn, seinen Eltern einen "respektvollen Gruß" auszurichten. Böhnchen sagte artig "danke", und wir hörten von Selm: "Und ihr, ihr seid eine Klasse voller Flegel!" Er machte eine Pause, dann brachte er es fertig hinzuzusetzen: "Aber als ich ein Schüler war, war ich auch ein Flegel. Es ist gut". Dabei lächelte er ein wenig hilflos. Wir waren verdutzt - über den Rotwein, über seine Versöhnlichkeit. Von da an ärgerten wir ihn nicht mehr.
Wenn ich in Böhnchens Elternhaus eintrat, prallte ich immer erst unmerklich ein wenig zurück. Es gibt ein Bakterium, das sich mit Vorliebe in alten Abwaschlappen aufhält und vermehrt und sie zum Stinken bringt. Solche Lappen, anders als die heutigen Schwammtücher, meistens aus alten baumwollenen Unterwäschefetzen zurechtgerissen, gab es in jedem Haushalt. Es war eine Frage der olfaktorischen Empfindlichkeit der Hausfrau, ob sie dasselbe Tuch lange benutzte oder nicht, ob sie es öfter mal mit der Wäsche auskochte oder nicht. Frau Bartels war da ganz gewiss unempfindlich und die übrige Familie auch. Wesentlich war das nicht. Im wesentlichen war die Familie hochkultiviert. Im oberen Stock, wo ich nur einmal hinkam, gab es ein Musikzimmer. Darin stand ein Flügel, obendrein ein Cembalo, so etwas kannte ich bis dahin noch gar nicht, zwei Notenständer waren da, ein Cello lehnte an der Wand, mehr konnte ich nicht sehen.
Die Familie ging regelmäßig zur Kirche; als Böhnchen und ich Vorkonfirmanden waren und die zwei Jahre lang auch sonntags zum Gottesdienst mussten, sah ich Vater und Mutter jedes Mal, auch die Schwester meistens. Ich hörte von der Waldorfschule, die die Mutter und anfangs auch die Schwester Gertraud besucht hätten und die 1938 hatte schließen müssen, und von den starken musischen Einflüssen (das Wort "musisch" hörte ich zum ersten Mal), die von dort ausgingen. Ich sah, dass die Mutter handgewebte Röcke trug, Trägerröcke, zu einer bestickten Bluse. Und ich lernte, nach wiederholten Besuchen in dem interessanten Haus, Böhnchens siebzehnjährige Schwester Gertraud als Bildhauerin kennen. Sie "haute nicht Bilder", sie modellierte mit Ton. Sie setzte mich in Erstaunen - und auch in Verlegenheit. Böhnchen hatte, soviel ich weiß, keine weiteren Freunde. Immer wenn er wieder etwas Neues gebaut oder angefangen hatte, wollte er es mir zeigen, und ich ging gern zu ihm.
Und eines Tages überraschte er mich auf dem Schulhof mit etwas völlig Unerhörtem, ganz und gar nicht Technischem. Er sagte: "Komm mal hier rüber!" und zog mich aus dem Pausengebrüll der anderen in eine ruhigere Ecke. Dann sprach er ohne weitere Vorrede: "Ein Knie geht einsam durch die Welt, / Es ist ein Knie, sonst nichts, / Es ist kein Baum, es ist kein Feld, / Es ist ein Knie, sonst nichts .." - und so bis zum Ende. Er grinste übers ganze Gesicht. Ich konnte nichts sagen, sah ihn groß an. Aber mitten in der nächsten Stunde, bei einem englischen Lesestück, musste ich an das verrückte Gedicht denken und platzte mit Lachen heraus, hörte den Lehrer schimpfen über die Störung und musste danach doch noch ein paar Mal gnickern. In der nächsten Pause musste mir Böhnchen dasselbe wiederum aufsagen oder vormachen, ich hörte, das Gedicht sei von Christian Morgenstern, und verlangte nach mehr, nach dem ganzen Buch.
Aber als ich am Spätnachmittag gleich nach der Konfirmandenstunde mit ihm heimging, wartete etwas anderes auf mich.
Ich sah Gertrauds Werkstatt. Die Geschwister sahen sich ähnlich, und die Ähnlichkeit der beiden mit der Mutter war sogar verblüffend: dieselben krausen dunkelblonden Haare, bei Frau Bartels zu einem tief hängenden Knoten, bei Gertraud zu einem dicken Zopf geflochten, das längliche Gesicht, vor allem die Augenpartie mit spitz zur Seite sich ziehenden Lidern, auch die roten kalten Hände, dann eine leicht belegte, fast heiser wirkende Stimme. Mit einer nachdenklichen Miene, ein wenig abweisend, sah mir die Künstlerin entgegen, als wir in ihr Atelier eintraten, das eigentlich ein Wintergarten war und große Fenster auf zwei Seiten hatte. Kleinere Köpfe standen auf den Fensterbänken, den Vater, die Mutter glaubte ich dabei zu erkennen. Vor allem gab es Tierplastiken. Ein Hund, stehend, den Kopf nach hinten gedreht. Mehrere Katzen, aufrecht sitzend, liegend, gestreckt stehend, ein Reh, ein junger Bär, der mir nicht gelungen schien. Die schon gebrannten Tonfiguren waren dunkler als die nur getrockneten. Ich erfuhr, dass die Sachen in der eigentlich geschlossenen Waldorfschule gebrannt werden konnten. Sie durften nur nicht zu groß sein. Da ich immerhin viel zeichnete, was Böhnchen wusste, fühlte ich mich nicht allzu fremd unter den Bildwerken. Erklärt wurde nichts. Böhnchen sah mich nur gespannt an. Er war stolz auf seine künstlerische Schwester. Von ihr hatte er auch die Bekanntschaft mit Morgensterns Gedichten. Ich wusste nichts zu sagen, blickte aber überall genau hin, auf die Ähnlichkeit kam es ja an, bei Menschengestalten, bei Tieren. Ich sah das Werkzeug, die Wanne mit gelbbraunem Ton, und dann sah ich vor der Wand vier größere Gebilde, die mit großen Tüchern, wahrscheinlich alten Bettlaken, verhängt waren. Da machte ich doch den Mund auf und fragte, was darunter sei. "Große Figuren", hörte ich, "sie sind ungebrannt, sehr empfindlich". "Zeig sie ihm doch!", sagte der Bruder. Gertraud sah von ihm zu mir. "Es sind Akte", sagte sie, dann: "meinetwegen". Akte? Ach so, nackte Gestalten. In München, wo ich ein Jahr früher zu Besuch bei Verwandten gewesen war, hatte ich im Haus der Deutschen Kunst Akte gesehen, von Breker zum Beispiel und von Thorak. Es war aber etwas anderes, jetzt in einem Zimmer von einem Mädchen, das ich kannte, speziell für mich Akte gezeigt zu bekommen, die dieses Mädchen angefertigt hatte, nach der Natur selbstverständlich, nach ausgezogenen Menschen.
Die nackten Menschen, die ich zu sehen bekam, waren erst einmal zwei weibliche Figuren, eine ganz gerade stehend, eine sitzend, diese hatte einen Unterarm über den Schoß gelegt. Sie schienen sehr jung zu sein, jedenfalls die stehende, und hatten kleine Brüste. Erst als ich eine Weile hingesehen hatte, nahm Gertraud von der dritten, Böhnchen von der vierten Gestalt die Tücher ab. Zu sehen waren die beiden Geschwister selbst. Das Gesicht jeweils gut und treffend ausgearbeitet, da gab es ja auch schon Köpfe vorher, Vorstudien, überhaupt gab es die Vertrautheit mit dem eigenen Aussehen und dem des Bruders. Ich war dreizehn Jahre alt, und ich war verlegen. Man zog sich nicht voreinander aus damals, nicht einmal wir Jungen zum Turnen, zum Schwimmen, ohne unten etwas vorzuhalten.
Nun sah ich sozusagen die Freiheit der Kunst und ihre Werke, die künstlerische Wahrhaftigkeit bei allen Details. Gertraud hatte einen volleren Busen als die beiden anderen Mädchengestalten, und so war er zu sehen, nach dem Spiegelbild gearbeitet und mit deutlichen, gar nicht unscheinbaren Nüppchen. Der Bruder in seiner Magerkeit, mit etwas heraustretenden Beckenknochen, mit hängenden Schultern und mit Armen, deren Überlänge nochmals ein wenig übertrieben worden war. Was ich nicht einmal in München, bei den Idealgestalten im Museum, gesehen hatte, gab es hier, etwas, was man heute veristisch nennen würde. Nämlich eine ganz ausführliche Gestaltung dessen, was zwar eine nackte Kleiderpuppe, wie man sie manchmal bei einem Dekorationswechsel im Schaufenster sieht, auch nicht braucht, was aber zum Menschenleib notwendigerweise gehört: der Genitalien. Böhnchens Penis ausgeformt, nicht verniedlicht, zwei Kügelchen dahinter. Und dort, wo die Venusgestalten immer nur ihren sanften Mons pubis sehen lassen, war bei Gertrauds Mädchenfigur durchaus auch noch ein Spalt zu sehen. Was ist dabei, was war dabei? Es ist ja die Wirklichkeit und hat seine Richtigkeit, so sieht der Mensch aus. Aber was der Mensch eben auch an sich hat, das ist die Schamhaftigkeit, und die ist im Jugendalter besonders groß, sie war es damals noch viel mehr als heute. In Gertraud aber hatte ich nun eben eine Künstlerin in ihrem Atelier vor mir. Das war ein Erlebnis.
Böhnchens enorme Begabung, ja Leidenschaft für die Physik und deren Nutz- und Spielanwendungen kam natürlich vom Vater. Bei mir merkte er bald, dass ich zwar beeindruckt war von seinen Einfällen und den funktionierenden Apparaten, aber nicht imstande und auch nicht begierig, ihm nachzueifern. Er hatte jedoch noch mehr zu bieten. Hinten im Garten stand ein Häuschen, eine Art Laube, die nur ihm gehörte. Als er mich dort eintreten ließ, roch ich etwas Fremdes, Interessantes. Vielleicht war Chlor dabei oder eine Schwefelverbindung, oder beides und mehreres andere dazu. Viel Glas gab es zu sehen und viele verschlossene Gefäße mit Aufschriften. Ich war in einem Chemielabor. Wieder einmal hatte er mir etwas voraus und konnte es zeigen. Er führte mir auch ein paar Experimente vor mit Zischen, mit Dämpfen und Verfärbungen. Er musste nicht viel machen oder sagen. Ich hörte den Namen "Versandhaus für Vermessungswesen" und erfuhr, dass dort die Schulen ihre Bestellungen für den Chemieunterricht aufgäben. Dass man aber auch direkt da einkaufen könne. Von dem Tage an war ich der Chemie verfallen, für lange Zeit, bis zum Abitur.
Das Fach Chemie gab es erst ab der nächsten Klasse, der Obertertia. Ich war nicht darauf angewiesen. Die beiden Bücher von Wilhelm Römpp, "Chemische Experimente, die gelingen" und "Organische Chemie im Probierglas" fanden sich im Buchladen. Ich machte mich in einem Kellerraum breit, hatte aber keinen Bunsenbrenner und musste, wenn ich eine Flamme brauchte, an den Gasherd in der Küche gehen. Von den Kämpfen mit meiner Mutter will ich nichts schreiben, bis auf die Geschichte mit der Hose, später. Zunächst einmal: Ich setzte alles durch, ließ mich einfach nicht abhalten. Die Benutzung der Gasflamme in der Küche fand in den Abendstunden statt. Viel Geld hatte ich nicht - ich bettelte also Verwandte an. Was ich brauchte, konnte ich nach und nach kaufen. Was ich im einzelnen trieb und mir vorführte, will ich nicht detailliert erzählen. Aber dass ich sehr gründlich wissen wollte, wie sich die Natur der Stoffe in ihren Reaktionen offenbart, was Elemente, Säuren, Basen, Salze, Ketten- und Ringkohlenwasserstoffe eigentlich sind, führte dazu, dass ich mehrmals in die große Städtische Bibliothek ging und dort schwere - im doppelten Sinne - Bücher entweder entlieh oder darin im Lesesaal nachschlug. Dumm und schlimm war es, dass ich keine Laborkleidung trug, weil ich so etwas nicht hatte, an eine Schürze, zum wenigsten, gar nicht dachte und mir deshalb einen fürchterlichen Schaden zufügte. Säuren machen schreckliche Löcher, die kleinsten Spritzer schon sind verheerend, am schlimmsten solche von der Schwefelsäure. In der Erwartung des nächsten Jahres, des Frühjahrs 1943, wo wir dann, nach vier Jahren Jungvolk, in die Hitlerjugend überwechseln würden, hatte ich mich für die Marine-HJ entschieden und angemeldet. Ein paar ältere Jungen aus unserer Gegend waren schon dabei und hatten jetzt ihren Dienst auf dem Marine-HJ-Heimgelände am Fluss. Der Hauptgrund für mich war aber die besonders schöne Uniform mit Matrosenkragen und Knoten daran, die Bändermütze und vor allem die sehr schicke Latzhose, die vorn mit einer großen Klappe geschlossen wurde und deren Hosenbeine unten gar nicht weit genug sein konnten, das nannte man "Schlag haben". Eine Mütze habe ich dann nie mehr bekommen, eine Bluse mit Kragen auch nicht. Aber eine solche Hose fand ich lange vor dem Austritt aus dem Jungvolk schon, im Herbst 1942, in einem Uniformladen und auf Bezugsschein.
Das kostbare Stück trug ich Tag für Tag voller Stolz. Idiotischerweise zog ich meine herrliche Hose auch nicht aus, wenn ich an meine Chemikalien ging und mit Säuren hantierte. Eines Tages waren die ersten Löcher da. Ich versuchte, sie zu ignorieren, aber sie wurden größer und zahlreicher. Meine Mutter raste vor Zorn, nicht zuletzt, weil ich natürlich noch im Wachsen war und ohnehin wenig Klamotten hatte, aber auch wegen des Preises, wegen der Rarität und wegen meiner riesengroßen Dummheit. Sie schrie mit mir, beinahe hätte sie mich geschlagen. Irgendwann, während mir die Tränen in den Augen standen aus Wut über mich selbst, beruhigte sie sich und sagte kalt: "Du bist bestraft genug, eine größere Strafe gibt's überhaupt nicht." Da liefen mir die Tränen nun auch wirklich herunter. Sie versuchte trotzdem, die Löcher ganz fein, "wiebelnd", wie sie es nannte, fast nach Kunststopferart zu stopfen, aber überall zeigten sich neue, und neben den gestopften Stellen ging das Gewebe doch wieder kaputt.
Es sollte noch Schlimmeres passieren. An einem Abend im Januar 1943 war ich in der Küche, über ein Becherglas gebeugt, das auf einer Asbestplatte über der Gasflamme stand, und sah nach, ob meine Mischung noch nicht kochen wollte. Es sollte Zuckerkohle werden, ein Gemisch aus Zucker und Säure war in dem Gefäß. Zuckerkohle ist ein besonders feines Kohlenstoff-Pulver, und es muss irgendein Zweck mit Knallen oder auch mit Filtrieren gewesen sein, für den ich sie brauchte. Von Siedepunktsverzögerung wusste ich nichts, somit auch nicht, dass man sie mit Hilfe von Siedesteinchen, kleinen Glassplittern zum Beispiel, verhindern kann. Es dauerte mir zu lange, ich blickte also hin, mit den Augen genau über dem Glasgefäß, und da puffte der Inhalt heftig hoch und mir in die Augen. Nicht einmal die Nierenkoliken, die ich viele Jahre später einmal bekam, haben mir solche Schmerzen gemacht, wie ich sie jetzt und dann noch ein paar lange Tage und Nächte auszuhalten hatte. Ich lief zu Mutter und Schwester ins Zimmer, wollte nicht schreien und dämpfte meine Stimme zum Grabeston, als ich sagte: "Jetzt - jetzt werd' ich, glaub' ich, blind".
Es war spät, zwischen neun und zehn Uhr abends. Meine Mutter lamentierte nicht, sie war stumm vor Entsetzen. Sie lief mit mir zum Krankenhaus, zum Glück nicht gar so weit von uns gelegen; ich bekam eine Spülung und später mehrmals Borwasser in die Augen getropft, meine Mutter musste bedrückt, mit der Angst um mein Augenlicht, wieder nach Hause laufen. Die zehn Tage, die ich nun liegen musste, waren schlimm. Erstens wegen der Schmerzen, denn die oberen und die unteren Lider waren verätzt und verbrannt zugleich. Außerdem wegen der üblen Gesellschaft, zwischen die ich gelegt worden war, in einen Saal voll alter Männer, die den ganzen Tag über sauigelten und dreckig lachten, vor allem dann, wenn sie wieder eine liebenswürdige junge Schwester mit Schweinkram angepöbelt hatten.
Wäre ich nicht so gepeinigt gewesen von meinem miserablen Zustand, hätten mich die Kerle wahrscheinlich weniger gestört, Ferkeleien waren mir ja auch nicht fremd. Es kam aber auch noch dazu, dass fast den ganzen Tag über ein Radio-Lautsprecherkasten im Krankensaal angeschaltet war, und durchs Radio kamen jetzt gerade immer wieder die schrecklichen Nachrichten von den allerletzten Kämpfen in und bei Stalingrad, wo ganze Armeen zugrunde gingen.
Schließlich gab es eine Nachwirkung, die ich auch noch auszuhalten hatte, das waren die Vorwürfe meiner Lehrer und unseres Konfirmandenpfarrers, immer mit Hinweis auf meine arme Mutter, der ich dies nun angetan hätte.
Die Chemie-Besessenheit war aber so groß, dass ich immer noch nicht genug hatte. Zu Hause ging ich nicht mehr an den Herd mit einem riskanten, meine Mutter ängstigenden Arbeitsgang. Ich hatte aber einen Verbündeten gewonnen, etwas jünger als ich, der mich wegen meiner Kenntnisse und bedenklichen Kunststücke bewunderte. Er hatte auch eine Attraktion zu bieten, eine Fahrrad-Rennbahn rund um den großen Garten seiner Eltern. Seit sein Bruder, der sie angelegt hatte, zum Reichsarbeitsdienst eingezogen war, konnte er über dessen Zimmer verfügen. Ich durfte auf dem Grundstück ebenfalls mit dem Rad rennen; wir stoppten auch unsere Zeiten. Für mich war es eine Gelegenheit, immer wieder mal "zum Radrennen" zu gehen - ich hatte aber etwas anderes erreicht. Ich konnte meinen Zweck-Freund mit der Chemieleidenschaft anstecken, und er durfte sogar einen Bunsenbrenner anschaffen, der dann von einer Gasflasche gespeist wurde.
Jetzt ging ich mit meinem Assistenten zum Sprengstoffmachen über. Schießbaumwolle herzustellen war nicht schwierig, nur umständlich: Die rauchende Salpetersäure, die man dazu brauchte, gab es nicht zu kaufen, wir stellten sie her aus Kalisalpeter und Schwefelsäure, beides wurde über der Flamme in einem Destillierkolben zu der benötigten Salpetersäure umgesetzt. Diese musste wiederum mit Schwefelsäure gemischt werden, dann kam Watte hinzu, sie wurde nach ein paar Stunden herausgenommen, gespült und dann getrocknet. Wir hätten mit dieser Prozedur auch Nitroglyzerin machen können, aber das traute ich mich doch nicht. Nun brauchten wir noch Zünder. Und dafür wieder brauchte es roten Phosphor und Un-kraut-Ex, das heißt, Kaliumchlorat, als Sauerstoffgeber. Wie ich an den Phosphor kam, kann später berichtet werden. Wir konnten jetzt kleine Bomben oder Granaten herstellen, aus alten Gewehrpatronen-Hülsen, die mein jüngerer Freund früher in Mengen auf einem stillgelegten Schießplatz gesammelt hatte, dazu dem Phosphor-Chloratgemisch, ein paar winzigen Splittsteinchen für den Zündschlag und dann der eigentlichen Ladung, eben der Schießbaumwolle. Die Hülsen wurden oben mit einer Zange zugekniffen. Wir schmissen unsere Granaten mit großem Vergnügen in einem Schrebergarten-Gelände, das Knallen war - im Frühsommer - sozusagen unser Sylvesterspaß. Es passierte nichts Schlimmes. Andere Jungen ließen wir nicht dabei sein, Erwachsene mieden wir, das heißt, wir warteten ab, bis niemand in der Nähe war. Verbotene Spiele, natürlich! Aber um so schöner. Immerhin waren wir vorsichtig genug, die paar Dinger, die nicht krepiert waren, in einen Bach zu werfen, der durch das Gartengelände floss.
Lange hielt das Vergnügen nicht an, es war ja immer dasselbe. Ich wollte auf eine echte Sprengung hinaus. Dazu brauchte ich Böhnchen wieder. Ich überredete ihn, mir mit einem Stück Glühdraht, einem dünnen, genügend langen Leitungsdraht und einer Klingelbatterie zu Hilfe zu kommen. Wir zogen zu dritt nach der großen Lehmgrube einer Ziegelei, die nicht mehr arbeitete. Dort in der Nähe gab es große hölzerne Lichtmasten, außer Funktion, mit herunterhängenden Drähten. Einer stand ganz nahe an der Grubenwand. Wir stiegen, einander abwechselnd, auf eine große gefundene Kiste und arbeiteten uns mit einem Klappspaten in den schweren Lehmboden ganz nahe unterhalb des Mastes hinein. Es dauerte lange, wir wussten, dass eine effektvolle Sprengung nur gelingt, wenn die Ladung tief sitzt und gut abgeschlossen ist.
Die Ladung aber bestand aus einer großen Konservenbüchse voll Nitrozellulose, der Glühdraht war von Böhnchen vorher fest angeklemmt worden, die Leitung wurde gelegt, wir saßen weit weg auf dem Grubenrand an der gegenüberliegenden Seite. Böhnchen guckte uns beide kurz an und schloss den Kontakt. Der Knall war enttäuschend, eher dumpf, Erdbrocken flogen weg, der Effekt aber war doch groß und stellte uns vollkommen zufrieden. Der hölzerne Mast riss nämlich von unten nach oben auf und kippte dann langsam die Wand hinab, das obere Ende schlug unten klatschend und spritzend ins Grundwasser.
Eine unglaubliche Frivolität! In Russland, in Serbien, in Afrika, auf den Ozeanen wurde scharf geschossen, die ersten großen Städtebombardements hatten schon begonnen, Soldaten ließen zu Hunderttausenden ihr Leben, Zivilpersonen zu Zigtausenden, und mit derselben zerstörerischen Energie, nur sozusagen in kleiner Münze, spielten wir herum und hatten Spaß! Abgerissene Finger hätten die Folge sein können, andere schwere Verletzungen, selbst Lebensgefahr war nicht ausgeschlossen. Über den Kulminationspunkt war ich aber nun hinweg, so als hätte der sehr große Knall meinen Umgang mit der Chemie auf einmal beendet, jedenfalls die gefährliche Praxis. Es gab für mich noch andere Interessen, das Zeichnen zum Beispiel, auch das Briefmarkensammeln und -tauschen. Die Sprengung hatte aber noch eine Nachwirkung.