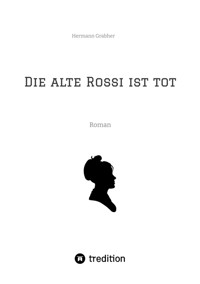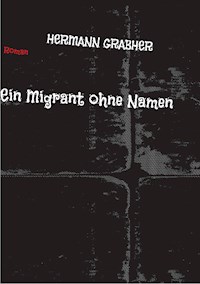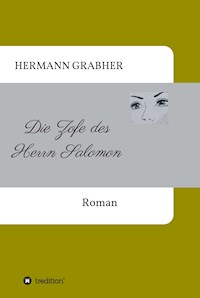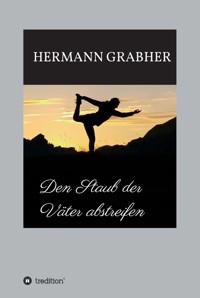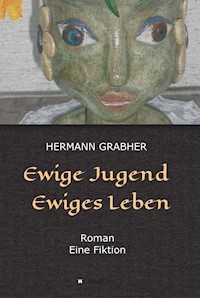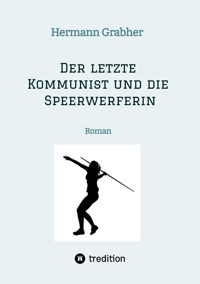
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1972 besuchte Kubas Staatschef Fidel Castro die DDR, wobei u.a. Geschenke ausgetauscht wurden. Fidel Castros Gadget war eine Karibik-Insel. Erich Honeckers Angebot war, Fachleute zu entsenden zwecks Weiterentwicklung des sozialistischen Bruderstaates. 1987 wird WW, bekennender Kommunist, in die Karibik abkommandiert. Er gilt als der Stratege der sehr erfolgreichen DDR-Leichtathleten, wird als Strippenzieher in Sachen Doping vermutet. Sein Spitzname: Die Apotheke. Weil WW ahnte, dass ihm die Anti-Doping-Experten auf den Fersen sind, stellte er seine entsprechende Tätigkeit ein. Sein Sinneswandel kostete ihn seine Führungsposition im DDR-Verband der Leichtathleten und die Abschiebung in die Verbannung, wie es WW bezeichnet. Im neuen Tätigkeitsfeld in Kuba ist WW unglücklich. Durch den Fall der DDR im Jahr 1989 verliert WW nicht nur seine Heimat, sondern seine Situation wird für ihn existenzbedrohend.. Bis WW eine junge Speerwerferin entdeckt, mit der er sich nochmals als Trainer und gewiefter Manager erfolgreich verwirklichen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
www.tredition.de
HERMANN GRABHER
DER LETZTE Kommunist UND DIE Speerwerferin
ROMAN
2025 HERMANN GRABHER
ISBN
Softcover
978-3-384-60273-2
ISBN
Hardcover
978-3-384-60274-9
ISBN
E-Book
978-3-384-60275-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors durch:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, D-22926 Ahrensburg
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgten im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
Hermann Grabher, Kobelstrasse 3, CH 9442 Berneck SG
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1 DDR-Erbe
2 Havanna
3 Magere Aussichten
4 Cuba Libre
5 Noch ein Ungemach
6 Neues Leben
7 Das Drama seines Lebens
8 Hilf dir selbst
9 Überraschung über Überraschung
10 Musterung
11 Dolores Diaz
12 Start einer Karriere
13 Der letzte Kommunist?
14 Geschäft ist Geschäft
15 Auto Posen und Philosophieren
16 Hartes Heimspiel
17 Studebaker Ärger
18 Zinn-Vase mit Plastikblumen
19 Die Junge riecht die Lunte
20 Wettkampf
21 Galadiner
22 Immer dieses Thema Geld
23 Vereinbarung
24 Der Studebaker ist zurück
25 Die nahe Zukunft planen
26 Geburtstagsfeier
27 Verhandeln auf Japanisch
28 Bewährung im Haifischbecken
29 Vertragsabschluss
30 Glück und Pech sind so nahe beieinander
31 Geduld bringt mehr als nur Rosen
32 Das schwierige weibliche Geschlecht
33 Wettkampfpause
34 Des Trainers Abschiedsvorstellung
35 WWs letzter Gang
36 Die Zukunftspläne stehen Kopf
37 Ein rasanter Neuanfang
Der letzte Kommunist und die Speerwerferin
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1 DDR-Erbe
37 Ein rasanter Neuanfang
Der letzte Kommunist und die Speerwerferin
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1 DDR-Erbe
Sommerolympiade Tokio 1964. Sie war die letzte Station, bei der ein gemischtes deutsches Team aus West und Ost gemeinsam an einem grossen Sportanlass auftrat. Danach kämpfte jeder Teil Deutschlands für sich, vor allem aber insbesondere auch gegen den anderen deutschen Staat. Jede Seite war bestrebt zu demonstrieren, die bessere zu sein.
Die Deutsche Demokratische Republik war im Leistungssport eine Macht. Die Ostdeutschen waren stolz darauf, ihre Brüder in der Bundesrepublik regelmässig übertrumpfen zu können. Dies wurde erreicht, indem in der DDR-Sportszene Drill und überwiegend auch devoter Gehorsam herrschte, aber auch der entsprechende Leistungswille der Athleten gegeben war. Denn als international anerkannte Elitesportler hatten die jungen Leute der DDR das Privileg ins Ausland reisen zu dürfen – wenn auch unter strengster Aufsicht. Dies war für gewöhnliche Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sonst weitgehend ausgeschlossen, insbesondere wenn es in Richtung Westen ging. Doch der wohl entscheidendste Faktor, weshalb Ostdeutschland gegenüber der Bundesrepublik in sportlichen Dingen die Nase mehrheitlich vorne hatte, war der Umstand, dass in der DDR-Struktur die Manipulation Teil des Systems war. Mittels Psychologie wurden nicht nur die eigenen Athleten zu Höchstleistungen getrimmt, sondern auf nicht weniger perfide Weise die Gegner unter Druck gesetzt. Ein anderer wichtiger Trumpf war Doping, dessen Einsatz, raffiniert ausgeklügelt wie sonst nirgendwo, in vielen Sportarten angewandt wurde. Moralische Skrupel bestanden nicht. Denn das Staatssystem basierte in sich schon grundsätzlich in vielen Teilen auf Täuschung, Lug und Trug, war am Gängelband der Sowjetunion. Allerdings war die Gegenseite auch nicht zimperlich. Es war die Zeit des Kalten Kriegs.
Im Juni 1972 besuchte der kubanische Machthaber Fidel Castro den kommunistischen Bruderstaat Deutsche Demokratische Republik. Ausser dem Schwur ewiger gegenseitiger Treue und Unterstützung, wurden auch Geschenke ausgetauscht. Fidel Castro vermachte Erich Honecker eine Insel als Präsent. Dieses Eiland wurde nach dem ehemaligen deutschen Kommunisten Ernst Thälmann benannt und bedeutet in der heutigen Zeit, eines der letzten Relikte jener Epoche, in der die Deutsche Demokratischen Republik existierte. Im Gegenzug versprach die DDR, nebst Technik, unter anderem auch hoch qualifizierte Fachleute in die Karibik zu entsenden, zwecks Unterstützung im Aufbau des sozialistischen Bruderstaates. Im Grunde hatte die DDR aber nichts zu verschenken. Denn im Ostteil Deutschlands herrschte zum Leidwesen der Bürger des Landes eine latente Mangelwirtschaft. Produkte jeglicher Art fehlten an allen Ecken und Enden. Selbst normale Lebensmittel, welche für die Zufriedenstellung der Bevölkerung wichtig gewesen wären, waren in den Verkaufsregalen oft nicht vorzufinden. So gab es in der Tat letztlich wenig Überfluss, den man hätte abschöpfen können, um ihn jenen noch bedürftigeren kubanischen Brüdern zukommen lassen zu können. In der Praxis verblieb schliesslich als übrig gebliebene Option nur die Ressource Mensch.
Wie es vielen repressiven Staatssystemen eigen ist, versuchte auch Kuba das internationale Renommee durch sportliche Höchstleistungen möglichst mit Titeln an Olympia und Weltmeisterschaften aufzuwerten. In diesem Sinn passte es ins Konzept, dass die DDR, als wesentlich erfolgreichere Nation, in der Folge sowohl Trainer wie auch Spezialisten in Sachen Sport aus ihren Reihen nach Kuba abkommandierte. Manchen dieser «Staatsangestellten» passte es gut, endlich dem eigenen System entfliehen zu können, auch wenn es meistens nur für eine zeitlich limitierte Periode war. Es gab aber nicht wenige, denen eine solche staatlich angeordnete «Republik-Flucht» widerstrebte. Zum Beispiel aus Angst vor dem Fremden, aus familiären Gründen, aber auch aus idealistischen Gründen. Zum Beispiel, weil sie die bisher aufgezogenen eigenen Athleten nicht zurücklassen wollten. Oder eben, weil sie glaubten, sprachliche Barrieren und kulturelle Eigenheiten des anderen Landes nicht aushalten zu können.
Im Jahr 1988 wurde ein gewisser Wolfgang Winkler, 38-jährig, abkommandiert, den Kubanern den aufrechten Gang zu vermitteln, wie sie es in jenen DDR-Kreisen vollmundig bezeichneten. Sprüche dieser Art enthielten eine Prise Überheblichkeit, waren aber insbesondere auch mit einem Augenzwinkern verbunden. Winkler war in internationalen Leichtathletik-Kreisen kein Unbekannter, bei den weltweit tätigen Doping-Überwachungsgremien gar gefürchtet, oder noch eher gehasst. Denn Winkler galt als eigentlicher Kopf der DDR-Dopingszene. Die DopingJäger im Westen hätten ihn noch so gerne zur Strecke gebracht, allein es gelang ihnen nicht – aus Mangel an Beweisen. So blieb es bei Hohn und Spott, den man über Winkler versuchte auszuschütten: Im Westen nannten sie ihn despektierlich Doktor Wolfi, den Mann mit der Apotheke, oder einfach die Apotheke der DDR. In Karikaturen wurde Winkler bevorzugt als langes, dünnes Männchen mit wild wallendem Haar, einem Bocksbart und Fläschchen oder Reagenzgläschen in beiden Händen, in einem zu weiten, weissen Kittel dargestellt.
Im Fall von Winkler ging es aber – aus der entsprechenden höheren Regierungswarte betrachtet, eher um die Entfernung eines angezählten Experten, den man aus dem Fokus der Öffentlichkeit weghaben wollte. Winkler realisierte die Wirklichkeit: Er war zu einem internen Problemfall verkommen, dem sich die Strategen entledigen wollten. Zwar war man sich in DDR-Führungskreisen hinsichtlich Winklers Verdiensten sehr bewusst, auch dankbar für seine Leistungen und seinen zum Teil fanatischen Einsatz. Gerne hätte man sich auch weiterhin aus Winklers reichem Erfahrungsschatz bedient. Andererseits waren sich nicht nur Winkler, sondern auch das DDR-Ministerium für Körperkultur und Sport bewusst, dass es wohl nur noch eine Frage von mehr oder weniger kurzer Zeit sei, dass es der Gegenseite gelingen würde, die Betrugs-Vorwürfe zu beweisen. Denn die Antidoping-Jäger waren nicht untätig und bediente sich ebenfalls immer fortschrittlicheren Methoden, beziehungsweise Techniken, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierten. Und sollte die Falle - wie ernsthaft befürchtet – über kurz oder lang zuschnappen, wollte man auf offizieller DDR-Seite keinesfalls mit ins Schlamassel hineingezogen werden.
Wolfgang Winklers beruflicher Werdegang als Trainer und Sportfunktionär entsprach nicht dem sonst allgemein üblichen DDR-Standard. Der Mann liess sich zum Grundschullehrer ausbilden. Damit hatte er sich zumindest ein Basiswissen in Pädagogik angeeignet. Weil sein Hang in Richtung Sport ging, belegte er noch einige entsprechende Ausbildungs- und Weiterbildungskurse. Das wars dann aber auch schon. Winkler hatte in seinen jungen Jahren absolut kein Gefallen am Studieren gefunden. Ein Lehrer im Gymnasium warf ihm mal vor versammelter Klasse an den Kopf: «Wolfgang, wie kann es sein, dass du als der Kerl mit der grössten Intelligenz der schlechteste Schüler im Hause bist!?» Die Lehrerausbildung machte er wohl nur, weil schon sein Vater Lehrer war und dieser den Sohn in diese Richtung hinein manövriert hatte. Doch Wolfgang unterschied sich von seinem Vater. Der alte Winkler war musisch begabt, der die klassische Musik liebte. Im Orgel- und Pianospiel war er ein Virtuose, der sein Leben lang nur schlecht verwinden konnte, nie für eine höhere Aufgaben entdeckt worden zu sein. Seine Liebe galt vor allem Mozart. Deshalb war die Namensgebung für seinen erstgeborenen Sohn nicht nur nachvollziehbar, sondern eher logisch. Winkler Junior dagegen mied die Musik und den Gesang, weil seine Ohren einst im Elternhaus zu intensiv damit vollgestopft worden waren.
Erst zog es Wolfgang Winkler in seiner Sportlehrer-Karriere zu den Boxern. Aber die Argusaugen der STASI – der staatlichen Überwachungsorganisation – hatten seine homosexuelle Neigung als eine gewisse Gefahr erkannt. Denn Homosexualität existierte im Arbeiter- und Bauernstaat eigentlich nicht, zumindest nicht offiziell. Sie wurde weitgehend totgeschwiegen. Also wurde von oben die Auflage erteilt, dass Wolfgang Winkler nur Frauen trainieren dürfe. Winkler entschied sich in der Folge in die Leichtathletik zu wechseln.
WW bezeichnete sich als hundertprozentiger Kommunist und war grundsätzlich auch solidarisch mit dem sozialistischen System der DDR. Dies, obwohl er eigentlich als Freigeist und Outsider, der gerne motzte, in diesem Staat als eine atypische Gestalt bezeichnet werden musste.
2 Havanna
Wolfgang Winkler wehrte sich vorerst vehement gegen seine Liquidierung, wie er die staatlich verordnete Abschiebung nach Kuba nannte. Aber letztlich wirkte die Hirnwäsche, die man ihm schon sein Leben lang verpasst hatte. Er fügte sich dem Verdikt der Obrigkeit, so wie man es ihm beigebracht hatte. Nämlich, dass Regierungs-Entscheide stets einen wichtigen Hintergrund hätten und deshalb immer zweckdienlich und damit richtig seien. Winkler erkannte, dass er als Meister des nicht nachweisbaren Dopings das Opfer seines eigenen Erfolges geworden war. Dennoch hinterfragte WW aufgrund der persönlichen Verunsicherung seine bedingungslose Unterwürfigkeit gegenüber dem Staat. Dabei fand sich eine logische Antwort: Es war nichts anderes als die aufrichtige Liebe und Solidarität zu seinem Heimatland, der Deutschen Demokratischen Republik. Es bedeutete eine bedingungslose Bereitschaft, die persönlichen Ambitionen hintenanzustellen, sich keine narzisstischen Extravaganzen herauszunehmen, jeglicher Anfechtung anders zu denken zu widerstehen.
Winklers Unterordnung gegenüber der Staatsraison hinterliess bei ihm Spuren. Sein Gemüt trübte sich ein. Während Winkler sich bewusst war, hiermit persönlich vor einer überaus ungewisse Zukunft zu stehen, war er überzeugt, dass ihn seine Leichtathletinnen künftig sehr vermissen würden. Denn er war bis dato der Trainer, dem die Frauen – zumindest teilweise – ihre Erfolge zu verdanken hatten. Es brauchte eigentlich kaum eine grosse Erklärung. Es waren ziemlich viele Medaillen an Welt- und Europameisterschaften, wie auch Olympischen Spielen, die in seiner Zeit als Trainer eingefahren worden waren. In diesem Sinn konnte man Winklers Versetzung in die Karibik durchaus als Sakrileg betrachten.
Für Winkler war unverständlich, dass man an höchster Stelle respektlos über seinen Kopf hinweg entschieden hatte, ohne mit ihm den Fall überhaupt zu diskutieren. Denn eigentlich ging es vordergründig gar nicht um ihn und seine Ambitionen, sondern es ging um Grundsätzliches, insbesondere zum Wohle der Nation, nämlich: Waren sich die Entscheidungsträger bewusst, dass man durch Winklers Versetzung das Risiko einging, dass die DDR-Leichtathletinnen künftig ihre überragende Spitzenstellung beinbüssen könnten!?
Winkler wurde gezwungen nochmals die Schulbank zu drücken, um die spanische Sprache zu lernen und auch um sich mit der kubanischen Kultur und auch mit der kubanischen Staatsstruktur vertraut zu machen. Man wies ihn in aller Freundschaft darauf hin, dass dies keine Schikane sei, sondern im Gegenteil ein sinnvolles und notwendiges Standardprozedere, das ihm Vorteile verschaffe. Dies werde er spätestens dann erkennen, wenn er im karibischen Land sei und sich dann dort zurechtfinden müsse. Dass ihn dieser Zirkus, wie er es nannte, anwiderte, war aber wohl auch, vielleicht sogar vor allem, eine logische Folge seines schon manischen Hasses gegenüber jeglichem Schulbetrieb, den er früher in seiner Jugend schon beinahe zelebriert hatte. Dass er sich seinerzeit dennoch zum Lehrer ausbilden liess, aber danach kaum je als Lehrer vor einer Klasse stand, dokumentiert, wie ziel- und orientierungslos der Knabe seinerzeit in seiner Jugend in den Tag hineingelebt hatte.
Kam hinzu, dass sich Winkler nicht nur von seinem bisherigen Arbeitsumfeld verabschieden musste, sondern eben auch von seinem bisherigen Privatleben, seiner Familie, seinen Geschwistern, der vertrauten Gemeinschaft seines Wohnortes und seinem jungen Freund und Lebenspartner Uwe. Wie sich Winkler auch bemühte, ebenfalls für Uwe eine Ausreise-Genehmigung nach Kuba zu bekommen, er wurde von den Behörden ohne Begründung abgewiesen. In Wirklichkeit war die Situation allerdings logisch: Dieser negative Entscheid war als gezielte Lanze gegen seine homosexuelle Veranlagung angelegt und somit Teil einer bewusst ausgeheckten Strategie des DDR-Ministeriums für Körperkultur und Sport,
Als Wolfgang Winkler Anfangs 1988 in Havanna eintraf, fühlte er sich sehr verloren. Der Mann sprach nur ungenügend spanisch, gab sich auch keine Mühe, die neue Sprache seriös zu lernen mit dem Ziel, diese dereinst einigermassen sicher zu beherrschen. Die Hitze, die ihn im Januar empfing, wirkte lähmend auf ihn. Die verlotterte Altstadtwohnung, die man ihm zuwies, war nicht eben aufbauend. Doch solches kannte er auch schon von seiner Heimat. Der nächtliche Strassenlärm und die Musik in der Nachtbar im gleichen Haus töteten im wahrsten Sinne des Wortes seinen letzten Nerv. Er fand zu wenig Schlaf, was ihn an den Rand einer Nervenkrise trieb. Die kubanischen Sportfunktionäre, die hier als seine Partner vorgestellt wurden, entsprachen in keiner Weise seiner Vision von professionellem Sport. Alle diese Personen waren zumindest eine Generation älter als er und hatten nach seiner Ansicht eigenartige Vorstellungen von Spitzensport. Anscheinend hatten diese Leute in der Vergangenheit grosse Verdienste zu Gunsten des kubanischen Sportes angesammelt, was für Winkler allerdings ohne Relevanz und ohnehin ohne Nutzen war. Denn damit konnte man in der modernen Zeit nichts gewinnen. Die Infrastruktur zum Trainieren, zum Ausüben des Sportes, die er vorfand, war weniger als mässig. Sie hätte in Deutschland nicht mal Amateur-Anforderungen genügt.
Wolfang Winkler haderte mit dem Schicksal. Er verfasste einen Brief an das Ministerium für Körperkultur und Sport, in dem er sich aufs Heftigste beschwerte. Diesen gab er per Post auf, weil zu jener Zeit keine elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten wie E-Mail oder WhatsApp bestanden, mit Ausnahme von Telex. Doch Privatmenschen bedienten sich nicht des Telex. Der Telex war Firmen und Institutionen vorbehalten. Als nach einem Monat keine Antwort aus Berlin bei ihm eingetroffen war, wandte er sich erneut per Briefpost an die Behörde in Berlin Ost. Diesmal hielt sich Winkler nicht mehr zurück, er drohte. Ob man ihn mit Gewalt dazu zwingen wolle, rüber ins nahe Florida zu übersetzen? In den Vereinigten Staaten würde man seine Dienste ohne Zweifel zu schätzen wissen, ihn mit beiden Händen willkommen heissen. Dort wäre ein weit angenehmeres Leben gegeben. Erstens beherrsche er die englische Sprache um Längen besser als das Spanische. Zweitens seien dort erstklassige Sportstätten selbstverständlich. Und drittens würde er dort gutes Geld verdienen können. Den vierten und für ihn nicht unwichtigen Grund erwähnte er bewusst nicht, nämlich, dass dort Leute wie er mit homosexueller Neigung, weder verfolgt noch schräg angesehen würden.
Dass dieser Brief provokant abgefasst war, entsprach Winklers Strategie. Der Mann war für seine unverblümte Sprache bekannt in Fällen, in denen er meinte, sich unbedingt durchsetzen zu müssen. Winkler wollte Druck aufbauen mit dem Ziel, seine Lebensbedingungen zu verbessern. In Wirklichkeit war der Brief ein Bluff, der eigentlich mit Händen zu greifen war. Wenn Winkler tatsächlich einen Plan gehabt hätte, in die Vereinigten Staaten zu desertieren, wäre er blöd gewesen, dies den Herrschaften in Berlin aufs Brot zu schmieren. Denn eines hatte Winkler in den 38 Jahren DDR wie jeder andere Bürger dieses Landes als Lektion gelernt, nämlich Lebenspläne, die den Vorstellungen des Regimes widersprachen, niemals öffentlich in die Welt hinauszuposaunen. Denn dies konnte sich lebensbedrohend auswirken. Einem Geheimnisträger wie er einer war, allwissender Magier in Sachen Doping, wäre die Wahrscheinlichkeit fataler Auswirkungen gross gewesen. In diesem Sinn bewegte sich Winkler – zumindest theoretisch - auf dünnem Eis. In der Realität konnte sich WW dieses taktische Geplänkel allerdings leisten, weil die in Berlin Ost ihren Wolfgang Winkler durch und durch kannten: Der Mann stand trotz seiner ab und zu provokativen, ja frechen Schnauze felsenfest zum Regime, zu seinem Heimatland. Als aufrechter Kommunist war es für ihn selbstverständlich, solidarisch zur DDR mit ihrem sozialistischen System zu stehen, egal was geschehe.
Nach diesem seinem zweiten Brief erfolgte endlich eine Reaktion, dies innerhalb weniger Tage: Ein Kommissar des Ministeriums für Körperkultur und Sport der DDR stand auf der Matter und nahm Genosse Wolfgang ins Gebet. Er erklärte ihm lang und breit, dass man mit den Menschen dieser Hemisphäre mit Geduld und Langmut zu verkehren habe und dass man vor allem Durchhaltewillen an den Tag legen müsse. «Nicht aufgeben, Mann, du schaffst diese Veränderung, auch wenn sie hart für dich sein mag! – Wolfgang sei nicht zurückhaltend, erklär ihnen, was du brauchst, wie du dir das vorstellst. Und du wirst sehen, sie werden spuren! Sie werden Jegliches in die Wege leiten, welches du forderst. Bring ihnen bei, dass Spitzenleistung eben vorherigen solidarischen Einsatz, Kreativität und Arbeit voraussetzt! Von nichts eben nichts komme!»
Blablabla! Füllige Plattitüden von Leuten aus dem Sport-Ministerium kannte Winkler aus früheren Zeiten zur Genüge. Auf einer Seite zum Ohr rein und auf der anderen Seite zum Ohr raus! Noch war er WW – Wolfgang Winkler - und er hatte vor, weiterhin Winkler zu bleiben. Wenn er auf keine entsprechende Unterstützung zählen könne, argumentierte er, werde er auch nicht imstande sein, jenes zu erreichen, was das Ziel sei. Wenn er nun schon hier sei in diesem Land, wolle er Spitzensport aufbauen. Sollte dies nicht möglich sein, werde er konsequenterweise adieu sagen. Punkt mit Ausrufezeichen!
Der Genosse aus Berlin setzte sich anschliessend nochmals mit seinen kubanischen Kollegen zusammen, um nach einem gangbaren Weg zu suchen. Weil man Winkler bei dieser Unterredung nicht dabeihaben wollte, konnte er nur mutmassen, wie dieses Gespräch gelaufen war. Fakt war, dass man Winkler in der nachfolgenden Woche eine neuere, modernere Wohnung zuwies, in der alle Geräte und Vorrichtungen, sowohl in der Küche wie auch im Badezimmer einwandfrei funktionierten. Und zur Nachtzeit war die Ruhe selig. Das grosse Haus, in dem sich seine Wohnung befand, lag nahe dem Meer, sodass man das Rauschen der Wellen hören konnte, wenn der Wind vom Wasser her wehte. Hier war auch die Luft besser, nicht so stickig wie im Zentrum der Stadt. Und – oh Wunder - seine sportliche Wirkungsstätte wurde nun auch ausgewechselt. Diese lag nun etwas weiter ausserhalb der Stadt, schon fast im Dschungel. Doch die Tartanbahn war neueren Datums. Und aus den Duschköpfen rieselte tatsächlich lauwarmes Wasser, dünn zwar, aber immerhin. Doch das war selbst in den Luxushotels der Stadt kaum anders, weil die lokalen Wasserwerke nicht in der Lage waren, einen korrekten Druck zustande zu bringen. In Winklers Heimatland lag vieles im Argen, aber was die Leute hier hinnehmen mussten, überstieg doch all jenes, was er sich vorgestellt hatte.
3 Magere Aussichten
Nachdem der Genosse aus Berlin Ost die Stadt Havanna wieder verlassen hatte, bestand für Wolfgang Winkler die endgültige Gewissheit, dass diese Verbannung, nicht mehr rückgängig zu machen war. Es lag nun an ihm, das Beste aus der für ihn nicht sehr erfreulichen Situation zu machen. Er musste sich selbst aus dem Sumpf der Bedrängnis herausziehen, sich selbst auch von seiner Lethargie befreien.
Wegen der Distanz von über zwanzig Kilometern zwischen seiner neuen Wohnung und der Sportstätte, die nun sein Arbeitsfeld war, erstand er ein Motorrad. Es war ein älteres, gebrauchtes Vehikel russischer Produktion mit Name URAL, ein Exemplar, das auch in der DDR zu finden war. Das Einzigartige an diesem Motorrad war, dass es einstmals einen Seitenwagen angebaut hatte, der später aus welchen Gründen immer, entfernt worden war. Die Spuren der einstigen Verbindung waren an den entsprechenden Stellen am Eisengestell deutlich erkennbar. Dort setzte besonders viel Rost an. Winkler nahm sich vor, Farbe zu kaufen, um diese hässlichen Stellen zu überpinseln.
Sehr schnell erkannte der Europäer, dass ein fahrbarer Untersatz das eine war, Benzin dafür zu ergattern das andere. Man musste die Wege der Burg kennen, um nicht Gefahr zu laufen, plötzlich einmal im Niemandsland zu stranden. Raul, ein junger Sportlehrer, den man ihm als Unterstützung zur Seite gestellt hatte, informierte Winkler laufend, wie hier im Land des ewigen Mangels man dennoch an jene Produkte gelangen konnte, die dringend benötigt wurden. Wolfgang Winkler erkannte, dass die Mangelwirtschaft in Kuba tatsächlich noch mehrere Grade dramatischer war als in seiner Heimat. Jene problematische Situation, vor der man ihn zuhause aufmerksam gemacht hatte, entsprach tatsächlich den entsprechenden Warnungen.
Für Winkler war es zermürbend, täglich so viel Energie wegen Banalitäten zu verpuffen, nur weil der Gaumen vielleicht nach einem Hähnchen rief, solche aber weiträumig nirgends zu finden waren. Weil einmal Eier nicht aufzutreiben waren, ein anderes Mal Butter, einmal fehlte es sogar inselweit an Brot, weil die Russen den Weizen mit Verspätung geliefert hatten. Die Lösung war, stets jene Produkte auf Vorrat einzukaufen, die gerade verfügbar waren. Allerdings galt es vorsichtig zu sein, vor allem vorausdenkend zu handeln, weil es häufig zu Stromabschaltungen kam und dann Produkte im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe Gefahr liefen, zu verderben. Doch auch für dieses Problem gab es eine Lösung, nämlich einen mit Diesel betriebenen Stromgenerator anzuschaffen, was sich allerdings nur die besser Bemittelten leisten konnten. Wolfgang Winklers Gehalt wurde von Berlin aus bezahlt. Dieser war bescheiden, aber immerhin ziemlich viel besser als jene bescheidenste Entlohnung, womit sich die Einheimischen über die Runden bringen mussten. Im Notfall konnte er auf seinen Notgroschen zurückgreifen, der mit seiner Übersiedelung mitgezogen war. Wie auch immer, Winkler entschloss sich, einen neuen Stromgenerator chinesischer Provenienz anzuschaffen, der sich bei Stromausfall automatisch einschaltete. Dieses Gerät wurde von einem Elektriker auf dem Balkon fachgerecht installiert, Auspuff nach aussen. Immer bei einem Stromausfall war das Surren dieser Dinger in der ganzen Umgebung zu hören, links und rechts, oben und unten.
Als Winkler alle diese privaten Nebenschauplätze einigermassen im Griff hatte, konnte er sich seiner eigentlichen Tätigkeit zuwenden, nämlich der Ausbildung von jungen Leichtathletinnen, die man ihm als talentiert beschrieben hatte.
Als erstes liess er alle Mädchen – es waren etwa drei Dutzend – vom ärztlichen Dienst medizinisch untersuchen. Mehr als ein halbes Dutzend der Kinder mussten sofort aus dem Kader eliminiert werden, wegen irreparablen Schäden an Gelenken, wegen Fehlhaltungen, wahrscheinlich infolge Mangel- oder Fehlernährung. Bei einer wurde TBC festgestellt, eine war HIV-positiv und eine andere schwanger, ohne dass sie es selbst realisiert hatte, wie sie bekannte. Dies mit 15 Jahren! Anschliessend wurden alle verbliebenen Girls, nicht wenige davon Farbige, in verschiedenen Disziplinen getestet: Im Hundertmeterlauf, im Hürdenlauf, im Hoch- und Weitsprung, im Kugelstossen, im Speerwerfen, im 800- Meter-Lauf. Die Hälfte der Mädchen erreichte in keiner Disziplin eine Leistung, die von Winkler als Minimum-Messlatte festgelegt worden war. Diese Mädchen wurden zu ihrer Enttäuschung sofort wieder nachhause geschickt. Es gab Tränen.
Übrig blieb ein knappes Dutzend Mädchen, mit denen er es versuchen wollte. Aber eigentlich war nicht begeistert über die lokale Human Ressource – wie man es hier nannte, die er hiermit zu Gesicht bekommen hatte. Es gab kein einziges vielsprechendes Talent, von dem irgendwann Spitzenleistungen erwartet werden konnte. Winklers Kommentar an seinen Assistenten Raul lautete: «Sehr enttäuschend. Keine ist mir besonders positiv aufgefallen. Ich hoffe sehr, dass ich hier nicht meine Zeit vergeude!»
Der Assistent trug Winklers Seufzer den kubanischen Verbandsoberen zu, welche keine Freude an dieser Bemerkung hatten.
4 Cuba Libre
Wenn Wolfgang Winkler das Leben der Kubaner mit jenem der Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik verglich, stellte er – unabhängig der kulturellen Unterschiede - nicht unerwartet signifikante Parallelen fest: Wer sich duckte, nicht auffiel, die vom Staat festgelegten Regeln einhielt, der konnte sich eher wenig beschweren. Es schien, dass in Kuba niemand hungern musste, genau so wenig, wie dies in der DDR der Fall war. Aber gut schien es dem Grossteil der Kubaner offensichtlich dann doch auch nicht zu gehen. Auf Vorteile schienen Parteimitglieder zählen zu können. Sie durften von gelegentlichen kleineren Privilegien profitieren. Leute, die gegen den Staat aufmuckten, gab es hier offensichtlich deutlich weniger als in seiner Ostdeutschen Heimat. Auch die einstmals grossen Fluchtbewegungen nach Florida waren zwischenzeitlich abgeflacht. Viele der hier herumgereichten Witze waren politisch, weswegen man allerdings in der Regel anscheinend kaum je belangt wurde. Diese betrafen nicht nur die eigene Revolution mit ihren teilweise grotesken Auswüchsen, sondern in gleichem Masse auch die Amerikaner in Guantánamo oder die Russen, die in hartnäckiger Weise immer wieder einen erfolglosen Anlauf nahmen, in Richtung Norden ausgerichtete Atombomben auf der Insel zu stationieren.
Von der so hoch gepriesenen, viel besungenen, anscheinend sprühenden Lebensfreude karibischer Art spürte Winkler vorerst wenig. Dies aber lag wohl in erster Linie daran, dass die Menschen wegen der sehr niedrigen Einkommen mit allem, was sie hatten, mächtig Rudern mussten, um einigermassen über die Runden zu kommen. Was Wunder, dass es ihnen deshalb nur in Ausnahmefällen zum Festen und Tanzen zu Mute war. Andererseits lag es aber sicher nicht weniger auch am schwerblütigen Gemüt des wenig kommunikativen Ostdeutschen, der nur beschränkt Zugang zu Einheimischen fand. Sein Mangel an Empathie gab kaum je Anlass die Kubaner rocken zu lassen. Winklers grösstes Handicap war noch immer seine äusserst mangelhafte Kompetenz im Umgang mit der spanischen Sprache einerseits und seine noch immer bestehende innere Ablehnung gegenüber der einheimischen Kultur und der Lebensweise seines Gastlandes mit ihren Menschen. Er bemühte sich kaum, dieses Handicap zu verbergen. Unter diesen Umständen war es schwierig, eine gegenseitige Akzeptanz aufzubauen, geschweige denn Harmonie.
Andererseits stellte Winkler beiläufig fest, dass in Havanna eine grosse internationale Community bestand. 1959 trieben die Revolutionäre unter Führung von Che Guevara und Fidel Castro den Diktator Batista in die Flucht, der sich seinerseits 1952 an die Macht geputscht hatte. Die Revolution warf ihrerseits die Amerikaner und alles Amerikanische aus dem Land – mit Ausnahme der Autos Made in USA, die nach wie vor verkehrten. Stattdessen machten sich die Russen und Leute ihrer Vasallenstaaten breit. Durch diesen Umstand kamen die Kubaner im wahrsten Sinn vom Regen in die Traufe. Dabei war die Traufe wohl kaum vorteilhafter als der Regen zuvor.
Für Winkler waren die sich hier aufhaltenden Ausländer keine Exoten, mit denen er zum ersten Mal im Leben zurechtkommen musste, im Gegenteil. Russen, Balten, Tschechoslowaken, Polen, Ungarn und andere prägten hier wie dort die Expat-Szene. Auch in der DDR waren sie überall anzutreffen, was ihm schon dort nicht besonders behagte. Denn seine Losung war schon je: Deutschland den Deutschen, womit er die DDR meinte. Doch nun war der Blickwinkel um hundertachtzig Grad gedreht: Er gehörte hier zur Gruppe der Ausländer, wurde von den Einheimischen vielleicht genau so wenig als Augenstern betrachtet, wie er das zuhause gegenüber Fremden empfunden hatte.
Winkler hielt sich eher unverbindlich an seine Landleute, von denen sich nicht Dutzende, sondern zu seiner Verwunderung eher hunderte in der Stadt herumtrieben. Jeder hatte eine Aufgabe zu erfüllen, um Honeckers Sendebewusstsein Genüge zu tun. Weil Winkler – nicht unbedarft auf diesem Gebiet – schon so das Gras wachsen hörte, fand er schnell heraus, welcher Kerl ihn im Heimatauftrag zu überwachen hatte. Zu dieser Person hielt er im eigenen Interesse grösstmögliche Distanz. Eigenartig empfand er, dass man auch ihm eine entsprechende geheime Order aufgetragen hatte, nämlich den anderen, also übers Kreuz, zu überwachen. Ein Auftrag, den er ignorierte, Heimatliebe hin oder her.
In der zehnten Woche seines Kuba-Aufenthaltes kontaktierte ihn ein Russe, der sich Igor Davidoff nannte. Dieser Mann sagte, dass er in offizieller Funktion verhandeln wolle. Winkler war erstaunt. Worüber verhandeln, bitte? Davidoff fragte Winkler ohne jegliches