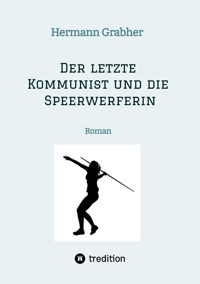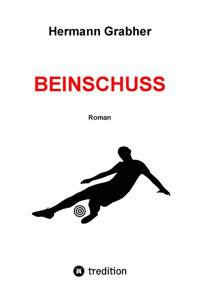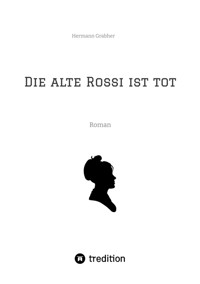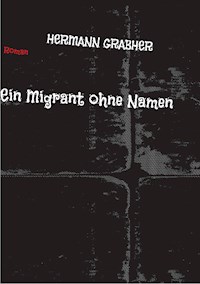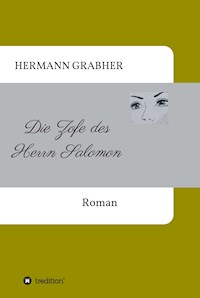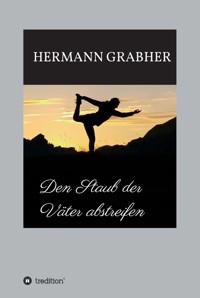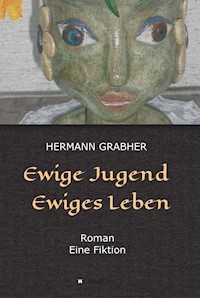
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mediziner und Forscher sucht nach einem Heilmittel gegen Krebserkrankungen, ist jedoch erfolgslos. Findet dabei aber zufällig ein Mittel zum Stoppen der Alterung menschlicher Zellen. Die Folge: Ewige Jugend? Ewiges Leben? Der fiktive Roman von Hermann Grabher beschreibt, wie Menschen reagieren könnten bei einer Aussicht, die eigene fortschreitende Alterung zu stoppen und das Ablaufdatum des eigenen Lebens nach hinten zu verschieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hermann Grabher
Ewige Jugend Ewiges Leben
Roman Eine Fiktion
© 2017 Hermann Grabher
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-7611-5
Hardcover:
978-3-7439-7612-2
e-Book:
978-3-7439-7613-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Wohl denen, die bis zu den letzten Tagen ihres Erdendaseins die Lebensfreude behalten und auch den Optimismus und den freien Geist nicht verlieren. Denn ihnen gelingt es, einen Hauch vom Geheimnis der ewigen Jugend einzufangen. Um schliesslich gut gerüstet das Leben danach, das Ewige Leben anzugehen.
1
Es gab sie noch, die zelebrierten Liebesnächte von Paul Meier und seiner Gattin Talia. Und dies im dreiundzwanzigsten Jahr ihrer Ehe. Das Paar hätte durchaus als Paradebeispiel dienen können, dass auch nach fast zwei Dutzend Ehejahren und nach dem Eintritt in die zweite und damit letzte Lebenshälfte der Hunger und der Durst füreinander noch keineswegs gesättigt sein muss. Und das landläufige Gelaber, dass um das fünfzigste Lebensjahr, wenn nicht gar früher, die Glut erkaltet, das Feuer erloschen sei, dies empfanden sie beide – Talia und Paul - als falsch, ja absurd. Zwar wurden Feuerwerke dieser Art auch beim Ehepaar Meier beileibe nicht täglich, oder eben nächtlich gezündet. Um bei der Wahrheit zu bleiben, es gab Perioden, da geschahen diese wundersamen Begegnungen in Zweisamkeit weit seltener. Talia, die Frau, hätte es bevorzugt die körperliche Nähe ihres Gatten öfter zu erfahren. Aber umständehalber war dies nicht möglich. Denn Paul, ihr Mann, war intensiv in seine Geschäftsaktivitäten eingebunden und so nicht nur ausnahmsweise ortsabwesend. Pauls Geschäftspartner waren über alle Kontinente der Erde verstreut. Und weil persönliche Begegnungen unumgänglich waren, befand sich der Mann oft über längere Perioden auf Reisen und damit fern von seinem zuhause.
Nach Nächten wie diesen empfand das Paar, sie beide, den anschliessenden Tag als Geschenk, als wertvolles Gut, das sie so lange als möglich im Innersten zu bewahren trachteten. Denn das Gefühl der gegenseitigen Nähe und Geborgenheit währte fort, selbst wenn jeder längst wieder räumlich getrennt den persönlichen Verpflichtungen nachging.
Sowohl Paul als auch Talia waren sich bewusst, dass diese harmonischen Stunden danach sehr geeignet waren, um anstehende kleinere und grössere Familienthemen oder private Probleme zu besprechen und in Minne zu lösen. Und das Ehepaar nutzte diese Augenblicke regelmässig für einen nahen Gedankenaustausch. Denn nie war der eine offener und empfänglicher für jenes, was den anderen beschäftigte. Und in einer Familie wie der von Meiers, einer mit drei Kindern, gab es stets genug Stoff, genug Themen, die der Besprechung, der Abarbeitung harrten.
Dieses Mal nutzte Paul die Gunst der Stunde und beichtete seiner Gattin einen Entscheid, von dem er wusste, dass er Talia damit nicht erfreuen würde. Als Arzt, Forscher und Unternehmer entwickelte Meier und sein Team wiederkehrend neue pharmazeutische Produkte, die eingehender Tests bedurften, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Nun waren sie – Paul Meier und sein Team - aktuell mit einer Versuchs- und Testreihe zuwege, die vielleicht Umwälzendes bringen konnte, allein das finale Resultat stand in den Sternen. Meier hatte sich entschlossen Tests mit dem neuen Medikament an sich selber, an sich persönlich durchzuführen, eine sogenannte Selbstmedikation, was naturgemäss mit Risiken verbunden war. Allfällige Nebenwirkungen zeigten sich ja stets erst in der Praxis, im realen Leben, am Menschen. Meier sprach von einem minimalen, einem sehr kalkulierbaren Risiko und er versuchte seine Gattin zu beruhigen. Talia, selber Ärztin, aber vornehmlich der Naturheilkunde zugetan, war gegenüber pharmazeutischen Medikamenten grundsätzlich kritisch eingestellt, mitunter gar ablehnend. Als sie von Pauls Hasardspiel hörte – Hasardspiel, ja, so nannte sie es wörtlich, erstarrte sie innerlich förmlich und Frost überkam die Frau. Sie erinnerte ihren Gatten daran, dass er eine Familie habe, eine fünfköpfige nämlich und diese ein Recht auf einen gesunden Gatten und Vater habe, einen verantwortungsvollen hoffentlich, dies betonte sie mit Nachdruck. Das Verständnis für seine Frau und ihr Anliegen war das eine - und dieses empfand Meier durchaus, sein eigener harter Kopf allerdings stand dem entgegen (wie so oft), stand sozusagen auf der gegenüber liegenden Seite und dies fordernd, unerbittlich. Diesem eigenen harten Schädel konnte sich Meier selten erwehren und widersetzen. Dieser konnte sich hin und wieder selbst gegen Regeln der Vernunft durchsetzen, wenn es denn die Umstände verlangten.
Meier küsste seine Frau behutsam und flüsterte: „Vertraue mir, Liebstes!“
Am 1. April des Jahres 1970 - Jahrzehnte bevor das Internet geboren war, ja sogar ein Dezennium vor Einführung des Faxgerätes im Büroalltag, weckte eine knapp abgefasste Pressemitteilung erstaunlich geringe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit:
Schweizer Forscher findet Substanz, welche die Alterung menschlicher Zellen stoppt!
Der Mangel an Resonanz war zweifellos zum grossen Teil im unglücklichen Termin begründet. Jedermann verbindet das Datum des ersten Aprils mit einem Scherz. Zum andern nahm die Öffentlichkeit solche Schlagzeilen schon lange nicht mehr unbedingt für bare Münze. Nach dem zweiten Weltkrieg hatte auch im deutschsprachigen Raum die Unart der Übertreibung in der Boulevardpresse Fuss gefasst. Da war man nicht mehr weit entfernt vom angelsächsischen Stil, der schon von jeher versuchte Leser mit Schlagzeilen zu ködern.
Der Name des Forschers war Paul Meier (geboren 1920), ein Mediziner. Meiers eigentliches Ziel war es ein Medikament zu finden, das Tumorerkrankungen präventiv abwenden sollte. In seinem Hinterkopf war auch die Idee eines Konzepts, um gewisse diagnostizierte Krebserkrankungen zu heilen. Stattdessen fand Meier bei seinen Versuchs- und Forschungsaktivitäten entgegen seines Ziels und auch nicht seinen Erwartungen entsprechend - eine Substanz, welche den normalen Alterungsprozess der menschlichen Zellen stoppte. Diese Substanz wurde aus einer speziellen Flechte gewonnen, die im Labor gezüchtet wurde. Flechten sind Doppelwesen bestehend aus einer Alge und einem Pilz, die in einer Symbiose existieren. Dabei bildet die Alge mit Hilfe des Chlorophylls und von Stärke (Glucose) auf der Basis von Sonnenlicht die Lebensgrundlage für den Pilz. Der Pilz ist für die Alge notwendig, um sie vor dem Austrocknen zu bewahren. Auf diese Weise verbinden sich Pilz und Alge in einer Ehe, die explizit nur auf Zweck aufgebaut ist. Der eine ist auf den anderen angewiesen, jeder für sich könnte ohne seinen Partner physisch nicht existieren.
Die Versuchsreihe mit Tieren war zeitaufwendig und die Resultate fielen zwiespältig aus, ja eigentlich sogar unbefriedigend: Man behandelte die Hälfte der Tiere mit dem neu entwickelten Medikament und die andere Hälfte nicht. Als Resultat zeigte sich, dass sich die medikamentös behandelten Tiere besser entwickelten, länger gesund blieben und durchschnittlich älter wurden. Andererseits unterschied sich der prozentuale Anteil jener Tiere, die von Krebs oder einer anderen schweren Erkrankung befallen wurde, nur unbedeutend. Die Erkrankungsrate bei behandelten und unbehandelten Tieren war weitgehend identisch.
Bei der anschliessenden Versuchsreihe mit menschlichen Probanden machte ein solches Vorgehen aus verschiedenen Gründen, speziell aber auch wegen des Zeitaspektes keinen Sinn. Deshalb konzentrierte sich das Forscherteam vorerst auf Krebspatienten. Das Medikament zeitigte hinsichtlich der Heilung von Tumorerkrankungen – identisch wie zuvor bei Tieren - keinerlei Wirkung. Kein Patient wurde geheilt. Dies war ein Ergebnis, das vorerst in den Augen von Paul Meier und seinem Forscherteam als Desaster betrachtet wurde, weil das gesetzte Ziel verfehlt wurde. Aber es war eine Situation, wie sie immer wieder vorkam, denn in der Forschung und der Entwicklung sind negative Ergebnisse und Rückschläge tägliches hartes Brot, das zwangsweise verdaut werden muss und als Erfahrung abgehakt wird.
Andererseits stellte Dr. Meier bei seiner Versuchsreihe gewisse Veränderungen der gesunden Zellen der Krebspatienten fest, die der Forscher einstweilen nicht deuten konnte. Die behandelten Patienten lebten durch die Behandlung vorerst in positiver Weise auf, fühlten sich besser, schöpften Hoffnung. Jegliche Zuversicht wurde jedoch stets nach einer gewissen Zeit geknickt, weil die Krebserkrankung weiter bestehen blieb, weder gestoppt, noch eliminiert werden konnte und folglich der Verlauf des Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsstatus eines Patienten oft mit einem tödlichen Ergebnis endete. Die Erkenntnis war, dass die Tumorzellen von diesem Vorgang im menschlichen Organismus nicht betroffen waren, wohl aber die gesunden Zellen.
Wegen der negativen Testergebnisse mit den Krebspatienten entzog die Schweizer Gesundheitsbehörde Dr. Meier und seinem Team die Erlaubnis, weitere Versuche mit Testpersonen durchzuführen, soweit dies die Krebsforschung betraf.
Doch der Forscher war getrieben herauszufinden, was die Anwendung seines Medikamentes bei gesunden Menschen bewirken würde. Deshalb entschied er sich letztlich für jene Selbstmedikation, bei der er sich verpflichtet fühlte, es seiner Gattin zu beichten und womit er bei ihr eben keinen Lorbeerkranz errang.
Die neue Substanz wurde bei Meier gespritzt und zwar in minimalen Dosen. Die Abgabe mittels Spritzen wurde deshalb gewählt, weil vorangehende Versuche mit oraler Einnahme – ausser einer Magenverstimmung - keine Wirkung gezeitigt hatten. Meiers Laborassistentin Jutta führte die Versuchsreihe an Meier durch. Auch sie bot sich an bei diesem Versuch teilzunehmen, aber Meier lehnte ab. Der Forscher war nur bereit das Risiko selber und persönlich zu tragen, dieses auf sich selber zu beschränken.
Fortan wurden regelmässig Tests mit Meiers Blut vorgenommen, dies auch deshalb, um den Versuch sofort abbrechen zu können im Falle einer negativen Entwicklung. Erstaunt stellte Meier und die Assistentin fest, dass sich Meiers Werte, insbesondere die Blutwerte, tendenziell verbesserten. Der Forscher fühlte sich physisch und psychisch grossartig, dynamisch und doch relaxed. Er hatte permanent Lust Bäume auszureissen. Seine Sinne waren wach. Seine Schaffenskraft befand sich im Dauerhoch. Er benötigte wenig Schlaf und fühlte sich dennoch ausgeschlafen. Seine Haut sah jugendlich, frisch und gesund aus. Für Meier fühlte es sich an, als hätte er sich einen Gesundbrunnen einverleibt. Es hörte sich übertrieben an, aber dieses neue Lebensgefühl konnte nicht anders beschrieben werden, als eben genau mit dieser Portion an Euphorie. Dabei war dieser Resultat, die Wirkung eigentlich medizinisch kaum erklärbar, es sei denn unter dem Aspekt der Psychologie.
Das Resultat mit dem tollen Effekt erweckte in Meiers Assistentin Jutta den Wunsch, ebenfalls in den Versuch einzusteigen, ohne dass Meier sie diesbezüglich animiert hatte. Auch bei Jutta schlug die Medikation in identischer Weise positiv an.
In der nachfolgenden klinischen Forschung mit einer grösseren Anzahl von freiwilligen Probanden wurden durchwegs sehr positive Ergebnisse gezeitigt, auch in einer länger dauernden Versuchsreihe. Es war möglich nachzuweisen, dass der natürliche Alterungsprozess der menschlichen Zellen gestoppt werden konnte. Dabei muss man wissen, dass der Mensch hundert Billionen Zellen besitzt (dies ist eine 1 mit 14 Nullen) – würde man alle Zellen eines Menschen aneinander reihen, reichte dies 60 Mal um die Erde. Jede Sekunde sterben 50 Millionen Zellen im menschlichen Körper ab und werden durch neue ersetzt. Dieser permanent stattfindende Regenerationsprozess bewirkt den eigentlichen Alterungsvorgang. Meiers Substanz wirkte dem Prozess der Alterung entgegen. Explizite Voraussetzung für den Erfolg war, das Medikament in regelmässigen Intervallen zu spritzen. Es wurde des Weiteren festgestellt, dass bei Menschen, welche den Forschungsversuch abbrachen, somit das Medikament absetzten, die Zellenentwicklung zum Standard-Modus zurückkehrte: Der übliche Alterungsprozess setzte wieder ein und sich in normaler Weise fort.
Die Mehrzahl der Probanden wollte auch nach der offiziellen Beendigung der klinischen Testreihe unbedingt und um jeden Preis weiter behandelt werden. Dies, weil die Menschen, welche sich für die Forschungsreihe zur Verfügung gestellt hatten, dieses körperliche und mentale Hochgefühl nicht mehr missen mochten. Paul Meier willigte ein, weil er damit die Wirkung seines Medikaments auch in einer weiterreichenden Langzeitforschung eingebettet sah. Er ging davon aus, dass eine Zulassung dieses Medikaments nur möglich sein würde, wenn ein positives Ergebnis in einem Langzeitversuch nachgewiesen werden konnte. Und dies sollte auch die Basis für einen eventuellen späteren kommerziellen Erfolg sein.
Das Forscherteam entwickelte spezielle Kapseln, die Paul Meier und auch den Probanden implantiert wurden. Diese Kapseln setzten den Wirkstoff fortwährend automatisch in Kleinstmengen an den Körper ab. Damit war man nicht mehr auf die frequentierte Applikation mittels Spritzen angewiesen – eine wesentliche Erleichterung!
A
In der Zeit vor, während und unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg ging es vielen Menschen, um nicht zu sagen der Mehrheit der Bevölkerung, materiell eher schlecht als recht. Die Weltwirtschaftskrise zwischen den beiden Weltkriegen bewirkte, dass sich die Leute durchwegs nur mit einem äusserst kargen Einkommen durchs Leben schlagen mussten. Heerscharen von Menschen waren ohne Anstellung und somit ohne Arbeit und geregelten Verdienst. Die Familien und Sippen standen zusammen. Sich in der Gemeinschaft solidarisch zu verhalten, bedeutete für den Einzelnen Sicherheit. Wenn ein Mitglied einer Familie eine Anstellung hatte und somit einen Lohn heimtragen konnte, einerlei ob Vater, Mutter oder Kinder, egal welchen Alters, war es selbstverständlich, dass dieses Geld in die gemeinsame Familienkasse floss und damit beitrug, dass alle Mitglieder der Familie überleben konnten. Insbesondere in ländlichen Gebieten bewirtschafteten die Familienverbände ein Stück Garten- oder Ackerland, auf dem Grundnahrungsmittel angebaut wurden: Kartoffeln, Mais, Weizen, Bohnen, Rüben, Karotten. Populär waren auch Fruchtbäume: Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pflaumen, Nüsse, Beeren. Wer es sich einrichten konnte, hielt auch einige Hühner oder gar ein Schwein. In der Ostschweiz boten Textilunternehmen oft Heimarbeit an, allen voran die Stickerei-Industrie. Viele Häuser im Dorf hatten einen kleinen Anbau, ein Lokal, in dem eine Handstickmaschine stand. Vater, Mutter und grössere Kinder waren im Stande solche Maschinen zu bedienen. Aber gerade auch die Textilindustrie machte zwischen den beiden Weltkriegen eine schlimme Krise durch. So verschwanden mit den Jahren die meisten der Stickmaschinen.
Die Folge war, dass sich die Menschen mit Ach und Krach durchs Dasein zu zwängen hatten. Es war eher ein Überleben als ein Leben. Die Pflicht stand im Vordergrund, Vergnügen und Ablenkung gab es wenig, und wenn, nur in bescheidenem Rahmen: An Geburtstagen stand ein Kuchen oder gar eine Torte auf dem Tisch. An Weihnachten wurden kleine Geschenke verteilt. Anlässlich einer Hochzeit oder einer Taufe freuten sich die Familienmitglieder, die Verwandten und Gäste auf ein gutes Essen. Und an Pfingsten wurde im Festzelt getanzt und Bier getrunken.
Paul Meier stammte aus einfachem Haus. Die Eltern waren wenig begütert. Er musste sich insbesondere auch während seiner Studienjahre einschränken, wie dies bei weitaus den meisten Studenten in jener Zeit nicht unüblich war. Mal abgesehen von der kleinen Minderheit, die auf besser bemittelte Eltern zählen konnte, waren die Studierenden auf Stipendien oder dann eben auf Gelegenheitsjobs angewiesen. In den Ferienperioden versuchten viele der jungen Leute jenes bescheidene Geld zu generieren, das es brauchte, um über das Jahr hindurch überhaupt über die Runden zu kommen. Grundsätzlich ging es aber darum, auf bescheidenstem Niveau zu leben und wenig Geld zu verbrauchen.
Im Falle von Paul Meier war dies nicht anders. Doch einmal im Berufsleben angelangt, fasste Meier schnell Fuss und wähnte sich selber auf Rosen gebettet, wie dies einmal seine Mutter nicht unzutreffend – mit den Worten der damaligen Zeit - formulierte. Meier schätzte den Wechsel vom Habenichts zu einem Menschen mit einem geregelten und erst noch guten Einkommen ausserordentlich. Er fühlte sich sehr privilegiert und befreit nun über Geld zu verfügen, Besitzer eines kleinen Vermögens (gemäss seiner bescheidenen Beurteilung) zu sein, keine Gedanken mehr mit existentiellen Grundproblemen vergeuden zu müssen.
Es ist allgemein bekannt, dass in der Medizin von zehn Forschungsprojekten weniger als eines erfolgreich ist, welches dann schlussendlich als Medikament produziert wird und den Weg zum Patienten findet (von Blockbustern ohnehin nicht zu reden). Meier strafte Statistiken dieser Art Lügen. Dem jungen Forscher war das geniale Gespür angeboren, intuitiv zu ahnen, heraus zu finden, wie eine Idee umzusetzen war, wie etwas funktionieren konnte. Er schlug in seinen Forschungskonzepten selten falsche Wege ein und seine Arbeiten zeitigten oft schon nach überdurchschnittlich kurzer Zeit erstaunliche Erfolge. So fiel er in der Universitätsklinik schon in seinen jungen Jahren bereits vor und erst recht nach seinem Staatsexamen mit zum Teil bahnbrechenden Ergebnissen auf. Deshalb war es logisch, dass von verschiedenen Universitäten ein Buhlen um Meier einsetzte und er die Qual der Wahl hatte. Schliesslich entschied er sich für eine Professur in Genf. Zwei Jahren später wechselte er nach Kalifornien, kehrte aber weitere zwei Jahre später wieder zurück in die Schweiz.
Professor Dr. med. Paul Meier machte Entdeckungen und diese wurden insbesondere in Fachorganen publiziert. Sie machten ihn in Insiderkreisen einigermassen bekannt. So war es nicht verwunderlich, dass der Forscher auch der Pharmaindustrie nicht verborgen blieb und grössere Firmen streckten ihre Fühler nach ihm aus. Aber Meier widerstand den Verlockungen, die da hiessen: Ein Salär, von dem andere nur träumen konnten. Bonuszahlungen bei entsprechenden Erfolgen. Ein motiviertes Team von Assistenten. Aufstiegsmöglichkeiten. Geregelte Arbeitszeiten, die viel Freizeit versprachen. Überproportional viele bezahlte Ferien- und Freitage. Einen Dienstwagen der gediegenen Kategorie. Eine gesicherte Altersvorsorge. Dazu ein Labor nach dem letzten Stand der Technik.
Doch Paul Meier liess sich von den paradiesisch anmutenden Anstellungskonditionen der Pharmafirmen - Blendwerk wie er es nannte - nicht verführen. Sein Ziel war ein anderes: Er wollte sein eigener Herr und Meister sein und beabsichtigte ein eigenes Unternehmen zu gründen. Der erste Schritt dazu war, kaum aus den Vereinigten Staaten in die Schweiz zurückgekehrt, dass er sich ein privates Labor einrichtete. Mit dieser Anschaffung waren alle bisherigen Ersparnisse auf einen Schlag verbraucht. Seine Gattin hatte keine Einwände, unterstützte ihn im Gegenteil.
Dieses Privatlabor war nun sein eigenes, sein ganz persönliches Reich, in dem er tüftelte und forschte und zwar ohne dass ihm die Öffentlichkeit - sprich Dutzende Augen von Kollegen und Studenten - über die Schulter guckte.
Obwohl Meiers Herz nun fortan vor allem für sein eigenes Labor schlug und dieses eine im Handelsregister eingetragene und registrierte Firma war - die Dr. med. Paul Meier Pharma AG, behielt Meier seine Professur an der Uni weiter. Der Wissensaustausch und insbesondere der Kontakt zu jungen, lernbegierigen Menschen mochte er sehr und keinesfalls missen. Diese Aktivität bedeutete ihm viel. Sein Spezialgebiet war der Einsatz und die Wirkung spezifischer Pharmazeutika in der Medizin. Meiers Vorlesungen waren beliebt und begehrt bei den Medizinstudenten, weil diese aufbauend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen waren, dazu verständlich und mit gediegener Rhetorik vorgetragen. In der Regel arbeitete Meier auch mit visuellen Mitteln, zum Beispiel mit einem Overhead Projektor, einem Gerät, das er einst in den USA entdeckt und in die Schweiz mitgenommen hatte – zu jener Zeit in Europa sonst noch weitge- hend unbekannt.
Indes tat sich in Paul Meiers eigenem Labor Entscheidendes. Er hatte eine Substanz gefunden oder wohl eher mittels harter Arbeit entwickelt, die den Haarausfall radikal stoppen konnte und das Kopfhaar über die Jahre hinweg, selbst bis ins vorgerückte Alter in seiner natürlichen Farbe beliess. Damit wurde jegliche Färbung oder Tönung überflüssig. Es war ein Produkt, das sowohl Frauen wie Männer gleichermassen ansprach. Meier patentierte die Substanz und verkaufte das Patent an eine deutsche Firma – Weltmarktführer in der Haarpflegemittel-Industrie, dies gegen ein für seine Verhältnisse enorm hohes Entgelt.
Allerdings verbockte der besagte weltbekannte Produzent von Haarpflegemitteln Meiers einzigartige Errungenschaft, dies sehr zum Ärger und Verdruss des Erfinders. Damit verkam des Professors sensationelle Errungenschaft zur Totgeburt. Und dies kam so:
-Das deutsche Industrieunternehmen war spezialisiert in der Produktion von Haarpflegemitteln zur äusserlichen Anwendung. Damen und Herren wuschen sich mit Produkten dieser Firma ihre Haare, schäumten sie damit ein, wodurch die Haare getönt oder gefärbt wurden. Durch viel Werbeeinsatz waren diese Präparate bekannt und populär und verkauften sich rund um den Globus multimillionenfach. In der Tat waren diese Haarfärbe- und -Tönungsmittel für die Anwender äusserst hilfreich. Sie waren einfach in der Handhabung und Applikation, umwerfend in der Wirkung, dazu preisgünstig und deshalb sehr beliebt und geliebt. Jedermann war in der Lage den Vorgang auch selber zuhause durchzuführen und zwar mit oder sogar ohne zusätzliche helfende Hand. Das Unternehmen machte gutes Geld mit diesen Produkten.
-Paul Meier wies anlässlich der Verhandlung mit der Delegation des Haarpflegemittel-Konzerns betreffend Nutzung des Patentes nachdrücklich darauf hin, dass die vom Professor entwickelte Substanz ein Medikament sei und kein Produkt für äussere Selbst- oder Frisör-Anwendung. Mit Sicherheit könnten nur Mediziner die Behandlung durchführe und insbesondere würde eine seriöse medizinische Überwachung notwendig sein, wollte man Erfolg haben. Die Applikation könnte durch Spritzen erfolgen, vorteilhafter jedoch mittels Implantation einer kleinen Kapsel in den Körper, die den Wirkstoff permanent in kleinen Mengen an den Körper abgeben würde. Meier erklärte, dass es wohl angezeigt sei, eine neue Abteilung innerhalb des Konzerns aufzubauen, die für eine entsprechende systematische Instruktion der Mediziner zuständig wäre. Ärzte und Spitäler müssten geschult werden betreffend der Anwendung, wie es auch absolut notwendig wäre insbesondere jene Menschen umfassend zu instruieren, die sich bereit erklärten, sich dieser Behandlung zu unterwerfen.
-Doch alles entpuppte sich schliesslich als ein riesiger Flopp, als eine arge Täuschung, verkam für Meier zum enttäuschenden Desaster. Der Patenterwerber hatte nämlich gar nie die Absicht gehegt, das von Dr. Meier entwickelte Produkt auf den Markt zu bringen. Im Gegenteil: Der Haarpflegemittel-Firma ging es nur und ausschliesslich darum, Meiers Medikament zu eliminieren, vom Markt auszuschliessen, auf das Totgeleise zu fahren. Weshalb? Weil bei den Besitzern des Konzerns die Furcht gross gewesen war, dass sich künftig Millionen Menschen die Substanz spritzen oder das Implantat einsetzen lassen könnten. Und diese Leute wären dann dadurch keine Konsumenten der äusserlich anwendbaren Haarpflegeprodukte mehr gewesen. Ausserdem wollte die Erwerber-Firma unter allen Umständen verhindern, dass ein Konkurrenzunternehmen Zugriff auf Meiers Patent bekäme. Die Gefahr, dass durch die Einführung von Meiers Errungenschaft weltweit ein Riesenmarkt wegbrechen würde, betrachteten die konzerneigenen Analysten als sehr realistisch und für den Konzern gar existenzbedrohend. Also wurde Paul Meier mit einem überzeugenden Angebot geködert und das Patent, das exklusive Nutzungsrecht der Substanz NIE MEHR HAARAUSFALL, NIE JE GRAUE HAARE in den firmeneigenen Tresor eingeschlossen und damit still beerdigt, das Projekt eingestampft.
Für Paul Meier war dieser Vorgang eine ernüchternde Erfahrung, eine bittere Enttäuschung. Allerdings und immerhin war er fortan aufgrund des Erlöses aus dem Verkauf des Patents ein gemachter Mann. Der Professor stand nun fortan materiell auf starken Beinen und brauchte künftig vor niemandem mehr aus wirtschaftlichen Gründen zu Kreuze zu kriechen. Er verfügte nun über jenes Kapital, das ihm ermöglichte, seinem Unternehmen einen entscheidenden Schub zu verleihen. Gleichzeitig wurde Meier – dem Arglosen, dem Gutgläubigen - bei dieser Gelegenheit aber auch eine harsche Lektion erteilt, nämlich wie moderne Marktwirtschaft funktioniert. Er musste erkennen, dass Falschspielen eine durchaus übliche und in der Realität praktizierte Geschäftsart sein kann, andererseits Offenheit, Treue und Glauben nicht unbedingt als Begriffe von relevanter Bedeutung betrachtet werden.
Im Grunde genierte sich Meier über sein unbedarftes, eher amateurhaftes Vorgehen und war eigentlich froh, dass die Geschichte nicht weiter publik wurde. Denn es war ja mehr als offensichtlich, dass er vor allem dem Blinken des Mammons erlegen war. In der Tat hatte es Meier unterlassen, den Geschäftsvorgang etwas eingehender zu hinterfragen. Andererseits hatte Meier als junger und noch unerfahrener Geschäftsmann in seiner Blauäugigkeit nie damit gerechnet, dass ihn jemand so dreist linken würde, schon gar nicht eine Firma mit einem dermassen wohl klingenden Namen.
Und auch dem Haarpflegemittel-Konzern war es recht, dass diese ihre Aktion in der Öffentlichkeit keine Wellen warf. Denn dieser Vorgang hätte durchaus das Potenzial gehabt, einen Skandal zu entfachen und damit einen Imageschaden grösseren Ausmasses anzurichten, wäre er auf den Kicker eines vifen Journalisten geraten.
Damit hatte Meier also zumindest materiellen Erfolg und kam schon innerhalb kurzer Zeit nach seiner Firmengründung zu Wohlstand. Doch unter den gegebenen Umständen erntete Meier in seinem Umfeld nicht nur Bewunderung, sondern eben auch Neid, so wie es nun mal ist im Leben. Die Wurzel der Missgunst beruhte insbesondere darin, dass Meier nicht nur mit Erfolgsresultaten in seiner Forschungsarbeit aufzuwarten wusste und damit Ehre und Hochachtung einheimste, sondern weil er zudem noch im Stande war, seine Entwicklungen kommerziell höchst vorteilhaft umzumünzen. Für gewisse Leute, insbesondere Kollegen war diese Tatsache ein Zacken zu viel des Guten! Andererseits liess es Meier kalt, was andere dachten, redeten oder schnödeten. Unschöne Reaktionen - von wem immer inszeniert – prallten wie eisige Graupelkörner an einer glatten Stahlwand an Meier ab, richteten bei ihm keinerlei Schaden an. Im Gegenteil: Meier lachte in eher hochmütiger Weise über Leute, die den Versuch wagten, ihn zu Moppen.
B
Paul Meier stellte weitere Mitarbeiter in seinem Unternehmen ein. Durch seine Tätigkeit als Professor war er stets nahe an den Studenten und konnte sich die fähigsten Leute für seine Firma aussuchen.
Das vorerst noch kleine Team trieb die Forschung unbeirrt und mit akribischer Zähigkeit weiter. Der nächste Schlager war ein Medikament zur Verhinderung von Zahnkaries. Die Tests entwickelten sich äusserst erfolgversprechend. Meier meldete auch dieses Produkt weltweit zum Patent an, was in gewissen Kreisen Aufsehen erregte. Weltkonzerne in der Zahnpflege meldeten sich und wünschten mit Meiers Unternehmen zu verhandeln. Und auch Regierungen zeigten Interesse an diesem Produkt. Nicht nur Meier und seine Mitarbeiter erkannte ein enormes Geschäftspotential. Abhängige und unabhängige Marktanalysten und vor allem Grossfirmen der Pharmabranche sahen dies in absolut identischer Weise. Die Fantasie sowohl von Gesundheitsministern, wie auch von Finanzministern in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichsten politischen Ausrichtungen war angeregt und überbordete beinahe. Eine Bombe sei dies, hörte man, eine hoch karätige Bombe. Die Vorsteher dieser Ministerien verifizierten gleich eine doppelte, äusserst attraktive Chance, nämlich einerseits die Volksgesundheit zu verbessern, andererseits die Gesundheitskosten zu senken. Denn Zahnkaries ist weltweit eine Volksseuche, die enorme Kosten verursacht – und nicht zu vergessen auch üble Pein: Ein hohler Zahn kann
schmerzen, das Wohlbefinden eines Menschen massiv beeinträchtigen.
Meier hatte eine Vision: Sein Ziel war es dieses Produkt – den Kariesprotektor, wie er seine Entwicklung nannte, selber zu produzieren und zu vertreiben. Immerhin umfasste die Firma zwischenzeitlich schon eine Belegschaft von einigen Dutzend Angestellten. Seine Firma, die Dr. med. Paul Meier Pharma AG war gut aufgestellt. Das Unternehmen umfasste ein auf dem letzten technischen Stand installiertes Labor mit einem Team von innovativen, höchst kreativen und willigen Mitarbeitern - Chemikern, Pharmazeuten, Laboranten, Technikern, denen der Professor persönlich vorstand. Die Pharma hatte auch eine kleine, aber sehr feine Produktions- und Konfektionsabteilung, die nach dem letzten Stand der Technik konzipiert und eingerichtet war. Die Organisation verfügte über eine einwandfrei funktionierende Administration, die durch Unauffälligkeit und Effizient glänzte, was wiederum bewirkte, dass alle rund herum zufrieden waren: Die Kunden. Die Lieferanten. Die Mitarbeiter. Die Behörden. Ja, und auch der Chef selber. Einzig der Sektor Verkauf, der Vertrieb war noch nicht so aufgestellt, wie es bei einem Unternehmen dieser KMU-Grösse hätte sein müssen, einer Firma mit einem beinahe bombastisch anmutenden Expansionspotential. Dieses prognostizierte Marktpotential war im Übrigen keineswegs ein von Meier erfundener Publicity-Gag, sondern jenes seriöse Substrat, wie es von unabhängigen Ökonomen zusammen mit Studenten seiner Universität erforscht und ermittelt worden war. Somit bestimmt kein Windhauch, keine Fantasie, wie der Professor stolz betonte. Die Krux der vernachlässigten Vermarkung war, dass der Meister selber – Dr. Meier - alle wichtigen Verkaufsverhandlungen persönlich führen wollte und nicht bereit war, diese Aufgabe an jemand anderen innerhalb seiner Firma zu delegieren. Denn hier ging es gemäss Meiers Ansicht in der Tat ums Eingemachte. Es ging nämlich darum, entweder aufstrebenden Erfolg zu haben oder dann weiter als kleiner, unbedeutender Wurm, sozusagen als Liliputaner in der Branche zu verharren. Kurz gesagt: Es ging um nichts anderes als um die Zukunft, um das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens.
Andererseits war es für Meier zeitmässig immer unmöglicher an allen Fronten jene Wirkung zu entfalten, die ihm eigentlich vorschwebte - in der Forschung und Entwicklung, wie auch in der Vermarktung. Meier erkannte, dass er dringend Stellvertreter aufbauen musste, um delegieren zu können. In der Produktionsund Verpackungsabteilung hatte er diesen Schritt bereits erfolgreich vollzogen. Er überliess das Geschehen vollkommen einem fähigen, sehr gewieften Betriebsleiter, einem routinierten reifen Haudegen, der mit allen Wassern gewaschen war, dem er vertraute.
Meiers Situation war verhext. Wiewohl der Professor seine Kräfte und seine Pensen bündelte und so effizient wie nur möglich einsetzte, war er mit seinem persönlichen Zeitmanagement unzufrieden. Insbesondere wurde es dem Professor wind und weh, wenn er daran dachte, dass der Schutz eines Patentes jeweils lediglich über eine Zeitdauer von 10 Jahren seine Gültigkeit behielt. Nur ungern mochte er an die Zeit danach denken, an die Auswirkungen nach dem Ablauf dieser 10 Jahre. Dann nämlich, wenn die Konkurrenz mit ihren Nachahmerprodukten in jene Lücke springen würde, die sich vielleicht auftun könnte, wenn man den Markt nicht aktiv und professionell genug besetzt halten würde. Meier hasste diese Generikaprodukte.
Paul Meier reiste hintereinander nach Deutschland, England und in die Vereinigten Staaten. Er verhandelte mit grossen Pharmakonzernen, wie auch mit Regierungsvertretern betreffend des Anti-Karies Produkts. Man brachte ihm Hochachtung entgegen, man hoffierte ihn, man umwarb ihn. Dies alles schmeichelte dem Ego des Professors, brachte ihn aber jener Lösung, die ihm selber vorschwebte, nicht näher: Meier war fixiert, ja geradezu versessen auf seine Idee, selber in seinem Betrieb zu produzieren und das fertige Produkt zu exportieren. Um anschliessend die Distribution des Produkts über Generalimporteure in den verschiedenen Ländern vorzunehmen. Die Verhandlungspartner outeten sich allerdings durchwegs mit Lösungsvorschlägen, die diametral entgegen gesetzt von Meiers Idee angeordnet waren: Sie strebten vornehmlich den Kauf der Lizenz an, um selber in ihren jeweiligen Ländern produzieren zu können. Dafür hatte Meier allerdings aus naheliegenden Gründen ziemlich wenig übrig. Zu übel lag ihm noch die Erfahrung mit dem Haarpflege-Konzern in den Knochen.
Der Gesundheitsminister, wie auch der Wirtschaftsminister der amerikanischen Administration zeigten Meier auf, welche Mengen an Dosen in ihrem Fall notwendig wären, würde man den grösseren Teil der nordamerikanischen Bevölkerung in eine Kampagne zur Kariesprävention einbeziehen. Dies war nämlich das angesagte Ziel der US-Regierung. Meier sah ein, dass es – zumindest kurz- und mittelfristig - für seine Firma ausgeschlossen sein würde, jene Stückzahlen zu produzieren, die in diesem Fall benötigt würden. Meiers Firma war ein Zwerg im Vergleich mit anderen Produzenten in dieser Branche. Vorerst zauderte der Professor noch immer, war nicht bereit klein bei zu geben, obwohl die Fakten eigentlich glasklar auf dem Tisch lagen. Meier marterte Tag und Nacht sein Gehirn auf der Suche nach einer Lösung, sprach sich selber Mut zu: Ja, richtig, noch war er ein Zwerg. Noch. Doch seine Firma war auf dem Weg zu grossem Wachstum. Dies hatte er sich auf die Fahne geschrieben!
Es nützte nichts, die Zeit lief ihm davon. Wenige Tage später kapitulierte Meier vor sich selber. Er musste einsehen, dass dieses Ding von seiner Firma nicht zu stemmen war. Meiers Fantasiedenken wurde von Meiers Vernunftdenken auf radikale Art und Weise erdrosselte und der Professor trat schweren Herzens auf einen Deal mit den Amerikanern ein. Denn Meier hatte eingesehen, dass er es Drehen und Wenden konnte wie er es wollte: Die geforderten Stückzahlen waren von seinem Betrieb nie und nimmer zu bewältigen - zu weit entfernt war dieses Ziel von der Wirklichkeit, sozusagen Lichtjahre entfernt.
Für die exklusive weltweite Nutzung des Patents für den Kariesprotektor, des Produkts NIE MEHR KARIES generierte Meiers Firma die stolze Summe von zweihundertfünf Millionen US Dollar. Eingebunden in den Vertrag war einerseits die US Regierung, wie andererseits auch ein potenter, sehr bekannter multinationaler Pharmakonzern mit Sitz an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Diesem sollte die Produktion obliegen. Mit dieser Struktur schien dem Professor das Projekt doppelt abgesichert und er hegte keinerlei Argwohn, dass es diesmal so laufen würde, wie beim Haarschutz Projekt seinerzeit, nämlich dass es seinen Partnern nur darum ging zu verhindern, dass es das Produkt auf den Markt schaffte.
Obwohl der Professor hiermit letztlich umständehalber seine persönliche Zielvorstellung verraten hatte, reiste er dennoch erhobenen Hauptes und glücklich zurück in die Schweiz. Denn nun sollte er jenes Geld in die Kasse bekommen, das notwendig war, den nächsten Innovationsschritt in seiner Firma vollziehen zu können. Es ging darum die Entwicklungs- und Produktionskapazität entscheidend zu vergrössern, um schliesslich in der Zukunft endlich in eine höhere Liga aufzusteigen, um jeglicher Konkurrenz die Stirn bieten zu können.
Als Paul Meier den Bankkontoauszug sah, auf dem der Eingang der 205 Millionen Dollar vermerkt war, überkam ihn ein ganz besonderes Hochgefühl, ein ehrlicher Stolz nämlich, dass er es hiermit geschafft hatte. Er empfand ein andächtiges, beinahe religiöses Empfinden, worüber er sich im Grunde schämte, dieses aber nicht aus seinem Kopf zu verbannen im Stande war. Denn eigentlich war es nie Meiers Ziel gewesen, Geld, den Mammon anzubeten.
In den Wochen und Monaten danach verfolgte der Professor gespannt die weiteren Vorgänge in Übersee. Doch nichts geschah. Die Wochen kamen, die Wochen gingen. Jahreszeiten lösten sich ab und es geschah noch immer nichts. Einfach Nichts!
Nach einem Jahr wurde Meier sehr nervös und er ahnte Ungemach. Kurz entschlossen reiste er nach Amerika, um sich an Ort und Stelle nach der Situation zu erkundigen. Denn alle schriftlichen Anfragen waren unbeantwortet geblieben, alle Versuche der Kontaktnahme zu seinen ehemaligen Vertragspartnern waren ins Leere gelaufen. Und auch jetzt vor Ort gestaltete sich die Situation für Meier nicht aufschlussreicher, der Nebel wollte sich nicht lüften. Niemand zeigte sich für ihn zuständig. Seine einstigen sich gönnerisch gebenden Partner, die sich damals seine Freunde nannten, der Gesundheitsminister, der Wirtschaftsminister waren jetzt permanent unabkömmlich: Die Sekretärinnen der Departement-Chefs liessen die Herren entschuldigen, denn diese befanden sich immerzu in Sitzungen, auf Konferenzen, auf Reisen im In- und Ausland. Auf einen Rückruf, das Mindeste, was Meier aus Gründen der Loyalität und des Anstands erwartete, hoffte er vergebens. Der Professor empfand die Situation zum Verzweifeln, so, als wären die Herren auf einen anderen Stern geflüchtet, schnöde abgehauen.
Meier kontaktierte den anderen Vertragspartner der Vereinbarung, den US-Pharmamulti. Dort waren alle Geschäftsleitungsmitglieder, mit denen er seinerzeit die Verträge gezeichnet hatte, nicht mehr in ihren Positionen. Für die neuen Geschäftsführer war Dr. Paul Meier ein Mann ohne Bedeutung, ein Nichts, eigentlich sozusagen unbekannt. Auf jeden Fall sahen sie in Meier keine Person, bei der es sich lohnen würde, einige Minuten für ein Gespräch zu investieren. Aus diesem Grund sah Meier allenthalben nur die kalte, die abweisende Schulter. Dem Professor wurde keine Chance gegeben mit den neuen Zeichnungsberechtigten auch nur in Kontakt zu treten, geschweige denn zu sprechen. Die Vorzimmerdamen fragten Meier, ob er mit einem der Direktoren einen Termin vereinbart habe. Da die ehrliche Antwort in jedem Fall lautete, dass der Grund von Meiers Kontaktnahme eben genau den Zweck habe, einen solchen Besprechungstermin zu vereinbaren, wurde er stets eher harsch denn freundlich abgewiesen. Meier solle bitte gefälligst die hier gültigen Spielregeln akzeptieren, nämlich dass auf diesem Businesslevel der Wunsch und das Bedürfnis für eine Besprechung stets und in jedem Fall von Seiten der Firmenchefs ausgehen würde und niemals umgekehrt. Immerhin kannte er hiermit den Tarif.
Als sich Meier am Abend frustriert und resigniert in sein Hotelzimmer zurückgezogen hatte, bereit am nächsten Tag unverrichteter Dinge heim zu reisen, erreichte ihn ein mysteriöser Telefonanruf. Ein Mister Peter Hole meldete sich und erklärte dem Professor, dass er seinerzeit als Wasserträger der Chefs der Pharmafirma bei den Verhandlungen vor einem Jahr mit dabei gewesen sei. Meier konnte sich an diesen Mann nicht mehr erinnern. Wie auch immer, dieser Mr. Hole gab Meier den freundschaftlichen, wie auch dringenden Rat, sich zurück zu ziehen und ohne jegliches weitere Störgebaren – ja Störgebaren nannte es der Mann wortwörtlich - den Nachhauseweg anzutreten. Meier habe sein Geld bekommen und dies nicht knapp. Dem Lizenznehmer könne man nichts vorwerfen, er habe auf jeden Fall den Vertrag vollumfänglich eingehalten. Juristisch sei alles sauber abgehandelt worden. Also wären alle Verpflichtungen ohne Wenn und Aber abgegolten. Punkt!
Auf die leise Frage Meiers, Hole solle ihm zumindest bitte sagen, ob der Kariesprotektor produziert werde oder nicht, und wenn ja, wann man mit der Produktion beginne, antwortete der Mann lapidar, dass Meier die Tatsache zur Kenntnis nehmen solle, dass das seinerzeitige Projekt, einen Grossteil der amerikanischen Bevölkerung in eine Anti-Karies Kampagne einzubinden, verworfen worden sei, nicht mehr existiere. Jenes Projekt sei umständehalber in Stille beerdigt worden. Der Grund: Die mächtige nationale Lobby der Zahnärzte sei aufgestanden, habe gewaltig Druck gemacht und der Regierung allen Ernstes die Existenzfrage gestellt, nämlich ob man wirklich gewillt sei, ihren Berufsstand zu ruinieren, ja auszuradieren. Immerhin würde die Existenz von
2 Millionen Arbeitsplätzen im Dentalbereich auf dem Spiele stehen. Die Berufsvereinigung der Zahnärzte drohte mit handfesten Klagen gegen die Regierung wegen mutwilliger Bedrohung tausender Existenzen. Worauf sich die Regierung der Vereinigten Staaten genötigt sah, ein Machtwort zu sprechen, einen Grundsatzentscheid zu treffen, der da lautete: Nein, das wolle man nicht! Der entsprechende Entscheid fiel umso leichter, als die US Dentist Association bereit war der Regierung und dem beteiligten Pharmamulti das Patent mit der Bezeichnung NIE MEHR KARIES für einen Betrag von 300 Millionen US Dollar abzukaufen. Dies allerdings nicht zum Zwecke der Vermarktung, sondern um ein Moratorium daraus zu machen, plump gesagt, das Projekt zu versenken. Jeder amerikanische Zahnarzt hätte somit etwa hundertfünfzig Dollar beisteuern müssen, um seine Existenz zu retten – haha, welch ein Klax – der Gegenwert einer Zahnhygienebehandlung für einen einzigen Patienten, um es im Zahnarztjargon auszusprechen. Und dabei sei zu berücksichtigen, dass damit gleichzeitig auch die Existenz aller Kollegen weltweit gesichert wurde – bestimmt kein Pappenstiel! Denn die Patentrechte würden ja weltweit gelten.
Paul Meier war am Boden zerstört. Er war unglaublich wütend auf sich selber. Hatte er sich also somit zum zweiten Mal so dämlich angestellt, sich über den Tisch ziehen zu lassen. Dabei hatte er genau das Ziel verfolgt, nicht noch einmal in den Hammer zu laufen, nicht noch einmal einen gleichen Flop zu landen. Meier war so aufgebracht, dass er am liebsten das Hotelzimmer kurz und klein geschlagen hätte. Aber als gesitteter Mensch machte er das nicht, gebärdete sich nicht wie ein stoner Popstar nach oder vor einem Konzert, zerschlug weder das Lavabo, noch das Zahnglas in der Toilette und auch nicht das Whiskeyglas in der Minibar. Er kochte vor allem innerlich. Gleichzeitig fragte sich der Professor, wie weit hier Wahrheit und Lüge auseinander liegen würde. Ihm war aus früheren Erhebungen bekannt, dass wohl weit keine 2 Millionen Dentisten in Amerika existieren würden, sondern vielleicht zehn Mal weniger, wodurch die Milchmädchenrechnung dieses Mr. Hole in keiner Weise stimmen konnte. Doch dies war ja nun wirklich nur ein eher unwichtiger Nebenschauplatz. Das Kind war in diesem Fall schon in den Brunnen gefallen und nicht mehr zu retten. Wie sich die Rechnung letztlich auch ausnehmen würde, er hatte verloren. Er strich damit die Segel ein weiteres Mal in grossem Stil und das Traurige war: Diese Pleite war ähnlich strukturiert wie die erste. Meier war nicht nur wütend, er schämte sich auch über seine eigene Stümperhaftigkeit. Dass er es offensichtlich ein zweites Mal nicht geschafft hatte, ein in jeder Hinsicht sauberes Geschäft hin zu kriegen.
Ab sofort stand für Meier fest, dass er künftig niemals mehr Patentrechte abtreten würde. Das Motto für die Zukunft war klar, nämlich nur noch selber zu produzieren und selber zu vermarkten, unabhängig vom Stand der Sonne, des Mondes und der Sterne.
C
Als um 1960 die Antibabypille auf den Markt kam, argwöhnten einschlägige Fachkreise – Anthropologen, Politologen, Ökonomen, Zukunftsforscher und nicht zuletzt der Vatikan, dass diese Entdeckung möglicherweise eine fundamentale Kulturrevolution heraufbeschwören könnte. Das Volk von der Strasse sah in der Pille vor allem eine gute und simple Art der Empfängnisverhütung. Insbesondere Frauen sahen sich von Zwängen befreit. Nun waren es vor allem sie, welche die Anzahl der Kinder bestimmen konnten. Die Geburtenkontrolle bewirkte, dass die Familien kleiner wurden. Die Schulklassen in den Ländern der westlichen Hemisphäre bestanden nun nicht mehr aus dreissig und mehr Kindern, sondern nur noch aus zwanzig. Die Eltern und die Lehrer konnten sich den Kindern individueller widmen, wodurch der allgemeine Bildungsgrad stieg. Mädchen erlernten nicht anders als Buben Berufe oder studierten. Frauen emanzipierten sich zunehmend und befreiten sich von der finanziellen Abhängigkeit ihrer männlichen Partner. Dies insbesondere in den Industrieländern.
Als junger Wissenschaftler verkehrte Meier oft mit Ärzten jeglicher Gattung. Viele Frauenärzte wiesen auf die relative Unzuverlässigkeit dieser Art Schwangerschaftsverhütung hin. Dabei wurde nicht die Zuverlässigkeit des Medikaments in Frage gestellt, sondern im Gegenteil, es ging um die nicht über alle Zweifel erhabene Verlässlichkeit des Menschen. Wurde einmal an einem Tag die notwendige Pilleneinnahme durch die Frau unterlassen, konnte das Malheur schon passiert sein, nämlich eine unerwünschte Schwangerschaft.
Dr. Paul Meier hatte eine Vision, nämlich die nach wie vor viel zu hohe Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen – statistisch jährlich etwa 50 Abtreibungen auf 1000 gebärfähige Frauen – drastisch zu reduzieren, oder besser gänzlich zu eliminieren. Eine Abtreibung bedeutete für Meier ein Horror, ein Übel, das es zu eliminieren gelte und zwar von der Wurzel her. Aus diesem Grund entschloss sich der Professor auf dem Gebiet der sogenannten Reproduktionsmedizin zu forschen und bei entsprechendem Forschungserfolg geschäftsmässig einzusteigen. Dabei betrachtete Dr. Meier nicht nur die künstliche Befruchtung als Gebiet dieser Medizin, sondern eben auch periphere Segmente wie die medizinisch arrangierte Empfängnisverhütung. Der Professor hatte die Idee einer kontrollierten Langzeitmedikation und zwar sowohl für Frauen, als auch für Männer. Bei einer entsprechenden Anwendung sollte eine Empfängnis für die vom Menschen eigen bestimmte Zeit zuverlässig ausgeschlossen sein. Ein gleichzeitig angepeiltes Ziel war auch Unterbindungen (bei beiden Geschlechtern) den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn die sind ja in der Regel endgültig, was in gewissen Situationen Menschen, Paare oder Familien unglücklich machen kann.
Paul Meier und sein Team entwickelte ein Medikament für Frauen mit exakt dieser Wirkung. Die Implantierung einer kleinen Kapsel genügte, um eine behandelte Frau so lange von einer Empfängnis auszuschliessen, wie sich das Implantat im Körper befand und wirkte. Eine Hormonsubstanz in kleinsten Dosen an den weiblichen Körper abgegeben, verhinderte den sonst üblichen periodischen Eisprung. Bei einem späteren Kinderwunsch der Frau konnte ein Arzt die implantierte Kapsel dem Körper der Frau wieder entnehmen und der normale hormonelle Zyklus setzte wieder ein. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft war danach insofern erhöht, als dass sich der zuvor geschonte Organismus in kräftigem, regeneriertem Zustand befand.
Dr. Meier beantragte weltweiten Patentschutz seines Produktes, sah aber andererseits gleichzeitig zumindest einstweilen davon ab (entgegen von ursprünglich gehegten Plänen), auch ein entsprechendes Medikament für den Mann zu entwickeln.
Die neueste Kreation aus Meiers Entwicklungslabor schlug hohe Wellen und dies so zu sagen auf Vorschuss. Denn die praktische Markteinführung lag noch in ungewisser Ferne. Zwar waren die klinischen Tests durch und dies erfolgreich. Den Antrag für die offizielle Zulassung bei der zuständigen Gesundheitsbehörde hatte man schon vor Wochen deponiert. Aber ein Zeithorizont, wann die Erteilung einer Lizenz vom Bundesamt für Gesundheit zu erwarten sei, der stand einstweilen noch in den Sternen. Andererseits war man in Meiers Pharma Firma zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht bereit für die Produktion. Die neue automatische Linie zum Produzieren der Implantate für die Langzeit-Empfängnisverhütung harrte schon einige Zeit der Montage und Inbetriebnahme. Dazu musste im Werk aber erst entsprechender Platz geschaffen werden. Vorerst hatten die Produktion und Auslieferung anderer Produkte Vorrang, dies aufgrund von früher eingegangener Lieferverpflichtungen und firmeninternen Terminzwängen.
In der Tat befand sich Paul Meiers Unternehmen in einem stetigen Wachstumsprozess und hatte zwischenzeitlich eine beachtliche Grösse erreicht. Man war nun durchaus im Stande auch mittlere bis eher grössere Serien zu produzieren. Andererseits brauchte es keine hellseherischen Fähigkeiten, um erkennen zu können, dass es hier bei diesem Produkt, dem Implantat zur Langzeit-Empfängnisverhütung bei Frauen, um ein Multimillionen-Ding ging und hier sprach man nun mal von ganz anderen Dimensionen.
Wie sollte Meier es angehen, den gordischen Knoten zu sprengen? Beim Professor hatten sich die unguten Erfahrungen mit Lizenz-Geschäften in der Vergangenheit intensiv in die Hirnwindungen eingebrannt und tiefe Narben hinterlassen. Die seinerzeit eigen gesetzte Devise, künftig nur noch selber zu produzieren und selber zu vermarkten, wollte man wenn immer möglich durchziehen, eben auch und gerade bei diesem Produkt. Doch wie konsequent sollte man dieser einst sich selbst auferlegten Vorgabe folgen? Irgendwann würde sich mit Bestimmtheit die Frage stellen, ob es nicht doch sinnvoll wäre, zusätzlich zur eigenen Produktion, das Patent auch durch Dritte nutzen zu lassen, um die zu erwartende grosse weltweite Nachfrage überhaupt befriedigen zu können. Sollte sich Meier erneut selber untreu werden?
Paul Meier reiste von einem Kongress zum anderen. Ärztevereinigungen, Regierungen und insbesondere Frauenorganisationen buhlten um ihn, um direkt aus berufenem Munde orientiert zu sein. Dem Professor waren diese Einladungen willkommen und er nützte jede Gelegenheit, um für sein Produkt die Werbetrommel zu rühren.
Meiers ehemalige Universität in Genf verlieh ihm einen Ehrendoktor. Man munkelte, einflussreiche Kreise hätten Paul Meier für den Nobelpreis portiert. Auch die Schweizer Regierung war bestrebt ihre Anerkennung Kund zu tun. Meiers Erfolge in der Forschung, wie auch die unternehmerische Leistung mit der Schaffung vieler Arbeitsplätze sollten gewürdigt werden. Da die Eidgenossenschaft keine Orden vergibt, pushte sie den Wirtschaftsverband dies zu tun. In der Laudatio erwähnte der Sprecher insbesondere die internationale Ausrichtung des Unternehmens und strich den hohen Exportanteil von Dr. Meiers Pharma Firma positiv heraus. Der Professor war allerdings misstrauisch. Er glaubte in dieser Auszeichnung eher – und dies mit etwas saurem Aufstossen - ein Leckerli für den Eigenwilligen, den Unbequemen, als den er offensichtlich in der Schweizer Politik wahrgenommen wurde. Meier vermutete Hintergedanken, vielleicht oder sogar wahrscheinlich ein Versuch, ihn sanft auf die Linie der Landesregierung zu biegen. Dabei hatte Paul Meier grundsätzlich gar nichts gegen die Landesregierung, schlug sich höchstens ab und zu mit gewissen Ämtern herum, kämpfte hin und wieder mit einzelnen Politikern, Funktionären und Beamten, die sich manchmal gar allzu bürokratisch – aus Meiers Sicht entsetzlich dumm - ihm in den Weg zu stellen versuchten.
Nicht ganz unerwartet folgte kurze Zeit später diese Begebenheit: Der Schweizer Wirtschaftsminister nahm Paul Meier ins Gebet. Die Helvetische Regierung versuchte dem Professor klar zu machen, dass die Produktion und Vermarktung dieses neuen Medikamentes nur über die landeseigene Pharmaindustrie erfolgen dürfe. Zu viel wirtschaftliches Potenzial, zu viele Arbeitsplätze seien davon abhängig. Doch die entsprechenden Bemühungen der Regierung entfachten keinerlei Wind. Denn Meier hatte überhaupt kein anderes Ziel im Kopf, als eben genau dieses. Er befand allerdings – mal grundsätzlich betrachtet, dass sich diesbezüglich überhaupt niemand einzumischen habe, weil Entscheide dieser Art allein seine Sache sei, Sache seiner Firma. Wie auch immer, man erkannte auf beiden Seiten kein Konfliktpotential, man zog am selben Strick, man hatte in diesem Fall das Heu auf der gleichen Bühne.
Dass die Dr. med. Paul Meier Pharma AG die Produktion des weltweiten Bedarfes der Implantate zur Empfängnis-Verhütung alleine bewältigen könnte, davon schien offensichtlich überhaupt niemand auszugehen: Denn darüber war man sich einig: Die Produktionskapazität war zu klein, der Ausstoss zu bescheiden! Diesbezüglich waren sich die Experten auf der ganzen Linie einig, obwohl keiner von ihnen den Betrieb je von innen gesehen hatte. Um bei der Wahrheit zu bleiben: Selbst Meier hatte im Innersten seiner Seele seine Zweifel. Aber selbstverständlich äusserte er sich diesbezüglich niemals öffentlich dazu. Als gläubiger Mensch krallte er sich an die Möglichkeit eines Wunders, das sich vielleicht irgendwann auf geheimnisvolle Weise ergeben würde.
Noch bevor der Professor mit seinen Startverhandlungen mit jenen Kreisen, die ihm vorschwebten, loslegen konnte, kam es zu einigen anderen Treffen, die allerdings nicht von Meier gesucht worden waren.
Als erstes meldete sich der Apostolische Nuntius in der Schweiz. Als Abgesandter des Heiligen Stuhls machte der Kardinal den Professor auf die verheerenden Folgen dieses neuen Produktes aufmerksam: Der absolute moralische Zerfall wäre damit programmiert. Nicht auszudenken, wenn sich künftig jede Frau folgenlos der sexuellen Freizügigkeit hingeben könnte und dann gewiss wohl auch würde. Sodom und Gomorra eben. Meier bedankte sich für die nach seiner Aussage aufschlussreichen Worte des Nuntius.
Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Schweiz lud Meier zu einem Vieraugengespräch in seine Residenz nach Bern ein. „Nennen Sie mich John, ich darf Sie wohl Paul nennen. Vorerst meine Hochachtung, Sir, die ich einerseits Ihnen als Persönlichkeit gegenüber hege, aber auch für Ihre professionellen Leistungen, Ihre Entdeckungen in der Welt der Medizin, die man wohl epochal nennen darf. Ich spreche hiermit nicht nur als offizieller Repräsentant der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ihnen. Ich spreche insbesondere auch als Republikaner, als Texaner und als bibeltreuer Christ zu Ihnen. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass dieses medizinische Empfängnisverhütungs-Konzept verantwortungsvoll eingesetzt wird. Denn uns muss bewusst sein: Wenn die Masse dieses Produkt zur freien Benützung bekommt, werden wir – insbesondere die Menschheit der westlichen Hemisphäre, das Abendland – dereinst aussterben! Weil kaum jemand mehr Kinder haben wird! Im Prinzip ist dies ein Produkt gegen die Natur. Und unsere Widersacher, die Moslems, die Chinesen, die Kommunisten, die Kubaner, die Schwarzen, die Gelben und alle anderen, die vom Teufel besessen sind oder zumindest das Potential dazu in sich tragen, werden Kinder in Massen produzieren. Dies nur schon aus dem einfachen Grund, weil sie diese Implantate wohl nicht finanzieren könnten. Oder ihre Regierungen, ihre weltlichen und klerikalen Führer werden das Produkt verbieten, verunmöglichen, verteufeln, wegschliessen. Deshalb, mein Freund, ein guter Rat an Sie: Übergeben Sie das Patent uns zu treuen Händen, geben Sie es in unsere Verantwortlichkeit, in die Obhut der Vereinigten Staaten von Amerika! Wir werden damit - seiner Wichtigkeit entsprechend - verantwortungsvoll umgehen. Und überdies: Es wird Ihr materieller Schaden nicht sein, dies garantier ich Ihnen, lieber Doktor!“
Paul Meier antwortete dem Botschafter höflich, dass er die Message seiner Exzellenz verstanden habe und definitiv in seine Überlegungen mit einbeziehen werde.
Meier wurde vom Deutschen Bundeskanzler angerufen. Die Regierungs-Chefs von Australien und von Kanada, Japans und Südkoreas, aus Brasilien und Argentinien, aus Indien und Pakistan, Südafrika und Malaysia machten unerwartete und ausserplanmässige, kurzfristig arrangierte Aufwartungen in der Schweiz.
Nicht nur die Schweizer Bundesregierung wunderte sich über die aktuelle Popularität der Eidgenossenschaft. Dass alle diese wichtigen Delegationen nicht nur die Regierungsrepräsentanten Helvetiens begrüssten, sondern auch und insbesondere Professor Paul Meier persönlich trafen, konstatierte man im Bundeshaus mit Aufmerksamkeit, mit etwas Stolz zwar, ja, aber auch mit einer gewissen Sorge und absolut nicht nur am Rande. Man war sich einig: Da schien sich wirklich etwas Ausserordentliches zu tun, einiges im Busch zu befinden.
Das Boulevardblatt BLICK trötete in gewohnt platter Weise mit dümmlich geschwellter Brust: Wir Schweizer sind wieder wer in der Welt! Dabei wurden im Zeitungsartikel typischerweise nur die übermässig grossen diplomatischen Aktivitäten erwähnt, ohne eventuelle mögliche Gründe zu hinterfragen, die Hintergründe recherchiert zu haben. Einen Hinweis auf einen diesbezüglichen Zusammenhang mit Professor Meiers Errungenschaften im medizinischen Bereich gab es nicht.
Meier scherte sich wenig darum. Noch wurde er in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Er nahm es mit Gelassenheit hin. Seine Zeit würde noch kommen, dessen war er sich sicher.
Andererseits riskierte der Schweizer Wirtschaftsminister jetzt schon jeden zweiten Tag ein Telefon und rieb dabei Paul Meier den verlängerten Drohfinger unter die Nase, erinnerte ihn an seine moralische Verpflichtung als Bürger dieses Landes.
Australier, Kanadier, Japaner und Südkoreaner wiesen gegenüber Meier nachdrücklich darauf hin, dass hinter ihnen eine sehr powervolle Pharmaindustrie stünde, die eine entsprechende Produktion auf Lizenzbasis problemlos bewältigen könne. Die Deutschen mussten erst gar nicht betonen, dass sie Weltmeister aller Klassen in allen Disziplinen seien. Und dies entsprach wohl nichts anderem als der nackten Wahrheit, die kaum jemand in Frage stellen wollte. Denn Deutschland hatte sich zwischenzeitlich zum Weltmarkt-Führer empor geschwungen. Und dies war keine vollmundige Behauptung der Bildzeitung, des Spiegels, der Frankfurter Allgemeinen oder gar der bundesdeutschen Regierung selber, sondern es war die nackte Wahrheit, durch neutrale Institutionen ermittelt und mit Statistiken belegt. Diese Statistiken bestätigten jene Erfahrungen, mit welchen die Wirtschaftskreise weltweit tagtäglich konfrontiert wurden: Die Auferstehung der Nation aus der Asche des zweiten Weltkriegs war endgültig vollzogen! Und dies durfte man neidlos als eine gewaltige Leistung bezeichnen und nötigte Respekt ab. Nun ja, zwischenzeitlich wurde diese wahrlich geballte Kraft, diese Macht schon wieder gefürchtet und dies durchaus zu recht. Auf die Regierungen und Unternehmungen ausserhalb Deutschlands konnte diese Situation schon wieder ziemlich bedrohlich wirken. Und es gab nicht wenige in Europa und ausserhalb, die sich diese noch immer im Aufschwung begriffene Dominanz der Deutschen schon wieder hinter die sieben Berge zum Kuckuck wünschten.
Paul Meier liess es gewähren, dass er mit Regierungsjets aus Grossbritannien, Frankreich und Russland in die entsprechenden Länder geflogen wurde und dies mit einem für ihn typisch eigenwilligen Argument: Alle diese persönlichen Kontakte könnten künftig mal von Vorteil sein. Bei den entsprechenden Meetings durfte der Professor in würdevoller Umgebung mit den höchsten Spitzen der jeweiligen Landesregierung und den entsprechenden Politik- und Wirtschaftsrepräsentanten Tee, Kaffee, Kuchen und noch anderes essen. Meiers Gesprächspartner berichteten durchwegs in glorios gefärbter Darstellung die Kompetenz ihrer Pharmaindustrie, die für eine Kooperation bereit stehe, von sehr grossem Verantwortungsbewusstsein und unverbrüchlicher Freundschaft zur Schweiz und insbesondere zu Professor Meier und seinem sehr ehrenwerten Unternehmen. Meier bedanke sich in jedem Fall äusserst höflich und versprach zu gegebener Zeit eine Entscheidung zu treffen und Bescheid zu geben.
In Wahrheit vermochte nichts und niemand mehr Meiers schlussendlich gefassten Entschluss zu stürzen. Denn Meier glaubte nun den Überblick zu haben. Er war bereit, seine finale Verhandlung zu starten und er war entschlossen, diese erfolgreich durchzuziehen und abzuschliessen. In Meiers Focus standen die grossen Pharmaunternehmen in Basel. Da bewegte man sich zumindest mentalitätsmässig auf dem gleichen Level. Alles war berechenbarer als bei Ausländern, wo Meier in der Vergangenheit hatte Lehrgeld bezahlen müssen.
Meier ging akribisch vor. Diesmal hatte er einen bekannten Wirtschaftsjuristen an seiner Seite, der zwar unverschämt teuer war, aber wohl auch lohnend, davon war der Professor überzeugt. Ziel des Vertrages war es, das Nutzungsrecht des Patentes gemäss Patentanmeldung durch den Patentnehmer bis zum Ablauf der Patentgültigkeit zu fixieren. Das Agreement umfasste das weltweit gültige Herstellungs- und Vermarktungsrecht des von der Meierschen Pharma entwickelten Systems zur Langzeit-Schwangerschaftsverhütung bei Frauen mittels Implantaten durch die besagte Basler Pharmafirma. Ausgenommen von dieser Vereinbarung war die eigene Firma, die Dr. med. Paul Meier Pharma AG selber, die Entwicklerin und Patentanmelderin. Dieser war es ausdrücklich ebenfalls erlaubt, sowohl zu produzieren, wie auch zu verkaufen und zwar an wen immer. Doch vor dieser Konkurrenz fürchtete sich der Basler Pharmariese nicht. Man betrachtete Meiers Firma als Zwerg unter Giganten, so zu sagen als Quantité Négliable.
Dieser Vertrag mit der Pharmafirma aus Basel machte Meier um etwas mehr als 800 Millionen Franken reicher und damit in jeder Hinsicht potent. Das Geld erfreute nicht nur Paul Meier, sondern beglückte auch seine Einwohnergemeinde im Appenzellerland. Denn der Steuersegen bewirkte einen gewaltigen Boom in der Wohngemeinde des Professors. Weil Meiers Steuerzahlungen eine aussergewöhnlich markante Reduktion des Steuerfusses in der Gemeinde bewirkte, siedelten sich viele andere reiche Menschen und auch Unternehmungen im Ort an. Die Land- und Immobilienpreise schossen in astronomische Höhen. Eine typische Wechselwirkung eben, die – von aussen betrachtet – als ungesund angesehen werden konnte, aber eben eine übliche Markterscheinung war und entsprechend hinzunehmen war. Insbesondere umliegende Gemeinden gaben sich gelassen, denn auch sie profitierten von dieser heissen Situation. Familien und Menschen, die in Firmen der reichen Gemeinde arbeiteten, liessen sich hier im Umland nieder und pendelten. Denn dort waren die Wohnungen einerseits noch vorhanden und die Landpreise andererseits noch bezahlbar.
Die Geschichte des Implantats zur Langzeit Empfängnisverhütung entwickelte sich allerdings zumindest vorerst und einstweilen noch nicht zum Happyend. Dies weil ausnahmslos alle Gesundheitsbehörden und medizinischen Zulassungsinstitutionen der Länder diesseits und jenseits der Ozeane eine Zertifizierung ablehnten, ja geradezu manisch verhinderten. Insbesondere und federführend machte sich die Schweizerische Eidgenossenschaft als Schlüsselnation für eine einstweilige Ablehnung stark. Und man weiss: Ohne Zulassung der Gesundheitsbehörde kommt kein Medikament auf den Markt. Das Produkt sei vorerst noch zu wenig klinisch getestet, um eine Genehmigung erlangen zu können, hiess es in der offiziellen Begründung.
Die Firmenangehörigen waren deprimiert und der Professor kochte. Für Meier roch diese Argumentation nach einem Komplott und zwar gegen den Wind. Denn gemäss Meiers Überzeugung hatte seine Firma alle Anforderungen vollumfänglich sauber und professionell erfüllt. Und die entsprechende Eingabe lag inzwischen viele Monde zurück. Dabei tickte die Zeitbombe der Patentgültigkeit unerbittlich Monat um Monat runter und runter.
Meier ärgerte sich im Besonderen auch über die Partnerfirma aus Basel, der Lizenznehmerin, die sich dieses unwürdige Theater anscheinend tatenlos gefallen liess. Der Professor fragte sich, weshalb der grosse Bruder nicht mehr Dampf entwickelte, um dem Projekt den Durchbruch zu bescheren. Und irgendwann kam die Wahrheit an den Tag – hinterrücks und auf verschwörerische Art und Weise: Trotz grösster Bemühungen war es den Baslern bis dato nicht gelungen, das Implantat zur Produktionsreife zu entwickeln. Und was nützte eine Zulassung, wenn man technisch (noch) nicht in der Lage war, zügig und problemlos zu produzieren und liefern?
Es ging also offensichtlich bei diesem Verzögerungsspiel nur darum, Zeit zu gewinnen. Die Basler Pharmafirma hatte den Fuss in der Türe und Bern machte brav den Buckel. Der einzige Grund der Hinhaltetaktik war: Man wollte dem kleinen Lizenzgeber keinen Vorsprung zugestehen. Denn selbst ein Zwerg konnte ja gefährlich werden, würde man ihn gewähren lassen.
Bei der Dr. med. Paul Meier Pharma AG war der Ärger gross, insbesondere bei der Besitzerfamilie. Andererseits lächelten die Mitarbeiter, der ganze Staff unverhohlen hämisch über diese geballte Ladung an Unvermögen des mächtigen helvetischen Bruders aus der Nordschweiz. Die Meier-Leute waren sich einig, ja absolut sicher: Sobald die Zulassung vorliegen wird, werden wir in der Lage sein, unverzüglich mit der Produktion los zu legen. Denn wir haben das Rüstzeug und sind produktionstechnisch bereit für den Start. Und zwar mit Volldampf! Wir schaffen das, wir können das!
2
Die Zeit war reif geworden für jenes Produkt, das ewige Jugend verhiess – zwei Dezennien nach seiner Entdeckung durch Paul Meier und dem Versenken in der hauseigenen Schublade, fernab jeglicher Publizität. „Das Jahr meines 70. Geburtstags - dies ist ein gutes Zeitfenster für diesen grossen Schritt, den wir wagen wollen“, befand Meier mit einem glücklichen, abgeklärten Lächeln im Gesicht. „Ich stelle mich samt meinen Forschungsergebnissen jedem seriösen Untersuchungsgremium bedingungslos zur Verfügung. Meine langjährige Assistentin Jutta tut das auch, ebenso die zwei Handvoll Alliierten, welche die Implantat-Kapseln mit dem Zellzerfall-Stopper gleichfalls seit Jahren in sich tragen!“ Und der Professor fügte mit einem Augenzwinkern an: „Dabei trugen diese Probanden die Versuche nicht nur aus Freundschaft zu mir mit, sondern durchaus auch aus Eigennutz, weil sie die positive Wirkung am eigenen Leib erfuhren und noch immer erfahren. Und dies ist keine Fiktion, dies ist nicht Glaube, kein Hokuspokus, keinesfalls ein obskurer Psycho-Trick, sondern reale Wirklichkeit, die erwiesen ist!“
Die Universitätsklinik in Leuven (Belgien) führte die entsprechenden neutralen Prüfungen und Checks durch und die Experten des Ärzteteams stellen mit grosser Verwunderung fest, dass der Zustand der Zellen der Probanden durchwegs einen Status aufwiesen, den man bei Personen einer Generation jünger erwarten würde. Verblüffend war aber insbesondere, wie sich diese Menschen darstellten, Frauen und Männer, welche sich dieser Behandlung seit rund zwei Jahrzehnten unterzogen hatten:
Sie strahlten eine schwer zu fassende, eine fast unglaubliche Jugendlichkeit aus. Ihre positive physische Präsenz war für jedermann, selbst für jeden Laien leicht erkennbar. Die Menschen passten so gar nicht ins Durchschnittsschema ihres entsprechenden Alters. Dies war auch in einem gewissen Sinn verwirrend, um nicht zu sagen verstörend für die Mediziner, welche die Prüfung durchführten. Denn da waren nicht nur die optischen Eindrücke zu konstatieren, sondern messbare Resultate brachten handfeste Beweise auf den Tisch.
Damit war die Funktionalität des Medikaments zum Stoppen des Zerfalls menschlicher Zellen bewiesen, nachgewiesen und es stand nichts mehr im Wege, die offizielle Zertifizierung zu beantragen.
Professor Meier meldete das Medikament weltweit zum Patent an.
Nicht nur in medizinischen Fachmagazinen wurden tiefschürfende Artikel verfasst, sondern auch in der gesamten Weltpresse füllte die Sensation Seiten - nicht selten medienwirksam auf der Front Page: Ein Medikament mit dem Versprechen, den natürlichen Alterungsprozess der Zellen stoppen zu können! Man stelle sich so etwas vor! Kein Märchen. Keine Fantasie. Und gar viele Journalisten versahen ihren Text mit einem Bild, das uns allen wohl bekannt ist: DER JUNGBRUNNEN, jener Zeichnung von Lucas Cranach dem Älteren aus dem Jahre 1546. Man erinnert sich: Auf der linken Seite werden Greise angekarrt, alte Männer und Frauen. Sie steigen ins Bad und tauchen auf der anderen Seite nach einer wunderbaren Metamorphose in prächtig jugendlicher Gestalt wieder aus dem Wasser. So, als würden wunderschöne Schmetterlinge aus ihren Cocons entspringen. Doch genau dieses Bild entsprach einem völlig falschen Synonym: Meiers Medikament versprach keine Rückkehr zur einstigen, zur vergangenen Jugendlichkeit, sondern nur eine weitgehende Konservierung des Status der menschlichen Zellen zum Zeitpunkt des Starts der Therapie.
Der Professor dachte nicht ohne verstohlenes Schmunzeln an die Zeit der Entdeckung vor zwanzig Jahren zurück, als der mediale Widerhall zu Meiers Enttäuschung gleich Null war. Der jetzt entfachte Presserummel war nun wirklich genau das Gegenteil, nämlich gigantisch, ja beängstigend. Unzählige Journalisten wollten Interviews. Paul Meiers Vorträge fanden bei höchstem Beachtungsgrad vor grossem Publikum statt. An Kongressen wurde der 70-jährige Meier als Wunderknabe Spätlese gefeiert. Dabei waren genau diese Schlagworte, das euphorische Hervorheben von ZU WELCHEN HÖCHSTLEISTUNGEN EIN MENSCH IN FORTGE-SCHRITTENEM ALTER NOCH FÄHIG SEI grundfalsch. Denn diese Forschung und die Entdeckung des Schlüssels, der jenen Code knackte, welcher das Altern menschlicher Zellen austrickst, lagen ja Jahrzehnte zurück! Und ausserdem war es schon damals eine Teamleistung, also keineswegs exklusiv und allein auf Meiers eigenem Mist gewachsen. Dass eine so lange Zeit dazwischen lag, war weder Mutwilligkeit noch Trödelei, sondern der nicht so tolle, aber absolut notwendige Teil des Projektes: Diese Zeit musste notwendigerweise aufgewendet werden, um ein wirklich zweifelfreies, durchschlagendes Resultat erbringen zu können. Nämlich der Nachweis der Wirksamkeit, ein Beweis, dass die Erwartung an das Medikament auch über eine längere Zeitdauer entsprach.
Die grossen Pharmakonzerne klopften an die Tür und wünschten betreffend einer Lizenzvergabe in Verhandlung zu treten – einmal mehr war man bei der Dr. med. Paul Meier Pharma AG geneigt zu sagen. „Genau wie einst und je“, sagte Meier zu seinen