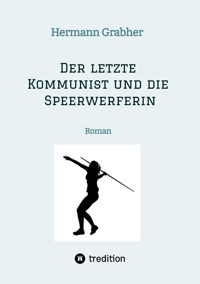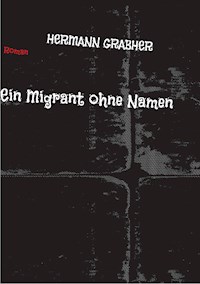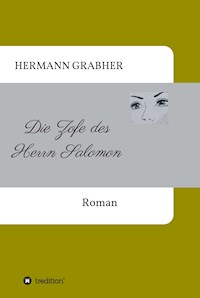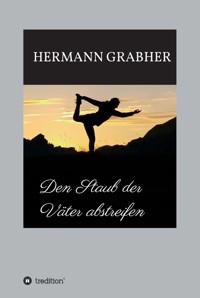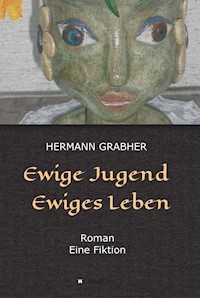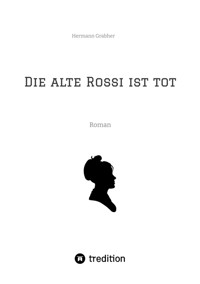
7,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die grösste Stadt des St. Galler Rheintals, die aber auch nur ein Städtchen ist, beklagt den Tod einer geschätzten Mitbürgerin: Irina Rossi erreichte das hundertste Lebensjahr gerade nicht ganz. Zur Beerdigung und dem nachfolgenden Erbgang sind ihre sechs direkten Nachkommen aus der halben Welt angereist. Die Erbschaft ist wesentlich grösser als erwartet und diese erweckt Begehrlichkeiten, weniger bei der einzigen Tochter als bei den fünf Söhnen. Doch das von Mutter Irina abgefasste Testament beinhaltet Fussangeln der besonderen Art: Die Patriarchin testet zum Abschied ihres irdischen Daseins, ob die Erziehung, die sie seinerzeit ihren Kindern angedeihen liess, Früchte getragen hat. Dem entsprechend soll die Aufteilung des Erbes erfolgen. Diese Ausgangslage führt zu einem spannenden Challenge unter den Geschwistern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
www.tredition.de
HERMANN GRABHER
Die alte Rossi ist tot
Roman
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1 Ein Blick zurück in die Vergangenheit dieser Geschichte
2 Die alte Rossi ist tot
3 Aufregung im Schlösschen
Frau Irina Rossi
4 Mutter Irina wird in Ehren gehalten
5 Was nach der Abdankung folgt
6 Ein herausforderndes Testament
7 Psychospiele
8 Der Lebenslauf von Robert R. Rossi
9 Der Lebenslauf von Irina Rossi
10 Lebensläufe der Nachkommen des Ehepaars Rossi
Aline
Bert
Carlo
Dany
Eugen
Benjamin
11 Die Zäsur
12 Die finale Entscheidung
Die alte Rossi ist tot
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1 Ein Blick zurück in die Vergangenheit dieser Geschichte
12 Die finale Entscheidung
Die alte Rossi ist tot
Cover
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
© Copyright by Hermann Grabher
Buchsatz von tredition, erstellt mit tradition Designer
ISBN Softcover
978-3-384-01244-9
ISBN Hardcover
978-3-384-01246-8
ISBN E-Book
978-3-384-01248-3
Gross-Schrift
978-3-384-01247-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition Gmbh, Halenreie 40-44, D-22395 Hamburg
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jeder Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung «Impressumservice», Halenreie 40-44, D-22359 Hamburg/Deutschland.
1 Ein Blick zurück in die Vergangenheit dieser Geschichte
Diese Geschichte beschreibt die Entstehung und die weitere Entwicklung einer Familie Namens Rossi.
Werfen wir zu Beginn einen Blick auf ein Geschehen, welches tagtäglich weltweit vonstattengeht und eben schon zu jeder Zeit geschah, in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, wie auch in den Jahrhunderten zuvor, nämlich Migration. Während innoffizielle Quellen von 300 Millionen Migranten sprechen, berichtet das UNHCR von 110 Millionen Menschen auf der Flucht, die aktuell - gegen Ende des ersten Viertels des 21. Jahrhunderts - ihre ursprüngliche Heimat verlassen haben, die meisten von ihnen nicht freiwillig, sondern aufgrund von Umständen, die sie selbst nicht zu verantworten hatten. Es seien mehr denn je, sagt die Institution. Dies ist eine Behauptung, die allerdings in Frage gestellt werden darf. Insbesondere sollte diese Zahl auch in Relation zur gesamten Weltbevölkerung betrachtet werden. Denn niemals in der Vergangenheit lebten auch nur annähernd so viele Menschen auf unserem Planeten wie aktuell. Wir sind gegenwärtig zirka 8 Milliarden. Um die heutige Flüchtlingssituation in eine korrekte Proportion zu stellen: Zirka 0.75 Prozent alle Menschen auf unserer Erde haben ihre einstige Heimat verlassen und sind auf der Suche nach einer neuen. Die Anzahl der Migranten in früheren Zeiten – vor dem Zeitalter der Digitalisierung – konnte niemals so genau erfasst werden, wie dies gegenwärtig möglich ist. Deshalb sind Vergleiche problematisch und in jedem Fall mit Vorsicht zu betrachten.
Jegliche Migration ist die Folge einer strukturellen Fehlentwicklung. Migration wird hervorgerufen durch Krieg, durch ideologische, ethnische oder religiöse Konflikte, durch Missernten, materielle Not, Naturkatastrophen, wobei aktuell und wohl vor allem künftig der Klimawandel eine dominierende Rolle spielen wird. Migration kann aber auch ausgelöst werden durch Begehrlichkeiten auf Seiten der Nichthabenden. In Bildern jeglicher Art wird vor allem jungen Menschen in armen Ländern vorgegaukelt, dass in anderen Teilen der Erde jedermann und jedefrau eine imposante Villa mit Swimmingpool besitze, ein schnittiges Auto fahre und dafür kaum grösserer Einsatz von Geist und Händewerk notwendig sei. Wenn im eigenen Land jegliche positive Perspektive fehlt, ist der Entschluss für eine Veränderung schnell gefasst.
Wie wurde Migration in früheren Zeiten wahrgenommen? Bevor die Menschen sesshaft wurden, waren sie Nomaden - Jäger und Sammler. Zirka Elftausend vor Christus begannen die ersten Menschen mit einer sesshaften Lebensform. Sie richteten sich in Gruppen an einem ihnen geeignet erscheinenden Platz ein, um zu bleiben. Sie ernteten die Früchte von den Pflanzen, die sie säten. Sie züchteten Tiere zu ihrem Nutzen. Wahrscheinlich liegen die Gene des Herumziehens noch immer in unserem Blut. Dabei sind nicht unbedingt die Fahrenden gemeint, sondern eben die meisten von uns, die wir einen Hang zum Verreisen haben und sei es nur zur Ferienzeit. Doch Nebenschauplätze dieser Art sind hier keinesfalls gemeint, denn Migration ist etwas völlig anderes.
Wenn wir uns zu Gemüte führen, dass die Epoche vom vierten bis ins sechste Jahrhundert nach Christus in Europa als die Zeit der Völkerwandung bezeichnet wird, kann man sich vorstellen, welche Umwälzungen von gewaltiger Dimension damals geschahen. Doch Tatsache ist, dass es in jedem Jahrhundert wandernde Bevölkerungsgruppen in grosser Zahl gab.
Eingegangen in die Historie ist die Beschreibung des jüdischen Volkes, weil wir diese Geschichten im Alten Testaments der Bibel lesen können. Gott gab einst – zirka zweitausend Jahre vor Christus - Abraham den Auftrag, mit seinem Stamm Mesopotamien zu verlassen und dieser führte ihn gegen Süden nach Palästina. Weil Gott diesen Auftrag erteilt hatte, bezeichneten sie sich selbst als Auserwähltes Volk. Doch auch als Auserwähltes Volk waren sie nicht gefeit vor inneren und äusseren Anfechtungen jeglicher Art. Die Eigenständigkeit wie die Unterjochung durch fremde Herrscher wechselten sich im Verlauf der Geschichte immer wieder ab. Mit Salomon und David herrschten gloriose Könige, die auch ihr Volk gross erscheinen liessen. Zur Zeit von Jesus Christus andererseits waren die Juden unterdrückt, standen unter dem Protektorat der Römer.
Eingegangen in unser Gedächtnis – weil in der Bibel anschaulich dokumentiert und in Monumentalfilmen dargestellt - sind auch die Exodusse des Volkes der Israeliten, einerseits in die Verbannung nach Babylon, andererseits nach Ägypten. Wobei die Rückführung des Volkes durch Moses aus der Sklaverei des Pharaos zurück ins gelobte Land, wo Milch und Honig versprochen wurde, sich aus heutiger Sicht spektakulär anhört, was es in Wirklichkeit aber mit Sicherheit nicht war. Doch es gab nicht nur die in der Bibel beschriebenen Vertreibungen nach Babylon und Ägypten, sondern später noch zahlreiche andere. Tatsache ist, dass schliesslich weitgehend alle Juden in alle Welt verstreut wurden, insbesondere nachdem der Tempel in Jerusalem endgültig zerstört worden war. So existierte das jüdische Volk in der Diaspora an unterschiedlichen Orten. Dort wo Juden wohnten, wurden sie nicht selten in ihren Rechten beschnitten, oft sogar verfolgt. Dass sie zwar ein Volk aber keine Nation mit eigenem Territorium waren, schmerzte. Die Tragik der Verfolgung gipfelte in der systematischen Vernichtung eines grossen Teils des jüdischen Volkes durch Nazi-Deutschland. Die Sehnsucht der Juden nach einer eigentlichen Heimat, und damit meinten sie nichts anderes als Palästina, bestand zu jeder Zeit. Nicht umsonst verabschieden sich die jüdischen Leute am Ende von Pessach traditionell mit dem Satz nächstes Jahr in Jerusalem. Dieser Satz wurde geprägt lange bevor Jerusalem Israels Hauptstadt wurde. Die Gründung eines eigenen Staates durch die Zionisten war somit nichts anderes als eine logische Folge der Ereignisse im Laufe der Geschichte, und dass dieses Ziel geografisch in Palästina sein würde, ebenso. Allerdings erfolgte dieser Schritt in die Eigenständigkeit gegen den Widerstand der Vereinten Nationen und insbesondere gegen die britische Mandatsmacht. Dabei setzten sich die Zionisten teilweise mit Gewalt durch, mit dem Erfolg, dass die Gründung des Staates Israel 1948 Tatsache wurde. Die bis dahin im Umgang ruhende Sprache Hebräisch wurde zur Landessprache erhoben, wodurch man sich eine Festigung der nationalen Einheit versprach. Aber noch immer ist die traditionelle Umgangssprache alter Juden das Jiddisch, eine Gattung von Althochdeutsch. Aktuell zählt Israel bald 10 Millionen Einwohner. Der jüdische Staat kann gut mit europäischen Nationen konkurrieren. Leidtragend waren und sind die Araber, welche nicht akzeptieren können, dass sich die Israeli darauf berufen, dass dies einst – bis zur Vertreibung - das Land ihrer Ahnen war. Es ist ein Konflikt, zu dem es wohl nie eine Lösung geben wird.
Ab dem Fünfzehnten Jahrhundert schlug die Stunde der Entdecker. Verwegene Seefahrer suchten nebst Ruhm und Ehre für sich, die Heimatnation und den Christlichen Glauben insbesondere Gold und Gewürze. In der Annahme, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel sei, versuchte Christoph Kolumbus Indien nicht in Richtung Osten zu erreichen, sondern über den atlantischen Ozean Richtung Westen. Gefunden hat er Amerika. Er nannte die Einheimischen fälschlicherweise Indianer. In den nachfolgenden Jahrhunderten kolonialisierten vor allem Engländer, Iren und Franzosen den nordamerikanischen Kontinent mit dem Resultat, dass von den heute 370 Millionen Menschen in den USA und Kanada nur 7 Millionen Indigene sind, somit zirka 2 Prozent. Über 80 Prozent haben eine weisse Hautfarbe. Die Schwarzen in den Vereinigten Staaten sind die Abkömmlinge der ehemaligen Sklaven aus Afrika. Mit zirka 13 Prozent Anteil bilden sie einen weitaus grösseren Bevölkerungsanteil als die Urbevölkerung, welche der Staat mehrheitlich in Reservate zurückgedrängt hat. Die Spanier und die Portugiesen eroberten Mittel- und Südamerika mit dem Resultat, dass in den Ländern dieses Kontinents die weisse Oberschicht bis heute das Sagen hat und man dort Spanisch und Portugiesisch spricht. Auch auf dem fünften Kontinent – Australien und Neuseeland – wurde die indigene Bevölkerung rücksichtslos von europäischen Kolonialisten an den Rand gedrängt.
Briten beherrschten Indien bis zur Unabhängigkeit (1947) und in Kanada schmückt der Kopf von Queen Elizabeth eine Mehrzahl von Briefmarken. Der Commonwealth hält noch immer die Schar ehemaliger britischer Kolonien zusammen, wobei der englische König oder die Königin theoretisch Staatsoberhaupt ist. Auch die Niederländer hatten rund um den Globus zahlreiche Kolonien, die sie später mehrheitlich wieder aufgeben mussten.
Doch noch heute gibt es traditionelle Verbindungen im Transportwesen, insbesondere der See- und Luftfahrt, im Bankensektor, im Gewürz-, Tee- und Tabakhandel, im Samenhandel, welche die einstige Blütezeit der Kolonialisierung überdauert haben. Die weisse Oberschicht in Südafrika sind mehrheitlich Nachfahren der Buren (1.5 Millionen von total 60 Millionen Einwohner, somit weniger als drei Prozent), die über lange Dekaden mit ihrem Apartheit System die Schwarzen mit eiserner Gewalt niederhielten. Die Sprache in Südafrika ist noch immer Afrikaans, eine Schwestersprache von Niederländisch. Allmählich setzt sich aber zunehmend Englisch als Umgangssprache durch.
Der ältesten Generation der aktuell lebenden Menschen sind die Flüchtlingsströme während des zweiten Weltkriegs noch präsent. Die Juden wurden aus Nazi-Deutschland vertrieben oder in Konzentrationslagern vernichtet. Andererseits wurden Deutsche, die sich teilweise schon vor Generationen in Osteuropa, beispielsweise in Ostpreussen, angesiedelt hatten, enteignet und vertrieben. Die Sowjets streckten in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges die Hand nach diesen Gebieten aus. Gleiches widerfuhr auch Schweizern. Ihre einstige Auswanderung aus ihrem helvetischen Heimatland und die Besiedlung in Ostpreussen erfolgte in gleicher Weise, zumeist viele Generationen zuvor, beginnend im 18. Jahrhundert. Weil die Pest damals vor über zweihundert Jahren tausende Menschen dahingerafft hatte, drohten in Europa ganze Landstriche zu veröden, so auch in Ostpreussen, was die Versorgungssicherheit des gesamten Landes gefährdete. Deshalb rief der Preussische König Ausländer auf, sich in seinem Reich anzusiedeln, insbesondere in der Landwirtschaft, der Milch- beziehungsweise Käse-Produktion. Auf diesem Gebiet kannten sich die Schweizer aus. Was lag näher für Menschen, die im Heimatland keine Perspektive sahen, als dort die Aussicht auf das Glück zu suchen, wo es angeboten wurde.
Zurück zur Familie Rossi. Ronaldo Rossi (geboren 1882) kommt 1912 infolge wirtschaftlicher Not in seiner Heimat aus Italien in die Schweiz. Er arbeitet als Sprengmeister im Tunnelbau beim Projekt Simplon II (1912-1921). Dort lernte er die Sizilianerin Angelina (geboren 1890) kennen, die in der Kantine tätig ist. Weil Angelina schwanger wird, heiraten Ronaldo und Angelina. 1913 kommt Sohn Roberto zur Welt. Das Kind wird in seinen ersten Jahren von Angelinas Mutter betreut, seine Muttersprache ist italienisch.
Nach der Fertigstellung des Simplontunnels lässt sich Ronaldo Rossi von der Rheinbauleitung anstellen. In Diepoldsau wird an der Rheinbegradigung gearbeitet. Das Ehepaar Rossi zieht 1921 ins St. Galler Rheintal, wobei der kleine Roberto nun endlich mit seinen Eltern vereint ist. Die Familie nimmt Wohnsitz in der grössten Gemeinde des Rheintals, die aber auch nur ein Städtchen ist. Angelina übernimmt als Wirtin die Wirtschaft „Zum Baum“ in Pacht.
Sohn Roberto ist nun achtjährig, geht im Städtchen zur Schule, wo er der kleine Tschingg genannt wird. Roberto ist auffallend aufgeweckt, Klassenbester, obwohl ihm die deutsche Sprache zu Beginn Probleme bereitet. Der Junge ist und bleibt das einzige Kind der Familie Rossi.
1923 wird die Rheinbegradigung fertiggestellt. Vater Ronaldo kränkelt, findet deshalb keine neue Anstellung. Die Familie ist nun vollständig auf den Verdienst von Mutter Angelina angewiesen, den sie als Wirtin generiert.
1925 stirbt Vater Ronaldo. Todesursache: Staublunge. Mutter Angelina ist nun Witwe und Sohn Roberto ist Halbwaise.
1928 beendet Roberto seine Grundschulzeit. Seine Lehrer empfehlen ein Studium. Doch Mutter Angelina hat Bedenken dies finanziell verkraften zu können. Deshalb beginnt Roberto eine Banklehre. Damit bringt der Sohn zumindest einen kargen Lehrlingslohn nachhause.
1932 schliesst Roberto die Banklehre ab, wird von seiner Bank sofort voll angestellt und bekommt die Zeichnungsberechtigung. Er ist nun Prokurist und nennt sich gemäss Visitenkarte seiner Bank Robert R. Rossi. Der Mittelkonsonant steht für Ronaldo, sein zweiter Vorname. Weil Robert nun innerhalb der Bank für die Kreditvergabe verantwortlich ist, wird er im Städtchen ernst genommen. Keiner nennt ihn nunmehr kleiner Tschingg. Mutter Angelina und Sohn Robert lassen sich einbürgern, besitzen nun den Schweizerpass.
1933 beginnt für Robert die Rekrutenschule. Weil die Banken in der damaligen Zeit die militärischen Karrieren ihrer Kadermitarbeiter kompromisslos fördern, ist Robert in der Folge nicht mehr so oft in seinem Bankoffice anzutreffen. Dies hat insbesondere damit zu tun, dass zwischen 1939 und 1945 in Europa Krieg herrscht und die Schweiz sich gegen den Aggressor Hitler zu wappnen hat. Am Ende seiner Militärkarriere bekleidet Robert den Rang eines Majors.
Anfangs 1944 wird Robert von der Eidgenossenschaft in den diplomatischen Dienst aufgenommen. Nach einer kurzen Grund-ausbildung liegt sein Einsatzgebiet vornehmlich in Osteuropa, auch weil er fünf Sprachen beherrscht, eine davon ist Russisch. Er wird mit der Evakuierung von Schweizer Bürgern aus dem Gebiet von Ostpreussen beauftragt. Seine Aufenthaltsorte sind jetzt vornehmlich Königsberg, das heutige Kaliningrad, eine russische Enklave, sowie Elbing, heute Elblag, polnisches Hoheitsgebiet. Die Schweizer Eigenossenschaft hat «erhebliche Bedenken» (offizieller Wortlaut der Regierungserklärung), dass sich das Kriegsgeschehen nach Ostpreussen verlagern könnte und dass die Russen den Versuch unternehmen würden, dieses Gebiet zu erobern. Die hier lebenden Schweizer haben zwar mehrheitlich keinen direkten Bezug mehr zu ihren helvetischen Wurzeln, aber sie verfügen immerhin noch über einen Schweizer Pass, der ihnen vielleicht einen Sonderstatus bei einer Flucht verschaffen konnte.
Jetzt, gegen Mitte des 20. Jahrhunderts, zumeist Generationen später, betrachten diese Leute jedoch Ostpreussen als ihre Heimat. Denn hier haben sie teilweise über Generationen hinweg ihre Existenzen aufgebaut. Viele der Menschen sind eher unwillig, sich für eine Evakuierung in die für sie fremde Schweiz zu entscheiden. Ihnen ist gewissen, mit der Flucht ihre Existenz, ihre ganze Habe zu verlieren. Sie sind frustriert, verzweifelt. Aber letztlich geht es vor allem darum, nicht ins direkte Kriegsgeschehen mit allen Folgen eingebunden zu werden, zumindest das eigene Leben durch die Flucht zu retten.
Robert muss in seiner Mission sensibel vorgehen. Seine Tätigkeit beruht auf Menschlichkeit und diplomatischem Fingerspitzengefühl, vor allem sein Organisationstalent ist gefragt. Er muss immer einen Weg finden, wie die Fluchtwilligen sicher in die Schweiz geführt werden können. Dabei ist nicht nur er, der Schweizer Diplomat, wegen der nahen Kriegshandlungen andauernder Lebensgefahr ausgesetzt, sondern auch seine ihm Anvertrauten. Überdies zählt in Zeiten von Not und Gewalt ein diplomatischer Status oft nur wenig, manchmal sogar gar nichts. Ein weiteres Problem: Viele der anrückenden sowjetischen Krieger kennen nur die kyrillische Schrift und können weder einen Reisepass noch ein anderes Schriftstück in lateinischer Schrift entziffern.
Im Sommer 1944 wird der offizielle Schweizer Delegationsleiter in Ostpreussen, Robert Rossi, mit einem Geschehen konfrontiert, das seinem Leben eine schicksalhafte Veränderung beschert: Er trifft eine Frau, in die er sich verliebt.
2 Die alte Rossi ist tot
Frühling im Jahr 2022. Markttag im Städtchen. Hunderte Menschen pilgerten durch die alten Gassen. Die Früchte- und Gemüsehändler hielten ihre frische Ware feil, der Absatz schien gut. Der Pelzverkäufer nahm sich wie aus der Zeit gefallen aus. Der Stand mit den Messern und den Ledergürteln fand kaum Beachtung. Das Verkäuferehepaar aus Norditalien versuchte in gebrochenem Deutsch alle Register zu ziehen: «Geräucherte Wurst und Speck aus dem Südtirol, erstklassige Qualität! Und Spitzenkäse aus dem Piemont! Probieren, probieren!» Einige Frauen erkundeten die eher altbackenen Wäsche- und Kleidungsstücke des türkischen Händlers: Büstenhalter gemacht für Brüste von Damen mit Jumbogrösse und Unterhosen, als wären sie zum Überziehen von Wagenrädern gefertigt. Der Mann sagte: „Frauen, das findet ihr in der heutigen Zeit nicht mehr im Laden ab der Stange. Dort gibt es nur Grössen für Pin Up Mädchen, sechsunddreissig, achtunddreissig, seltener vierzig! Frauen greift zu!»
«Wo kann ich anprobieren?»
«Hinter dem Vorhang, Madame!»
Eine der Frauen verdrückte sich mit drei Wäschestücken in einer Hand hinter den Vorhang, während die eine die andere mit dem Arm anstiess. «Hast Du gehört, die Rossi ist tot!»
«Wer?»
«Die alte Rossi!»
«Die vom Schlösschen? Irena?»
«Sie heisst Irina, nicht Irena! Weshalb nur wird der Name dieser Frau wiederkehrend falsch angesprochen!?»
«Jetzt nicht mehr!»
«Nein, wenn es so ist, dann nicht mehr!»
«Waren das noch Zeiten, als bei einem Todesfall die Totenglocke der Stadtkirche läutete, oder jene im Kloster. Bei einem Mann viermal, bei einer Frau dreimal. Alles wird in der heutigen Zeit abgeschafft! Wird immer schwieriger für die Menschen den Rank zu finden! – Wann ist die Beerdigung?»
«Steht morgen in der Zeitung!»
«Was soll morgen in der Zeitung stehen?»
«Die Todesanzeige!»
«Wie alt ist die Rossi geworden?»
«Uralt! Ich denke nahe an die hundert!»
«Bei Gott, so alt! Die war zäh! – Ich hoffe, dass ich nicht so alt werde! – Du?»
«Ich schon, warum nicht!? Leider bin ich nicht so vermögend wie die Rossi!»
«Ist sie reich, ich meine richtig reich?»
«Haha! Ich denke schon, dass es etwas zu erben gibt! Immerhin ist der äussere Schein entsprechend! Nicht jede wohnt in einem Schloss hoch über dem Tal, wird von einer Dienerschaft umsorgt und wird in einem Bentley herumkutschiert!»
«Wie sagt man!? Der Teufel scheisst immer auf die selben Haufen! - Wie viele Kinder hat die Rossi? Ich meine, wer kommt fürs Erben in Frage?»
«Soviel ich weiss, gibt es sechs Kinder. Fünf Söhne und eine Tochter! Alle auch schon wieder in fortgeschrittenem Alter!»
«Du kennst dich aus in der Familie! Anscheinend!»
«Etwas! Ich ging dort vor Jahrzehnten ein und aus. Daniel, einer der Söhne, ging mit mir in der Sekundarschule in die gleiche Klasse wie ich. Ein schöner, blitzgescheiter Kerl, einerseits! Aber andererseits ein Versager, der nicht in der Lage war, auch nur den kleinsten Teil seiner Anlagen zu seinem Vorteil zu nützen!»
«War er dein Schulschatz?»
«Ja, wir haben Händchen gehalten! Mehr ging zu jener Zeit nicht ab in dieser Altersgruppe!»
«Ich muss gehen! Das Kochen steht an! Der Herr wartet ungern, kann recht ungnädig reagieren, wenn nicht um Punkt zwölf das Essen auf dem Tisch steht!»
«Genau aus diesem Grund habe ich keinen Herrn mehr zuhause! Stattdessen habe ich einen Hund, der ist treu und liebt mich bedingungslos! Und er nimmt das Fressen, wann immer ich bereit bin, es ihm zu geben!»
«Dafür küsst dich abends niemand in den Schlaf! - Genügt dir die Gegenleistung des Hunds?»
«Nicht immer, aber was kann man tun! Ich war auch schon mal schöner! Das persönliche Tafelsilber hat Patina angesetzt»
«Haha, bei dir auch!? Ich dachte, das sei nur bei mir der Fall!»
«Geht allen so! Mach es gut!»
«Danke! – Bete ein Vaterunser für die Rossi!»
«Sag mal, war die Rossi überhaupt katholisch? Ich glaube nicht, sie oft in der Kirche gesehen zu haben! Aber ihr Mann war einst Kirchenpräsident! Daran kann ich mich noch erinnern!»
«Robert! – Ist lange her! Irinas Mann kann man schon seit Jahrzehnten nur noch als Inschrift auf der entsprechenden Tafel des Familiengrabs antreffen. Bei gewöhnlichen Leuten wäre das Grab längst aufgehoben! Bei Leuten, die entsprechend zahlen, bleiben die Leichen ewiglange drin im Boden. Aber die Gärtner müssen auch leben! – Und übrigens: Die Rossi war während Jahrzehnten Leiterin des Kirchenchores. Und die traten früher jeden Sonntag im Hochamt auf. Also, Irina hat die Kirche durchaus auch innen gekannt!»
«Wenn man gestorben ist, wird man schnell vergessen! Ist es nicht so?»
«Wie wahr du sprichst, es ist so! Mach das Beste aus dem Tag!»
«Du auch!»
3 Aufregung im Schlösschen