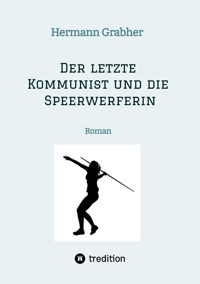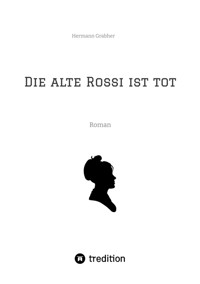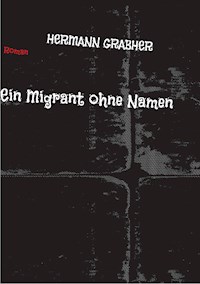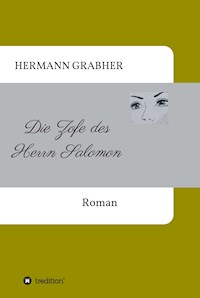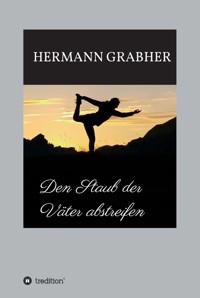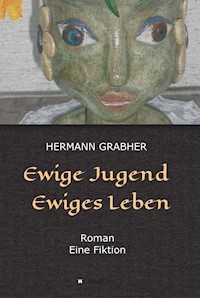5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
von wegen früher war alles besser Diese Notizen sind eine persönliche Rückbetrachtung des Autors Hermann Grabher (geboren 1940), die aufzeigt, wie sich die Lebensumstände und damit auch die Menschen in der Zeit seit dem zweiten Weltkrieg bis heute verändert haben. Man erkennt, dass sich in dieser Zeit eines Menschenlebens sozusagen alles geändert hat. Heute ist nicht alles gut, wir alle wissen das. Aber die Menschen haben wirklich die Chance auf ein besseres Leben in einer Dimension, wie sie noch nie eine Generation vor uns hatte. Wir haben allen Grund optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HERMANN GRABHER
von wegen
früher war alles besser
© 2020 HERMANN GRABHER
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-02433-5
Hardcover:
978-3-347-02434-2
e-Book:
978-3-347-02435-9
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, öffentliche Zugänglichmachung und Verbreitung.
1 Als ich noch jung war
Als ich geboren wurde, schrieb man das Jahr 1940. Man befand sich im zweiten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Und diese Welt war in Aufruhr. Auf unserer Erde brannte es lichterloh. Frauen, die Knaben zur Welt brachten, fragten sich voller Sorge: Muss auch dieses Kind dereinst mal in den Krieg ziehen? Deshalb hätten alle Mütter lieber Mädchen geboren.
In der ersten Klasse waren wir zu meinem Erstaunen doppelt so viele Buben wie Mädchen im Schulzimmer. Als ich nach dem ersten Schultag meiner Mutter von dieser meiner Feststellung erzählte, antwortete sie: «Das richtet die Natur so ein. Im Krieg fallen Männer als Soldaten, also muss der fehlende männliche Anteil entsprechend wieder kompensiert werden!» Mich, den Erstklässler, traf diese Bemerkung der Mutter tief ins Herz. Denn das hiess wohl nichts anderes, als dass auch ich mal dereinst vielleicht ausersehen sein würde als Kanonenfutter missbraucht zu werden. So nahm ich mir fest vor, nie Soldat zu werden und dies gelang mir. Entsprechend meiner damaligen eigenen Vorgabe schaffte ich es, dass ich nie in meinem Leben ein Gewehr in meinen Händen halten musste. Folglich feuerte ich auch nie je einen Schuss ab. Man kann diesen meinen Entschluss, entschieden von einem Menschen in frühen Jahren seines Lebens, als Feigheit abtun. Und so falsch ist diese Vermutung gar nicht, denn gewiss war auch eine Portion fehlender Mut mitbestimmend für diese meine Einstellung. Allerdings versuchte ich damit vor allem und in erster Linie meine Gesinnung auszudrücken, die Gesinnung eines durch die Kriegsereignisse gereiften Kindes, das sich vornahm, niemals mit Gewalt ein Problem zu lösen. Ich war somit ein kleiner Pazifist, ohne diesen Begriff überhaupt zu kennen.
Als ich noch jung war, liebte ich es jenes zu hören, was Alte aus früheren Zeiten erzählten. Diese Alten waren oft noch gar nicht besonders alt. Aber wenn man zehn, fünfzehn oder zwanzig Lenze zählt, können selbst lumpige fünfzig Lebensjahre schon eine beeindruckende Marke darstellen. Es waren meine Eltern, meine Onkel und Tanten, die Grosseltern, Nachbarn, Mitarbeiter meines Vaters und manche andere, die aus vergangenen Zeiten berichteten. Damals war ich sehr glücklich, dass ich in der «Neuzeit» leben durfte, denn wie es schien, war es alles andere als einfach, sich in früheren Epochen durchs Leben kämpfen zu müssen. So vieles stellte sich den Menschen unserer Vorgängergenerationen als schwierige Hürden in den Weg: Grassierende Arbeitslosigkeit. Kleine bis allerkleinste Entlohnung für ehrliche Arbeit. Krankheiten und Seuchen, bei denen die Medizin machtlos war und die Menschen zu Hunderten weggerafft wurden. Kriege, die Angst, Zerstörung und Tod brachten. Wenig Brot auf dem Teller, von Fleisch oder Käse gar nicht zu reden. Weder elektrischer Strom noch fliessendes Wasser im Haus. Schlafkammern ohne Heizung, Betten ohne jeglichen Komfort. Bettdecken, die kratzten, weil sie mit Laub gefüllt waren und die sehr wenig wärmten. Kleider und Schuhe, die für die kalte Jahreszeit nur bedingt geeignet waren, weil sie nicht in der Lage waren Kälte und Nässe wirksam abzuhalten. Dies hörte sich alles andere als lebenswert an, eigentlich im Gegenteil ziemlich lebensfeindlich – kurz gesagt schrecklich!
Was ich andererseits gar nicht nachvollziehen konnte, waren wehleidige Bemerkungen gewisser reifer Menschen, die man hin und wieder zu hören bekam. Nämlich, dass früher dennoch alles besser gewesen sei und dementsprechend und konsequenterweise heutzutage alles schlechter sei. Diese betonten, dass Dinge, die früher als wichtig und wertvoll galten, heute schnöde bachab gehen würden. Die Moral zum Beispiel, die Leistungsbereitschaft, der Lern- und Arbeitswille, der Respekt, die Leidensfähigkeit, die Gottesfurcht. Ja, es mangle an vielem, wurde von diesen betont, insbesondere und nicht zuletzt auch an der notwendigen Intelligenz. Früher seien die Menschen gescheiter gewesen, irgendwie vernünftiger. Man habe es gemacht, wie man es in der Vergangenheit schon je gemacht hatte und damit sei man gewiss nicht schlecht gefahren. Man habe nach dem gesunden Menschenverstand und dem guten Gefühl entschieden. Man habe ohne jegliche Spitzfindigkeit gespürt was gut und was schlecht sei. Und dass man damals vaterländische Ohrfeigen ausgeteilt habe, das sei soweit bestimmt auch kein Fehler gewesen, es habe niemandem geschadet. Dann hätten diejenigen, welche damit bedient wurden, das eben wohl verdient gehabt!
Wenn ich mich heute ertappe beim Einbringen einer persönlichen Bemerkung mit dem Neben- oder gar dem Einleitungssatz als ich noch jung war, kann meine Stimme unvermittelt ins Stocken geraten. Dann kann ich richtiggehend über mich selbst erschrecken, weil ich realisiere, dass ich ganz ohne Wenn und Aber in jener Generation angekommen bin, die gerne von früher erzählt und teilweise eben auch mit dem heute vergleicht. Das heisst: Ich bin offensichtlich alt geworden. Es kann vorkommen, dass ich über mich selbst erstaunt bin, weil auch ich ab und zu den Mahnfinger hebe, was ich früher in meinen jugendlichen Jahren bei älteren Menschen verabscheute. Weil ich darin die Geste ewig gestriger Besserwisser zu erkennen glaubte, etwas, was der Jugend noch nie zugesagt hat, in welcher Epoche auch immer sie lebte. Doch ich kann zu meiner eigenen Entlastung sagen, dass ich immerhin nicht zur Fraktion der notorischen Nörglern gehöre, zu den Negativdenkern, die voller trübsinniger Ahnung kundtun, die Welt gehe demnächst unter, ja wir alle seien sozusagen schon verloren, es gebe keine Rettung mehr, die Apokalypse habe schon eingesetzt. Im Gegenteil, ich bin einer, der es vorzieht, das Glas halbvoll und nicht halbleer zu sehen. Und ich betrachte meine positive Grundeinstellung als ein Segen. Denn neigt sich das Gemüt mehr dem Sonnenschein zu, denn der fatalen Kunst des Schwarzmalens, lebt es sich beschwingter. Eigentlich sollte sich jedermann dies zu seinem eigenen Vorteil beherzigen. Denn die Wissenschaft sagt: Eine positive Grundeinstellung hebt die Lebensqualität, kann den Lebenszyklus verlängern!
Ich stehe zu meiner dezidierten Meinung, dass sich die Welt grundsätzlich zwar weit nicht perfekt, aber durchaus in positiver Weise entwickelt hat im Zeitfenster meines Lebens. Auf vielen Gebieten konnten erhebliche Fortschritte erzielt werden, sehr zum Wohle von uns Erdbewohnern. Und dies lässt sich auch rein statistisch belegen: In den letzten sechzig Jahren hat sich die globale Lebenserwartung von einst 47 Jahren auf heute 72 Jahre erhöht! In der Schweiz liegt die Lebenserwartung sogar noch elf Jahre höher. Die Sterblichkeit von Kindern bis 15 Jahren liegt aktuell bei weniger als 4 Prozent. Vor siebzig Jahren lag die Zahl sieben Mal höher. Der Analphabetismus konnte weiter reduziert werden auf heute weniger als 10 Prozent weltweit. Diese Zahl bedeutet allerdings im Rückschluss, dass noch immer zirka 800 Millionen keinen Zugang zu einer rudimentären Schulbildung hatten oder haben – ein Skandal in unserer Zeit! Täglich bekommen 200'000 Menschen neu Zugang zu Trinkwasser und 325'000 Menschen erstmals einen elektrischen Anschluss. Nie zuvor gab es weniger Menschen in extremer Armut als heute. Allerdings ist im selben Atemzug anzumerken, dass der hierfür angewandte Richtwert des Tageseinkommens mit zwei US-Dollar als menschenverachtender Hohn betrachtet werden muss! Denn davon kann niemand existieren, auch im ärmsten Land der Welt ist dies nicht möglich! Eine beeindruckende Zahl von Seuchen und Krankheiten, einst Geisseln der Menschheit, wurden zwischenzeitlich endgültig besiegt. Dies heisst allerdings nicht, dass künftig keine Seuchen oder gar Pandemien mehr über uns hereinbrechen können. Denn unser mobiles Verhalten ist förderlich für diese Bedrohung. Immerhin dürfen wir darauf zählen Gefahren dieser Art heutzutage medizinisch und präventiv effizienter bekämpfen zu können. Die allgemeine Gesundheitsversorgung ist in vielen Ländern glücklicherweise umfassend und die Fürsorge-Institutionen und sozialen Einrichtungen helfen vor allem auch älteren, kranken und minder bemittelten Menschen über die Runden zu kommen. Andererseits besteht in vielen Bereichen noch immer ein riesiges Verbesserungspotential, insbesondere in Ländern der Dritten Welt. Es existiert ein Nachholbedarf an Schulen, Krankenstationen und sanitären Anlagen. Vielerorts mangelt es an sauberem Wasser. In unseren Breitengraden ist die Energieversorgung gut organisiert; sie ist es auch in einer Vielzahl anderer Ländern in anderen Kontinenten. Der Trend zur Produktion von Ökostrom mittels Photovoltaik, Erdwärme und Wind hält an. Doch wir alle wissen, dass wir erst am Anfang dieser Entwicklung stehen und unsere Anstrengungen noch bedeutend intensiviert werden müssen, um die gesteckten ambitionierten Ziele erreichen zu können. Der allgemeine Bildungsstand der Menschen hebt sich kontinuierlich und beeindruckt. Dies ist allerdings absolut notwendig bei den heutigen Anforderungen, die das Leben in mannigfaltiger Weise stellt. Noch nie gab es mehr Menschen auf Erden, die einer geregelten Arbeit nachgehen und damit auch im Stande sind ein einigermassen kalkulierbares Einkommen zu generieren. Wenngleich klar festzustellen ist, dass noch immer längst nicht alle Löhne fair sind (insbesondere in Ländern der Dritten Welt) und es noch immer viele Firmen gibt (auch in unserer Hemisphäre), deren vordergründiges Ziel scheint, Arbeitsstellen weg zu rationalisieren, statt neue zu schaffen. Denn wenn Arbeitsstellen gestrichen werden, hebt sich der Wert der Aktien an der Börse. Die Welt des Kapitals hat eine eigene Logik und korrespondiert oft nicht mit unserem Gespür für Moral. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, einerlei ob Mann oder Frau, steht noch vielerorts in harschem Gegenwind. Wir haben internationale Organisationen von weltumspannender Bedeutung, die sich unablässig bemühen, Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Es sind dies die politisch organisierten Institutionen wie die UNO mit den Untersektionen UNESCO und UNICEF, oder NGO Organisationen wie das RoteKreuz, Caritas, Ärzte ohne Grenzen und viele andere. Es gibt sie in beeindruckender Zahl, die Leute mit Courage. Es sind Menschen mit Herz, Frauen und Männer mit enormem Engagement und grosser Eigenverantwortung. Es sind Persönlichkeiten, die hohen ethischen Ansprüchen gerecht werden. Sie setzen sich ohne jeglichen Blick auf Eigennutz ein, verfolgen nur ein Ziel, nämlich Benachteiligten zu helfen, unsere Welt lebenswerter zu gestalten. Ihnen gebührt uneingeschränktes Lob, wie auch Dank und Anerkennung.
In der Tat dürfen wir nicht ruhen, müssen weiter intensiv in lauterer Weise alles unternehmen unseren Heimplaneten besser zu machen - auf allen Gebieten. Die Natur muss noch umfassender verstanden und effektiver geschützt werden. Es werden noch viel zu oft Kriege angezettelt und Konflikte zwischen Ländern münden in kriegsähnliche Auseinandersetzungen, insbesondere zum Nachteil der Zivilbevölkerung. Es gibt Terror von Einzelnen und Gruppen mit der Folge, dass Menschen verwundet werden oder gar zu Tode kommen, ihre Existenz und ihre Heimstätten verlieren und zu Flüchtlingen werden. Es existieren noch viel zu viele Herrscher und Politiker, die korrupt sind, deren Fokus vor allem auf die persönliche Bereicherung ausgerichtet ist. Sie sind unfähig zwischen Dein und Mein zu unterscheiden mit der Konsequenz, dass die Ökonomie ihrer Länder darnieder liegt und nicht hochkommen kann, die Menschen somit keine Zukunftsaussichten haben. Ihre Führer andererseits mit goldenem Besteck aus goldenen Tellern essen. Es gibt Religionsführer, die den Begriff Religio (was Gottesfurcht, Rückbesinnung und auch Gewissen meint) in keiner Weise verstehen, wenn sie zu Hass und Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen. Die Moral weltweit ist nicht besser geworden in einer Zeit, in der Gott und andere übergeordnete Institutionen nicht mehr oder höchstens mit Vorbehalt akzeptiert werden. Aber immerhin gelten die zehn Gebote für viele von uns noch immer und das eigene Gewissen ist bei einer Mehrzahl der Menschen nicht platt gewalzt. Die meisten von uns wissen ziemlich genau, was unsere Pflichten sind oder zumindest wären und was wir unserem Nächsten schulden, wer auch immer als unser Nächster zu betrachten ist. Wir sagen laut und vernehmlich, dass Humanismus, Achtung des Individuums, Schutz der Schwachen, vor allem von Frauen und Kindern, nicht falsch ist, sondern im Gegenteil nichts anderes ist, als ein menschliches Urbedürfnis zu respektieren, nämlich die Menschenrechte! «Was Du nicht willst das man Dir tu, füg Du auch keinem andern zu!» Dies vermittelte mir meine Mutter sozusagen mit der Muttermilch. Und natürlich gilt dies heute noch immer in unveränderter Weise. Dies wird sich auch in den nachfolgenden Generationen nicht ändern. «Du sollst nicht stehlen»! «Du sollst nicht lügen»! «Du sollst nicht töten»! Nichts, aber auch gar nichts ist falsch an diesen Geboten, egal, ob man sie nun als christlich bezeichnen will oder als etwas anderes. In gleicher Weise sollten wir die Antipoden der Zehn Gebote im Auge behalten, nämlich jenes was wir tun sollen: «Du sollst den Nächsten lieben wie Dich selbst»! «Du sollst teilen, solidarisch sein mit denen, die wenig oder nichts haben»! «Du sollst zur Umwelt Sorge tragen zwecks Erhaltung unseres Planeten!»
Unsere Erde hat sich prächtig entwickelt, so gut, dass die Regeneration der Natur nicht mehr Schritt halten kann mit dem, was wir erschaffen und tun, was wir gerne als technischen Fortschritt bezeichnen. Unser Erfindergeist hat bewirkt, dass wir uns sozusagen selbst überholt haben. Wir leben aktuell auf zu grossem Fuss, wir leben zu unbescheiden, weit über unsere Verhältnisse, auf Kosten der nächsten Generationen. Unsere Schritte laufen nicht einher im Einklang mit der natürlichen Rekuperationssfähigkeit der Erde. Es hat lange gedauert bis wir - oder zumindest viele von uns - akzeptierten, dass unser C02-Ausstoss zu gross ist und dieser radikal gesenkt werden muss, damit die Erderwärmung reduziert werden kann. Dies mit jeglicher bekannten Konsequenz. Auf dass sich künftig der «sonnige Süden» mit dem mediterranen Klima nicht bis zur Nord- und Ostsee erstreckt und unsere Landwirtschaft nicht gezwungen sein wird in unseren Gefilden Reis oder Soja, statt Kartoffeln und Weizen anzupflanzen. Wir müssen unsere Abfallberge reduzieren. Verpackungen dürfen nur noch aus rezyklierbaren Materialien bestehen. Und es darf insbesondere nicht sein, dass unsere Gesellschaft diese grossen Mengen von Lebensmitteln verschwendet und ungenutzt wegwirft, so wie das aktuell leider in überbordender Weise geschieht.
Viele von uns haben das ungute Gefühl in einer heillosen Krisenzeit zu leben. Tatsache ist aber, dass schon jegliche Generation vor uns dieses Empfinden hatte. Bereits im Alten Testament war die Rede davon und die damaligen Menschen glaubten nahe vor dem Weltuntergang zu stehen. Dabei waren sie der Ansicht, dass dies die gerechte Strafe Gottes sei für menschliche Verfehlungen. Gefühle dieser Art können beim Menschen in der Tat das Grundvertrauen erschüttern oder sogar zerstören. Dies mit fatalen Folgen: Es besteht die Gefahr mutlos zu werden, den inneren Halt zu verlieren. Eine Hauptursache der Verunsicherung ist die schnelle, allumfassende Kommunikation in der heutigen Zeit. Jegliches Ereignis, wo immer es geschieht, geht in Minutenschnelle um die Welt – Fake News genauso wie korrekte Informationen. Und es ist für jedermann schwierig zwischen richtigen und falschen News, zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden. Wem soll man glauben? Dabei kommen viele daher, als wären sie ein neuer Messias, als hätten sie die absolute, die einzige Wahrheit im Gepäck.
Wir sollten uns mehr Gelassenheit aneignen. Ich traue uns - der Menschheit - zu, sowohl die Vernunft wie auch den Geist, die Inspiration, die Erfindungsgabe, wie auch insbesondere die Moral zu besitzen, die Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Noch können wir die Weichen umlegen, noch können wir die Kurve kriegen. Ich traue uns Menschen zu, die notwendige Weitsicht aufzubringen, das richtige zu tun. Staaten, Institutionen werden die umfassenden finanziellen Mittel sprechen, die notwendig sein werden, diesen Challenge zu bestehen. Und zwar nicht halbherzig, sondern aus Vernunft mit voller Überzeugung. Diese Herausforderung wird gleichzeitig auch eine grosse Chance sein. Jegliche neuen technischen Innovationen, kreative Ideen und letztlich die praxisgerechte Umsetzung all dieser in die Zukunft gerichteten Entwicklungen werden uns und die kommenden Generationen fordern. Der Schub wird viele zusätzliche Arbeitsplätze generieren und Menschen Arbeit und Brot in neuen herausfordernden Tätigkeitsfeldern verschaffen. Das Lösen dieser anspruchsvollen Aufgaben wird uns weitere Schritte vorwärtsbringen und den Männern und Frauen künftiger Generationen die Chance bieten, nicht nur zu überleben, sondern ein gutes, interessantes und vor allem menschenwürdiges Dasein zu führen. Und das über viele weitere Generationen.
Nun kann man sich allen Ernstes fragen, ob es klug, korrekt und sinnvoll ist Phrasen dieser Art in die Welt hinaus zu posaunen, wenn man selber das Glück hat im Paradies leben zu dürfen, in einem Land, in dem es den Menschen an nichts fehlt, in einer Gesellschaft, in der es alles in Fülle gibt, in dem Jegliches seinen Platz und seine Ordnung hat. Unser Kampf ist ja keiner gegen den Hunger, sondern eher einer gegen das eigene Übergewicht. Die meisten von uns müssen sich nicht mehr gegen körperliche Erschöpfungszustände stemmen, sondern eher etwas gegen die Bewegungsarmut und ihre Folgen unternehmen. Doch nur eine Minderheit der Erdbewohner hat solch paradiesisches Glück auf Erden wie wir. Wie hat es ein Mensch verdient zum Beispiel als Mädchen in den Slums von Bangladesch oder im Busch des Sudans auf die Welt zu kommen? Was mag sich Gott denken, wenn er das Menschlein in einer Ecke der Welt abstellt, wo seine Chancen für ein menschenwürdiges Leben schon beim Start so reduziert sind, wie sie in der Realität eben sind? Unter diesem Aspekt getraut man sich kaum mehr weiter zu denken, denn da fehlen uns selbst nur im Ansatz die entsprechenden Perspektiven, die Welt zu verbessern, gerechter zu machen.
*
2 Wurzeln
Kein Mensch hat einen Einfluss auf seine Wurzeln. Niemand kann seine Familie selbst aussuchen, auch wenn er der König von Brunei oder der Maharadscha von Jaipur ist, kann er das nicht. Erst wenn er/sie einen Partner/Partnerin (möglichst fürs Leben) findet und Kinder zeugt, nimmt der Mensch individuell Einfluss auf den weiteren Verlauf des Stammbaums und somit in die Zukunft. Eltern können ihre Gene vererben, sie können auch durch eine entsprechende Erziehung Einfluss nehmen, ob Kinder mehr oder weniger gut geraten. Aber letztlich ist jeder Erdenbürger ein Unikat, von dem es kein zweites davon gibt. Das Aussehen ist nur ein Merkmal von vielen. Charakter, Gemüt, Intelligenz, physische Konstitution und Stabilität der Gesundheit sind andere. Irgendwann, früher oder später, entfernt sich jeder Mensch dem Einflussbereich der elterlichen Fürsorge, dann ist er sich selbst überlassen, muss für sich sorgen, muss sich den Prüfungen des Lebens selbstverantwortlich stellen.
Meine Familie hat einen recht gut dokumentierten Stammbaum, der mir an sich aber ziemlich unwichtig ist. Denn zum rückwärts ausgerichteten eigenen Stammbaum habe ich nichts beigetragen. Ich bin ich geworden, ohne dass man mich fragte, genauso wie es bei jedem Menschen ist. Meine persönliche Möglichkeit der Beeinflussung liegt nur in der vorwärts ausgerichteten Linie, nämlich durch die Existenz eigener Kinder. Dennoch ist es manchmal interessant, nicht selten auch kurios, wie sich unsere Ahnen in der Vergangenheit verhielten.
Ich war eigentlich der Meinung, dass in unserer bodenständigen, eher traditionell geprägten Gegend die früheren Gesellschaftsstrukturen wohl ziemlich homogen sein mussten. Ich nahm an, dass sich Einheimische geographisch eher wenig veränderten und es auch nicht viele Zuzüger gab. Ein wenig Ahnenforschung jedoch genügte, um zu einem etwas anderes Bild zu gelangen, nämlich dass durchaus fremdes Blut in meinen Adern pulsiert, und zwar von Vaters Seite, wie auch von Mutters Seite. Unter diesem Aspekt ist es wohl angebracht anzunehmen, dass schon unsere Vorfahren reisten, immigrierten, ihre angestammte Heimat aus welchen Gründen und Umständen auch immer verliessen, um sich irgendwo an einem anderen Ort neu anzusiedeln. In schwierigen Zeiten gab es Massenexodusse. Bekannt in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Immigrationswelle der Italiener in die Schweiz in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, sowie die Ausreiseaktivitäten von Europäern nach Amerika vor und nach der Jahrhundertwende um 1900, aber auch schon früher. Meistens waren Katastrophen oder Zwangszustände in der Heimat wie Raumnot, Mangel an Nahrung, gesellschaftliche Verfolgung und negative Ereignisse privater Natur die Triebfeder von Immigration. So sei denn die Frage erlaubt: Ist es nicht nachvollziehbar, wenn heute viele Afrikaner ihr Glück in Europa versuchen? Oder Südamerikaner an der Grenze zu den USA anklopfen? Ob und wie sich diese Menschen bei uns integrieren lassen, das ist ein anderes Thema. Ein Mann, der hier in der Schweiz Asylanten betreut, sagte mir kürzlich, dass das Verhalten vieler erwachsener Flüchtlinge absolut unselbständig sei, nicht anders als wären sie Kinder. Werden sich diese Leute je in unserer Gesellschaft zurechtfinden, sich integrieren lassen? Es ist unsere Pflicht ihnen in freundlicher Weise unsere Kultur und unsere Gepflogenheiten nahe zu bringen, dass sie möglichst schnell lernen, wie hier der Hase läuft.
Die Blutaufmischung auf Vaters Seite kam wie folgt zustande: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts drohte die Sippe mit dem Dorf-Familiennamen «Knechts» auszusterben. Die letzte Familie des Stamms hatte keine männlichen Nachkommen, sondern nur zwei Töchter und die kamen auch schon in fortgeschrittene Jahre. Insbesondere war es schon damals für «alte Jungfern» nicht einfach einen Ehemann zu ergattern. Diese Frauen liessen sich aber ihre Lebenslust nicht verbieten und hauten anscheinend tüchtig auf den Putz. Bei einem Fest in Bregenz lernten sie Soldaten aus der Slowakei kennen, die eigentlich gar keine Krieger waren, sondern Musikanten. Sie waren Angehörige eines Musik-Bataillons in der K. & K. Kaserne am Bodensee stationiert. Aus dem Techtelmechtel gingen beide Mädchen schwanger hervor. Als die beiden Frauen ihre Schwangerschaft feststellten, waren die Herren leider längst aus der Kaserne ausgezogen. So war es nicht einmal möglich die Väter der Kinder in den Bäuchen der Schwangeren zu eruieren. Denn sie hatten es unterlassen Namen und Adressen auszutauschen. Offensichtlich war die Sache damals als kurzes, lustvolles Intermezzo eines Sommerabends betrachtet worden. Es scheint, dass sie die Folgen ihres Tuns ganz offensichtlich krass unterschätzt hatten. Wie auch immer, die zwei Frauen gebaren je einen Sohn - logischerweise mit dem Geschlechtsnamen Grabher, dem Ledig-Namen der Damen. Das lockere Verhalten der Frauen zeitigte immerhin einen positiven Aspekt, nämlich dass damit das Überleben der Sippe der Knechts gerettet war. Zumindest etwas scheinen die anonymen lebenslustigen slowakischen Musikanten mit ihren Genen weiter gegeben zu haben: Ihre musikalische Begabung. Manche der Nachkommen zeigten und zeigen noch immer ein musikalisches Talent, das auffallend ist.
Die Blutaufmischung auf Mutters Seite war wie folgt: Die Mutter meiner Mutter mit Namen Nora, also meine Grossmutter, hatte einen Vater, der aus Ungarn (damals K. & K. Österreich-Ungarn) stammte. Als Schuhmacher auf Wanderschaft machte dieser Mann zufällig Halt in Lustenau, dem Dorf meiner Urgrossmutter Sidonia (1865 – 1930). Der tüchtige Schuhmacher lachte meine Urgrossmutter Sidonia nicht nur an, sondern er heiratete sie. Das Paar war fruchtbar, es hatte 21 Kinder, von denen 15 das Erwachsenenalter erreichten. Daraus entsprossen 44 Enkel und 101 Urenkel (einer davon bin ich). Somit starben 6 ihrer Nachkommen im Säuglings- oder Kindesalter. Der Tod eines Kindes wurde zu jener Zeit nicht unbedingt als grosse Katastrophe betrachtet, sondern als natürliche Auslese: Der Herrgott gab und der Herrgott nahm, es war sein Wille. Kinder im Himmel betrachtete man als wichtige Fürsprecher vor Gott aller jener, die nach ihnen heimgeholt würden. Die Menschen jener Zeit gewannen somit dem Kindstod auch eine positive Seite ab. Es wurde erzählt, dass der Vater Franz am Morgen der Beerdigung eines seiner Kinder traurig war und heftig lamentierte. Am Nachmittag in der Schusterwerkstatt hatte sein Gemüt aber schon wieder eine positive Stimmung gewonnen und er pfiff ein Liedchen vor sich hin, wie das bei ihm anscheinend üblich war. Das Erwerbsleben der Familie war polyaktiv. Einerseits betrieb die Familie zwei Stickmaschinen. Andererseits führte der Vater seine Schuhreparaturwerkstatt vorwiegend abends und nachts, denn tagsüber arbeitete er als Arbeiter in einer Zichorie-Fabrik in Au auf der anderen Seite des Rheins.
Meine Grossmutter Nora heiratete Julius Bösch im Jahre 1911. Aus dieser Verbindung entsprossen 8 Kinder, Leni, meine Mutter, war das zweite Kind der Familie. Grossvater und Grossmutter mütterlicherseits lernten sich beim Musizieren kennen. Nora hatte einen blinden Onkel, der Musiklehrer war. Ihn betreute sie als Führerin. Bei diesem Onkel Pepi lernte sie das Spielen auf der Zither. Julius lernte gleichzeitig auf der Violine zu spielen. Julius ernährte seine Familie vorerst durch den Betrieb seiner Stickmaschine. Daneben wurden die meisten Lebensmittel in Eigenregie gepflanzt, insbesondere Kartoffeln, Türken (Mais), Getreide, sowie jegliche Art von Gemüsen und Salaten, die unser Klima hergibt. Obst und Nüsse gediehen auf den Bäumen der Hofstatt und Beeren wuchsen in den Sträuchern rund um das Haus. Ausserdem ermöglichte eine kleine Schweinezucht, dass ab und zu auch Fleisch auf den Tisch kam. Vor allem im Hauskamin geräucherter Speck liess sich lange haltbar aufbewahren. Nachdem die Stickmaschine durch ein Erdbeben beschädigt worden war und die Stickerei nach dem ersten Weltkrieg ohnehin in der Krise steckte, wurde Grossvaters Stickmaschine - wie hunderte andere in der Gegend auch – abgebrochen und zu Alteisen. Julius wurde Strassenmeister der Gemeinde bis zum Jahr 1938, dem Jahr, als die «Grossdeutschen» an die Macht gelangten und die «Schwarzen» (Christlichen) aus allen Ämtern verjagt wurden. Diese Beschreibung ist sehr typisch für eine durchschnittliche Familie, die zu Beginn des 20. Jahrhundert im Rheintal lebte, diesseits, wie jenseits des Rheins – die politische Komponente mal ausgeklammert. Deshalb ist sie erwähnenswert. Hunderte, wenn nicht gar tausende Familiengeschichten verliefen ähnlich. Ganz anders präsentierte sich die Entwicklung auf der politischen Ebene linksseitig und rechtsseitig des Rheins. Die Annektierung Österreichs durch Deutschlands Nationalsozialisten war für die Vorarlberger einschneidend und für viele überaus schmerzvoll. Die Menschen auf der Schweizer Seite waren glücklicher, denn ihr Leben fand in einem politisch stabileren Land statt.
Die Familie der Eltern meines Vaters war hingegen weniger typisch strukturiert. Mein Grossvater Franz-Sepp verlor im ersten Weltkrieg als 30-jähriger Soldat das Leben. Die Witwe (meine Grossmutter Kathrin) mit 2 Knaben (der Ältere war mein Vater) heiratete wieder und gebar noch sechs weitere Kinder vom zweiten Ehemann. In dieser Familie studierten drei der vier Söhne, was für eine Arbeiterfamilie jener Zeit eher ungewöhnlich war. Einer von ihnen wurde katholischer Priester, der andere Lehrer. Mein Vater besuchte das Technikum. Der Umstand, dass der Staat den zwei Waisen eine kleine Rente auszahlte, half dabei entscheidend.
Nach der Ausbildung fand mein Vater keine Arbeitsstelle, es ging ihm nicht anders als den meisten anderen Schulabsolventen des Technikums. Genau zwei Mitschüler in Vaters Klasse fanden einen Job und dies auch nur durch die Protektion ihrer einflussreichen Eltern. Infolge der wirtschaftlichen Depression vor dem zweiten Weltkrieg herrschte eine katastrophale Arbeitslosigkeit. Um die jungen Leute nicht der Resignation anheimfallen zu lassen, wurden verschiedene Hilfsprogramme und Aktionen für Jugendliche betrieben. Zum einen wurden defekte Apparate und Geräte wie Radios, Fotoapparate, Fahrräder, Motorräder und sogar Autos gratis repariert. Wer konnte, der zahlte einen bescheidenen Obolus, jeder entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten. Beliebt war unter anderem der Rede-Club, bei dem unser Vater eine treibende Kraft war: Jedes Mitglied war gehalten sich periodisch mit einem spezifischen Thema intensiv auseinander zu setzen, um dann darüber vor all den Kollegen und der Öffentlichkeit im Allgemeinen einen Vortrag zu halten. Dies war eine Art Volkshochschule. Das Ziel war vor allem auch das Allgemeinwissen der einfachen Menschen im Dorf zu heben. In Anbetracht, dass nur wenige ein Radio besassen und die Television noch gar nicht existierte, das Internet noch nicht mal in der Fantasie bestand, war dies eine sehr sinnvolle Bildungsinstitution.
Als der Vater hörte, dass im Fürstentum Liechtenstein ein Mechaniker gesucht werde, schwang er sich aufs Fahrrad und stellte sich bei Josef Kaiser in Schaanwald (heute Kaiser Fahrzeugbau) vor. Die Realität war folgende: Ja, der Kleinbetrieb, der sich auf den Umbau von ausgedienten Autos in Traktoren spezialisiert hatte, sogenannte Auto-Traktoren, suchte tatsächlich eine Hilfskraft. Aber Josef Kaiser bekannte ohne Umschweif, keinen Lohn zahlen zu können, hingegen für Kost und Logis aufzukommen. Sozusagen beiläufig sagte Frau Kaiser, die Frau des Chefs, zum jungen Mann (unserem Vater), dass er wohl hungrig sei und dass sie ihm Spiegeleier braten würde, er solle ruhig sagen wie viele er möge. Am Schluss hatte er 7 Stück verdrückt. Unter diesen Umständen fiel es unserem Vater nicht besonders schwer zu entscheiden bei Familie Kaiser zu bleiben, Arbeit ohne Lohn hin oder her.
Die Tätigkeit meines Vaters war eine Mischung aus Konstrukteur, Mechaniker, Hausknecht und Mädchen für alles. Da die Familie Kaiser auch noch eine kleine Landwirtschaft betrieb – sehr üblich zur damaligen Zeit, musste der Vater am Morgen schon um halb sechs aus den Federn, um die Kühe zu melken. Wenn der Stall und die Tiere versorgt waren, wurde gemeinsam ein reiches Frühstück eingenommen: Üblicherweise Kaffee, Türken-Ribel, Rösti und Spiegeleier. Danach gingen Josef Kaiser und unser Vater – sein einziger Mitarbeiter – ans Tüfteln und Werkeln in der Werkstätte. Auch am Abend fand Vaters Abschlusstätigkeit im Stall statt. Nach einem Jahr eröffnete Josef Kaiser dem Vater, dass er sehr zufrieden sei mit seiner Arbeit und er gab ihm eine grüne Banknote, die das Abbild eines Holzfällers aufgedruckt hatte - fünfzig Franken. Der Vater war sehr stolz auf dieses Geld und er fuhr auf direktem Weg heim zur Mutter, übergab ihr das ganze Geld in der Annahme, dass sie es wohl nötiger hätte als er.
Unser Vater wurde bei der Familie Kaiser wie ein eigener Sohn gehalten, entsprechend harmonisch war das Verhältnis. Im nachfolgenden Jahr übergab Josef Kaiser unserem Vater eine blaue Banknote mit einem Mäher drauf - hundert Franken. Und auch dieses Geld überbrachte der Vater seiner Mutter.
Weil der Chef meines Vaters irgendwann der Ansicht war, es wäre an der Zeit, dass der Junge Geld verdienen sollte und Kaiser seinerseits nicht in der Lage war einen vernünftigen Verdienst anzubieten, half er zumindest mit auf der Suche nach einer Existenz und dies mit Erfolg. 1936 wagte mein Vater – 23-jährig - seine Geschäftsidee in die Realität umzusetzen, er gründete seine eigene Firma in der Schweiz. Es ging um die Konstruktion und Herstellung einer handbetriebenen Maschine zum Verschliessen von Konservendosen für private Haushalte. Nach dem Verschliessen durch Doppelfalz mussten die Dosen im kochenden Wasserbad sterilisiert, um den Inhalt haltbar zu machen. Mein Vater rühmte sich sein Leben lang damit, die Firma mit fünf Franken Startkapital gegründet zu haben. In der Tat waren es bestimmt einige Franken mehr. Doch es ist allemal erstaunlich mit wie wenig Geld man damals ein solches Wagnis eingehen konnte. Drei Jahre später – 1939, im Jahr des Ausbruchs des zweiten Weltkriegs - heirateten meine Eltern. In diesem Jahr – somit drei Jahre nach der Gründung – hatte Vaters Firma schon 50 Angestellte. Sein Produkt war gefragt in einer an sich desaströsen Weltlage. Wohl eher zufällig war er Produzent und Anbieter des richtigen Produkts im passenden wirtschaftlichen Umfeld. Es war Kriegszeit und wohin die Blicke schweiften, es gab vorwiegend Sorgen. Unbeeindruckt von allem gab unser Vater – der ewige Optimist - den Bau seines Familienhauses samt kleiner Werkstätte in Auftrag, das 1941 fertiggestellt war. Es war ein Lichtblick, oder eigentlich eher ein Wunder am dunkeln Firmament.
Doch leider sollte die Glückssträhne meiner Familie nicht lange dauern. Der Vater, der nun schon mehrere Jahre in der Schweiz wohnhaft war, aber sich noch nicht eingebürgert hatte (also noch immer Österreicher war), wurde von der Deutschen Besatzungsmacht mittels eines Stellungsbefehls in die Deutsche Wehrmacht eingezogen. Alle Widerstandsversuche waren ohne Chance - hoffnungslos erfolglos. Damit änderte sich die Situation schlagartig. Die Mutter – eine in Geschäftsdingen unerfahrene junge Frau – war gezwungen die Firma ohne Ehemann an ihrer Seite weiter zu führen. Doch wiederum geschah ein kleines Wunder: Als der Vater 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, existierte die Firma noch immer, wenn auch in stark redimensionierter Form. Meiner Mutter war es gelungen mit viel Mut, Gottvertrauen und weiblicher Intuition das Geschäft um alle Klippen zu schiffen. Der Neuanfang konnte beginnen.
*
3 Das angepasste Kind
Angepasst zu sein ist in der heutigen Zeit mit einem Makel behaftet. Ich weiss das. Dennoch sind auch moderne Eltern von heute dem Himmel dankbar für Kinder, die sich nicht allzu renitent und auffällig gebärden. Andererseits ist es oft geradezu unerträglich mitansehen zu müssen, wenn unerzogene Kinder ihre Eltern in Geiselhaft nehmen nach dem Motto: «Entweder bekomme ich jetzt diesen Schleckstängel oder es gibt eine Szene!» Wenn man dem cleveren Kind diese Erpressung ein- oder zweimal durchlässt, hat man als Erzieher die Schlacht meist schon verloren. Und selbstredend kommt noch der andere Aspekt dazu: Tag für Tag ist das Kind in der Kita, wo die pädagogisch geschulte Tante das Regiment führt und wo die oder der Kleine genau weiss wie der Hase läuft: Da gelten für alle Kinder die gleichen Regeln, es gibt weder Ausnahmen noch Gnade. Ein Kind kapiert das nach sehr kurzer Zeit. Wenn dann die Familie zusammen ist, möchte man das Fehlen der elterlichen Nähe und Wärme während des Tages mit kleinen Gefälligkeiten kompensieren. Und sei dies nur mit einer Süssigkeit unmittelbar vor dem Abendessen. Ausserdem neigen insbesondere Eltern von nur einem oder zwei Kindern dazu, den kleinen Pascha – vielleicht etwas weniger die kleine Prinzessin – nach Strich und Faden zu verwöhnen. Es sind in vielen Fällen Paare mit später Elternschaft – heute eher das Gegenteil einer Seltenheit - mit und ohne Migrationshintergrund und einer Mentalität, die früher üblicherweise vornehmlich südlich der Alpen zu beobachten war.
Die Frage ist: Werden diese Kinder je etwas wie Verzicht lernen, insbesondere in den nächsten Altersstufen? Werden dann die Eltern nein sagen können, wenn unbedingt ein neues Smartphone oder ein Tablet der letzten Generation Not tut, selbstverständlich mit dem entsprechenden Abo? Wenn es ausschliesslich Markenklamotten sein müssen, weil die Kollegen / Kolleginnen diese auch tragen und man ohne vielleicht ausgelacht würde? Wenn der oder die Fünfzehnjährige nicht mehr akzeptieren will, schon um 22 Uhr abends zuhause sein zu müssen?
Ich persönlich war – vor vielen Jahrzehnten - ein angepasstes, folgsames und somit unproblematisches Kind. Es ist mir absolut klar, dass dies reichlich unbescheiden klingt, doch ich schwöre, es ist die Wahrheit! Ich versuchte schon in sehr jungem Alter bewusst vernünftig zu agieren. Es ging mir darum einerseits meinen Eltern und Erziehern keinen Ärger zu bereiten, andererseits war mir aber sicher auch wichtig, selbst gut dazustehen, ja vielleicht sogar ein Lob für mein stromlinienförmiges Verhalten einzuheimsen.
Der ältere meiner zwei Brüder – Werner - ist weniger als zwei Jahre jünger als ich und insbesondere bis zum Beginn der Schulzeit machten wir alles zusammen. Wir hatten nie Streit, alles verlief harmonisch. Dabei betrachtete der Kleine mich Grösseren als wegweisend in Sachen Verhalten. Wenn meine Mutter damals erzählte, dass es bei uns Buben – ihren Kindern - niemals Streit gebe, hielt dies jedermann für die Übertreibung einer Mutter mit dem Hang das Leben in schönen Farben zu malen. Aber dies war mit Sicherheit nicht der Fall, denn unsere Mutter wurde während der Kriegsjahre von Sorgen geprüft. Unser Vater, ein immerwährender Optimist, hatte sich niemals vorstellen können, dass sich Adolf Hitler (der Wahnsinnige, wie Vater sich jeweils ausdrückte) als Machthaber etablieren würde. Unser Vater hatte gute, einflussreiche Schweizer Freunde und die empfahlen ihm dringend, sich schnellstens um die Schweizer Staatsbürgerschaft zu bemühen. Unser Vater – nie in seinem Leben ein Meister rascher Entschlüsse – meinte, dass dies Zeit habe. Leider zeigte sich schnell, dass dieses Verhalten ein fataler Fehlentscheid war mit schwerwiegenden Folgen für ihn persönlich, wie auch für unsere Familie. Was unser Vater niemals erwartet hatte, trat ein: Als gebürtiger Lustenauer wurde er 1942 von der Deutschen Wehrmacht kompromisslos eingezogen und in den Krieg geschickt Auftrags eines Regimes, das er zutiefst verabscheute und verachtete. Dies auch unabhängig davon, dass er als gewaltloser Mensch hinsichtlich psychischer und auch physischer Bereitschaft völlig ungeeignet war für einen Dienst als Soldat und als Krieger ohnehin. Die Androhung der Nazis, bei einer allfälligen Weigerung auf die alternden Eltern Regress zu nehmen, zeigte Wirkung. Der Vater hatte keine Wahl. Mit Hitlers Schergen liess sich nicht diskutieren und ohnehin nicht spassen. Unsere Mutter war genötigt in Abwesenheit des Geschäftsmannes, Ehepartners und Vaters ihrer Kinder die Firma zu führen - ein Akt voller Probleme und Schwierigkeiten für die Frau, welche ursprünglich von Beruf Näherin war. Immerhin hatte sie etwas Führungserfahrung, denn sie war vor der Heirat Kursleiterin für Frauen, die auf der Maschine nähen lernen wollten.
Ich nahm den Krieg in den ersten fünf Jahren meines Lebens sehr bewusst als überaus bedrohlich wahr. Mein Verhalten war abgeklärt und reif, somit ziemlich untypisch für ein kleines Kind. Der Vater fehlte ab meinem zweiten Lebensjahr und dies war eine riesige Lücke. Allerdings pflanzte die Mutter als sehr gläubige Frau in mir den unerschütterlichen Glauben ein, der Vater würde allen Gefahren widerstehen könne. Dabei ging es nicht darum, den Vater zu heroisieren, sondern im Gegenteil, Mutter sagte, dass es Gott sei, welcher allzeit die schützende Hand über ihn halten werde und dafür sorgen würde, dass er dereinst wohlbehalten in unsere Familie zurückkehren werde. Diesbezüglich hatte ich ein absolutes Vertrauen in die Mutter, ich glaubte ihr ohne jegliche Einschränkung. Andererseits war das Thema «Krieg» bei den Erwachsenen, die in unserem Haus ein und aus gingen, ein allgegenwärtiges, ein sehr dominantes Dauerthema – umständehalber viel präsenter als bei normalen Schweizer Familien. Und ich hörte stets mit spitzen Ohren mit, was gesprochen wurde, insbesondere wenn die grossen Leute flüsterten. Und sie flüsterten oft und leidenschaftlich. Diese rechneten nicht damit, dass sich das Kind für die Themen der Erwachsenen interessieren würde. Und sie rechneten ohnehin nicht damit, dass dieses Kind die Zusammenhänge verstehen würde. Aber das Kind verstand diese Welt der Erwachsenen immer besser. Ich interessierte mich dafür und ich brachte die Zusammenhänge immer logischer auf die Reihe, auf jeden Fall viel besser als man mir das zutraute. Krieg war für mich das Synonym für Verwüstung, Zerstörung und Tod, der Inbegriff des Bösen! Auch die fünf Brüder meiner Mutter und ein Bruder meines Vaters dienten als Soldaten im Krieg. Die Sorge meiner Mutter galt ihnen in gleicher Weise. Mehrere Male fühlte ich mich auch persönlich bedroht, zum Beispiel wenn hunderte Flugzeuge der US-Streitkräfte in niedriger Höhe über das Rheintal gegen Norden flogen, um Minuten später ihre tödliche Fracht über der Stadt Friedrichshafen am Bodensee – nur 50 Kilometer entfernt von uns - abzuwerfen. Die Detonationen der dicht aufeinander folgenden Bombeneinschläge drangen in sehr bedrohlicher Weise bis zu uns vor und liessen die Erde unter unseren Füssen beben. In solchen Momenten weinte meine Mutter und sagte, dass nun wieder hunderte unschuldige Menschen sterben müssten und tausende obdachlos würden. Ich versuchte sie in jedem Fall zu trösten, ihr Halt zu geben. Ich erinnere mich auch noch gut an die Nacht im Jahr 1945, als die französischen Befreier von Norden her in Vorarlberg einmarschierten und die letzten Widerstandsnester in und um Götzis mit Kanonen beschossen wurden. Die Leuchtspuren wiesen den Weg der Kanonenkugeln: In weitem Bogen flogen die Geschosse seitlich an uns vorbei und schlugen weniger als 20 Kilometer von uns entfernt ein. Dort wo sie nieder gingen, war das mit lauten Detonationen verbunden und es entstand eine Feuersbrunst, die den Himmel in gespenstiger Weise erhellte. Noch zehn Jahre später waren am Kirchturm von Götzis Dutzende Einschläge zu sehen. Der Turm war beschädigt, aber er stürzte nicht ein. Meine Mutter erklärte, dass Gott die Kirche beschützt habe. Die Einwohner von Götzis erzählten später, dass durch die Einschläge der Granaten der Turm zu vibrieren begann und die Glocken ähnliche Töne von sich gaben, als hätte man sie geläutet. Meine Erinnerung ist auch noch frisch hinsichtlich eines anderen Ereignisses, das mich stark beschäftigte: Ein Amerikanisches B17-Flugzeug stürzte in unserer Gegend ab. Mit auffällig unregelmässig knatternden Motoren und einer Rauchschwade hinter sich nachziehend, stürzte der Flieger in einiger Entfernung ins Feld. Die Besatzung rettete sich mit Fallschirmen aus der Maschine. Meine Tante Sidy, ein junges Mädchen von nicht mal 25 Jahren, die zur Entlastung der Mutter in unserem Haushalt tätig war, zog mir und Werner eilig die Schuhe an und nahm uns an der Hand. Und was mir auch noch geblieben ist: In ihrer Aufregung beachtete die Tante nicht, dass der linke Schuh an meinem rechten Fuss sass und der rechte Schuh am linken Fuss. Aber Zeit zum Wechseln gab es nicht mehr. Zwei Besatzungsmitglieder trug es mit ihren hellen Fallschirmen in unsere unmittelbare Nähe. Einen trieb es nach Osten ab und wir mussten annehmen, dass er in den Rhein stürzte oder eben auf die andere Rheinseite. Der zweite Fallschirmspringer versuchte verzweifelt gleichfalls auf die andere Rheinseite zu gelangen, was meine Tante nicht fassen konnte. Er zerrte an den Leinen und zappelte mit seinen Beinen, so als wäre er ein Hampelmann. Schlussendlich purzelte er wenige Meter vor uns zu Boden und der weiss gleissende Fallschirm bedeckte ihn vollständig. Schliesslich krabbelte er – ein sehr junger Mann, wie ich erkannte – unter dem Stoff hervor und blickte uns mit erschrockenen Augen an. Meine Tante, die auch Englisch sprach, beruhigte ihn in seiner Sprache. Sie eröffnete ihm, dass er Glück habe, denn hier sei er in der Schweiz angekommen, was ihn offensichtlich erstaunte. Er hatte geglaubt, dass diese Seite Feindesland sei und auf der anderen Seite des Rheins die Schweiz. Meine Tante, eine eher resolute junge Frau, bemerkte auf Deutsch, dass Amerikaner offensichtlich keine Ahnung in Sachen Geografie hätten. Der Mann fragte, wo sein Kamerad sei. Tante Sidy antwortete, dass er entweder in den Rhein gefallen sei oder eben wohl auf Feindesland, was ihn sichtlich traurig stimmte. Schon nach wenigen Minuten langte eine Patrouille der Schweizer Armee ein und lud den Amerikaner samt Fallschirm in den Jeep ein und fuhr davon. Dabei wurde der Amerikaner mit harschen Worten empfangen und sehr grob geschubst, was mir absolut missfiel und meiner Tante ebenso. Sidy sagte in aufgebrachtem Ton zu den Schweizer Soldaten, dass sie anständig sein sollten zum armen Kerl. Diese maulten zurück, dass dies kein armer Kerl sei, im Gegenteil, er sei ein Glückspilz, weil für ihn nun der Krieg vorbei sei und er noch immer am Leben.
Mein Vater gelangte nach Ende des Krieges noch in Gefangenschaft der Alliierten, kehrte schliesslich 1946 wohlbehalten heim.
Ein Jahr später wurde ich eingeschult, ohne zuvor den Kindergarten besucht zu haben. Meine Mutter hatte befunden, dass es mir zuhause mit dem Bruder als Spielkamerad besser gehen würde. In der Schule lernte ich dann andere Sitten kennen. Als friedfertiges Kind, das jeglicher Streiterei aus dem Weg ging, wurde ich fallweise Opfer aggressiver (allerdings soweit nicht bösartiger) Buben. Weil ich mich niemals aktiv wehrte, fiel ich dem schönsten Mädchen in der Klasse auf: Judith. Judith teilte mit mir den Sinn für Gerechtigkeit. Ihr gefiel ganz offensichtlich mein gewaltfreies Verhalten. Sie stürzte sich beherzt - sich selbst nicht schonend – an meiner statt in den Kampf gegen die Übermacht der Buben, sobald ich von diesen bedrängt wurde. Denn Judith war nicht nur schön, sondern ebenso kräftig und mutig. Und sie besass gleich mir einen Sinn für Friedfertigkeit, Ruhe und Ordnung. Mit Lineal und Griffelschachtel verteidigte sie mich so vehement, dass im Laufe der Zeit dies und jenes zu Bruche ging. Ich verliebte mich in meinen starken Schutzengel, sie wurde mein Schulschatz. Zwanzig Jahre später heirateten wir, Judith und ich. Vor einigen Jahren feierten wir unser Goldenes Ehejubiläum – Sie wissen, es bedeutet 50 Jahre verheiratet.
Als unser Sohn Kornelius in die erste Klasse kam, berichtete mir Jules, der Abwart des Schulhauses, ein lieber Freund, dass der neue Jahrgang ein ganz wilder sei, einer, wie er noch nie je zuvor erlebt habe. Und das wildeste Kind unter allen sei offensichtlich unser Sohn Kornelius. In jeder Pause sei er, der Schulabwart, genötigt einen Knäuel raufender Buben auseinander zu schälen und zuunterst würde immer unser Söhnchen Kornelius zum Vorschein kommen - und dies mit lachendem Gesicht. Anscheinend mache es dem Buben einfach Spass, die Kraft raus zu lassen und mit anderen herum zu balgen. Aber, mit Verlaub, er könne sich dies einfach nicht zusammenreimen. Denn ich - sein Vater - sei doch immer so ein friedfertiger, nicht aggressiver Junge gewesen. «Du und Dein Sohn sind diesbezüglich so was von unterschiedlich!» Ich antwortete meinem Freund: «Ob Du es glaubst oder nicht, ich bin sein Vater! - Oder hast Du Zweifel?» Jules fiel mir beinahe ins Wort, so schnell antwortete er: «Ja, Du bist gewiss sein Vater! - Aber sonderbar ist das schon!»
Die Eltern von Kornelius hätten freilich einen schlüssigen Erklärungsansatz gehabt für dieses Phänomen. Schliesslich hat jedes Kind zwei Elternteile. Doch wir zogen es vor eine entsprechende Erklärung für uns zu behalten. Eigenartig war nur, dass Kornelius zuhause und auch wenn wir auf Reisen waren, sich als sehr gesittetes Kind benahm. Wir erhielten sogar oft Komplimente, weil sich der Bub in der Öffentlichkeit, in Restaurants und Hotels, wirklich auffallend wohl erzogen gab. In Sachen Aggressivität fiel er nach unserer Wahrnehmung höchstens dadurch auf, dass er im Winter mit seinen Skiern wie ein Berserker die Schneepisten runter pfiff und im Sommer auf ziemlich waghalsige Art und Weise mit seinem Trottinett - heisst jetzt wohl Kickboard - auf der ins Dorf runter führenden Strasse regelmässig seinen eigenen Mut testete. Immerhin trug der Junge meist einen Sturzhelm, was für uns Eltern zumindest eine kleine Beruhigungspille war. Kornelius’ Verhalten gegenüber seinen Kollegen in der ersten Klasse erklärten wir uns so, dass er es hiermit zum ersten Mal im Leben mit Gleichaltrigen zu tun bekam. Denn weil das Kind jeden Mittag ein längeres Schläfchen genoss, hatte meine Frau entschieden, den Sohnemann nicht in den Kindergarten zu schicken. Einen Kindergartenzwang gab es zu Anfang der Siebzigerjahre noch nicht. Kornelius musste zu Beginn seiner Schulzeit lernen in einer Gemeinschaft – seiner Klasse – sich zurecht zu finden. Dabei fühlte er sich offensichtlich richtiggehend herausgefordert, seine Kraft mit anderen zu messen. Und dies mit grossem Spass, Engagement und täglich neuen blauen Flecken.
*