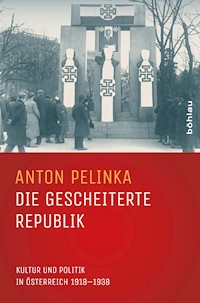Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Was am Beginn des 20. Jahrhunderts noch eine exotische Ausnahme war, wurde ein Jahrhundert später zur Normalität: Frauen eroberten politische Machtpositionen, im demokratischen Wettbewerb mit Männern. Welchen Einfluss hat diese Veränderung auf die Inhalte der Politik? Und wie verändern sich dadurch Bilder von Weiblichkeit? Das 20.Jahrhundert war durch einen politischen Megatrend charakterisiert – durch die Feminisierung der Politik. Anhand einer luziden Analyse der politischen Karriere von drei erfolgreichen Frauen geht der bekannte Politikwissenschaftler Anton Pelinka der Frage nach, welchen Einfluss das Geschlecht von politisch Handelnden auf die Inhalte von Politik hatte und hat. Die Untersuchung der Erfolgsstrategien und Alleinstellungsmerkmale von Eleanor Roosevelt, Indira Gandhi und Margaret Thatcher helfen uns die Rolle von Politikerinnen der Gegenwart besser zu verstehen. Gleichzeitig vermitteln diese Kurzbiografien dreier Ausnahmepolitikerinnen eine leicht verständliche und erhellende Geschichte des 20. Jahrhunderts in Bezug auf Gleichstellungskämpfe und -errungenschaften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anton Pelinka
Der politische Aufstieg der Frauen
Am Beispiel von Eleanor Roosevelt, Indira Gandhi und Margaret Thatcher
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Zeltgasse 1, A-1080 Wien Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Lektorat: Ellen Palli, Innsbruck
Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien
Satz: Bettina Waringer, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21141-9
Inhalt
EINSTIEG: DAS JAHRHUNDERT DER FRAUEN
1. DIE EPOCHE DES AUFSTIEGS WEIBLICHER POLITIK
1.1 Vom Ausnahme- zum Normalfall
1.2 Feminisierung als Modernisierung
2. ELEANOR ROOSEVELT: INDIREKTE POLITIK
2.1 Die politische Sozialisation einer politischen Frau neuen Typs
2.2 Das Unverwechselbare an Eleanor Roosevelt
2.2.1 Gleiche Rechte für alle
2.2.2 Sozialstaat
2.2.3 Internationalismus
3. INDIRA GANDHI: HINEINGEBOREN INS ZENTRUM DES POLITISCHEN GESCHEHENS
3.1 Die politische Sozialisation einer privilegierten Tochter
3.2 Das Unverwechselbare an Indira Gandhi
3.2.1 Modernisierung
3.2.2 Säkularismus
3.2.3 Großmacht- und Weltpolitik
4. MARGARET THATCHER: JENSEITS VON HERKUNFT UND FAMILIE
4.1 Die politische Sozialisation einer konservativen Revolutionärin
4.2 Das Unverwechselbare an Margaret Thatcher
4.2.1 Neoliberalismus
4.2.2 Atlantizismus
4.2.3 Weltpolitischer Realismus
5. DAS WEIBLICHE IN DER POLITIK: SELBSTZERSTÖRUNG DURCH ERFOLG?
5.1 Frauen in der Politik – Weibliche Politik?
5.2 Zwei andere Entwürfe – Rosa Luxemburg und Hannah Arendt
5.3 Nicht Auszug aus der – Einzug in die Politik!
5.4 Kein Patriarchat und kein Matriarchat
BIBLIOGRAPHIE
NAMENSREGISTER
NACHWORT
Einstieg: Das Jahrhundert der Frauen
Das 20. Jahrhundert wurde durch einen politischen Megatrend geprägt – durch die Feminisierung der Politik. Nahezu überall, jedenfalls in allen durch politischen Pluralismus gekennzeichneten Demokratien, erhielten Frauen dieselben politischen Rechte wie Männer. Sie konnten wählen – und sie konnten in Parlamente gewählt, in Regierungen entsandt werden.
Die Auswirkungen dieser Gleichstellung waren zunächst nur bescheiden. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein waren Frauen im US-Kongress, im britischen Unterhaus und in anderen Parlamenten eine kleine, exotisch anmutende Minderheit. Ihr Anteil an den Sitzen in den Parlamenten und in den Kabinetten der Staats- und Regierungschefs widersprach eklatant dem Anteil der Frauen an den Wählenden. Frauen waren über Jahrzehnte auffallend unterrepräsentiert in einer Demokratie, die – unvermeidlich – auf dem Grundgedanken der Repräsentation aufbaute.
Dieses Missverhältnis änderte sich mit auffallender Geschwindigkeit in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts. Und am Beginn des 21. Jahrhunderts werden Regierungen oft daran gemessen, ob sie im gleichen Maße „weiblich“ wie „männlich“ sind. Eine 50-Prozent-Quote von Frauen wird oft angestrebt – etwa von Parteien, die für Parlamentswahlen sich zu einem „Reißverschlussverfahren“ verpflichtet haben, in dem auf den zur Wahl stehenden Listen eine Frau immer einem Mann folgen muss – oder umgekehrt. Bei Regierungsbildungen wird oft eine „gendergerechte“ 50 : 50-Quote angestrebt, und auch die 2019 gebildete Europäische Kommission (unter der Präsidentschaft einer Frau) versuchte, eine solche Form der Balance zwischen den Geschlechtern herzustellen.
Diese Versuche waren bisher nur selten erfolgreich – im Sinne einer buchstabengetreuen Umsetzung eines solchen Vorhabens. Aber insgesamt gibt es kaum eine Demokratie, die sich 2020 erlauben könnte, eine ausschließlich von Männern gebildete Regierung zu legitimieren; und Frauen in den Parlamenten sind schon seit Jahrzehnten keine exotischen Ausnahmeerscheinungen mehr.
Für diesen signifikanten Wandel gibt es Gründe. Der wichtigste ist, dass Frauen – jedenfalls viele – dazu neigen, Parteien an der Wahlurne zu bestrafen, die ihnen zu sehr „männerdominiert“ erscheinen. Mehr und mehr Frauen nützen ihre Macht als Wählende – und stärken so die Feminisierung der Politik. Der bloße Anschein von Frauenfeindlichkeit ist zum Nachteil geworden, und Frauenfeindlichkeit wird auch daran gemessen, in welchem Ausmaß Frauen für politische Spitzenpositionen kandidieren. Parteien fördern daher – aus Eigeninteresse, aus dem Interesse am Wahlerfolg – die Rekrutierung von Frauen. Dieses Eigeninteresse wird, ja muss auch von den Männern in der Politik respektiert werden. Die Politik insgesamt ist jedenfalls im 20. Jahrhundert auf eine geradezu dramatische Weise „verweiblicht“.
Diese „Verweiblichung“ ist im Bereich von „politics“ verankert, ist überdeutlich bei den politischen Prozessen und Institutionen: Parteien wollen Wahlen gewinnen und berücksichtigen daher die Wünsche auch und vielleicht speziell gender-sensibler Wählerinnen; Parlamente haben aufgehört, geschlossene Männerklubs zu sein; Regierungen dürfen – auch und gerade in ihrer Außenwirkung – keinesfalls als „männerbündisch“ erscheinen. Aber was bedeutet das für den Bereich der „policies“, für die Inhalte der nun eben nicht mehr nur (oder fast ausschließlich) von Männern zu verantwortenden Entscheidungen? Wenn Parlamente und Regierungen „verweiblichen“, „verweiblichen“ dann auch die politischen Inhalte, die Weichenstellungen, die für die Zukunft der Gesellschaft bestimmend sind?
Damit verbunden ist die Frage nach einer weiblichen Identitätspolitik – „female identity politics“: Waren, sind die Erfolge von Frauen in der Politik ursächlich damit verbunden, dass sie speziell eine weibliche Identität, eine vor allem weibliche Loyalität ansprechen – dass Frauen vor allem Politik für Frauen machen oder machen sollen? Hat Politik, artikuliert und umgesetzt von Frauen, vor allem die Konsequenz, dass die Identität von Frauen gestärkt wird, deren Selbstbewusstsein, deren Selbstvertrauen – oder ist das ein, wenn überhaupt vorhanden, nur sekundärer Effekt weiblicher Politik? Mobilisiert weibliche Politik vor allem Frauen – und stärkt sie in erster Linie weibliches Bewusstsein in der Politik? In welchem Maße verfestigt weibliche Politik, die vor allem an die Loyalität von Frauen mit Frauen appelliert, den „gender gap“ – die vorhandenen Unterschiede im politischen Verhalten der Geschlechter – und vertieft damit politische Gegensätze zwischen Frauen und Männern? Was verbindet die Interessen von Frauen – von wohlhabenden und armen, von jungen und alten Frauen? Von Frauen mit und Frauen ohne höhere Bildung? Sind die Interessen von Frauen nicht ebenso vielfältig, ebenso widersprüchlich wie die Interessen von Männern?
Diesen Fragestellungen wird am Beispiel von drei Frauen nachgegangen, die – ausgestattet mit weltweiter Prominenz, mit politischer Macht, ja mit Geschichtsmächtigkeit – auf unterschiedliche Weise die geänderte Rolle von Frauen in der Politik repräsentieren. Dass diese Frauen prägende politische Rollen spielen konnten – als Frauen, das war in jedem dieser Fälle eine politische Pionierleistung. Dass diese ihre politischen Rollen wesentliche Folgen hatten, für ihr Land und für die Welt – also einen nationalen und globalen „impact“, kann für Eleanor Roosevelt, für Indira Gandhi, für Margaret Thatcher außer Streit gestellt werden. Aber was war das spezifisch „Weibliche“ an den Resultaten ihrer politischen Tätigkeit, ihrer politischen Erfolge? Dass die Geschichte der USA, die Geschichte Indiens, die Geschichte des Vereinigten Königreiches signifikant von diesen drei Frauen beeinflusst wurde – das ist das Eine. Das Andere ist die Frage: Haben Eleanor Roosevelt, Indira Gandhi, Margaret Thatcher Geschichte gemacht, und zwar nicht nur als Frauen, nicht nur als Pioniere weiblicher Politik, sondern Geschichte mit einer erkennbaren spezifisch weiblichen Qualität?
1. Die Epoche des Aufstiegs weiblicher Politik
‚Frauen‘ als kohärente politische Einheit entsteht aus der Feststellung eines Unterschiedes beziehungsweise Gegensatzes zu ‚Männer‘. Auf Grund dieser Entstehungsgeschichte ist der politische Begriff ‚Frauen‘ primär eine strategische Vorgehensweise und weniger eine theoretische Ableitung. (Rosenberger 1996, 39 f.)
Frauen machten auch vor dem Siegeszug der pluralistischen, der liberalen Demokratie Geschichte. Aber sie wurden immer nur als „Lückenbüßer“ in einem feudalen System in politische Funktionen gebracht – weil absolute Herrscher keine Söhne hatten, folgten auf Heinrich VIII. in England Elisabeth I. und auf Karl VI. im Reich der Habsburger Maria Theresia auf den Thron. Diese Herrscherinnen machten Geschichte. Und sie waren in mehrfacher Weise Ausnahmeerscheinungen: Eine Frau an der Spitze eines Reiches war eigentlich nicht vorgesehen. Regeln mussten verändert oder willkürlich interpretiert werden, damit Elisabeth und Maria Theresia regieren konnten. Beide waren aber auch Ausnahmeerscheinungen, weil in der im Gefolge der Renaissance von antiken Denkmustern geprägten europäischen Zivilisation von Frauen alles Mögliche, nur nicht Geschichtsmächtigkeit erwartet wurde.
Geschichtsmächtig aber waren sie ohne Zweifel – Elisabeth und Maria Theresia und auch Katharina, die Zarina, der nicht zufällig von der Geschichtsschreibung der Zusatz „die Große“ verliehen wurde. Insofern waren Elisabeth, Maria Theresia und Katharina auch „role models“ für Frauen, die im 20. und 21. Jahrhundert – unter postfeudalen, unter demokratischen Vorzeichen – politisch mächtig wurden: Es brauchte eigentlich nicht mehr den Nachweis, dass Frauen politisch befähigt sind. Die Frage war freilich: Waren, sind sie befähigt wie Männer auch, oder hat ihre Befähigung eine besondere, eine weibliche Qualität, die sich von der männlichen deutlich unterscheidet?
Das 20. Jahrhundert brachte entscheidende Veränderungen für die gesellschaftliche Position und die politischen Möglichkeiten von Frauen. Hannah Arendt hat die Lebensgeschichte Rahel Varnhagens genützt, um die doppelte Entfremdung einer gebildeten, sozial abgesicherten, ökonomisch privilegierten Frau im Berlin und im Wien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zu analysieren. Varnhagen blieb, weil Frau und Jüdin, Paria – trotz ihrer gesellschaftlichen Position als Angehörige einer reichen Familie (Arendt 1959). Es war ihr unmöglich, Politik zu gestalten, wie dies eineinhalb Jahrhunderte später Indira Gandhi und Margaret Thatcher möglich war. Und im Umfeld des Absolutismus des Hohenzollern- und des Habsburger Reiches – in einer quasi selbstverständlich antisemitischen Atmosphäre – wäre ihr die politische Rolle, wie sie im 20. Jahrhundert von Eleanor Roosevelt ausgeübt wurde, auch verwehrt gewesen: eine Rolle als meinungsbildende Intellektuelle.
Hundert Jahre später wäre Varnhagen, etwa im Deutschland der Weimarer Republik, als Frau „ermächtigt“ gewesen – sich in einer Partei zu engagieren, in ein Parlament einzuziehen, also nicht nur in Salons über Politik zu parlieren, sondern selbst Politik zu „machen“. Wenige Jahre später allerdings hätte sie als Jüdin um ihr Leben fürchten müssen – und als Frau hätte sie sich in der deutschen Politik zwischen 1933 und 1945 in der Ordnung des NS-Staates nur als Heil-Rufende betätigen können. Ab 1945 aber hätte sich das Fenster wieder geöffnet, das ihr zwischen 1918 und 1933 offengestanden war. Und in den folgenden Jahrzehnten hätte sie sich politisch entwickeln können, wie dies davor einer Frau (und Jüdin) nie möglich gewesen wäre. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war so etwas wie eine goldene politische Epoche für Frauen in Europa. Diese Epoche war nicht „golden“ im Sinne einer auch nur annähernd erreichten Perfektion – aber sie war die relativ beste, die Frauen generell, jenseits des aristokratischen Milieus, in Europa bis dahin je erfahren hatten.
Frau-Sein ist jedenfalls zwei Jahrhunderte nach Rahel Varnhagen nicht mehr mit einem Paria-Status gleichzusetzen – jedenfalls nicht in Europa, jedenfalls nicht in der Politik. Allen in der Politik Aktiven ist bewusst, dass die Frauen nicht nur die Hälfte der Gesellschaft stellen, sondern auch die Hälfte derer, die darüber entscheiden, was in Parlamenten beschlossen wird und welchen Kurs die einzelnen Regierungen verfolgen. Gemessen an der Ausgangslage am Beginn des 19. und der am Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Situation von und für Frauen in der Politik am Beginn des 21. Jahrhunderts eine ganz andere. Passt diese Entwicklung nicht in eine generelle Erfolgsgeschichte des Feminismus, der Frauenbewegungen?
Für Eric Hobsbawm ist das 20. Jahrhundert die Epoche der Extreme (Hobsbawm 1996). Dafür kann Hobsbawm gute Gründe anführen: Die erste Hälfte des Jahrhunderts war durch die – vermutlich – größten Katastrophen gekennzeichnet, die Politik je verursacht hat: durch die beiden Weltkriege und den Holocaust. Aber auch wenn Hobsbawm diesbezüglich zugestimmt werden kann und muss – ist seine Sichtweise nicht eine eurozentrische? War das 20. Jahrhundert auch für den gesamten amerikanischen Kontinent durch bis dahin nicht gekannte politische Extreme charakterisiert? Wäre nicht die „Entdeckung Amerikas“, die Landnahme und Besiedlung der westlichen Hemisphäre durch europäische Mächte, wäre nicht die mit den Begleiterscheinungen eines Völkermordes vorangetriebene Marginalisierung der indigenen Bewohner ein überzeugenderer Grund, nicht das 20., sondern das 16. und 17. Jahrhundert als Epoche der Extreme zu qualifizieren, jedenfalls für die gesamte westliche Hälfte der Welt? Und Süd- und Südostasien und Afrika – ist für diese Teile der Welt das 20. Jahrhundert nicht auch und vor allem die Umkehrung, die Zerstörung des Extrems des europäischen Kolonialismus, bestimmt vom Rückzug der „weißen“ Herrenmenschen?
Doch auch wenn die eurozentrische Betrachtung in Bezug auf Europa viel für sich hat – gibt es nicht auch aus europäischer Sicht Argumente, Hobsbawms Befund zu relativieren? Am Ende des 20. Jahrhunderts stand ja, auch nach Hobsbawm, der Niedergang, jedenfalls das Verdämmern der Extreme: Nachdem der intendiert zerstörerischen, Völker und „Rassen“ mordenden Expansion des nationalsozialistischen Deutschland im Mai 1945 mit militärischer Gewalt ein Ende bereitet war, war verglichen damit die zweite Hälfte des Jahrhunderts doch eine Abkehr von Extremen. Und 1989 folgte die Aufhebung der Dichotomie zwischen der „Ersten“, durch liberale (pluralistische) Demokratie und Kapitalismus definierten Welt und einer 1917 als revolutionäre Antithese entstandenen „Zweiten Welt“. Das 20. Jahrhundert war ein Hochschaukeln der Extreme – und dann, ab 1945, in den Jahrzehnten der poststalinistischen Koexistenz, ein Abflauen. Doch unabhängig vom Begriff des Extremen, wie ihn Hobsbawm verwendet, verdient das Jahrhundert auch eine andere generelle Bezeichnung: Das Jahrhundert des Fortschritts; eines insgesamt kontinuierlichen Fortschritts in der Beantwortung einer dauerhaft existenziellen Frage: die nach dem Verhältnis von Frau-Sein und Mann-Sein. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der systematischen Besserstellung der Frauen.
Für Hobsbawm ist der Feminismus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine Erscheinung, die vor allem von Frauen der Mittelklasse vorangetrieben wurde und primär diesen zugutekam (Hobsbawm 1996, 316 f.). Er konzediert auch, dass diese Entwicklung zu einer signifikanten Verschiebung des Frauenanteils in akademischen Berufen geführt hat, zur Angleichung männlicher und weiblicher Lebensperspektiven, zur Auflösung geschlechtsspezifischer Gettos. Aber Hobsbawms Sicht ist – und in diesem Sinn ist er orthodoxer Marxist – von dem alles andere überlagernden Fokus auf die „Klassenfrage“ bestimmt. Dass Frauen in diesem Jahrhundert in die Machtzentralen der Politik eingezogen sind, ist für ihn nicht bedeutungslos, aber von keiner primären Wichtigkeit – weil er keine Veränderung der sozioökonomischen Ungleichheit feststellen kann. Die „Frauenfrage“ ist für den Marxismus gegenüber der „Klassenfrage“ nachrangig. Und damit reduziert Hobsbawm die große Errungenschaft der Frauen des 20. Jahrhunderts – die Zerstörung des politischen Machtmonopols der Männer – zu einer Nebensache. Wenn es aber nur von sekundärer Bedeutung ist, dass Frauen Regierungen führen und darüber entscheiden, welche Gesetze beschlossen werden, dann ist es auch von sekundärer Bedeutung, was Menschen überhaupt in der Politik machen – zum Beispiel, ob und wen sie wählen. Dann ist Politik insgesamt sekundär.
Hobsbawm stellt für das Ende des 20. Jahrhunderts die weiter bestehende Verteilungsungerechtigkeit fest, die – gemessen an dem Graben zwischen Arm und Reich – weiterhin zu beobachten ist, trotz des politischen Aufstiegs der Frauen. Aber gibt es nicht – neben der Verteilungsgerechtigkeit – auch eine Zugangsgerechtigkeit? War die Verdrängung des Geburtsadels durch das Bürgertum im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht auch ein Fortschritt im Sinne einer Zunahme von Gleichheit? Und ist nicht die Zerstörung des männlichen Machtmonopols ein Mehr an Gleichheit, eben an Zugangsgleichheit?
Hobsbawm und andere, die wie er weiterhin dem Marxismus auch nach dem Ende des marxistisch-leninistischen Experiments verpflichtet blieben, müssen sich der Frage stellen: Was hat das jahrzehntelange Warten auf die Herstellung einer klassenlosen Gesellschaft dazu beigetragen, dass die „Frauenfrage“ im 21. Jahrhundert anders zu stellen ist als im Jahr der Oktoberrevolution? Ist das Patriarchat im Russland des 21. Jahrhunderts weniger dominant, weil mehrere Generationen russischer Frauen und Männer nicht „bürgerlich“, sondern „proletarisch“ erzogen wurden? Ist das postsowjetische Russland „fortschrittlicher“ als Westeuropa oder Nordamerika, bezogen auf die teilweise Überbrückung des Grabens, der die gesellschaftliche Stellung von Männern von der von Frauen trennt? Hat der Sozialismus à la W. I. Lenin den Frauen mehr gebracht als die liberale Demokratie à la Franklin Roosevelt? Wie begründet Hobsbawm seine Position, die den Feminismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als eine Bewegung der Mittelklasse für die Mittelklasse, also der Bourgeoisie für die Bourgeoisie abtut? Hobsbawms Relativierung der Erfolge der Frauenbewegung – die aus anderen Gründen auch von manchen Exponentinnen eines radikalen Feminismus geteilt wird, denen das Glas des weiblichen Fortschritts halb leer und nicht halb voll ist – läuft darauf hinaus, die Politik von Frauen fast abschätzig als bloß sekundär, jedenfalls als bescheiden zu sehen.
Das mag die Folge einer marxistischen Sichtweise sein, die alle Widersprüche, die es neben der „Klassenfrage“ gibt, als zweitrangig abtut. Aber dies bedeutet eigentlich, dass Politik insgesamt – eine Politik, die nicht „Revolution“ ist – sekundär ist; dass der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur zur Nebensache wird; dass Wahlerfolge, dass parlamentarisch vorgenommene Weichenstellungen ebenso sekundär sind wie der Anteil der Frauen in Parlamenten und die Einebnung der politischen Ungleichheit zwischen Frauen und Männern.
Ian Kershaw setzt bei seiner Analyse des 20. Jahrhunderts in Europa andere Akzente. Er bewertet die Erfolge des Feminismus als großen und bleibenden Fortschritt, als „major lasting achievement … one of the most important social changes of subsequent decades …“ (Kershaw 2018, 212). Kershaw freilich sieht diese Errungenschaften nicht primär in der Sphäre des Politischen, sondern in einem radikal veränderten Sexualverhalten. Dass Thatcher eine der bedeutendsten Personen der britischen und damit auch der europäischen Politik in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war, bestreitet Kershaw nicht im Geringsten. Dass ihr Aufstieg aber etwas mit Feminismus, mit einer wesentlich veränderten Sichtweise des „Weiblichen“ zu tun haben könnte, das sieht Kershaw nicht.
Kershaw ignoriert das eigentlich Politische am Feminismus – und in diesem Sinn ist sein Zugang dem marxistischen Zugang Hobsbawms ähnlich. Wie Hobsbawm ignoriert Kershaw die Bedeutung des Kulturbruchs, den der Einzug einer Frau in Downing Street 10 anzeigte – als Premierministerin. Und er ignoriert auch, dass Parteien überall in Europa im 21. Jahrhundert gezwungen sind, mit all ihrer Energie, unter Einsatz all ihrer Instrumente der Information und der Techniken der Beeinflussung, der Manipulation, sich um die Zustimmung von Frauen bemühen, bemühen müssen; und er ignoriert, dass in diesem demokratischen Wettbewerb die Frauen nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte des politischen Konkurrenzkampfes sind. Die Befreiung von rigiden Normen des Sexualverhaltens, eine vor allem Frauen betreffende Befreiung, ist sicherlich signifikant – aber ist nicht die politische Machtverschiebung zugunsten von Frauen, gegen den Widerstand von Männern, ebenfalls bedeutsam?
Tony Judt behandelt das Phänomen des Feminismus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ähnlich wie Kershaw. Er sieht darin eine Mischung einander überkreuzender Entwicklungen: eine Liberalisierung der Sexualmoral, die Entkriminalisierung der Abtreibung und einen rasant steigenden Anteil der Frauen am (vor allem westeuropäischen) Arbeitsmarkt (Judt 2005, 487–499). Zur Politik im engeren Sinn – zum ebenso rasant steigenden Anteil der Frauen in Parlamenten und Regierungen – zieht er keine Verbindung. Margaret Thatcher etwa betrachtet er vor allem als Exponentin einer „konservativen Revolution“ – und nicht als einer durchaus auch revolutionär zu nennenden Rolle der Frauen in der Politik (Judt 2005, 539–545).
Feminismus für Kershaw und Judt war (und ist) ein kulturell-gesellschaftliches Phänomen, dessen auch politisch prägende Kraft überhaupt nicht zu leugnen ist. Aber Feminismus und der Aufstieg von Frauen in Regierungen und Parlamenten – ein Aufstieg, der natürlich immer auf Kosten von Männern ging: Zwischen dem einem und dem anderen Feminismus wurde und wird keine kausale Verbindung hergestellt.
Hobsbawm, Kershaw, Judt – alle nehmen die Frauenbewegungen wahr, alle konzedieren dem Feminismus erkennbare Erfolge. Doch gerade der Blick auf die Politik im engeren Sinn wird kaum als Teil der Erfolgsbilanz gesehen. Hängt dies mit der Einsicht zusammen, dass der politische Aufstieg der Frauen einen graduellen, aber keinen prinzipiellen Unterschied gebracht hat – bei der Verteilung von Lebenschancen in einer Gesellschaft? Dass der Graben zwischen Arm und Reich – auch zwischen armen und reichen Regionen der Welt – nicht zu existieren aufgehört hat? Dass die politischen Erfolge der Frauen die Welt oder auch Europa nicht in ein Paradies verwandelt haben?
Die extremen Veränderungsschübe, die Europa im 20. Jahrhundert charakterisiert haben, sie haben auch eine extreme Veränderung des Frau-Seins und damit des Mann-Seins mit sich gebracht. Doch die Bilanz, die etwa Hobsbawm, Kershaw oder Judt ziehen, schließt die politische Dimension dieser extremen Veränderung nicht oder nur am Rande in ihre Gesamtbefunde ein.
Das 20. Jahrhundert war voll von Extremen. In diesem Jahrhundert wurde die Welt eine andere – aber nicht nur wegen der Mächte, die 1917 in Russland und 1933 in Deutschland zur Eroberung der Welt ansetzten: in Russland als eine sich wissenschaftlich tarnende Vorhersage, eine quasi religiöse Prophezeiung einer Weltrevolution; in Deutschland durch den Versuch einer „rassisch“ gerechtfertigten militärischen Expansion im Sinne von „Heute gehört uns Europa und morgen die ganze Welt“. Das 20. Jahrhundert war schrecklich – in seiner ersten Hälfte, und es war schrecklich vor allem in und für Europa. Aber aus der Sicht Indiens und Afrikas muss doch die Bilanz eine andere sein: Aus der Sicht Indiens und Afrikas war das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Befreiung.
Allerdings ist auch für Europa die Bilanz eine andere, sobald die zweite Hälfte des Jahrhunderts der ersten gegenübergestellt wird; wenn die viel weniger schreckliche Zeit nach 1945, nach 1953 mit der entsetzlichen Epoche zwischen 1914 und 1945 verglichen wird; mit den Jahren, die mit den Namen Stalin und Hitler identifiziert werden, mit den extremen Negativa der europäischen Geschichte. Dieses Jahrhundert insgesamt war doch auch eine Epoche der partiellen Aufhebung einer besonders extremen Dichotomie: Die politischen und gesellschaftlichen Grenzen zwischen den bis dahin voneinander konsequent und scharf getrennten Bereichen des „Männlichen“ und des „Weiblichen“ wurden durchlässig wie noch nie zuvor. Das, was als natürlich vorgegebene Trennung der einen Hälfte von der anderen Hälfte der Menschheit galt, gilt – jenseits der biologischen Differenz – so nicht mehr. Der Graben zwischen dem scheinbar so eindeutig „Männlichen“ und dem scheinbar so eindeutig „Weiblichen“ hat sich – teilweise – als überbrückbar erwiesen. Im Sinne der Dichotomie der Geschlechter war das 20. Jahrhundert nicht eine Epoche der Extreme – es war die Epoche einer Konvergenz, ja der Aufhebung der Extreme. Was um 1900 unumstritten das „Reich der Frauen“ war, abgeschirmt vom „Reich der Männer“ – auch und gerade von der Politik, die zum „Reich der Männer“ zählte, hat sich geöffnet. Der Harem ist nicht mehr, seine Mauern sind durchlässig geworden – jedenfalls in den meisten Teilen der Welt.
Die Ursachen dieser radikal neuen Durchlässigkeit waren vielfältig: Die Ökonomie war hungrig nach weiblicher Arbeitskraft; der Analphabetismus war generell im Rückzug – und damit stieg die Möglichkeit der Frauen, das Gleiche zu lernen wie die Männer. Das ermächtigte die eine Hälfte der Menschheit im gleichen Maße die Welt verstehen zu lernen wie die andere Hälfte. Begleitet, gerechtfertigt, ideologisch überhöht wurde diese neue Durchlässigkeit mit einem neuen Verständnis der Gleichheit der Menschen.
Diese das Jahrhundert charakterisierende allmähliche Aufhebung einer die gesamte Menschheitsgeschichte bestimmenden Dichotomie war in keinem anderen Bereich der Gesellschaft so sichtbar und in keinem anderen auch so umkämpft wie in der Politik. Am Beginn des Jahrhunderts bestimmten Männer die Politik. Am Beginn des 21. Jahrhunderts bestimmten Frauen und Männer die vormals ausschließlich männliche Sphäre des Politischen. Wie passt diese Entwicklung in eine Epoche der Extreme? Macht diese Veränderung das 20. Jahrhundert nicht doch zu einer Epoche der – teilweisen – Aufhebung der Extreme?
Im Zuge des 20. Jahrhundert setzte sich die Interpretation der Grundrechtsdeklarationen des späten 18. Jahrhunderts durch, dass die für „alle Menschen“ verkündeten Freiheiten, dass die Gleichheit vor dem Gesetz auch für Frauen gelten müssten. Die Konsequenz war das allgemeine und gleiche Wahlrecht nicht nur für Männer, sondern für Frauen und Männer gleichermaßen. Frauen wählten. Und Frauen wurden gewählt – zunächst als oft bestaunte, manchmal auch belächelte Ausnahmeerscheinungen in Parlamenten. Winston Churchill, der 1918 als (damals) Liberaler im britischen Unterhaus für die Einführung des Frauenwahlrechtes gestimmt hatte, verwendete in einer persönlichen Konfrontation mit der ersten konservativen Abgeordneten – Lady Nancy Astor – eine „witzige“ Wortwahl, die zwar in ihrer Sprachqualität über der Donald Trumps stand, die aber dennoch eindeutig als „antiweiblich“, als frauenfeindlich zu verstehen war (Roberts 2018, 167). Und Frances Perkins, Mitglied des Kabinetts Franklin D. Roosevelts, wurde von ihren männlichen Regierungskollegen zwar keinesfalls als politisches Leichtgewicht betrachtet – sie war aber doch irgendwie (nicht für den Präsidenten, und schon gar nicht für dessen Frau, aber in der öffentlichen Wahrnehmung) eine „Quotenfrau“; eine Ausnahme von der Regel einer männlich bestimmten Politik.
Das Einsickern von Frauen in die Zentren politischer Macht erfolgte in vorsichtigen, kleinen Schüben. Frauen, am Beginn des Jahrhunderts an der Spitze der Politik ganz einfach nicht vorhanden, wurden danach in den Sälen der hohen Politik zunächst zur exotischen Ausnahme, bis sie zur Selbstverständlichkeit wurden. Diese Entwicklung ist Teil eines generellen Zusammenbrechens von gesellschaftlichen Gettomauern. Das Verständnis von „Volk“, das im Laufe des 20. Jahrhunderts zum kaum bestrittenen – fiktiven – Souverän der Politik geworden war, ließ einen Ausschluss von Frauen (und auch von Minderheiten) ganz einfach nicht mehr zu.
Ab der Präsidentschaft Lyndon B. Johnsons wurden AfroamerikanerInnen Teil des Gruppenbildes jedes US-Kabinetts, bis, mit einer gewissen Logik, ein Afroamerikaner Präsident wurde. Dessen Nachfolger hütete sich, ein rein „weißes“ Kabinett zu bilden – und er berief auch Frauen in sein Regierungsteam. Die Ermächtigung von Frauen musste auch Donald Trump zur Kenntnis nehmen. Wetten dürfen abgeschlossen werden, wann mit derselben inneren Logik, die Barack Obama zum Präsidenten machte, eine Frau ins „Weiße Haus“ einziehen wird – und zwar nicht als „First Lady“.
1.1 Vom Ausnahme- zum Normalfall
Was im Fall von Nancy Astor und von Frances Perkins im britischen Unterhaus und im US-Kabinett eine viel beachtete Besonderheit war, ist – Jahrzehnte später – zu einem Normalfall geworden. In den demokratischen Parlamenten stieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Anteil weiblicher Abgeordneter kontinuierlich an. So waren Ende 2019 – dies nur als Beispiel für die generelle Entwicklung – 24 von 100 Mitgliedern des US-Senats weiblich, ein historischer Höchststand. 17 der Senatorinnen waren Angehörige der Demokratischen Partei (von insgesamt 47 demokratischen Senatsmitgliedern), 9 (von 53) der Republikanischen Partei. 1967, 52 Jahre zuvor, war eine einzige Frau Mitglied des Senats. Dieser Anstieg entsprach einer generellen Entwicklung – im US-Repräsentantenhaus, im britischen Unterhaus, im Parlament der EU. Und dies ist Teil eines weltweiten Trends, der noch nicht an einem Endpunkt angelangt ist.
„Die Frauen im Westen haben viel zu feiern, das sollten wir nicht vergessen“. Mary Beards Satz richtet sich an eine Art von Pflichtpessimismus, der in progressiven Milieus Europas und Nordamerikas weit verbreitet ist. Beard kritisiert damit eine Sicht auf den Fortschritt, die immer nur festhält, dass das Glas nicht voll ist. Dass es im Laufe der Jahrzehnte vor und nach 2000 aber immer voller wurde, das wird nur zu oft als unwesentlich abgetan. Und Beard weist auf einen anderen Umstand hin, der den politischen Machtzuwachs von Frauen zu überschatten scheint. Beard schreibt über ihre Mutter, die geboren wurde, bevor Frauen bei britischen Parlamentswahlen ihre Stimme abgeben durften: Was immer ihre Mutter „von Margaret Thatcher gehalten haben mag, sie freute sich, dass es eine Frau bis in die Downing Street Number 10 geschafft hatte, und sie war stolz darauf …“ (Beard 2018, 9).
Was immer man (frau) von den Erfolgen der Frauen inhaltlich hält, die auf demokratische Weise in Positionen politischer Macht gewählt worden sind, ist eigentlich sekundär: Dass die Ergebnisse dieses Aufstiegs von Frauen nicht alle Erwartungen erfüllen, auch nicht erfüllen können; dass das, was mächtige Frauen in der Politik erreichen, auch nicht annährend die politischen Verteilungskämpfe und die damit ursächlich verbundenen Ungerechtigkeiten durch generelle politische Befriedigung aller Bedürfnisse ersetzt hat; dass Frauen in der Politik diese nicht prinzipiell sanfter, liebenswerter, „besser“ gemacht haben – das ist doch die konsequente Umsetzung und Bestätigung des Grundgedankens, der die Frauenbewegungen des 19. und des 20. Jahrhundert angetrieben hat: des Grundsatzes der Gleichheit von Frauen und Männern.
Der offenbar unaufhaltsame politische Aufstieg von Frauen generell ändert nichts an der Besonderheit der politischen Rolle von Eleanor Roosevelt, von Indira Gandhi, von Margaret Thatcher. Diese drei Frauen waren Pionierinnen weiblicher Politik – freilich jede auf eine andere, höchst spezifische Art. Sie alle hatten maßgeblich Einfluss auf die Politik ihrer Länder und damit auf die Welt: Eleanor mehr durch die Begründung und Befestigung eines Narrativs des Fortschritts, bezogen insbesondere auf Frauen- und Minderheitenrechte. Indira und Margaret vor allem dadurch, dass sie durch eine zum jeweiligen Zeitpunkt eher unorthodoxe Art die politischen Systeme ihrer Staaten stabilisierten: Indira erreichte, ja erzwang Stabilität – und für einen beschränkten Zeitraum dies auch unter Verletzung demokratischer Freiheiten. Und Margaret begann eine zumindest für Europa signifikante Trendwende des politischen Zeitgeistes: von einer Hegemonie sozial- und wohlfahrtsstaatlicher Orientierung zu einer Hegemonie einer von Deregulierung gekennzeichneten, neoliberalen Marktwirtschaft. Alle drei sind aus der Geschichte nicht wegzudenken. Alle drei haben, auch und gerade durch ihre Gegenläufigkeit und Widersprüchlichkeit, prominente Plätze in der Geschichte.
Aber haben sie diese Bedeutung erreicht, weil sie Frauen waren – oder obwohl sie Frauen waren? Oder haben sie Geschichte gemacht, unabhängig von ihrer Weiblichkeit? Kann der Feminismus die drei Frauen für sich reklamieren, oder zumindest eine davon? Infrage käme für diese Rolle – aus der Sicht eines theoretisch konsistenten Feminismus – wohl zuallererst Eleanor. Mit Indira und Margaret tut sich der – jeder – Feminismus schwer.
Alle drei – Eleanor, Indira, Margaret – polarisieren. Sie wurden und werden in der Öffentlichkeit höchst gegensätzlich wahrgenommen: Sehr viele waren entschieden für sie, sehr viele waren ebenso entschieden gegen sie; und zwar Frauen wie auch Männer. Und diese Polarisierung hält bis heute an. Diese Polarisierung war nicht unbedingt die Intention der drei – jedenfalls nicht bei Indira, deren Politik darauf gerichtet war, der Polarisierung zwischen Religionen und Kasten Einhalt zu gebieten. Auch nicht die Absicht Eleanors, die historisches Unrecht gutmachen wollte – im Sinne dessen, was später „reversed discrimination“ genannt wurde. Aber Indira und Eleanor mussten zur Kenntnis nehmen, mussten akzeptieren, dass sie FreundInnen bestärkten – und die GegnerInnen ebenso.
Bei Margaret war dies wohl ganz anders. Sie war, anders als Eleanor und Indira, nicht an einer Politik der Inklusion oder auch des inhaltlichen Kompromisses interessiert. Sie lebte geradezu auf, wenn sie sich Gegner machte – in der eigenen Partei, und ebenso in der Konfrontation mit der parlamentarischen Opposition und den Gewerkschaften. Und wenn die Militärdiktatoren Argentiniens erwartet hätten, dass die britische Regierungschefin – weil Frau – einzuschüchtern wäre, dann hätten sie sich besonders getäuscht. Eleanor, Indira, Margaret sind darin vereint, dass sie den Erwartungen, an ihnen wäre etwas Gemeinsames zu entdecken (etwa das spezifisch Weibliche?), gerade nicht entsprachen.
Die erste der drei Frauen, die als Beispiele für die „Verweiblichung“ von „politics“ im 20. Jahrhundert herangezogen wird, lebte 12 Jahre im „Weißen Haus“ – als Frau des längstdienenden Präsidenten der Geschichte der USA. Sie hatte sich, anders als die beiden anderen Frauen, nicht in einem Wettbewerb im Rahmen eines Wahlkampfes zu bewähren. Sie war aber in ihrer politischen Funktion, in ihrer politischen Wirksamkeit teilweise davon abhängig, dass ihr Ehemann Wahlen gewinnen konnte. Das begründete ein besonderes Spannungsverhältnis – Eleanor konnte sprechen und vor allem auch schreiben, ohne unmittelbar Rücksicht auf das nehmen zu müssen, was „öffentliche Meinung“ heißt. Sie konnte Politik kommentieren und einfordern, auch gegen Mehrheitspositionen – im Interesse von Minderheiten. Aber sie musste akzeptieren, dass Franklin sehr wohl eine solche Rücksicht zu nehmen hatte; und dass ihre öffentlichen Wortmeldungen – mit denen sie die „öffentliche Meinung“ nicht zu berücksichtigen hatte, sehr wohl aber zu prägen vermochte –, dass das Gewicht ihrer Stimme auch davon beeinflusst wurde, ob Franklin Präsident werden und bleiben konnte.
Indira und Margaret waren – anders als Eleanor – nicht nur indirekt, sie waren auch direkt von den schwankenden Meinungsbildern in der Gesellschaft abhängig. Sie konnten nicht einfach ihre eigenen Grundsätze und ihre eigene Meinung zur einzigen Richtschnur ihres politischen Verhaltens erheben. Sie mussten, um Politik „machen“ und Gesellschaft wie auch Geschichte gestalten zu können, flexibel sein. Sie mussten sich dem Vorwurf des Opportunismus aussetzen. Sie waren immer wieder vor die Frage gestellt, welches „kleinere Übel“ sie in Kauf nehmen würden, um ein (in ihrer Sicht) „größeres Übel“ zu vermeiden. In diese Ambivalenz waren Indira und Margaret hineingestellt – nicht als Frauen, sondern als um Stimmen und damit um demokratische Legitimation Kämpfende; wie dies Männer in ihrem politischen Umfeld auch waren. Dieses Dilemma war kein spezifisch weibliches – es war und ist unter den Rahmenbedingungen eines demokratischen Mehrparteiensystems ein allgemein politisches (Pelinka 1999, 161–169).
Jawaharlal Nehru, Indiras Vater, war als Führer einer Partei (des INC, des Indian National Congress) und als Premierminister mit eben diesem Dilemma konfrontiert – wie auch John Major, Margarets Nachfolger als konservativer Parteiführer und Premierminister; und wie Franklin D. Roosevelt ebenso.
Eleanor unterschied sich von Indira und Margaret dadurch, dass sie selbst kein politisches Amt anstrebte – jedenfalls nicht das eines „chief executive officers“, eines Staats- oder Regierungschefs. Sie war auch nicht eine um Wahlerfolge bemühte Parlamentarierin. Ihre einzige formelle politische Spitzenfunktion war die einer Vertreterin der USA bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen – nominiert von Präsident Harry Truman, der durch die Bestellung Eleanors seinen Anspruch demonstrieren und stärken wollte, politischer Erbe des verstorbenen Franklin Roosevelt zu sein. Truman teilte dieses Erbe mit Franklins Witwe.
Eleanor war das Musterbeispiel einer „public intellectual“; einer Person, die in Wort und Schrift sich am öffentlichen politischen Diskurs beteiligte; sich an diesem rieb; und – auch – durch ihre Positionen als Frau des Präsidenten diesen Diskurs direkt und damit auch indirekt die Politik in besonderer Weise beeinflusste. Sie konnte dem politischen Prozess einen informellen Input geben. Von diesem Prozess selbst, der vor allem im Kabinett des Präsidenten und im Kongress stattfand, blieb sie ausgeschlossen. Freilich: Die Prominenz und das Gewicht ihrer Wortmeldungen und das Ausmaß an Zustimmung, die ihr ebenso entgegenkam wie heftige Kritik, standen immer auch in Verbindung mit der Position ihres Ehemannes.
Wie Indira unterschied sich Eleanor von Margaret durch ihre Herkunft: Eleanor stammte aus einer der Familien, die zur „Dutch aristocracy“ des US-Nordosten, speziell New Yorks und des Hudson-Tales gezählt wurden: Nachfahren der ersten, zu Reichtum gekommenen europäischen Siedler in dieser Region, die niederländischer Herkunft waren. Dass ihr Onkel Theodore Roosevelt Präsident der USA von 1901 bis 1909 war, dass ein entfernter Cousin (ihr Ehemann) 1932 erstmals und dann (als Bruch der von George Washington eingeführten Tradition, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfassungsrechtlich verankert war) 1936, 1940 und 1944 wieder gewählt wurde, signalisierte ihre Zugehörigkeit zur traditionellen Geburts-, freilich auch Leistungselite des republikanischen Amerika.
Diese elitäre Herkunft war bei Indira noch viel deutlicher. Aus einer Brahmanenfamilie Kaschmirs stammend, hatte sie an der Seite ihres Vaters dessen Aufstieg zum engsten Mitarbeiter Mahatma Gandhis miterlebt und in Grenzen auch mitgestaltet. Als Jawaharlal Nehru zum ersten Regierungschef des unabhängigen Indien wurde, war Indira bald eine seiner engsten MitarbeiterInnen. Ihr familiärer Hintergrund hatte sie in den engsten politischen Führungskreis Indiens gebracht. Anders freilich als Eleanor konnte (musste) sie sich schließlich als Partei- und Regierungschefin bewähren – bewähren vor allem in ihrer Fähigkeit, Wahlen zu gewinnen.
Der gesellschaftliche Hintergrund Margarets war da ein ganz anderer: Sie kam aus dem bürgerlichen Mittelstand, erwarb Qualifikationen durch ein universitäres Studium, und bei ihrem Eintritt in die Politik – als konservatives Mitglied des Unterhauses – konnte sie auf keine familiäre Tradition verweisen, die ihr beim Aufstieg an die Spitze von Partei und Regierung nützlich gewesen wäre. Margaret Thatcher verkörperte ein Prinzip pur: das der individuellen Meritokratie. Margaret stand auch für die weitgehend abgeschlossene Abkehr der Parteiführung von der Aristokratie: Winston Churchill stammte aus der Adelsfamilie der Marlborough, sein innerparteilicher Gegenspieler in den 1930er Jahren – Lord Halifax – hatte einen Sitz im House of Lords geerbt. Und als die Konservative Partei 1963 über die Nachfolge Harold Macmillans zu entscheiden hatte, entschied sie sich für Sir Alec Douglas-Home, den früheren Earl of Home. Douglas-Home musste erfahren, dass seine aristokratische Herkunft geradezu von Nachteil war: Er musste erst seinen (ererbten) Sitz im Oberhaus durch den Verzicht auf seinen Adelstitel loswerden, um – wie im 20. Jahrhundert de facto notwendig geworden – Partei- und Regierungschef im Unterhaus werden zu können (Rose 1965, 142 f.).
Das Ende der aristokratischen Verwurzelung der Partei hatte sich schon beim Aufstieg Edward Heaths abgezeichnet, der 1970 Premier wurde: Auch das war ein Signal für die „Verbürgerlichung“ der Konservativen Partei. Aber dass mit Margaret Thatcher eine bürgerliche, aus dem Mittelstand kommende Frau Edward Heath zunächst als Partei- und dann – nach zwei Labour-Kabinetten – auch als Regierungschefin nachfolgen sollte, das zeigte das Ineinandergreifen zweier Anpassungs- und Modernisierungsprozesse: Die Verbürgerlichung und ebenso die Verweiblichung einer ursprünglich aristokratischen Männerpartei. Leistung war an die Stelle von Herkunft getreten. Leistung steht aber Frauen und Männern gleichermaßen offen.
1.2 Feminisierung als Modernisierung
Die Übernahme politischer Führungspositionen durch Frauen war ein wesentlicher Teil eines allgemeinen Modernisierungsprozesses. Dass Frauen sich prominent am politischen Diskurs und am politischen Wettbewerb beteiligten, war Ausdruck eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels, der sich auch in der Politik niederschlug. Im 20. Jahrhundert wurde fast überall (jedenfalls im „Westen“) nicht nur die politische, sondern auch die familien- und vermögensrechtliche Gleichstellung von Frauen erkämpft. Fast überall eroberten Frauen den Zugang zu höherer Bildung, zeichneten sich Frauen in Wissenschaft und Forschung aus, drängten auf den Arbeitsmarkt in bis dahin für Männer reservierte Positionen – und sorgten dafür, dass die weiterhin bestehenden großen Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen Frauen und Männern als Defizit, ja als Skandal empfunden wurden. Fast überall wurden geschlechtsspezifische Trennungen allmählich aufgelöst: Frauen wurden Managerinnen und Lokführerinnen, Polizistinnen und Berufssoldatinnen, Leiterinnen von Universitätskliniken und Bischöfinnen protestantischer Kirchen – und eben auch Staats- oder Regierungschefinnen. Der insgesamt doch schnell erfolgte Aufstieg von Frauen in die Führungsetagen der Politik war Teil einer generellen Veränderung: In der Gesellschaft wurden (fast) alle geschlechtsspezifischen Grenzen aufgehoben – und die Politik war Teil des Gesamtbildes.
Eleanor, Indira, Margaret – alle drei hatten gemeinsam, dass sie im Zuge ihrer politischen Karriere Rollenmodelle wurden; Heroinen freilich mit höchst unterschiedlicher Ausstrahlung und Ausprägung. Eleanor wurde zur Identifikationsfigur der (links)liberalen Progressiven, denen in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren die faktische Rassendiskriminierung gerade auch durch die Demokratische Partei ein besonderes Ärgernis war. Des Weiteren sahen sie in der Krise des US-Kapitalismus, die 1929 eingesetzt hatte, ein entscheidendes Motiv für grundlegende Reformen des sozialen und ökonomischen Systems. Eleanor war eine der prominenten Stimmen dieses Progressismus. Und eben deshalb wurde sie auch für Konservative zu einer Provokation.
Ähnlich auch Indira: Sie verstörte diejenigen, die einer anti-modernistischen Tradition anhingen, wie sie auch in der Kongresspartei vertreten war; sie konfrontierte die faktisch vorhandene Kastendiskriminierung durch Programme, die der sozialen Durchlässigkeit dienen sollten; und sie propagierte eine systematische Geburtenkontrolle, um die Bevölkerungsexplosion unter Kontrolle zu halten und damit – indirekt – die Lebenschancen der indischen Frauen zu verbessern. Damit motivierte sie, freilich so von ihr nicht beabsichtigt, eine gegen sie gerichtete Allianz aus Hindu-Traditionalisten und denen, die in der Hegemonie des INC, der Kongresspartei, ein Defizit der indischen Demokratie sahen. Es war auch diese Allianz, die – zusätzlich von Indira durch die Ausrufung des Ausnahmezustandes 1975 provoziert – 1977 Indiras Wahlniederlage herbeiführte, die erste Niederlage der Kongresspartei auf der Ebene der Union überhaupt.
Eleanor und Indira hatten sich mit einer Gegnerschaft auseinanderzusetzen, die primär als „rechts“ einzustufen war: status-quo-orientierte Traditionalisten, die sich dem von Eleanor und Indira verkörperten Fortschritt entgegenstemmten. Da war die Opposition, auf die Margaret traf, eine ganz andere: Margarets Gegner wandten sich zwar auch gegen Innovationen, aber die Positionen dieser Anti-Thatcher-Opposition wurden und werden aus nachvollziehbaren Gründen nicht als „rechts“, sondern als „links“ eingestuft. Im Zuge ihrer Orientierung an einer Wirtschaftsordnung, die mit dem Namen Friedrich Hayek verbunden war, setzte Margaret Maßnahmen, die einige der Grundpfeiler des britischen Wohlfahrtsstaates gefährdeten, ja zum Einsturz brachten.
Margaret machte die nach 1945 von der Labour-Regierung Clement Attlees durchgeführten und von den nachfolgenden konservativen Regierungen weitgehend akzeptierten Verstaatlichungen rückgängig. Deshalb kam die massive Opposition gegen den „Thatcherismus“ von „links“; von den Gewerkschaften, von der Labour Party, von einem als linear vermuteten Fortschritt, der sich bald aber als einer von gestern herausstellen sollte. „Thatcherismus“ stand (und steht) für die Zerstörung eines sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Konsenses, wie er in Westeuropa nach 1945 dominant war. Thatcher wurde zum Symbol eines Fortschritts, der nicht mehr – im traditionellen Verständnis – nach „links“ führte, zu staatlicher Gleichheitspolitik, sondern nach „rechts“, zu einem teilweisen Rückzug des Staates aus Wirtschaft und Gesellschaft; „rechts“ im Sinne einer konsequent marktwirtschaftlichen, einer kapitalistischen Ordnung. „Thatcherismus“ wurde zum Synonym einer prinzipiellen Trendwende des politischen Zeitgeistes. In Abwandlung eines Slogans, den ihr politisch enger Freund Ronald Reagan geprägt hatte: Der Staat war für Margaret nicht die Lösung, er war das Problem.
Eleanor wurde zur progressiven Heroin, obwohl (weil?) sie nie in die Versuchung kam, sich die Hände „schmutzig“ zu machen. Ihr blieb die Notwendigkeit erspart, zwischen Übeln, zwischen dem einen und dem anderen, direkt abwägen zu