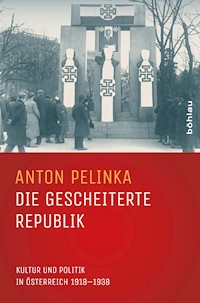19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die jahrzehntelange globale Weltvormachtstellung der USA ist unbestritten. Dies macht sie in seltener Einigung diametraler Pole zum Lieblings-Feindbild radikaler Islamisten wie liberal-intellektueller Europäer. Zeit für Uncle Sam, das Szepter an China oder die BRICS-Staaten weiterzugeben? Oder funktioniert die Annäherung etwa genau umgekehrt: Werden wir alle zu Amerikanern? Es stimmt, die USA sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Die USA mögen - als Volkswirtschaft - irgendwann im 21. Jahrhundert von China eingeholt werden. Die Militärmaschine der USA mag vieles von ihrer Überlegenheit einbüßen. Jedoch: Die Propheten des amerikanischen Untergangs sind Opfer ihres eigenen Wunschdenkens. Die USA sind im Wandel - sie sind aber nicht im Abstieg. Der Rest der Welt verringert den wirtschaftlich und militärisch gemessenen Abstand zur "westlichen Hegemonialmacht" tatsächlich immer mehr. Dies gelingt ihr jedoch nur aus einem Grund: weil sie den USA immer ähnlicher wird. Wir sind also, argumentiert Pelinka, alle Amerikaner - oder zumindest auf dem besten Weg zu solchen zu werden. Dass viele von uns das nicht sehen und schon gar nicht akzeptieren wollen, ändert nichts an den Mühlen eines Prozesses, der Globalisierung genannt wird; der aber genauso gut auch Amerikanisierung genannt werden kann. Die USA brauchen die Welt nicht zu beherrschen - die Welt ist dabei, sich Amerika immer mehr anzupassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Anton Pelinka
WIR SIND ALLE AMERIKANER
Anton Pelinka
WIR SIND ALLE
AMERIKANER
Der abgesagte Niedergang der USA
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2013© 2013 by Braumüller GmbHServitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Lektorat: Wolfgang StraubSatz: Palli & Palli OG, A-6020 InnsbruckCoverillustration unter Verwendung von Bildmaterialvon fckn_images / istockphoto.com und Mifti_Stock / sxc.huISBN der Printabgabe: 978-3-99100-099-0
ISBN E-Book: 978-3-99100-100-3
INHALT
Vorwort
Kein Untergang des Westens
Ein amerikanisches Zeitalter
The West and the Rest
Die USA: Spiegelbild der Stärken und Schwächen des Westens
Beacon on the Hill
Religiöser und sekundärreligiöser Messianismus
Widersprüche
Der große Unterschied
Von Amerika lernen?
Bestätigung und Wiederkehr der Faszination
Schmelztiegel Amerika
Die Elite definiert Volk und Nation
Eine neue Nation
Who Governs?
Back to Blood?
Das Schicksal der „WASPs“ und die Hartnäckigkeit der Hopi
Eine ganz normale Demokratie
Das Modell des Verfassungsstaates
Die Macht der Wächter
Amerika und Europa wachsen zusammen
Unterschiede und Parallelen
Zeichen des Niedergangs?
Weltmacht Amerika
Amerika: noch immer ein Traum
Anders als die anderen?
Gleichmacher Globalisierung
Die Naivität des Antiamerikanismus
Feindbild Amerika
Antiamerikanismus und legitime Kritik
Antiamerikanismus als Zeichen von Denkschwäche
Amerika als „Defining Other“?
Geschichtstrunkenes Amerika
Wer sind wir?
Der Bürgerkrieg
Kontinuität und Personalisierung
Die Globalisierung der Geschichte
Laboratorium der einen Welt
Amerika als Projektionsfläche
Demokratie ohne Alternative
Die große Lust am kleinen Unterschied
Die Macht der Megatrends
Die kosmopolitische Zukunft hat schon begonnen
Literatur
VORWORT
Eine Anregung für diese Arbeit war Simon Schamas wundervolles Buch „The American Future. A History from the Founding Fathers to Barack Obama“. Schama, mit dem gemeinsam ich ein Jahr (1990/91) als Fellow am Minda de Ginzburg Center for European Studies der Harvard University verbrachte, schrieb ein Buch, das seine persönlichen Erfahrungen als Europäer in Amerika mit einer Analyse von Politik und Gesellschaft der USA verband. Das machte mir Mut, ein Buch zu schreiben, das auf sehr persönlichen Erfahrungen beruht – und gleichzeitig auch so etwas wie den politikwissenschaftlichen Stand des Diskurses um Amerika ausdrückt.
Das Buch ist auch ein Diskussionsbeitrag zu der Debatte, die von meinem Freund Andrei Markovits auf den Punkt gebracht wurde: Europa (miss)braucht Amerika als „Defining Other“; als etwas, von dem Europa glaubt, sich ständig abgrenzen zu müssen. Markovits Argumentation überzeugt – was die subjektive Seite betrifft: die zumeist feindselige, misstrauische, jedenfalls immer auf Distanz bedachte Wahrnehmung Amerikas in weiten Teilen Europas. Meine Argumentation soll Markovits’ Position ergänzen: Europa bildet sich ein, von Amerika so verschieden zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es Amerika sehr, sehr ähnlich.
Der Hintergrund des Buches sind Erfahrungen, die ich über Jahrzehnte hindurch bei kürzeren und längeren Aufenthalten in den USA sammelte – ergänzt durch Erfahrungen, die ich in Vorlesungen und Seminaren in Hörsälen machen konnte: an europäischen, an amerikanischen Universitäten; Erfahrungen mit der Herausforderung, die Komplexität Amerikas „auf den Punkt“ zu bringen, ohne unzulässig zu vereinfachen.
Im Sinne der Alltagssprache verwende ich in diesem Buch den Begriff Amerika oft synonym für die USA. Das dient ebenfalls der Lesbarkeit – lateinamerikanische und kanadische Freunde mögen dies verzeihen. Die persönliche Note des Buches kommt in den ersten Absätzen jedes der acht Kapitel dadurch zum Ausdruck, dass sie kursiv gesetzt sind. Sie stehen für den subjektiven Zugang zu den einzelnen Themenbereichen. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, sind die Quellen- und Literaturbezüge auf ein Minimum reduziert.
Das Entstehen des Buches ist der bewährten Zusammenarbeit mit Ellen Palli zu verdanken, die – wie immer, bin ich versucht zu schreiben – für die technische Seite in höchst kompetenter Weise zuständig war.
Budapest, Wien, Innsbruck, Sommer 2013
KEIN UNTERGANG DES WESTENS
Dezember 1947. Im 18. Wiener Gemeindebezirk findet ein Weihnachtsfest für Schulkinder statt. Eingeladen haben „die Amerikaner“: Vertreter der USA, die 1945 Österreich befreit und gleichzeitig besetzt hatten – gemeinsam mit der UdSSR, Großbritannien, Frankreich. Der 18. Bezirk, in dem meine Familie wohnte, war Teil der US-Zone. Und ohne dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, einen Vergleich mit Weihnachtsfeiern in anderen Bezirken zu ziehen, war ich als gerade Sechsjähriger überzeugt, dass es eine schönere Weihnachtsfeier in ganz Wien nicht geben könnte.
Ich war positiv voreingenommen. Meine Eltern waren keine Nationalsozialisten und keine Kommunisten. Als politisch denkende Menschen sahen sie, im Österreich der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der Anwesenheit amerikanischer Truppen grundsätzlich nur Vorteile. Mir waren schon die großen amerikanischen Autos aufgefallen. Und die amerikanischen Soldaten waren in „meinem Bezirk“ immer nur freundlich – so schien es mir. Die Weihnachtsfeier bestärkte mich in meinem Urteil: Es gab viel Schokolade, ein Santa Claus trat auf – der sah „meinem“, dem Wiener Nikolaus sehr ähnlich. Und in dem Orchester, das für die Musikbegleitung sorgte, gab es eine Bassgeige, die mir beeindruckend riesig vorkam. Alles in allem – eine geglückte PR-Aktion der USA.
Vieles kam später dazu: US-Soldaten, die Baseball spielten – ein mir völlig unverständlicher Sport. Anders als Basketball, das ebenfalls von US-Soldaten gespielt wurde und das mich sofort faszinierte. Die Fotos, die ich von New York sah, inspirierten mich zu einem Drehbuch für ein Kindertheater – „Kasperls Reise nach New York“. Die USA beschäftigten mich. Aber ich wurde nicht zu einem unkritischen Bewunderer. In den 1950er-Jahren empörten mich die rassistischen Fanatiker, die – etwa in Little Rock, 1957 – die Aufhebung der Segregation „schwarzer“ Kinder verhindern wollten. Ich fand Dwight D. Eisenhowers Entscheidung, in Little Rock mit militärischer Gewalt das 1954 gefällte Urteil des Supreme Court umzusetzen, völlig richtig; auch wenn ich 1952 und 1956 die Daumen für den demokratischen Kandidaten Adlai Stevenson gedrückt hatte. Und 1960, im Jahr meiner Matura, hätte ich gerne John F. Kennedy unterstützt – wäre meine Hilfe nur gebraucht worden.
Die negative Seite der USA war durch den Ku-Klux-Klan symbolisiert. Dass die USA erst im Zuge eines blutigen Bürgerkriegs die Sklaverei abgeschafft hatten, dass fast ein Jahrhundert nach Abraham Lincoln die Rassendiskriminierung nicht aufgehört hatte, empörte mich. „Vom Winde verweht“ – „Gone with the Wind“ – verachtete ich als Propagandafilm amerikanischer Rassisten. Doch mir war bewusst, dass meine Einstellung nicht unbedingt typisch für meine Umgebung war. Da hörte ich nur zu oft: „Die Amerikaner haben doch keine Geschichte und keine Kultur“. Und in Bemerkungen, dass „Rassenmischung“ doch nur die „schlechten Eigenschaften der einzelnen Rassen“ fördern würde, hörte ich in Europa dieselbe Bereitschaft zu denselben unsinnigen wie gefährlichen Vorurteilen wie die, für die der Klan stand.
Doch wenn es in den Konfrontationen der Nachkriegszeit darauf ankam, emotional Partei zu ergreifen, war für mich die Seite der USA immer die „richtige“: Im Korea-Krieg vor allem, in dem ich, als Kind, einen Kampf des Guten gegen das Böse sah. Allmählich führte aber mein Interesse an Politik zu einer differenzierten Betrachtungsweise: Im Bau der Berliner Mauer etwa, 1961, sah ich primär ein Schwächezeichen des sowjetischen Systems und erst in zweiter Linie ein moralisch empörendes Ereignis. Und das schon unter Kennedy beginnende militärische Engagement in Vietnam hatte für mich vor allem eines: ein großes Fragezeichen. Nicht, dass ich eine Intervention der USA von vornherein verurteilt hätte – dazu war meine frühkindliche, positive Erfahrung mit den Befreiern des Jahres 1945 zu lebendig. Aber die Vietnam-Politik der USA war für mich ein gefährliches Experiment: Die USA sollten, in Verbindung mit den unendlichen Leiden eines vor allem Vietnam treffenden Krieges, die Grenzen ihrer Macht erfahren.
Als ich die Möglichkeit hatte, die Ein- und Ausreiseprozeduren auf US-amerikanischen Flughäfen mit denen auf sowjetischen zu vergleichen, war eines überdeutlich: In den USA wurde die Einreise streng kontrolliert – in der UdSSR die Ausreise. Die USA gingen, wohl aus guten Gründen, davon aus, dass es attraktiv ist, nach Amerika zu kommen. Die Sowjetunion musste, aus ebenso guten Gründen, von der Attraktivität der Ausreise (der Flucht?) aus dem Land Lenins ausgehen. Die USA mussten (und müssen) Zuwanderung kontrollieren. Die Sowjetunion sah sich durch Auswanderung bedroht.
EIN AMERIKANISCHES ZEITALTER
1947 verkündete Harry S. Truman die mit seinem Namen verbundene Doktrin. Diese wurde zur Grundlage für eine globale Politik der USA im Kalten Krieg. Motiviert durch die – scheinbare, anscheinende – Entschlossenheit der Sowjetunion, das sowjetische Modell des Regierens mit allen möglichen Mitteln weltweit zu exportieren, setzten die USA dagegen. „Containment“ hieß die Politik, der Truman folgte, gestützt auf das mit dem Namen George Kennan verbundene Strategiepapier: Der sowjetischen Expansion sei mit allen Mitteln Einhalt zu gebieten, nötigenfalls auch mit denen des Krieges. Die Bereitschaft der USA, einer sowjetischen Aggression auch militärisch entgegenzutreten, wurde als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Friedens gesehen, weil nur eine solche erkennbare, glaubwürdige Bereitschaft eine gewaltsame Ausweitung des sowjetischen Einflussbereiches zu verhindern versprach.
1949 wurde die Volksrepublik China ausgerufen, und in Vietnam war eine kommunistisch geführte Unabhängigkeitsbewegung nicht mehr zu stoppen. In ebendiesem Vietnam sollte die der Truman- Doktrin folgende US-Politik an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen. In Europa mit „Containment“ erfolgreich, fanden die USA in Asien zu keiner entsprechenden, erfolgreich umgesetzten Strategie.
Nach dem Zusammenbruch der UdSSR galten die USA aber als die einzige verbleibende Supermacht, die (wie 1991 im Irak sowie 1995 und 1999 im vormaligen Jugoslawien) der Welt ihren Stempel aufzudrücken vermochte. Die USA waren nicht unbedingt stärker geworden, ihnen war aber der Gegenspieler abhandengekommen. Die USA, so schien es, würden in den kommenden Jahrzehnten der Welt nach Belieben diktieren können.
Das alles wurde unter der Präsidentschaft George W. Bushs verspielt. Sein im Frühjahr 2003 verkündetes „mission accomplished“ – eine Triumphmeldung, mit der er sich und der Welt etwas vormachen wollte – ging in die Geschichte als Beispiel amerikanischer Selbstüberschätzung ein. Die USA waren in der Lage, das System eines irakischen Diktators zu zerstören. Die USA waren nicht in der Lage, einer Region Demokratie und Prosperität zu garantieren.
Seither sind die Medien voll von Fantasien über das Heraufdämmern eines von China bestimmten Zeitalters. Die USA – absteigend, China – aufsteigend. Seither werden mit guten und weniger guten Argumenten den USA ihre Schwächen vorgehalten: die wachsende Ungleichheit in der US-Gesellschaft, die Verschlechterung der Infrastruktur, das Ungenügen des öffentlichen Schulwesens, die Begrenzung der Handlungsfähigkeit durch eine zunehmend ideologisch polarisierte Innenpolitik, der immanente Gewaltcharakter der amerikanischen Gesellschaft, der weiter schwelende Rassismus.
Harry S. Truman und George W. Bush – waren das bereits Anfang und Ende des amerikanischen Zeitalters? Sind die USA ein gescheitertes Imperium, das primär die Geschichtswissenschaft interessiert, wie das Römische Kaiserreich oder Napoleons Empire? Übersehen wird bei diesen vorschnellen Nachrufen, wie sehr und wie dauerhaft die USA die Welt prägten – jenseits ihrer politischen, militärischen, wirtschaftlichen Macht. China ist zu einem formidablen Akteur der Weltpolitik geworden, weil sich Chinas Wirtschaft nach dem Ende der fatalen Kulturrevolution schrittweise an westlichen Vorbildern orientiert – das heißt, am Vorbild der USA. Die Gruppe der BRICSStaaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) ist in jedem einzelnen Fall den USA heute ähnlicher als vor dreißig, vierzig Jahren. Der Unterschied zwischen den USA und der übrigen Welt ist heute geringer als je zuvor. Die USA beherrschen nicht die Welt. Aber die Welt ist amerikanisch geworden.
Die USA konnten 2003 durch ihre Militärintervention im Irak dem Nahen Osten nicht den Frieden und auch nicht die Demokratie bringen. Die USA aber inspirieren mehr denn je russische Dissidenten, chinesische Oppositionelle, indische WissenschafterInnen und die brasilianische Wirtschaft. Die Welt ist in einem hohen Maße amerikanisiert. Was braucht es da, könnte man fragen, den Nachweis der Überlegenheit der US-Militärmaschine oder der amerikanischen Industrieproduktion?
Joseph Nye hat in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts, als die USA nach dem Ende des Kalten Krieges vor Selbstbewusstsein strotzten, bereits gewarnt: Die USA können weltpolitisch nicht allein handeln; sie brauchen Partner, brauchen Alliierte. Die USA als allein agierender Weltpolizist wären maßlos überfordert: wirtschaftlich, militärisch. Vor allem aber darf die amerikanische Gesellschaft sich nicht mit der simplifizierenden, letztlich verblödenden, weil intellektuell einschläfernden, isolierenden Formel von der „greatest nation on earth“ einlassen. Die USA können und dürfen sich nicht als eine Insel sehen, die der Welt politisch zu diktieren, sich aber von der Welt konsequent abzugrenzen vermag.
In allen seriösen Statistiken des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts sind die USA nicht Nummer eins unter den Staaten der Welt – weder im Pro-Kopf-Einkommen noch bezogen auf das Bildungsniveau der amerikanischen Kinder; auch nicht in der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bürgerinnen und Bürger, und schon gar nicht in den Daten über Gewaltverbrechen oder bezüglich der Chancen eines Menschen, einen Teil seines Lebens hinter Gefängnismauern verbringen zu müssen. Wenn es allerdings um die Fähigkeit geht, Kriege zu führen, sind die USA noch immer die führende Macht der Welt. In der Militärtechnologie haben die USA einen gewaltigen Vorsprung – vor China, vor Russland, vor Europa. Aber was können sie damit anfangen? Offenbar reicht diese Kapazität nicht aus, um ein verhältnismäßig kleines Land wie Afghanistan zu stabilisieren. Die USA – ein militärischer Riese, dem die politische und gesellschaftliche Kraft abhanden kommt, seine Hochrüstung in eine globale Führungsrolle umzusetzen?
In der US-Politik gibt es den Begriff „lame duck“. Ein Präsident, der – vor allem gegen Ende seiner zweiten Amtszeit – keines seiner Programme mehr umzusetzen vermag, ist eine solche „lahme Ente“. Im Kongress gilt so ein Präsident bereits als Geschichte, und die öffentliche Meinung erwartet nichts mehr von ihm. Sind die USA in ihrer globalen Rolle eine „lame duck“?
Ein israelischer Premierminister kann einen US-Präsidenten ignorieren, der – wie Barack Obama – bestimmte Schritte einfordert, die für eine Friedenslösung im Nahen Osten notwendig wären. Ein Präsident Venezuelas kann vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen den US-Präsidenten (George W. Bush) einen Teufel nennen und mit Verachtung von den USA sprechen, wenn er seine „bolivarische Revolution“ forciert, die eine entschiedene Anti-US-Tendenz aufweist. Ein iranischer Präsident kann, ebenfalls das Forum der Vereinten Nationen nutzend, in New York den USA eine moralische Lektion erteilen. Und die USA können ihre Gefolgsleute und ihre Diplomaten nicht schützen – wie der 2011 gestürzte Präsident Ägyptens und der 2012 ermordete US-Botschafter in Libyen erfahren mussten.
Nimmt man die USA als Nationalstaat, dann weisen die Indikatoren amerikanischer Macht nach unten. Nimmt man aber die USA als erste Macht des Westens, und definiert man diesen nicht geografisch – Europa plus Nordamerika –, sondern als ein grundsätzlich überall verwirklichbares System, dann sind die USA mehr denn je global bestimmend.
THE WEST AND THE REST
Der Westen, das ist die in Europa begonnene Aufklärung, die sich nicht bloß europäisch versteht, die in ihrer Neigung, Bestehendes zu hinterfragen, einen ständigen Lernprozess fördert. Der Westen, das ist die Demokratie, die sich im britischen Parlamentarismus und amerikanischen Republikanismus, in den französischen Revolutionen und in der Schweizer Konsensdemokratie äußert; aber auch in der ebenso komplizierten wie erstaunlich stabilen Demokratie Indiens, in der Traditionen des Subkontinents sich mit den Erfahrungen der Demokratie in Europa und den USA verbinden. Der Westen, das ist die ökonomische Dynamik eines das individuelle Gewinnstreben akzeptierenden und kanalisierenden Marktmechanismus, der nationale Grenzen sprengt und sich – am deutlichsten im nach-maoistischen China – gegenüber den marxistisch-leninistischen und anderen Alternativangeboten als überlegen erweist. Der Westen, das ist der Säkularismus, der – explizit (wie etwa in Indien) oder implizit – individuelle religiöse Freiheit garantiert, der keiner Religion (besser: keiner Konfession) das Recht einräumt, die Normen der Gesellschaft direkt zu bestimmen.
1942 schrieb Joseph Schumpeter, Professor an der Harvard University, sein Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“. Schumpeter, der in früheren Jahren Professor an den österreichischen Universitäten Czernowitz und Graz und kurze Zeit – am Beginn der Ersten Republik – auch österreichischer Finanzminister war, gab mit seinem Buch dem Verständnis von Demokratie eine neue Qualität. Doch was bedeutete Demokratie 1942? Der europäische Kontinent war, mit Ausnahme der demokratisch-neutralen Kleinstaaten Schweden und Schweiz, fest im Griff von Diktatoren. In Asien hatte die japanische Militärdiktatur ein Imperium errichtet, das von den Grenzen Indiens und Australiens bis zu den Alaska vorgelagerten Inseln der Aleuten reichte. In Afrika herrschten europäische Kolonialmächte, die einander bekriegten, und in Lateinamerika dominierte ein volatiles Amalgam von autoritären Systemen, die sich mehr oder weniger glaubwürdig einen demokratischen Anstrich gaben. In keinem anderen Jahr der Geschichte des 20. Jahrhunderts schien die Entwicklung so sehr gegen die Demokratie zu laufen, ja schien die Demokratie bereits Bestandteil der Geschichte zu sein. Beschäftigte sich Schumpeter nicht mit einem Modell politischer Ordnung, das im Sterben lag?
Ein Sieg der Achsenmächte, aus der Sicht des Jahres 1942 nicht völlig unplausibel, hätte Schumpeters Buch wohl zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Vor allem eine NS-Herrschaft über ganz Europa und eine Herrschaft des japanischen Militarismus über ganz Ost- und Südostasien wäre das Ende der globalen Konzeption von Demokratie gewesen. Der Westen als demokratische und rechtsstaatliche Konzeption wäre wohl insgesamt Geschichte geworden. Doch es kam anders – vor allem Dank der USA. Und: Hätte im Kalten Krieg sich die Zweite Welt, im Sinne des von Nikita Chruschtschow propagierten Wettbewerbs der Systeme, als erfolgreich erwiesen, die Niederlage des Westens wäre zwar eine weniger eindeutige als bei einem Sieg der Hitlers & Co., aber eine Niederlage wäre es gewesen. Anders als der Nationalsozialismus und der japanische Militärimperialismus war der Marxismus zwar ein Produkt der Aufklärung und damit des Westens: eine Alternative zu den westlichen Konzeptionen von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft, aber wie die Intention des Westens von grundsätzlich universalem, globalem Zuschnitt. Dennoch hätte eine wohl nicht realistisch, aber hypothetisch denkbare Niederlage der USA und deren Verbündeten im Wettbewerb der Systeme gewaltige Folgen für die Werte, die mit dem Westen zu Recht identifiziert werden – vor allem für die persönlichen, individuellen Freiheiten.
Doch der Westen siegte in einer militärischen Allianz mit der Sowjetunion gegen die Achsenmächte, die Angriffskriege vom Zaun gebrochen hatten, und in einem letztlich zwar potenziell, nicht aber aktuell kriegerischen Wettbewerb mit der von der Sowjetunion geführten Zweiten Welt. Der rote Stern über den Türmen des Kreml, der einmal für den globalen Anspruch einer sich auf die internationale Solidarität der gesamten Arbeiterklasse berufenden Weltrevolution strahlte – wofür und für wen strahlt er noch? Für einige altlinke Nostalgiker? Oder doch nur als Zeichen der wachsenden touristischen Attraktivität der chaotischen, kapitalistischen Millionenmetropole Moskau?
Das Lincoln Memorial im Herzen von Washington, D.C. – es verkörpert noch immer einen globalen Anspruch. Die Demokratie, so die in den Marmor des Denkmals gemeißelten Worte der Gettysburg-Rede von 1863, sei die Regierung des Volkes, für das Volk und durch das Volk: eine Formel, voll von Widersprüchen und unbedingt interpretationsbedürftig. Aber es ist eine Formel, die eine Kernbotschaft, ja die zentrale Botschaft des Westens vermittelt – und nicht nur eine der USA. Daran ändert der notwendige Hinweis auf das Diffuse des Begriffes „Volk“ nichts. Und daran ändert auch der Verweis darauf nichts, dass Lincoln selbst und die USA immer wieder vor und nach Lincoln dem Anspruch dieser Botschaft nicht gerecht wurden und werden. Die Botschaft Lincolns steht – die Botschaft Lenins steht auch, aber nur mehr in den Geschichtsbüchern.
Dass der Westen dekadent sei, das entsprach einer bestimmten europäischen Zeitgeistigkeit des späten 19. und des gesamten 20. Jahrhunderts. Kaiser Wilhelm II. (und nicht nur er) bemühte die „gelbe Gefahr“, Oswald Spengler sah den Untergang des Abendlandes voraus, und Thomas Mann, im Zweiten Weltkrieg die nicht zufällig aus den USA tönende Stimme eines besseren, eines demokratischen Deutschland, schrieb während des Ersten Weltkrieges gegen die leere, kalte Zivilisation des Westens an – der er die „Kultur“ Deutschlands entgegenhielt. Die katholische Kirche hatte (und hat) generell Schwierigkeiten, sich mit Grundwerten der Aufklärung und der liberalen Demokratie anzufreunden – insbesondere mit dem Status der Frauen. Als Argumentationshilfe dient der Kirche die Wahrnehmung westlicher Dekadenz, in der die Ehe zwischen Frauen und Frauen sowie Männern und Männern umgesetzt wird. Die Zukunft sei in Afrika oder anderswo in der „Dritten Welt“, so die kirchlichen Erwartungen. Doch auch Afrika wird immer westlicher.
Hitler sprach abfällig von den „Plutokratien“, denen er die Stärke absprach, der Dynamik der deutschen Rassen- und der japanischen Militärdiktatur wirksam entgegentreten zu können. Mussolini machte sich über die Lähmung Franklin Roosevelts lustig und sah in der Krankheit des US-Präsidenten den Beweis fehlender Männlichkeit des Westens – Männlichkeit im Sinne des faschistischen Diktators, der auf der Flucht in die Schweiz ein erbärmliches (männliches?) Ende fand. Die europäischen Achsenmächte erklärten, ohne durch das Bündnis mit Japan dazu verpflichtet zu sein, im Dezember 1941 den USA den Krieg, geleitet von einer krassen Unterschätzung des wirtschaftlichen, militärischen, auch moralischen Potenzials der USA.
Demokratie – ein Zeichen von Schwäche? Tatsächlich hatten ja die Demokratien – die britische und die französische und schließlich die US-amerikanische – lange gebraucht, um den Aggressionen in Europa und in Asien entgegenzutreten. Spät, vielleicht schon zu spät? 1942, da schien die Demokratie für viele am Ende, Beleg für einen Kulturpessimismus à la Oswald Spengler. Schumpeters Demokratietheorie hätte, wie das fast gleichzeitig geschriebene Buch Stefan Zweigs – „Die Welt von gestern“ –, zum melancholischen Abgesang auf den Westen werden können.
Als 1917 die Bolschewiki in einem Revolution genannten Putsch in Russland an die Macht kamen und diese sich mit militärischen Mitteln gegen ausländische Interventionen und interne Gegner verteidigten und sicherten, da verstand sich die Führung der Kommunistischen Partei des bald in die Sowjetunion umgestalteten Russland als Avantgarde: als Speerspitze der Macht nicht nur der russischen, sondern der internationalen, der globalen Arbeiterklasse. Doch bald musste die Sowjetmacht erfahren, dass die Weltrevolution nicht stattfand; und auch die Ausbreitung des kommunistischen Machtbereichs vor allem im Zuge des Sieges gegen das nationalsozialistische Deutschland bedurfte der ständigen Stützung durch die Bajonette und Panzer der Roten Armee.
Der Zweite Weltkrieg hätte für die Demokratie insgesamt ein schlechtes Ende genommen, wäre da nicht eine Macht gewesen, die entgegenhielt: die USA. Ohne Franklin D. Roosevelt hätte der bewundernswerte Widerstand der britischen Regierung und der britischen Bevölkerung wohl kaum ausgereicht, die Totalniederlage der Demokratie zu verhindern. Doch die Politik der USA, vorsichtig vorbereitet von Roosevelt, und die amerikanische Demokratie, all ihren Defiziten zum Trotz, die sich etwa in der Rassentrennung in den US-Streitkräften manifestierte: Sie sicherten ein Ergebnis, das weiten Teilen Europas die Demokratie brachte.
Die Demokratie siegte, dank der Waffen der USA. In Japan wie auch in Deutschland und in Italien entstanden stabile Demokratien, wesentlich beeinflusst von den USA, ihren Interessen und Erfahrungen. Für Indiens Demokratie war der US-amerikanische Föderalismus Vorbild. Dass seit weit über einem halben Jahrhundert Indien und Japan das Vorurteil widerlegen, die liberale, die westliche Demokratie sei etwas, was nicht „exportierbar“ wäre – das ist auch und vor allem den USA zu verdanken. Der Westen ist keine Angelegenheit der „Weißen“ allein.
Wären die Diktaturen des 20. Jahrhunderts von Demokratien abgelöst worden – ohne die Politik der USA? Wäre in Westeuropa die Demokratie gesichert worden – ohne den Marshall-Plan, der ein wesentlicher Teil der politischen Strategie Trumans war? Nicht, dass die USA in ihrer Politik nach 1945 ohne nationale Egoismen gehandelt – und auch nicht, dass sie immer wieder Konzessionen an nicht-demokratische Kräfte gemacht hätten. Die Hoffnungen von Freiheitsbewegungen, die sich gegen den Kolonialismus europäischer Mächte wendeten, wurden von den USA oft enttäuscht. Aber, es bleibt: Ohne die Großmachtpolitik der USA – unter den Präsidenten Roosevelt und Truman – wäre es kaum oder nur eingeschränkt, jedenfalls (wenn überhaupt) extrem verspätet zum Siegeszug der Demokratie gekommen.
Der Erfolgskurs der Demokratie wiederholte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts – in der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichte der Entkolonialisierung, in der Etablierung Indiens als größte Demokratie der Welt; in der demokratischen Transformation der autoritären europäischen Staaten des Mittelmeerraumes in den 1970er-Jahren; im Sieg der Demokratie über die Militärdiktaturen Lateinamerikas und am Westrand des Pazifiks; in der Umwandlung der südafrikanischen Rassendiktatur in eine liberale Demokratie; und schließlich in der Transformation Mittel- und Osteuropas. Und überall, bei allen diesen dramatischen Siegesläufen der Demokratie, kam den USA eine, nur zu oft auch die entscheidende Rolle zu.
Diese Rolle insgesamt mag nicht immer positiv gewesen sein, war nicht immer positiv für die Entwicklung der Demokratie und der Menschenrechte. Lange Zeit hindurch sahen die USA im südafrikanischen Apartheidregime, in der südkoreanischen Militärdiktatur, im spätfaschistischen Spanien auch ein Bollwerk gegen die Sowjetunion. Doch schließlich setzte sich – nicht immer, aber oft mit eindeutig positivem Zutun der US-Politik – die Demokratie durch.
Der auch und wesentlich von den USA inspirierte Siegeszug der Demokratie provozierte Ressentiments. Wer mag immer wieder daran erinnert werden, dass es Gründe gibt, den USA „dankbar“ zu sein? Als unter der Präsidentschaft George W. Bushs sich die Beziehungen zwischen Europa und den USA verschlechterten und vor allem die Regierungen Frankreichs und Deutschlands sich der US-geführten „coalition of the willing“ entzogen, kamen Spannungen an die Oberfläche, die vieles aussagten. Gerhard Schröder sah sich 2002 genötigt, eine Justizministerin seiner Partei, der SPD, zu entlassen, die Bushs Außenpolitik in einen direkten Zusammenhang mit der Hitlers brachte – als hätte die SPD und nicht die USA der Herrschaft des Nationalsozialismus ein Ende bereitet. Und die Feiern im Juni 2004, zur sechzigsten Wiederkehr der alliierten Landung in der Normandie, waren von atmosphärischen Spannungen vor allem zwischen den USA und Frankreich begleitet: Das herrschende US-Narrativ setzte darauf, dass es Amerika war, das Frankreich (und Europa) die Freiheit zurückbrachte. Das französische Narrativ betonte viel stärker die Rolle des innerfranzösischen Widerstandes und der (verglichen mit den US- und den britischen Truppen quantitativ bescheidenen) militärischen Einheiten, die politisch der Exilregierung Charles de Gaulles unterstanden.
Die oft auf allen Seiten kindische Züge annehmende Empfindlichkeit zeigte sich in nicht immer klugen Karikaturen, die letztlich immer darauf hinausliefen, Unterschiede zu betonen – damit aber erst recht Gemeinsamkeiten ausdrückten: die Neigung, „den anderen“ (den Amerikanern, den Franzosen, etc.) einmal so richtig die eigene (moralische, wirtschaftliche) Überlegenheit zeigen zu wollen; zumindest mit Worten.
Wer lässt sich schon gerne ständig daran erinnern, dass die Unabhängigkeit eines demokratischen Frankreichs ohne die militärischen Kraftanstrengungen der USA vielleicht dauerhaft verloren gewesen wäre? Wer will immer wieder daran denken müssen, dass die Erfolgsgeschichte japanischer oder deutscher oder polnischer Demokratie nicht oder nicht primär das Resultat nationaler Revolutionen, sondern auch und wesentlich US-amerikanischer Politik ist? Wären die freien Wahlen in Polen im Juni 1989 – der erste Dominostein, dessen Fall das Ende des Sowjetimperiums signalisierte – ohne die Überlegenheit der USA im wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerb mit der Sowjetunion möglich gewesen? Wäre im November 1989 die Berliner Mauer gefallen, hätten nicht Millionen Bürgerinnen und Bürger der DDR durch ihr Drängen in den Westen den Zerfall der DDR eingeleitet – ein Drängen, dessen Eindämmung lange Zeit nur durch die von Moskau gestützte Gewalt möglich war; ein Drängen, das nicht nur als Zeichen einer Überlegenheit der Bundesrepublik Deutschland gewertet wurde, sondern auch der USA? Wäre die „Samtrevolution“ in der ČSSR im Jahre 1989 möglich gewesen – ohne den faktischen Rückzug der UdSSR aus den Staaten des Warschauer Paktes in der Ära Gorbatschow, und hätte dieser Rückzug ohne den beharrlichen Druck der USA stattgefunden? Der oberflächliche, oft genug hasserfüllte Antiamerikanismus, den man in Mumbai ebenso antrifft wie in Mexico City, in Rom ebenso wie in Paris – ist er nicht auch das nicht intendierte Produkt einer auch von den USA geprägten Freiheit, Demokratie genannt?
Die weitverbreitete Neigung, Entwicklung und Zustand der Welt als Resultat von Verschwörungen zu sehen, deren Zentren zumeist in den USA vermutet werden – ist diese Flucht aus einer komplexen Wirklichkeit in die einfachen Bilder amerikanischer Weltherrschaft nicht auch ein Beleg für die Amerikanisierung der Welt? Als nach dem 11. September 2001 die Gerüchte sich in Windeseile über das Internet verbreiteten, die Mordanschläge auf New York und Washington seien das Produkt einer US-Strategie zur Konstruktion irgendeines Vorwandes gewesen – für einen Kreuzzug gegen den Islam, für die Unterdrückung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger: Zeigt dieser intellektuell hilflose Unfug nicht auch das Ausmaß der globalen Fixierung auf die USA? Wem trauten die Verschwörungstheoretiker eine solche raffinierte Strategie zu? Den USA und vielleicht auch noch Israel, das in bestimmten Milieus immer in einem Atemzug mit den USA genannt wird.
In seinem Buch „Civilization. The West and the Rest“ demonstriert der britische Historiker Niall Ferguson, wie sehr die durch Parlamentarismus und (zunächst in der Praxis krass unterentwickelten) Menschenrechte, durch politischen und wirtschaftlichen Wettbewerb charakterisierten Standards des „Westens“ sich im Laufe des 18., 19. und schließlich 20. Jahrhunderts durchsetzten. Der „Westen“ – das war die konstitutionelle Monarchie Großbritanniens, die sich im 19. Jahrhundert zu einer parlamentarischen Monarchie wandelte; das war das Frankreich der Revolutionen und Reaktionen; und das waren auch und vor allem die USA, die sich als erster republikanischer Flächenstaat etablierten und in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit die Ambivalenz von Modernität und Aufklärung verkörperten – zwischen den 1776 verkündeten universellen Menschenrechten und der Realität der Sklaverei, zwischen dem antikolonialistischen Antrieb der Monroe-Doktrin und dem gegen die „Native Americans“ gerichteten systematischen Landraub, zwischen einer außenpolitischen Selbstbescheidung und dem gegen Mexiko zwischen 1846 und 1848 geführten Raubkrieg, zwischen dem demokratischen Interventionismus, wie ihn Franklin D. Roosevelt (gemeinsam mit Winston Churchill) in der Atlantic Charta von 1941 verkündete, und der im Kalten Krieg betriebenen Stützung antidemokratischer Systeme, von denen das südafrikanische Apartheidregime das wohl hässlichste, bei Weitem aber nicht das einzige war.
Als die britische Regierung im Zweiten Weltkrieg noch alles daran setzte, jede Aussage zu einer zukünftigen Unabhängigkeit Indiens zu vermeiden, versuchte Roosevelt den in Sachen des British Empire hoffnungslos reaktionären Churchill von der Sinnhaftigkeit und letztlich Unvermeidlichkeit einer indischen Unabhängigkeit zu überzeugen. Churchill, wie immer in rhetorischer Höchstform, antwortete mit einem Wortspiel über „Indians“ und „Indians“: Die einen, die „braunen“ Indians, unter der (in Churchills Sicht) wohlmeinenden britischen Herrschaft, wären zu Hunderten und Hunderten Millionen geworden, Tendenz: weiter zunehmend. Die anderen, die „roten“ Indians, in den USA aus ihren traditionellen Siedlungsräumen vertrieben und in Reservationen gedrängt, würden eine bloß geduldete Randexistenz als winzige Minderheit führen. Roosevelt, der mitten im Krieg (das Gespräch fand im September 1943 im Weißen Haus statt) sich einen offenen Konflikt mit Churchill nicht leisten konnte, lachte angesichts solcher Argumente – vermutlich gequält. Und er gab es bis auf Weiteres auf, Churchill überzeugen zu wollen.
Doch die Entkolonialisierung fand statt – beginnend mit Indien. Und sie fand statt, oft begleitet von kriegerischen Auseinandersetzungen – vor allem in Indochina und in Algerien, wo das um seine Großmachtrolle kämpfende Frankreich noch größere Schwierigkeiten als die Briten hatte, die Zeichen der Zeit zu verstehen. Die dominante Rolle der USA führte auch zu europäischen Reaktionen: 1956 planten die britische und die französische Regierung, in Absprache mit der Regierung Israels, an den USA vorbei die militärische Besetzung des Suezkanals. Die Regierung Anthony Eden wollte noch einmal zeigen, dass sich das Vereinigte Königreich nicht vom Ägypten Gamal Abdel Nassers