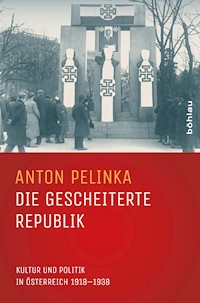Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Benito Mussolini, Adolf Hitler, Engelbert Dollfuß, Francisco Franco, die Militärdiktatoren Japans, Ante Pavelić, Ion Antonescu, António Salazar und andere galten als Faschisten. Waren sie alle Proponenten desselben Faschismus – oder ist der Begriff zu einem mitunter falsch verwendeten Etikett verkommen? Die faschistische Herrschaft in Italien begründete ein politisches Modell, das für Europa bis 1945 – und darüber hinaus – prägend war. Aber war Faschismus gleich Faschismus? Der absolute Totalitarismus des Nationalsozialismus unterschied sich von der autoritären Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur. Wenn einerseits die militärische Expansionspolitik der "Achsenmächte" Deutschland, Italien und Japan ein zentrales Merkmal des Faschismus war, können Dollfuß und Franco dann als Faschisten gelten? Wenn andererseits die Unterdrückung universeller Grundrechte den Wesenskern des Faschismus darstellt, was unterscheidet ihn von anderen repressiven Systemen wie den Diktaturen Stalins und Maos? Und was bedeutet es, wenn im 21. Jahrhundert Trump und Putin unter Faschismusverdacht geraten? Anton Pelinka dekonstruiert den Begriff anhand historischer Beispiele und geht der Frage nach, ob es eine allgemeine Faschismusneigung gibt, die immer wieder politische Beben und weltweite Katastrophen auslösen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anton Pelinka
Faschismus?
Zur Beliebigkeit eines politischen Begriffs
Böhlau Verlag Wien Köln
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Böhlau, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Michael Haderer unter Verwendung einer Adobe Stock-Grafik/Kebox
Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien
Korrektorat: Christoph Landgraf, St. Leon-Rot
Satz: le-tex publishing services GmbH, LeipzigEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21587-5
Inhalt
Einleitung
Faschismus – Mehr als eine Leerformel?
Die Instrumentalisierung der Begriffe
Faschist ist immer der andere
Die Suche nach dem Gemeinsamen aller Faschismen
Faschismus – die höchste und letzte Stufe des Kapitalismus?
Faschismus – die höchste (letzte?) Stufe des Nationalismus
Italien, 1922–1943: Der Real Existierende Faschismus
Der Zauberer von Oz
Die Schwäche der Demokratie
Die Lateranverträge: (k)ein Gang nach Canossa
Mussolini und Hitler – vom Wettbewerb zur Abhängigkeit
1939, 1940, 1941: Selbsttäuschung als Anfang vom Ende
Der Große Faschistische Rat
Nostalgie – Sehnsucht wonach?
Deutschland, 1933–1945: Faschismus, aber mehr
November 1923 – kein „Marsch auf Rom“
Januar 1933: Die traditionellen Eliten glauben, sich Hitler kaufen zu können
Juni 1934: Arturo Ui, unchained
Der NS-Staat: Idealtypus eines totalitären Systems?
September 1939, Juni und Dezember 1941 – der Weg in die Selbstzerstörung beginnt
Der Holocaust: Das Alleinstellungsmerkmal des Nationalsozialismus
Der „totale Krieg“
Österreich, 1933–1938: Faschismus, aber weniger
Machtergreifung – nicht von „unten“, sondern von „oben“
Habsburg-Trauma und Habsburg-Nostalgie
Faschismus? Ja, aber
Die Vaterländische Front: ein autoritäres Konstrukt
Repressionsintensität
„Das kleinere Übel“?
Hilflos und reaktiv
Die Unfähigkeit, zu überleben
Der „Anschluss“ als Systemversagen
Japan, 1937–1945: Militärdiktatur, aber kein Faschismus
Vom Feudal- über den Verfassungs- zum Militärstaat
Die „Achse“ – eine Chimäre
Ein „notwendiger“ Krieg, der nicht zu gewinnen war
Terror, Repression, Totalitarismus
Rassismus, aber kein Holocaust
Die Unfähigkeit, Halt zu machen
Die Unfähigkeit, zu kapitulieren
Hirohito – die Ambivalenz der Reservemacht
Spanien, 1939–1975: Die begrenzte Überlebensfähigkeit des Faschismus
Macht aus den Gewehren
Der Bürgerkrieg
Der Caudillo, der kein Duce und kein Führer war
Eine Militärdiktatur – aber was sonst?
Hendaye und die Anfänge der Westorientierung: der lernfähige Faschismus
1945: Der opportunistische Faschismus
Die Helden des Rückzugs
Merkmale des (eines) realen Faschismus
Faschismus ist Diktatur
Faschismus ist Zerstörung
Faschismus ist Populismus
Das revisionistische Ressentiment des Faschismus
Vorwärts, zurück in die Vergangenheit
Ersatzreligion und Liturgie
Weltpolitik als Roulettespiel
Faschismen im Vergleich
Die Faschismus-Frage und/oder die Nazi-Frage
Antifaschismus: Die Banalität des Guten
Der anständige Massenmörder
Die Beliebigkeit des Antifaschismus
Faschismus als Neigung und Versuchung
Jenseits des banalen Antifaschismus: Zerstörung von Scheinwissen
Was tun?
Die Dekonstruktion von „Volk“ und „Nation“
Die Notwendigkeit, zu differenzieren
Die Stärke der Demokratie ist die Schwäche des Faschismus
Die Demokratie ist nie garantiert – und ein Faschismus kann immer drohen
Literatur
Personenregister
Einleitung
Dieses Buch ist die Folge zweier Irritationen. Die eine betrifft die intellektuelle Unschärfe, mit der „Faschismus“ als eine Etikette zur Kennzeichnung von allem und jedem und des Gegenteils von allem und jedem verwendet wird. Gerade für die Darstellung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs trifft dies zu: Die militärische Allianz zwischen Deutschland, Italien und Japan wird immer wieder als ein Bündnis faschistischer Länder dargestellt. Der Begriff Faschismus kann mit gewissen Einschränkungen für die beiden europäischen Mächte verwendet werden – für die mit den Namen Mussolini und Hitler verbundenen Staaten. Diese waren durch einige zentrale Gemeinsamkeiten verbunden: eine Massenbewegung, die zur Monopolpartei einer Diktatur wurde; und die Konzentration politischer Macht in den Händen einer einzigen Person, die allein über Krieg und Frieden entschied – wie Hitler 1939, wie Mussolini 1940.
Aber Japan? Da gab es keine Massenbewegung und keine Monopolpartei, die im Zentrum der japanischen Politik in den 1930er und frühen 1940er Jahren gestanden wären; und es gab auch keinen „Duce“, keinen „Führer“, der alle Macht für sich beanspruchen konnte: Japan wurde in einem komplexen System der Machtteilung von militärischen Eliten regiert. Der Kaiser war ein manipuliertes Aushängeschild einer Militärdiktatur, die Premierminister des Landes waren von der Gunst der führenden Generäle und Admiräle abhängig. Wenn Faschismus nicht zum Sammelbegriff für alle Repressionssysteme des 20. Jahrhunderts werden soll, dann war Japan am Vorabend und während des Zweiten Weltkriegs kein faschistisches System. Wenn aber Faschismus zu einem solchen Sammelbegriff gemacht wird, dann war die UdSSR (und zwar nicht nur zu Stalins Zeit) ebenso faschistisch wie die Volksrepublik China. Faschismus ist nicht Faschismus, und nicht alle Systeme und Bewegungen und Strömungen, die sich gegen die universellen Menschenrechte richten, sind faschistisch. Eben deshalb hält Eric Hobsbawm fest – bemüht um die Rettung des Faschismus-Begriffes: „Japan was not fascist“. (Hobsbawm 1996, 132)
Die zweite Irritation ist der Streit um den Begriff Austrofaschismus. In Österreich und im Diskurs über die österreichische Zeitgeschichte wurde und wird es vielfach zu einem Glaubensbekenntnis, wie man das sich „Ständestaat“ nennende Regime – den „Bundesstaat Österreich“ – etikettiert; ob man die von Dollfuß 1933 und 1934 errichtete und von Schuschnigg bis 1938 geführte Diktatur „faschistisch“ nennt. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten akademischen Milieu wird oft dadurch demonstriert, ob man bereit ist, Dollfuß einen Faschisten zu nennen – oder ob man diese Qualifikation des österreichischen Diktators nicht teilt. Eine differenzierte Betrachtungsweise, die zunächst beim Begriff Faschismus einsetzen müsste, wird erschwert, wenn als Voraussetzung für die Beteiligung an einer geschichtsoder sozialwissenschaftlichen Debatte über das Österreich der 1930er Jahre von der einen Seite ein klares „Ja“, von der anderen ein ebenso klares „Nein“ verlangt wird. Das Beispiel des Disputes um die Einordnung eines unbestritten antidemokratischen Regierungssystems unterstreicht, wie sehr „Faschismus“ zu einem Kampfbegriff geworden ist.
Das gilt auch für den Antifaschismus: Eine Ablehnung des real existierenden Faschismus der Vergangenheit ist für alle, die sich zu Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten bekennen, die größte Selbstverständlichkeit. Das sollte in politischen und akademischen Debatten einfach vorausgesetzt werden. Dennoch wird Antifaschismus oft als eine Art Kampfruf verwendet; als ein Ritual, das emotional ein- und ausschließen soll.
Faschismus und Antifaschismus gleichen einander in der Beliebigkeit, in der diese beiden Begriffe im Alltag gebraucht und missbraucht werden. Und das ist nicht ungefährlich – für die real existierende Demokratie, wie sie sich in Europa (zunächst in Westeuropa) ab 1945 entwickelt und stabilisiert hat; gefährlich auch für einen rational geführten Diskurs, der auf Erfahrung, nicht auf Glauben setzt. Denn die Demokratie braucht den offenen intellektuellen Streit – und nicht Bekenntnisrituale.
Die semantische Wurzel von Faschismus ist klar: Sie ist ein Rückgriff auf die Symbole der Römischen Republik, auf die Rutenbündel des alten Roms. Die Faschistische Partei Italiens, die sich neu und revolutionär gab, wollte nach dem Ersten Weltkrieg Nostalgie und Nationalstolz ansprechen, Neues und Traditionelles verbinden. Jede Beschäftigung mit Faschismus muss mit dieser Partei beginnen, die so etwas wie ein „Trendsetter“ auch für andere antidemokratische und nationalistische Parteien war, die zumeist revolutionäres Auftreten mit reaktionären Rückgriffen auf Vergangenes verbanden.
Der italienische Faschismus ist immer auch in Verbindung mit dem Nationalsozialismus zu sehen, der sich selbst nie als faschistisch bezeichnete, der aber – auch wegen Hitlers anfänglicher Bewunderung für Mussolini und der in den 1930er Jahren entwickelten italienisch-deutschen Allianz – aus nachvollziehbaren Gründen als zweites historisches Muster für Faschismus gilt.
In diesem Buch werden der italienische Faschismus und der deutsche Nationalsozialismus in einen Vergleich mit drei anderen Beispielen gebracht, bei denen die Etikette Faschismus wenig oder gar nicht überzeugend ist: Österreich, das zwischen 1933/1934 und 1938 zwischen den Großmachtansprüchen der beiden faschistischen Nachbarstaaten eingeklemmt war und dessen autoritäres Regime wesentliche Anleihen beim System Mussolini machte; Japan, dessen Militärregime zwar nicht den Kriterien eines faschistischen Systems entsprach, das aber durch das Militärbündnis der „Achse“ eine Schicksalsgemeinschaft mit dem europäischen Faschismus einging; und das Spanien Francos, dessen Sieg im Bürgerkrieg gegen die spanische Republik auch und wesentlich der Unterstützung Italiens und Deutschlands zu verdanken war, während des Zweiten Weltkriegs insgesamt halbherzig die Achsenmächte unterstützte, sich aber der Umarmung des Deutschen Reiches entzog. Das spanische Regime – faschistisch oder doch nicht – überlebte als einziges der in diesem Buch behandelten Beispiele das Jahr 1945 und ist allein schon aus diesem Grund für eine vergleichende Analyse des Faschismus von besonderem Interesse.
Italien, Deutschland, Österreich, Japan und Spanien dienen als Fallstudien für die antidemokratischen (faschistischen?) Tendenzen in den 1930er und 1940er Jahren. Andere autoritäre Systeme – Rumänien und Ungarn, Portugal und Kroatien und die Slowakei – werden in den folgenden Ausführungen immer in Verbindung zu den fünf Fallstudien gebracht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Faschismen herauszuarbeiten.
Mussolinis Italien, Hitlers Deutschland, Dollfuß’ Österreich, Francos Spanien und auch die japanische Militärdiktatur hatten eine zentrale Gemeinsamkeit: Sie unterdrückten die Demokratie, die in allen fünf Staaten vor der „Machtergreifung“ der Diktatoren existiert hatte, aber ihre Wehrfähigkeit nicht beweisen konnte. Der Untergang der Demokratie in diesen fünf Staaten in der „Zwischenkriegszeit“ genannten Periode war nicht nur Zeichen der Zerstörungskraft der Faschismen, sondern auch der Schwäche der Demokratie.
Die liberale, „westliche“ Demokratie ist eine zarte Pflanze. Die Faschismen der Vergangenheit haben zwischen den Weltkriegen in weiten Teilen Europas die Demokratie zerstört. Die Bedrohung der Demokratie durch aktuelle Formen des Faschismus war real, ist weiterhin real und wird immer real bleiben. Dieser Bedrohung muss widerstanden werden, soll die Zukunft der Demokratie gesichert werden.
Eine inflationäre Beliebigkeit der Begriffe Faschismus und Antifaschismus ist dabei nicht hilfreich. Wenn mit Faschismus-Vorwürfen und Antifaschismus-Bekenntnissen alltäglich um sich geworfen wird, um damit im politischen Alltag zu punkten, wird die Wehrfähigkeit der Demokratie nicht gestärkt, ja sogar geschwächt; auch, weil alles, was sich antifaschistisch nennt, nicht notgedrungen demokratisch ist – ebenso weil nicht alles, was sich demokratisch gibt, wirklich demokratisch ist.
Es ist im Interesse einer wehrhaften Demokratie, dass politisches Scheinwissen zerstört wird; dass das Wortgeklingel um Faschismus und Antifaschismus nüchternen Analysen Platz macht. Das Buch will dazu einen Beitrag leisten.
Der besondere Dank des Autors gilt Ellen Palli, die – in bewährter und freundschaftlicher Form – bei der Texterstellung und Formatierung zur Fertigstellung des Buches beigetragen hat. Ein besonderer Dank geht auch an die Damen und Herren des Verlages Böhlau für die gute Zusammenarbeit.
Anton Pelinka, 7. Juni 2022
Faschismus – Mehr als eine Leerformel?
What the various brands of fascism had in common … is not easy to discern. Theory was not a strong point of movements devoted to the inadequacies of reason and rationalism and of the superiority of instinct and will. … Fascism cannot be identified either with a particular form of state organization.
(Hobsbawm 1996, 117)
The attempt to arrive at a satisfactory definition of fascism has been likened to the mystical quest for the Holy Grail …, to the prospector’s devotion to ‘unearthing of a finally pure lode’ of lexical gold …, and, even more, dispiritingly, to ‘searching for a black cat in a dark and possibly empty room’.
(Griffin 2018, 10)
Fascism was not a traditional autocracy, of a Middle Eastern or historic Latin America nature. It was not merely an extreme case of bourgeois liberalism, the last stage of capitalism, as various Marxists claimed, in which the façade of democracy is stripped and the true nature of capitalist society is cruelly exposed. Racism was not an essential characteristic of fascism. German racism was not matched by Italian racism.
(Kogan 1968, 17)
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch.
(Brecht, Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui)
Faschismus: Das war ein Begriff, der bald nach 1918 Aufbruch, Zukunft, Optimismus zu signalisieren schien – für die einen. Anderen war Faschismus eine Bedrohung – sowohl für die „westliche“, die liberale Demokratie, als auch für den Sozialismus, wie er von Moskau aus sich als die beste aller möglichen Optionen für die Zukunft offerierte. In einer Zeit, in der sich die von den Pariser Friedensverträgen etablierte Ordnung in explosiver Form aufzulösen begann; in der das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ gescheitert war – vor allem an der Unmöglichkeit, die Frage zu beantworten, was ein Volk ausmacht – in dieser „Zwischenkriegszeit“ ließ Faschismus niemanden kalt.
Die Faschisten Europas, die ab 1918 den Zeitgeist hinter sich zu haben schienen, waren vor allem jung, sie kamen aus dem Militär und waren – nicht nur in der Sicht der Zeit, sondern auch ein spezifisch faschistisches Verständnis reflektierend – männlich und agierten in einem Stil, den man später „macho“ nennen würde. (Mann 2004, 212–214) Aufmärsche in Uniform – in Uniformen der Armeen der Jahre bis 1918 und in den neu geschaffenen Uniformen der Parteimilizen prägten das Erscheinungsbild des Faschismus der Zwischenkriegszeit.
Die in Versailles, St. Germain und Trianon formulierte Ordnung war zum Untergang verurteilt, sobald die immanente Widersprüchlichkeit des Grundsatzes „nationaler Selbstbestimmung“ deutlich wurde; und als ein vor 1914 langfristig und in den 1920er Jahren wiederum kurzfristig steigender Wohlstand in die Krise gekommen war – verursacht von einem ungebremsten Kapitalismus. Dessen Krise provozierte Antworten, die – wie die Enge nationalstaatlich bestimmter Handelsschranken und einer ebenso nationalstaatlich und kurzfristig orientierten Politik der Schuldenbekämpfung („austerity“) – erst recht die politische Krise beschleunigten. Verstärkt wurde die damit verbundene Katastrophenstimmung von den Vorzeichen eines Endes der Herrschaft des „weißen Mannes“; einer Zeitenwende, die der „weiße Mann“ aber nicht erkennen konnte oder akzeptieren wollte: In dieser Zeit stand Faschismus für den – naiven – Glauben, dass mehr Autorität und weniger Demokratie das Rezept der Zukunft wäre; und dass diese Zukunft eine Abkehr von den Grundsätzen der Aufklärung erfordere – und nicht deren konsequente Umsetzung.
Faschismus war vielen auch die Antwort auf eine vage gefühlte Zivilisationskrise, auf die „Dekadenz“, die im Westen dem Westen zugeschrieben wurde. Faschismus war im „Abendland“ vielen die notwendige Reaktion auf den wahrgenommenen „Untergang des Abendlandes“. Die Moderne sollte zerstört werden – nötigenfalls mit den Mitteln der Moderne, um die „Authentizität“ von Volk und Vaterland zu retten.
Diese Zukunft schien von „starken Männern“ bestimmt zu sein. Und die waren eben Männer – und noch dazu weiße Männer. Doch dass die gelegentlich zu „Ehrenariern“ erklärten Japaner an der Gestaltung dieser (faschistischen?) Zukunft zentral Anteil haben sollten, zeigte schon die Brüchigkeit, die innere Widersprüchlichkeit dieses (faschistischen?) Wunschdenkens. Auch, dass die Kriegsanstrengungen der Diktatoren in Rom und Berlin und Tokio gerade das vorantreiben mussten, was eigentlich nicht der Idylle von Blut und Boden entsprach – eine wissenschaftlich-technologische Modernisierung, eine schon aus der Logik der Militarisierung erzwungene Industrialisierung, eine verstärkte Eingliederung der Frauen in die industrielle Produktion, und dazu noch eine (zumeist erzwungene) Massenmigration: Das alles unterstrich das Fatale an dem Konzept, das sich, höchst unscharf, unter dem Sammelbegriff „Faschismus“ entwickelte hatte. Faschismus war antimodernistisches Ressentiment und Modernisierung, war nationalistische Verengung und Globalisierung zugleich.
Der von Anfang an naiven Vorstellung, dass in Rom und Tokio und Berlin die Zukunft sichtbar wäre, ist 1945 mit katastrophaler Deutlichkeit jede Realität abhandengekommen – in Form der bedingungslosen Kapitulation der „Achsenmächte“, denen (in grober Vereinfachung) die Etikette Faschismus zugeschrieben wurde. Die Sieger von 1945 wollten alles Mögliche, nur nicht faschistisch sein; und auch Franco-Spanien wollte ab 1945 nichts mehr mit dem Faschismus der „Achse“ zu tun gehabt haben. Die UdSSR (und bald auch die Volksrepublik China) verstanden sich als Vorboten einer ganz anderen Zukunft, die sie als „Antifaschisten“ sozialistisch gestalten wollten. Und die von den USA geführte „freie Welt“ beanspruchte die Demokratie für sich, die vom italienischen Faschismus, vom deutschen Nationalsozialismus und vom japanischen Militarismus als ein dekadenter Restbestand einer Welt von gestern verachtet worden war.
Die Kräfte, die der „Achse“ ihren Willen aufgezwungen hatten, waren keineswegs von einem gemeinsam vertretenen, in sich schlüssigen Antifaschismus geprägt. Das Vereinigte Königreich war 1939 – wie Frankreich auch – aus einer Verpflichtung gegenüber Polen fast widerwillig in den von Deutschland begonnenen Krieg gestolpert. Die UdSSR hätte – wie zwischen 1939 und 1941 – dem gegen die westlichen Demokratien kämpfenden NS-Staat auch weiterhin kriegswichtige Rohstoffe geliefert, hätte nicht die Führung (der „Führer“) Deutschlands in selbstzerstörerischer Verblendung die Sowjetunion überfallen. Und Präsident Roosevelt wäre noch lange vor einem Kriegseintritt zurückgewichen, hätten nicht Japan und das Deutsche Reich dem US-Präsidenten den Gefallen getan und den Krieg gegen die USA begonnen.
Was die „Achse“ verband, das war kein gemeinsames Konzept zur Gestaltung der Welt. Es war ein Zweckbündnis der Raubtiere, die in zeitlich begrenzter Abstimmung die Welt unter sich aufteilen wollten. Es war ein Bündnis, dem jede klare Vorstellung von einer geopolitischen Ordnung fehlte; eine Allianz, deren Partnerschaft voll von Widersprüchen war: NS-Deutschland war auch 1941 noch bereit, die britische Herrschaft über Indien zu garantieren. Japan hingegen profilierte sich als Befreier der „nicht weißen“ Völker vom europäischen Kolonialismus. Die drei Achsenmächte waren auch außer Stande, eine rationale Bündnispolitik gegenüber anderen Staaten zu verfolgen: Italien stellte sich gegen jedes Entgegenkommen gegenüber Vichy-Frankreich, das den Staat Philippe Petains (wie von deutscher Seite gewünscht) enger an die „Achse“ gebunden hätte. Die deutsche Besatzungspolitik in Ost-Europa machte es unmöglich, das antisowjetische Potential in Polen oder der Ukraine militärisch zu nutzen. Und die japanische Führung sprach zwar von der Errichtung einer ganz Ost- und Südostasien umspannenden „Wohlfahrtszone“ („Prosperity Sphere“), aber China (auch die von Japan eingesetzte Marionettenregierung in Nanking) wurden von Japan schlechter behandelt und brutaler ausgebeutet als dies die Kolonialmächte in Süd- und Südostasien zur selben Zeit taten.
Und die „Vereinten Nationen“, wie sich die Gegner der „Achse“ bald nannten – was hatten sie gemeinsam? Sie waren letztlich durch nichts anderes verbunden als durch die ihnen von Deutschland und Japan aufgezwungene Notwendigkeit, sich und ihre Interessen vor dem Größenwahn der Achsenmächte zu schützen. Mehr als die gemeinsame Gegnerschaft gegen die drei Achsenmächte war da nicht: Roosevelts Konzept einer auf der Errichtung der UNO aufbauende Friedensordnung wurde weder von Churchill noch von Stalin wirklich ernst genommen.
Der Zweite Weltkrieg war nicht die Konfrontation zweier in sich schlüssiger Zukunftsvorstellungen. Faschismus war eine Überschrift ohne Inhalt, und der Antifaschismus der Vereinten Nationen war nichts als das verständliche und grundsätzlich defensive Interesse, sich gegen die Aggressivität der „Achse“ zu verteidigen, sich vor den Raubtieren zu retten.
Die Instrumentalisierung der Begriffe
Nur wenige Begriffe provozierten im 20. Jahrhundert so viel Leidenschaft wie der des Faschismus. Als Benito Mussolini 1922 von König Vittorio Emanuele III zum Ministerpräsidenten Italiens bestellt wurde und Mussolini und die Faschistische Partei innerhalb von zwei Jahren den italienischen Parlamentarismus und jede Form des politischen Pluralismus zerstört hatten, spaltete schon das Wort Faschismus die Welt. Die NSDAP berief sich in Deutschland während ihres Aufstiegs zur Macht auf das Vorbild des italienischen Faschismus, und als 1936 die Revolte eines Teils des Militärs der spanischen Republik den Bürgerkrieg startete, wurde dieser weltweit als eine vorweggenommene Entscheidungsschlacht zwischen Faschismus und Antifaschismus interpretiert.
Spanien wurde als eine Art Generalprobe für den Zweiten Weltkrieg wahrgenommen. Und die sich in diesem zerstörerischsten aller Kriege gegenüberstehenden Allianzen wurden als entweder faschistisch oder antifaschistisch gedeutet – eine grobe, eigentlich groteske Verfälschung, berücksichtigt man die Rolle der UdSSR zwischen September 1939 und Juni 1941 und mehr noch die bedeutende Rolle Japans, das von einer totalitären Militärdiktatur regiert wurde, die allen Kriterien des Faschismus nicht entsprach. Faschismus war zu einem plakativen Schlachtruf geworden – und Antifaschismus zu einer Heroismus signalisierenden Überschrift. Faschismus und Antifaschismus waren simplifizierende Etiketten – und sie sind es noch immer, viele Jahrzehnte nach der Kapitulation der Achsenmächte.
1945 war weltweit Faschismus out und Antifaschismus war in. In den 1945 triumphierenden Antifaschismus mischten sich authentische Erinnerungen an die Opfer der real vorhandenen Heldinnen und Helden mit einem rasch erkennbaren opportunistischen Vergessen. Gedacht wurde der eigentlichen Sieger über Nationalsozialismus, Faschismus und japanische Militärdiktatur – der Streitkräfte der Alliierten, der Partisanen in den Dschungeln Vietnams und in den Schluchten des Balkans. Gedacht wurde auch der zivilen Opfer – etwa bezogen auf die fast zu hundert Prozent zerstörten Städte Warschau und Stalingrad. Möglichst vergessen sollte „München“ werden – das Zurückweichen der westeuropäischen Demokratien vor der militärischen Erpressung durch Hitler-Deutschland. Und erst recht vergessen wollte die UdSSR den Pakt, den die Sowjetunion mit Hitler geschlossen hatte. Vergessen sollte sein, dass zwischen September 1939 und Juni 1941 die UdSSR und die Moskau-hörigen kommunistischen Parteien den Verteidigungskrieg, den Polen, Frankreich und das Vereinigte Königreich führten, als „imperialistischen Krieg“ denunziert hatten. „Antifaschistisch“ wurde dieser Krieg ja erst, als auch die Sowjetunion sich zur Wehr zu setzen hatte.
Kaum wahrgenommen wurde 1945 und in den Jahren danach, dass die Ausmordung derer, die vom NS-Regime als Jüdinnen und Juden punziert worden waren, von einer besonderen, einer erstmaligen Qualität des Bösen war. Der Holocaust war kein Kriegsverbrechen – und kein Verbrechen des Faschismus schlechthin. Diese Erst- und (bisherige) Einmaligkeit bewusst zu machen, das hätte die vor allem von der UdSSR benutzte generelle Kategorie „Faschismus“ in Frage gestellt. Gestört hätte es auch die Traditionen des europäischen, des christlichen Antisemitismus, weil so dessen Vor- und Weiterleben thematisiert worden wäre. Das aber wollten viele, die den Antifaschismus im Munde führten, gerade nicht: nicht die kommunistischen Parteien Europas, die sich bald – unter Nutzung der Etikette „Zionismus“ und „Kosmopolitismus“ – des Antisemitismus bedienten. Und das wollten ebenso wenig die christlichen Kirchen, denen wohl deshalb zum Holocaust nichts eingefallen war, weil dieser eine explizit christliche Vorgeschichte hatte.
Opportunistisches Vergessen war angesagt, wenn es um die zwischen Hitler und Stalin vereinbarte Aufteilung Mittel- und Osteuropas ging; oder auch um den politischen Hintergrund der Konkordate, die zwischen dem Papst auf der einen und Mussolini, Hitler, Dollfuß, Franco auf der anderen Seite geschlossen worden waren. Da wurde die Sicherung der pastoralen Freiheit der Kirche als rechtfertigendes Motiv angeführt – nicht aber, dass diese Konkordate auch Produkte der demokratiefeindlichen Soziallehre der Päpste waren; auch nicht, dass die Verträge zwischen Kirche und Diktatoren diesen als Propagandamittel dienten. Wäre Antifaschismus als die unbedingte Gegnerschaft zu den von Hitler und den japanischen Militärdiktatoren repräsentierten Systemen verstanden worden, hätten die Antifaschisten die eigenen Verbrechen nicht mehr geheim halten können – etwa die Morde von Katyn, als die UdSSR noch als faktischer Verbündeter Hitler-Deutschlands agierte; etwa die europäischen Kolonialsysteme in Asien, deren Beendigung der japanischen Aggression als Rechtfertigung diente.
Ein von politischen Interessen geprägter, höchst selektiver Umgang mit den „Faschismus“ genannten Realitäten zeigte sich auch bei den Kräften, die 1945 Deutschland und Japan (und davor schon Italien) zur „bedingungslosen Kapitulation“ gezwungen hatten. Nur verschämt und verspätet stellten sich die USA dem Widerspruch, dass sie gegen den deutschen und japanischen Rassismus mit nach „rassischen“ Kriterien segregierten Streitkräften gekämpft hatten. Churchill hatte bis 1945 sicherstellen wollen, dass die zwischen ihm und Roosevelt 1941 feierlich verkündete „Atlantic Charta“ nur für „weiße“ Menschen gelten sollte, nicht aber für die „farbigen“ Völker des britischen Weltreiches. Im Herrschaftsbereich Stalins kam es zu ethnischen Säuberungen, die sich nicht gegen Anhänger NS-Deutschlands richteten, sondern gegen ethnisch definierte Bevölkerungsgruppen – Krim-Tartaren, Sudetendeutsche und andere. Die dabei verwendeten Kriterien (ethnische Zugehörigkeit) entsprachen den Grundsätzen des Nationalsozialismus.
Der Faschismus der „Achse“ war eine Fassade, hinter der sich unterschiedliche Varianten politischer Ordnung verbargen – verbunden nur durch ihre entschiedene Frontstellung gegen Aufklärung, Demokratie und Menschenrechte; vereint freilich auch durch zufällig gegebene geopolitische Interessen. Diese reichten aber nicht aus, um eine gemeinsame globale Strategie zu entwickeln, eine gemeinsam abgesprochene Militärstrategie der „Achse“, wie dies die USA und das Vereinigte Königreich (und teilweise auch unter Einbindung der UdSSR) vermocht hatten. Hitler wurde 1940 von Mussolinis Angriff auf Griechenland ebenso überrascht wie Japan vom deutschen Überfall auf die UdSSR – wie auch Mussolini und Hitler im selben Jahr von Pearl Harbor. Die fehlende Gemeinsamkeit in allen zentralen Bereichen der Geopolitik zeigte sich auch darin, dass das faschistische (falangistische) Spanien sich nicht der „Achse“ anschloss. Franco hatte in Hendaye im Herbst 1940 gegenüber Hitler offenbar bewusst Forderungen gestellt, die mit den Interessen Mussolinis unvereinbar waren. Das halbfaschistische Portugal hingegen kooperierte de facto militärisch mit den westlichen Alliierten – bot aber nach 1945 halbfaschistischen und faschistischen Diktatoren wie Miklos Horthy und Ante Pavelic Asyl. Was war da Gemeinsames, das die Faschismen verbunden hatte?
Der Antifaschismus erwies sich allerdings ebenso als Fassade, hinter der vollkommen unvereinbare Systeme zunächst Lippenbekenntnisse antifaschistischer Art abgaben, bald aber sich einander vorzuwerfen begannen, die Tradition der gemeinsamen Gegner von gestern fortzuführen. Und diese Vorwürfe hatten ja auch nicht nur eine propagandistische Funktion, sondern auch – teilweise – Substanz: NS-Weltraumexperten, die davor noch an Techniken zur Zerstörung Londons und New Yorks gearbeitet hatten, entwickelten bald nach 1945 nicht nur Raketen für den Flug zum Mond, sondern auch Waffensysteme für die US-Air Force, deren strategischer Gegner die UdSSR war; und dem Unterdrückungsapparat der UdSSR konnte zu Recht vorgehalten werden, seine gegen tatsächliche oder vermeintliche politische Feinde gerichtete Repressionsenergie stünde der des SS-Staates in nichts nach.
Ein besonders groteskes Beispiel für die Beliebigkeit des Antifaschismus lieferte die Politik der UdSSR. Nach dem sechsten Kongress der Kommunistischen Internationale, 1928, wurden Sozialdemokraten weltweit als „Sozialfaschisten“ gebrandmarkt. Wenige Jahre später waren sie der Komintern als Partner im strategischen Konzept der „Volksfront“ willkommen – im Kampf gegen den Faschismus. 1939 verschwand, bis 1941, der Begriff Faschismus zur Gänze aus dem Vokabular der sowjetischen Propaganda (Kolakowski 1978, 127, 134) – nur um ab Juni 1941 mit aller Macht wiederzukehren, zur Kennzeichnung des Nationalsozialismus, nachdem Deutschland seinen Vernichtungskrieg gegen die UdSSR begonnen hatte. Antifaschismus war gerade für kommunistische Parteien ein sekundärer Faktor in ihrer unbedingten Loyalität gegenüber der Sowjetunion. Der Antifaschismus der UdSSR aber war ein Propagandaballon, der je nach der aktuellen Interessenlage der sowjetischen Außenpolitik hoch- oder niederging.
In den Moskauer Schauprozessen 1937 und 1938 war den Angeklagten aus dem „trotzkistisch-sinowjewistischen terroristischen Zentrum“ und dem „sowjetfeindlichen trotzkistischen Zentrum“ noch vorgeworfen worden, eine „Agentur der faschistischen Spionagedienste“ zu sein. (Wyschinski 1951, 632) „Faschismus“ war ein – in den konkreten Fällen der Moskauer Prozesse – erfundenes Verbrechen, das den Mitkämpfern Lenins vorgehalten wurde und zur Begründung für deren Hinrichtung diente. Dieser strafrechtliche Tatbestand war vergessen, als Stalin und Molotow im August 1939 Joachim Ribbentrop in Moskau willkommen hießen. Doch schon bald konnte niemand mehr die der UdSSR hörigen kommunistischen Parteien in ihrem Antifaschismus übertreffen.
An die Köpenickiade (besser: an die zynische Komödie) des sowjetischen Antifaschismus wollten sich die kommunistischen Parteien nicht mehr erinnern, als nach 1945 im Zusammenhang mit dem Ost-West-Konflikt ein anderer Wettlauf einsetzte: Welche Seite wäre glaubwürdiger, wenn es um einen Trennungsstrich gegenüber den Gegnern von gestern, den Faschisten, der „Achse“ ging? Und auf beiden Seiten gab es Gründe, statt einer differenzierten Debatte auf plakative Slogans zu setzen.
Faschist ist immer der andere
Faschismus und faschistische Bewegungen existierten überall – jedenfalls in Europa. Ernst Nolte zählt faschistische Parteien und Bewegungen in allen Staaten des Kontinents auf: Mit Ausnahme der UdSSR und Jugoslawien (nicht aber Kroatien) gab es überall Faschismus; freilich nur in einer Minderheit dieser Staaten kam der Faschismus „an die Macht“. Nolte verwendete auch demonstrativ den Begriff „Faschismen“, um damit zu unterstreichen, dass die Vielfältigkeit des Faschismus einen umfassenden Faschismusbegriff, der alle faschistischen Phänomene umfassen würde, eigentlich nicht zulässt – alle die Bewegungen, Parteien, Regierungen, auf die mehr oder minder schlüssig ein solcher Begriff angewendet werden könnte. (Nolte 1966)
1945 und danach wollten die meisten, die sich in faschistischen Bewegungen und Parteien engagiert hatten, nichts mehr davon wissen. Zu sehr hatte die Geschichte ein faktisches und ein moralisches Urteil gesprochen. Faschismus wurde zu einem Vorwurf, zu einem Schimpfwort geradezu, das man – vor allem auch im Zusammenhang mit dem „Kalten Krieg“ – einander an den Kopf warf. Kaum jemand, kaum eine Partei, kaum ein Staat wollte diesen Vorwurf auf sich sitzen lassen. Aber gerne zeigte man mit dem Finger auf andere und nannte sie Faschisten.
In der Bundeswehr des neu gegründeten westdeutschen Staates dominierten Offiziere der Wehrmacht, und der westdeutsche Geheimdienst – der BND (Bundesnachrichtendienst) – wurde anfangs von Spionage-Experten des NS-Staates geleitet. Staatssekretär im Bundeskanzleramt Konrad Adenauers war ein schwer belasteter „ehemaliger“ Nationalsozialist – Hans Globke. Der DDR diente deshalb der Antifaschismus als Versuch zur Identitätsstiftung, in Abgrenzung zu der – angeblich, tatsächlich – von früheren Nationalsozialisten beherrschten oder zumindest beeinflussten Bundesrepublik.
In der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald wurde der Kommunisten und der anderen Patrioten gedacht – die Besonderheit der Opferrolle der Jüdinnen und Juden wurde, wie im gesamten sowjetischen Einflussbereich, einfach übergangen. Die Uniformen der NVA – der „Nationalen Volksarmee“ der DDR – erinnerten an die der Wehrmacht. Sie hoben sich demonstrativ von den Uniformen der westdeutschen Bundeswehr ab, die sich an den US-Streitkräften orientierten. „Nazis“ und Kriegsverbrecher gab es – nach herrschender DDR-Diktion – nur im Westen, und die Bundesrepublik leistete diesem Argument auch Vorschub, indem sie bis in die 1960er Jahre hinein einer strafrechtlichen Auseinandersetzung mit dem NS- und SS-Staat auswich.
Als im Sommer 1961 die DDR West-Berlin mit einer Mauer einschloss, wurde diese von den ostdeutschen Kommunisten als „antifaschistischer Schutzwall“ gerechtfertigt. Der Antifaschismus wurde bemüht, um eine vom antinazistischen Spanienkämpfer Willy Brandt regierte Stadt zu isolieren; eine Stadt, in der nach wie vor Truppen der USA, des Vereinigten Königreiches und der Französischen Republik die oberste Autorität besaßen. Sollte die DDR (und Ost-Berlin) von den bis 1945 mit der UdSSR verbündeten antifaschistischen Mächten geschützt werden, die einen Antifaschisten von den anderen? Das war natürlich ein Unsinn, der niemanden überzeugen konnte und nicht einmal als Propaganda geeignet war – der aber vernebeln sollte, dass die Aufgabe dieses antifaschistischen Walls die Verhinderung der Massenflucht aus der DDR war.
Die Inflation des Faschismusbegriffes floss auch in die Debatte über die Einschätzung der mit dem Jahr 1968 identifizierten Protestbewegung in Westeuropa, aber auch in den USA und Japan ein. Die „68er Bewegung“ machte viele ratlos, die dieses Phänomen einer rebellierenden Jugend, die nicht proletarisch, sondern in ihrer Gesamtheit eher bürgerlich privilegiert war, begreifen wollten. Wie sollte man die „68er“ einordnen? Da bot sich „faschistisch“ an – zur Kennzeichnung von etwas, was sich „links“ gab, aber nicht Arbeiterbewegung, nicht „links“ in einem traditionellen Sinn war. „One reason why liberal and conservative observers were quick to speak of ‘left-wing fascism’ in the face of student rebellion was the apparent return of anti-parliamentarism …“ (Müller 2011, 183)
Als ab 2020 die Corona-Pandemie Regierungen in aller Welt veranlasste, Schutzmaßnahmen verpflichtend vorzuschreiben, die den individuellen Freiheitsraum der Menschen einschränkten, sprachen Kritiker rasch von einem „Corona-Faschismus“. Das war dieselbe Beliebigkeit, die hinter dem Begriff „Links-Faschismus“ um 1968 stand. Diese Unschärfe, diese Gedankenlosigkeit des Umgangs mit dem Faschismus-Begriff zeigte, dass Faschismus und Faschist zu einem Schimpfwort verkommen waren.
Zum Faschismus wollte sich nach 1945 niemand bekennen, wer im politischen Diskurs ernst genommen werden sollte. Der Faschismus konnte nicht verteidigt werden. Aber es war möglich, die Realität des Faschismus in unterschiedlichem Licht darzustellen; zu relativieren, zu verharmlosen. Der Faschismus war überwunden, aber seine Wurzeln waren noch vorhanden. Seine Wiederkehr konnte nicht ausgeschlossen werden.
In Italien begannen bald in von Renzo De Felice dominierten akademischen Diskussionen Versuche, die vorhandenen Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus als Argumente für eine Relativierung der Diktatur Mussolinis zu nutzen. (Beikircher 2003, 76–86). Hitler hätte sich völlig zu Unrecht auf Mussolini berufen, dieser hätte „bloß“ den Fehler begangen, sich von Hitler in die Katastrophe des Weltkrieges hineinziehen zu lassen. Diese Versuche eines partiellen Neuzugangs zum (italienischen) Faschismus fanden vor dem Hintergrund der diskutierten Einbindung der postfaschistischen „Alleanza Nazionale“ in ein breites Mitte-Rechts-Regierungsbündnis statt: eine weitere Bestätigung des Phänomens, dass das aktuelle Verständnis von Faschismus und Antifaschismus immer auch politischen Opportunitätserwägungen folgt.
In Japan ermöglichte die Kontinuität der Monarchie – trotz der von den USA durchgesetzten radikalen Demokratisierung anderer, entscheidender Teile des politischen Systems – eine Rechtfertigung, über die Kriegsverbrechen Japans (vor allem die in China) zu schweigen. Das wiederum ermöglichte Stimmen in Korea und China, nationale Empörung gegen das japanische Vergessen abzurufen. In Österreich sorgte ein nur an der Oberfläche akademischer Disput über den faschistischen Charakter des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes für die Möglichkeit, jederzeit einen Streit zwischen den beiden Parteien aufflammen zu lassen, die 1945 und in den Jahren danach gemeinsam die demokratische Republik (wieder) aufgebaut hatten: Der Streit über den Austrofaschismus, über den faschistischen Charakter der Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur, funktionierte und funktioniert noch immer wie auf einen Knopfdruck, der die Wiederholung längst bekannter Argumente auslöst.
In Japan förderten auch die katastrophalen Folgen des US-amerikanischen Bombenkrieges die Neigung, das Land (und indirekt damit auch das für den Aggressionskrieg verantwortliche System) als Opfer zu sehen. Hiroshima und Nagasaki wurden zum Symbol für die Verwerflichkeit des Krieges schlechthin. Hinter dieser Funktionalisierung konnte die Verantwortung für den Ausbruch des Krieges ebenso relativiert werden wie auch die Kriegsverbrechen Japans und die Brutalität der Militärdiktatur.
Insgesamt freilich war Faschismus, mit Ausnahme der Mussolini-Nostalgie einer kleinen Zahl Unverbesserlicher in Italien und insgesamt kleiner Terrorzellen (wie des NSU, des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ in Deutschland), zum Unwort geworden; besser – zu einem Schimpfwort, zu einem Begriff, den man sich wechselseitig an den Kopf werfen konnte. Diejenigen, die in Österreich den Unrechtscharakter des „Ständestaates“ relativieren, wollen diesen nicht faschistisch genannt sehen. Die konservativen Kräfte des wieder demokratischen Spaniens verweisen auf die Fähigkeit der in ihrer Sicht eben nicht faschistischen Diktatur, sich im Weltkrieg nicht von Mussolini und Hitler instrumentieren zu lassen – und auf das Geschick Francos, durch die Weichenstellung in Richtung Monarchie eine friedliche Transformation ermöglicht zu haben. Und in der Bundesrepublik Deutschland sehen zwar viele den Nationalsozialismus als eine Art Betriebsunfall der deutschen Geschichte und weichen so einer tieferen Debatte aus – aber die unbedingte Abgrenzung zum NS-Staat ist innerhalb der parlamentarisch wirkenden Kräfte Deutschlands unbestritten.
Jeder und jede hat seinen, hat ihren Faschismus und verwendet ihn zumeist als grobe Schlagwaffe gegen politische Gegner. Und jede, jeder nützt ihren und seinen Antifaschismus nach Belieben. Damit droht aber Faschismus aufzuhören, ein sinnvoller Begriff zu sein, verwendbar für eine Typologie nicht-demokratischer politischer Systeme. Für eine solche Kategorisierung kann der Begriff „Faschismus“ kaum noch einen sinnvollen Beitrag leisten. Wenn, dann dürfte nicht vom Faschismus schlechthin gesprochen werden, sondern von einem Faschismus à la Italien; von den Analogien und Unterschieden zwischen den verschiedenen Faschismen; aber auch von Gemeinsamkeiten zwischen Faschismen auf der einen, anderen Systemen – demokratischen wie auch nicht-demokratischen – auf der anderen Seite.
Aber weil der Faschismus zu einem im politischen Alltag bewusst eingesetzten Billigwort verkommen ist, schon vor 1939, und das auch nach 1945 geblieben ist, kann dieser Begriff trotz seiner Unschärfe und Beliebigkeit nicht ignoriert werden – vor allem, weil ihm ja eine Fülle historischer Erfahrungen zugrunde liegt. Dass der Begriff Faschismus nicht einfach abgelegt werden kann, bedeutet aber nicht, ihn als beliebig verwendbare Leerformel zu akzeptieren. Es geht vielmehr um die Differenzierung, und das heißt auch um die Dekonstruktion des Begriffes.
Die historischen Beispiele der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weisen eine Fülle von Gemeinsamkeiten aller Faschismen auf: ein militanter Affekt gegen die Aufklärung und das damit verbundene Bemühen um eine rationale Sicht der Welt; eine ebenso militante Neigung zu nationalistischen Opfernarrativen; eine extreme Neigung, als „fremd“ definierte Menschen aus der Gemeinschaft auszuschließen; auf die Tendenz, die gesellschaftliche Rollendifferenzen zwischen Frauen und Männern als naturgegeben und unaufhebbar festzuschreiben; auf eine geradezu hasserfüllte, emotionale Ablehnung über multinationale politische Verflechtungen eine transnationale Politikebene (wie die Europäische Union) aufzubauen und am unbedingten Vorrang nationalstaatlicher Souveränität festzuhalten.
Die in der politischen Realität aber wesentliche Gemeinsamkeit der sich mehr oder weniger auf das italienische Beispiel berufenden Systeme war die Ablehnung der (liberalen, „westlichen“) Demokratie. Doch dieses Merkmal der prinzipiellen Absage an die liberale Demokratie lässt sich auch für die deklariert antifaschistischen Systeme des (späteren) 20. Jahrhunderts feststellen: Es war die DDR, die – trotz ihres Anspruches auf den Antifaschismus – ein latent totalitäres Einparteiensystem errichtete; es war Kuba, in dem nach 1959, dem sowjetischen Muster folgend, jede Form organisierter politischer Opposition unterdrückt wurde – und dennoch von vielen „Antifaschisten“ insbesondere auch in Europa bewundert wurde. Waren Walter Ulbricht und Fidel Castro „Antifaschisten“ – oder wurde ihnen diese Etikette zugestanden, um die Diktaturen zu rechtfertigen, für die sie standen? Was bedeutet dies für eine sinnvolle Verwendung des Begriffes Antifaschismus, wenn ihn sowohl Demokraten als auch Antidemokraten in Anspruch nehmen können?
Besonders eindringlich wird die Beliebigkeit des Begriffes Faschismus demonstriert, wenn unter dem Deckmantel „Achse“ auch Japan für einen „globalen Faschismus“ in Anspruch genommen wird – als Teil einer „faschistischen Weltverschwörung“. (Hedinger 2021, 223–265, 365–408) Das Japan, das militärisch sich China zu unterwerfen versuchte; das Japan, das 1939 an der Grenze zwischen der Mandschurei und der UdSSR in Kämpfe mit der sowjetischen Armee verstrickt war, Schlachten, die eigentlich schon den Charakter eines nicht deklarierten Krieges aufwiesen; das Japan, das 1941 einen Angriffskrieg gegen die USA und das Vereinigte Königreich startete: Dieses Japan wies die zentralen Kriterien nicht auf, die generell für spezifisch faschistisch galten und gelten. Das japanische politische System baute auf keiner Massenbewegung und keiner Einheitspartei; es kannte keinen „Duce“ oder „Führer“ oder „Caudillo“. Hinter der Fassade einer konstitutionellen Monarchie, in der dem Tenno, dem Kaiser, ausschließlich eine symbolische Legitimationsfunktion zukam, diktierten Generäle und Admiräle eine aggressive, expansionistische Politik nach außen und eine repressive Politik nach innen. Wenn diese Merkmale der japanischen Diktatur ausreichen, um das Japan der Jahre 1937 bis 1945 faschistisch zu nennen, dann wird der Faschismusbegriff sinnentleert; dann steht Faschismus für jedes Unrechtsregime, für jede Diktatur; oder, besser, für alles, was gerade abgelehnt wird.
Das war und ist offenkundig das Schicksal des Faschismus: Er ist zu einem sinnentleerten Begriff geworden, der – nach 1945 fast ausschließlich negativ konnotiert – auf alles angewendet werden kann, was eindeutig nicht Demokratie, was eben Diktatur ist. Damit aber verlieren Faschismus und Antifaschismus jede sozial- und politikwissenschaftlich sinnvolle Funktion: Sie können nicht mehr zur Differenzierung der gesellschaftlichen, der politischen Realität verwendet werden. Sie sind zu beliebig einsetzbaren plakativen Slogans geworden.
Dass Faschismus und Antifaschismus zu intellektuell billigen Propagandavehikeln geworden sind, muss nachdenklich stimmen. Die Reduktion von Faschismus und Antifaschismus auf eine Phraseologie verlangt nach rationalen Antworten auf Fragen wie: Was ist gemeint, wenn von Faschismus und Antifaschismus gesprochen wird? Was verbirgt sich hinter der Nebelwand solcher Formeln? Wie kann man hinter dem Krieg der Worte deren Funktion als politisch instrumentierte Leerformeln ausmachen?
Die Suche nach dem Gemeinsamen aller Faschismen
Zu den Gemeinsamkeiten aller Faschismen wird gezählt, dass eine Machtergreifung des Faschismus eine Massenbewegung voraussetzt, die zur Monopolpartei wird. Das gilt sicherlich für Italien und Deutschland – das gilt aber ebenso eindeutig nicht für Japan. In Österreich wandelte sich 1933 die Christlichsoziale Partei, die als Partei des Politischen Katholizismus schon im Rahmen der Verfassung der demokratischen Republik regierte, in die Monopolpartei Vaterländische Front um: Die Regierungspartei wechselte ihre Etikettierung und zerstörte die Demokratie – blieb aber in der Substanz dieselbe. In Spanien bediente sich die Militärdiktatur der bereits bestehenden, antidemokratischen, aber zur Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen Falange, um – ex post – dem Modell des italienischen Faschismus zu entsprechen. Es war nicht die Falange, die Franco zum Sieg geführt hatte. Franco siegte im Bürgerkrieg mit militärischen Mitteln – und bediente sich dann der Falange. Die japanische Diktatur hatte überhaupt keinen Bedarf für eine Massenbewegung und eine Massenpartei: Erst als Japan schon im Krieg verstrickt war, wurde von den regierenden Militärs eine Art von Partei und Massenbewegung ins Leben gerufen, deren politische Bedeutung aber gleich null war.
Als ein weiteres Merkmal des Faschismus schlechthin gilt die Personalisierung der Macht – die Machkonzentration in einer Person: der „Duce“, der „Führer“, der „Caudillo“. Dieses Merkmal wurde beispielhaft von Benito Mussolini und Adolf Hitler entwickelt. Engelbert Dollfuß versuchte – ebenso wie Kurt Schuschnigg – mit eher begrenztem Erfolg sich als unbestrittene „Führer“ des österreichischen „Ständestaates“ zu profilieren. In Japan fehlte überhaupt jedes Äquivalent zur Personalisierung – sieht man von dem als mythische Figur der Öffentlichkeit entrückten Tenno ab.
Hitler-Plätze und Mussolini-Büsten erfüllten Pflichtaufgaben in deutschen und italienischen Städten. Aber weder in Italien noch in Deutschland gab es ein Äquivalent zu Leningrad und Stalingrad, und überlebensgroße Statuen, die an Diktatoren erinnern, gibt es noch im 21. Jahrhundert in Teilen Russlands – und im kommunistischen Nordkorea. Auch die USA haben ihre Hauptstadt nach einer Person benannt – nach dem ersten US-Präsidenten. In mehreren nordamerikanischen Staaten finden sich Städte, die nach anderen Präsidenten benannt sind: Jefferson, Madison, Monroe, Jackson, Lincoln. Personalisierung und Personenkult – ein Merkmal des Faschismus? Ja, aber.
Was die drei Achsenmächte und Spanien und mit gewissen Einschränkungen auch das Österreich der Jahre 1934 bis 1938 gemeinsam hatten, das war ein auf Repression und Terror errichtetes System. Alle fünf der faschistischen oder unter Faschismusverdacht stehenden Staaten verstanden sich als Antithese zu den Werten der (bürgerlichen) Revolution und des demokratischen Rechtsstaates. Was immer Faschismus bedeutet – er war und ist die prinzipielle Ablehnung von Demokratie, verstanden als ein offenes, pluralistisches System der Machtverteilung auf eine Mehrzahl von Institutionen. Doch diese liberale Demokratie bekämpften und bekämpfen die sich auf den Marxismus-Leninismus berufenden Systeme auch: in der UdSSR und deren Einflussbereich, in der Volksrepublik China, in Nordkorea, in Kuba. Sollte man deshalb den Herrschaftskommunismus „faschistisch“ nennen?
Die real existierenden Faschismen benötigten Feindbilder, gegen die Emotionen mobilisiert werden konnten. Diese Feindbildfunktion erfüllte beispielhaft das „Weltjudentum“ und die „jüdische Rasse“ – beides ein Konstrukt des Nationalsozialismus, zögerlich und verspätet übernommen vom italienischen Faschismus. Die österreichische und die spanische Diktatur kamen ohne dieses spezifische Feindbild aus. Und in Japan gab es ab 1941 ein anderes Feindbild: das des arroganten und gleichzeitig dekadenten Westens, repräsentiert von Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill. Der Westen war das Fremde, das Dämonische, das sich anschickte, die „Yamato Rasse“ zu vernichten – das von der göttlichen Vorsehung zur Herrschaft bestimmte Japan. (Dower 1986, 203–292) Dass in den USA zur Aufschaukelung der Kriegsbereitschaft ebenfalls antijapanische Klischees unter Nutzung vorhandener rassistischer Ressentiments genützt wurden, unterstreicht noch zusätzlich die Einsicht, dass Rassismus kein spezifisches oder gar ein ausschließliches Merkmal von Faschismus ist.
Die von Japan genutzten Feindbilder waren in den Bereich durchaus traditioneller politischer Propaganda einzuordnen – wie sie kriegführende Staaten schon im Ersten Weltkrieg verwendet hatten. Ein wirkliches Äquivalent zu dem vom Nationalsozialismus konstruierten Bild einer jüdischen Weltverschwörung – ein Bild, das auch schon davor politisch instrumentalisiert worden war (etwa im zaristischen Russland) – und die damit verbundene Reduktion aller NS-Gegner („Bolschewiken“ und/oder „Plutokraten“) zu Marionetten des Judentums sucht man vergeblich – im Italien Mussolinis, im Österreich Dollfuß’, im Japan der Militärdiktatur, im Spanien Francos. Feindbilder wurden in allen diesen Staaten genutzt – etwa die antikommunistischen Bedrohungsszenarien der Franco-Diktatur. Aber keine andere Konstruktion von Feindbildern führte zu einem Holocaust. Dieser bleibt ein Alleinstellungsmerkmal des Nationalsozialismus.
Der Bedarf an Feindbildern verbindet Faschismus und Nationalismus. Dieser baut auf einem übersteigernden Bewusstsein nationaler Identität – und für eine solche Übersteigerung braucht es ein „Defining Other“. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war für den deutschen Nationalismus das „Defining Other“ Frankreich – und für den französischen Nationalismus Deutschland. Für den irischen Nationalismus erfüllte England diese Funktion, für den polnischen Nationalismus Deutschland und Russland, und für den griechischen die Türkei. Tatsächlich waren die Faschismen des 20. Jahrhunderts und auch der japanische Expansions- und Eroberungsdrang durchwegs von einem ausgeprägten, ja extremen Nationalismus bestimmt – von einer scheinbar vorgegebenen Abgrenzung des nationalen „Wir“ gegenüber den anderen. Roger Griffin sieht daher den Faschismus – auch – als eine revolutionäre Form des Nationalismus. (Griffin 2018, 37–62)
Was den Faschismus, was die Faschismen auch charakterisierte, das war ein expansiver Imperialismus. Das Deutsche Reich musste zum „Großdeutschen Reich“ werden und Osteuropa als Siedlungsraum beanspruchen, um den nationalsozialistischen Zielvorstellungen gerecht zu werden. Mussolini setzte auf das „Imperium Romanum Secundum“ – ohne Rücksicht darauf, was die Menschen in Abessinien oder Albanien davon hielten. Japan kontrollierte ab 1933 die Mandschurei, ein wirtschaftliches Zentrum Chinas, das in das scheinsouveräne Kaiserreich Mandschukuo verwandelt wurde – von Japans Gnaden. Und die letzten Versuche, im Herbst 1941 doch noch einen Krieg zwischen Japan und den USA zu vermeiden, scheiterten an der Frage China: Japan war nicht bereit, einen Rückzug aus den bereits von Japan eroberten und besetzten Teilen Chinas auch nur zu diskutieren.
Aber Spanien? Francisco Franco ging auf Hitlers Anregungen nicht ein, sich territorial zu bereichern – auf britische Kosten (Gibraltar), auf französische Kosten (Nordafrika). Auch Ribbentrops Lockangebot, Portugal müsse doch nicht auf Dauer unabhängig sein, stieß bei der Führungsspitze der spanischen Diktatur auf taube Ohren. Und Österreich? Das pflegte zwischen 1934 und 1938 eine höchst unverbindliche Habsburg-Nostalgie, die aus mehreren Gründen keine politischen Konsequenzen haben konnte. Die militärische und wirtschaftliche Schwäche des kleinen Landes war eine Ursache für das Defensivgehabe, und die Rücksicht auf den Schutzpatron Italien eine andere: Hätte doch jeder Grenzrevisionismus sich zuallererst auf das Italien zugesprochene Südtirol beziehen müssen.
Was expansiven, kriegerischen Imperialismus betrifft: Da lieferte die sowjetische Expansion in Richtung Polen, das Baltikum und Bessarabien mehr Analogien zum deutschen und italienischen Faschismus als das halbfaschistische Österreich und das falangistische Spanien. Macht es Sinn, deshalb die Sowjetunion faschistisch zu nennen?
Der Faschismus in allen seinen Varianten nützte in seinem Aufstieg zur Macht nationale Opfernarrative – und auch nach der Erringung der Regierungsmacht wurden solche Narrative genutzt, um die bereits gewonnene Macht abzusichern. Die Erfolge der NSDAP waren nicht vorstellbar ohne den Versailles-Mythos, der in Deutschland ab 1918 herrschte – und nicht nur in rechtsextremen Zirkeln. „Im Felde unbesiegt“ – das Deutsche Reich wäre nicht militärisch geschlagen, sondern durch Intrigen hinterrücks erdolcht worden. (Krumeich 2018) Der Vertrag, der 1919 in Versailles den Vertretern der deutschen Republik diktiert worden war, wurde von vielen (wohl den meisten) in Deutschland als ein besonderer Unrechtsvertrag gesehen. Übersehen wurde nur allzu gerne, dass der 1917 von deutschen Interessen geprägte Vertrag von Brest-Litowsk sich in seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Verlierer mit der Rücksichtslosigkeit des Vertrages von Versailles durchaus messen kann. In Italien und in Japan spielte das Narrativ, in der 1919 formulierten Friedensordnung hätten einige Siegernächte – vor allem das Vereinigte Königreich und die Französische Republik – andere Siegermächte (eben Italien und Japan) übervorteilt, eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung weiter Teile der Gesellschaft gegen Parlamentarismus und Demokratie. Für Spanien freilich lässt sich kein Äquivalent zur Rolle solcher Opfererzählungen feststellen – außer man bemüht den nostalgischen Rückblick auf die Zeit, in der Spanien die Weltmacht Nummer eins war und weite Teile der westlichen Hemisphäre beherrschte.
Was die Faschismen aber sicherlich gemeinsam auszeichnete, das war der Affekt gegen die Moderne; gegen den Geist, der – gerade auch in der Sicht Benito Mussolinis, aber auch Engelbert Dollfuß’ – mit der Französischen Revolution einsetzte. Die Vorstellung der Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Geschlecht und Ethnizität und Religionsbekenntnis; eine Vorstellung, die in der amerikanischen und der französischen Revolution als eine abstrakte Norm zwar formuliert, aber (jedenfalls zunächst) nicht umgesetzt wurde, war wie ein Stachel, der die Faschismen reizte. Hitler hatte in seinen Erinnerungen formuliert, ihn hätte die Ablehnung des Gedankens, auch Juden wären Deutsche, schon in Wien um 1900 beeinflusst und politisch mobilisiert. Mussolini hatte für den Feminismus nichts als Verachtung übrig. Und die katholischen Diktatoren Österreichs und Spaniens konnten und wollten nicht akzeptieren, dass der Katholizismus keine privilegierte Vorrangstellung mehr einnehmen sollte – eben deshalb nutzten Dollfuß und Franco ihre nicht demokratisch kontrollierte Macht, der Kirche ihre Privilegien zu bestätigen oder zurückzugeben.
Mussolini, der einstmals sozialistische Revolutionär, der sich auch als Faschist zu einer – nebulosen – permanenten Revolution bekannte, stilisierte sich als „Duce“ in einem oft die Grenze der Peinlichkeit berührenden Weise: mit nacktem Oberkörper am Strand, als Sportler auf dem Tennis Court oder in Fechtposition, oder aber auf dem Balkon des Palazzo Venezia, den kahlen Schädel in einer Cäsaren-Imitation nach vorne gestreckt: Mussolini gab auch körperlich den starken Mann. Diese Inszenierung faschistischer Männlichkeit war dem nie für irgendeine sportliche Betätigung bekannten Hitler nicht möglich, und auch nicht dem eher klein gewachsenen und erkennbar übergewichtigen Francisco Franco. Bei Dollfuß war die auffallende Kleinwüchsigkeit Grund genug, ihn nicht in irgendeiner physischen Heldengeste zu filmen – und Schuschnigg war zu sehr der Typus des intellektuellen Bücherwurms, um in großen Gesten à la Mussolini glaubwürdig zu sein. Miklos Horthy benützte für die politische Selbstdarstellung immer ein weißes Pferd, auf dem er – reitend – Erfolge seines halbfaschistischen Regimes darstellte, immer in Uniform. Und der slowakische Diktator Jozef Tiso war durch die klerikale Kleidung, die er als katholischer Priester auch an der Staatsspitze nie ablegte, für Heldenposen wenig geeignet, die männliche Körperlichkeit betonen sollten. Die japanischen Militärdiktatoren wären wohl eher für Bilder in demonstrativ männlicher Siegerpose in Frage gekommen – aber allein der kollektive Charakter der japanischen Diktatur erlaubte es nicht, einen einzigen aus dem Kartell der Generäle und Admiräle als Duce oder Führer oder Caudillo hervorzuheben In der Rolle des körperlichen Supermans hatte Mussolini innerhalb der faschistischen Diktatoren eine Ausnahmestellung.
Mussolini hatte eine offenbar tief sitzende Abneigung gegen körperliche Behinderungen. Den US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der nach einer Kinderlähmung an den Rollstuhl gefesselt war, überschüttete Mussolini mit hasserfülltem Spott. Niemals in der Geschichte wäre ein Volk von einem teilweise Gelähmten regiert worden. Es hätte kahlköpfige und fettleibige, hübsche oder auch dumme Könige gegeben – aber niemals einen König, den man auf die Toilette hätte tragen müssen. (Bosworth 2002, 381) Dass dieser US-Präsident aber – unabhängig von seiner Behinderung – für die Kriegsniederlage des sich als Cäsar stilisierenden Mussolini verantwortlich werden sollte, das war eine besondere List der Geschichte.
Hitler konnte sich zwar persönlich kein Vorbild an Mussolinis physischer Selbstdarstellung nehmen, aber die das Körperliche betonenden Erziehungsprinzipien – etwa innerhalb der Hitler-Jugend: („Flink wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl“) – zeigen, dass das Macho-Gehabe Mussolinis auch Parallelen im Anti-Intellektualismus der NSDAP hatte. Die Betonung der „natürlichen“ Rollentrennung von Frauen und Männern war jedem der Faschismen immanent.
Japan war da widersprüchlich auch in einem anderen Sinn: Der Aufstieg Japans zur Großmacht, schon vor dem Ersten Weltkrieg, war begleitet von der Ablehnung der Vormachtsstellung des „weißen Mannes“, der europäischen Kolonialmächte. Das männliche Prinzip Japans vor und während des Zweiten Weltkrieges war die Vorherrschaft des Mannes, aber des „gelben Mannes“. Die antikolonialistische Komponente, die Japan auch zur Rechtfertigung seines Angriffs auf die USA und die europäischen Kolonialgebiete in Südostasien nutzte, entsprach der Gleichheitsnorm der Moderne. Aber im Widerspruch dazu beanspruchte Japan eine nationale Sonderstellung, die das „Land der aufgehenden Sonne“ zur Herrschaft der von europäischen Mächten befreiten Territorien berechtigen sollte und zur Hegemonie über Korea und China. Der aggressive japanische Nationalismus widersprach der Gleichheitsnorm, die Japan in der Auseinandersetzung mit „weißen“ Mächten für sich in Anspruch nahm.
Michael Mann hat für die faschistischen oder dem Faschismus nahestehenden Regierungsformen Europas eine Typologie entwickelt, die deutlich macht, wie vielfältig die Systeme waren, die mehr oder weniger nachvollziehbar in den Jahren und Jahrzehnten nach 1918 faschistisch genannt wurden. Er unterscheidet – unter dem Überbegriff „Autoritarismus“ – halb-autoritäre, halb-reaktionäre, korporative und die im engsten Sinn faschistischen Herrschaftsformen. Diese begründete Differenzierung, die viele Formen des Übergangs zwischen dem einen und dem anderen Regime beinhaltet, unterstreicht nur die Unschärfe von Faschismus als Herrschaftsform und als politischer Begriff. (Mann 2004, 44–48)
Faschismus – die höchste und letzte Stufe des Kapitalismus?
Deutschland, Italien, Japan waren verspätete Reiche. Spanien und Portugal hatten durch Eroberungen und Besiedlungen schon ab dem 16. Jahrhundert Kolonialreiche aufgebaut, deren Grundlage Vertreibung und/oder Ausbeutung indigener Völker war. Die Niederlande, Frankreich und Großbritannien folgten. Deutschland und Italien waren verspätete Kolonialmächte, die sich mit dem begnügen mussten, was die anderen europäischen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent noch übrig gelassen hatten. Japan begann noch später zu expandieren – als Großmacht, die sich auf Kosten asiatischer Staaten bereicherte. Es ist dieses Gefühl, bei der Verteilung der Welt „zu kurz“ gekommen zu sein, das sich mit dem Komplex verband, in Paris hätten 1919 Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA sowohl Japan als auch Italien übervorteilt – und Deutschland zutiefst gedemütigt.
Aber ein koloniales Besitzdenken kann Faschismus nicht erklären: Die Niederlande und England wurden zu Vorreitern einer Entwicklung, die zu Parlamentarismus und (einer zunächst noch sehr unvollkommenen) Demokratie führte; und beide Staaten wurden von der faschistischen Welle nicht überrollt, die in Italien und in Deutschland die Demokratie zerstörte. Die imperiale Vergangenheit war verbunden mit einem Rassismus, der sich in der als „natürlich“ angenommenen Vorherrschaft der „weißen“ Völker manifestierte. Aber eine solche Vergangenheit führte nicht mit innerer Logik zum Faschismus. (Ferguson 2007, 277–311)
Der Imperialismus europäischer Staaten hatte eine ökonomische Komponente – es ging um die Nutzung der Ressourcen in allen Teilen der Welt. Und Deutschland, Italien, Japan fühlten sich als verspätete Kolonialmächte in der Liga der alten Imperien nicht willkommen. Der aggressive Expansionsdrang der aufsteigenden Mächte richtete sich daher gegen die alten Mächte – freilich zuallererst gegen die Völker, die es zu unterwerfen galt, um „Lebensraum“ für das eigene Volk zu gewinnen.
Nicos Poulantzas bringt den Aufstieg des Faschismus in einen ursächlichen Zusammenhang mit ökonomischer Verspätung. Deutschland und mehr noch Italien waren im Vergleich mit England und Schottland in Westeuropa wirtschaftliche Spätentwickler – „late-comers…to capitalism“. (Poulantzas 1974, 25) Deutschlands Ökonomie entwickelte sich aber schnell und wurde bald weltweit die Nummer zwei hinter den USA, noch vor dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Italien jedoch blieb Nachzügler. Von allen größeren Staaten Europas aber war Russland das Schlusslicht der ökonomischen Entwicklung. Was ist davon abzuleiten – für den vermuteten Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus? Das Schlusslicht brach aus der kapitalistischen Entwicklungslogik aus und versuchte, eine systematische Antithese zum Kapitalismus zu etablieren – den Sozialismus. Italien, das mit verzögertem Erfolg in Richtung Kapitalismus unterwegs war, und Deutschland, das sehr rasch in eben diese Richtung voranschritt, wurden faschistisch. Die USA, die Nummer eins im kapitalistischen Ranking, blieb der liberalen Demokratie verpflichtet, den ökonomischen Krisen und der Massenarbeitslosigkeit zum Trotz. Das galt auch für das Vereinigte Königreich und – jedenfalls bis 1940 – auch für Frankreich. Daraus, so sollte man meinen, ist kein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus abzuleiten.
Von allen Faschismustheorien hat keine andere so viel Einfluss auf den ideengeschichtlichen Faschismus-Diskurs genommen wie die Theorie, die vom Marxismus ausging, um den Faschismus zu erklären. Für den orthodoxen Marxismus ist die politische Ordnung immer Überbau über die ökonomische Ordnung, und diese ist Ausdruck der Produktionsverhältnisse. In der Ära des Feudalismus, in der die Verfügungsgewalt über Grund und Boden die Machtverhältnisse bestimmte, entsprach die politische Ordnung den Bedürfnissen der ökonomisch herrschenden Klasse, der Feudalaristokratie. Innerhalb dieser Ordnung entwickelten sich neue gesellschaftliche Verhältnisse. Im Gefolge von Industrialisierung und Urbanisierung wurde die alte herrschende Klasse (die Aristokratie) durch eine neue ersetzt – die Bourgeoisie. Deren Primärinteresse war und ist die Maximierung der Profite. Wenn diesem Interesse eine liberaldemokratische politische Ordnung dienlich ist, lässt die herrschende Klasse Demokratie zu. Demokratie ist in diesem orthodox-marxistischen Verständnis nichts als Schönwetterkapitalismus.
Sobald aber im Gefolge der insgesamt unausweichlichen Krisen des Kapitalismus sich die Nützlichkeit einer auf politischem Pluralismus bauenden Ordnung nicht mehr zeigt – etwa im Zuge der Verschärfung des Klassenkampfes, hat die Demokratie ihre Nützlichkeit verloren. Die Bourgeoisie greift, zur Wahrung ihrer Primärinteressen, zu den Mitteln der Diktatur. Diese kommt nicht mehr in Form der feudalen Herrschaft der Vergangenheit, sondern in Gestalt eines Bündnisses zwischen Kapitalismus und den Teilen der Gesellschaft, die sich – mangels Einsicht in ihre wahren Interessen – dem Fortschritt in Richtung Sozialismus entgegenstellen. Der Bündnispartner der Herren über das Kapital ist vor allem das Kleinbürgertum, das seinen Klassenstatus nicht klar auszumachen versteht. Mit anderen Worten: Die Bourgeoisie braucht eine ihr dienende Massenbewegung, um den Ansturm der proletarischen Massenbewegung abzuwehren. Und diese dem Kapitalismus nützliche Bewegung ist der Faschismus. Faschismus ist Schlechtwetterkapitalismus. (Griffin 2018, 11–13)
Für diesen Erklärungsansatz liefert die Geschichte einiges an Evidenz. Wesentliche Exponenten des Industriekapitals finanzierten den Aufstieg der Faschistischen Partei Italiens und der NSDAP. Trotz diverser Lippenbekenntnisse zu Sozialismus und Planwirtschaft änderten weder Mussolini noch Hitler etwas am Wesen des Kapitalismus und dessen an privaten Profitinteressen ausgerichteten Ordnung. Damit entsprach der an die Macht gekommene Faschismus den wirtschaftlichen Interessen der Bourgeoisie. 1939 startete Deutschland, 1940 begann Italien den Zweiten Weltkrieg mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. In Japan konnte sich die Militärdiktatur auf die enge Kooperation mit den Kartellen stützen, die Japans Markt unter sich aufgeteilt hatten und sich auch von einer militärischpolitischen Expansion exponentielles Wachstum und Maximierung der Profite erwarten konnten.
Allerdings erforderte die Kriegswirtschaft aller kriegführenden Mächte staatliche Planungsvorgaben, die den Grundsätzen eines konsequenten Laissez-faire-Kapitalismus nicht mehr entsprachen. Die Rüstungsindustrie und auch die Versorgung sowohl des Militärs wie auch der Zivilbevölkerung konnten nicht einfach nur am Mechanismus von Angebot und Nachfrage ausgerichtet werden. Im Laufe des Krieges wurden planwirtschaftliche Elemente auf allen Seiten – auch bei den westlichen Alliierten – immer stärker.
Vor allem aber ist eines festzuhalten: Wenn das deutsche, das italienische, das japanische Industriekapital auf Maximierung der Profite gesetzt hatten, dann hatten sie die falsche Option gewählt. Denn 1945 waren die deutsche und die japanische (weitgehend auch die italienische) Industrie zerstört. Profit war dort nicht mehr zu erwarten.
Der Kapitalismus war nun auf der Suche nach etwas Neuem. Andere, neue Erfahrungen waren zu machen: Da die Option, sich des Faschismus als eines Instruments zur Sicherung der Profite zu bedienen, ins Nichts geführt hatte, war nach neuen Bündnispartnern und neuen Formen politischer Ordnung Ausschau zu halten. Nach 1945 – nach einer vor allem auch von den West-Alliierten bestimmten Phase – setzten nun der (west)deutsche, der italienische und der japanische Kapitalismus auf die liberale Demokratie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwies sich diese Option als die weitaus bessere als die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewählte: Die Profite stiegen – und mit ihnen der allgemeine Wohlstand, gerade auch in den vormals faschistisch regierten Staaten. Demokratie machte sich „bezahlt“.
Von marxistischer Seite wird immer wieder versucht, diese Erfahrung mit dem Verweis auf die weiter bestehende Krisenanfälligkeit des Kapitalismus zu konterkarieren oder zumindest zu relativieren. Und tatsächlich zeigt die jüngste Geschichte, dass der Kapitalismus nicht vollkommen krisenfrei sein kann. Aber eine kapitalistische Ordnung ist lernfähig: Gelernt wurde, dass eine liberal-demokratische Ordnung, in der die Freiheiten politischer Bewegungen und wirtschaftlicher Interessengruppen gewährleistet werden, die vermutlich beste Option ist, um eine wirtschaftliche Dynamik zu ermöglichen. Den Profitinteressen der wenigen und den Wohlstandsinteressen der vielen kann am besten die Demokratie dienen. Der Faschismus hat versagt – auch in seiner Funktion, in einer Schlechtwetterphase den kapitalistischen Interessen nützlich zu sein.
Alle Faschismen haben versagt – auf allen Ebenen. Die Demokratien aber können bleibende Erfolge vermelden: Die Realität hat sich den in den bürgerlichen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts formulierten Grundwerten, die zunächst noch so unerreichbar fern schienen, erkennbar angenähert. Individuelle Freiheit und soziale Gleichheit (definiert als Chancengleichheit) sind effizienter als zentrale Planwirtschaft oder auch eine Ordnung, die auf der Knute des Faschismus baut.
Am Ende des 20. Jahrhunderts konnte auch festgestellt werden, dass der traditionelle Kolonialismus Geschichte ist. Kein Volk, keine Nation, keine „Rasse“ kann den Anspruch erheben, über andere zu herrschen – und ein solcher Anspruch wäre, viele Jahrzehnte nach dem Untergang der Faschismen à la Mussolini und à la Hitler, auch gar nicht zu verwirklichen. Die Gleichheit zwischen Frauen und Männern ist rechtlich kaum bestritten und gesellschaftlich der Realität näher gerückt als je zuvor. Nicht in allen Regionen der Welt ist die Religionsfreiheit voll anerkannt und auch praktiziert. Aber diese Freiheit, die ja auch Gleichheit mit einschließt, war noch nie so weit verbreitet wie im 21. Jahrhundert. Und der Anteil der des Lesens und Schreibens Unkundigen an der Weltbevölkerung geht permanent zurück.
Was immer unter Faschismus verstanden wird – in einem sind sich alle Befunde einig. Unabhängig davon, dass Spielarten des Faschismus wiederkommen und auch Regierungsmacht erreichen können: Der große Verlierer des 20. Jahrhunderts war der Faschismus.
Faschismus – die höchste (letzte?) Stufe des Nationalismus
Nation, das ist – nach Ernest Gellner – ein Produkt der Moderne. (Gellner 1983) Eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Nationen kam naturwissenschaftlichen und ökonomischen Qualitätssprüngen zu: Maschinen halfen, Distanzen zu überwinden, und neue Techniken ermöglichten die Herstellung neuer Produkte. Damit wuchs das Interesse, neue Märkte zu erschließen. Neue Formen der Kommunikation – Presse, Radio, Fernsehen – förderten neue Ideen und die Möglichkeit, um des persönlichen Fortkommens willen die Welt von gestern gegen eine neue einzutauschen.
Die Beherrschung von Lesen und Schreiben, bis weit in die Neuzeit hinein ein Privileg einer Minderheit, wurde zur Notwendigkeit – für die Ökonomie, die Arbeitskräfte brauchte, die lesen und schreiben konnten; und für alle Menschen, die an der neuen Beweglichkeit teilhaben wollten. Alphabete und Sprachen wurden vereinheitlicht, und damit wurde die Wahrnehmung von Gemeinsamkeit gefördert: Es entstanden „Wir“-Gefühle jenseits von Familie oder Dorfgemeinschaft. Das „Wir“ wurde zu einer großen Gemeinschaft – eben zu einer Nation, die sich durch Sprache und/oder Kultur, Religion und/oder gemeinsamen Erzählungen verbunden fühlte. Dieses „Wir“ erlaubte Einschluss – aber es verlangte ebenso auch Ausschluss: Wer nicht zu „uns“ zählte, zählte zu den „Anderen“. Die Identität des „Eigenen“ erweiterte sich, aber ebenso die des „Fremden“.
Politische Organisiertheit in Form von Staatlichkeit musste sich immer mehr auf die Gemeinschaft, auf das Volk, auf die Nation berufen. Es reichte nicht mehr, in einem Vertrag – mit dem etwa ein Krieg beendet wurde – die Grenzen eines vom Fürsten beherrschten Staates zu verschieben, unabhängig vom Willen der Betroffenen. Schritt für Schritt wurden Volk und Nation zur Quelle der Legitimation von Herrschaft. Der politische Feudalismus war im Absterben. In Europa entstanden Nationalstaaten, die sich auf die Gemeinsamkeit einer – ihrer – Nation beriefen.
Italien und Deutschland waren – verglichen mit Frankreich oder Spanien – verspätete Nationalstaaten. In Italien musste die Herrschaft der Habsburger, der Bourbonen und des Papstes erst 1859 dem Bündnis des Königreiches Piemont mit den Revolutionären à la Garibaldi weichen. In Deutschland gelang die nationalstaatliche Einigung erst 1871, und zwar ohne revolutionäres Zutun: Unter Führung des Königreiches Preußen errichteten die deutschen Fürsten das Deutsche Kaiserreich als Nationalstaat. In beiden Staaten, in Italien und in Deutschland, musste das nunmehr erreichte oder erzwungene politische Einigungswerk kulturell unterfüttert werden. Wie es ein nicht belegtes, aber oft zitiertes Bonmot eines Beraters von Camillo Cavour, des Regierungschefs von Piemont und dann des Königreiches von Italien ausdrückte: „Wir haben Italien geschaffen. Jetzt müssen wir daran gehen, Italiener zu schaffen.“