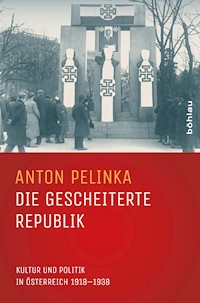Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Leykam Streitschriften
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ralf Dahrendorf wird immer wieder bemüht: In (West-) Europa wäre nach 1945 die Epoche sozialdemokratischen Hegemonie zu beobachten gewesen. Das kann und wird für die Gegenwart niemand zu behaupten wagen. Die Sozialdemokratie (auch und gerade die SPÖ) gleicht einer harmlosen alten Tante, die kaum noch etwas bewegt. Und doch: Als politische Antwort auf die ökonomische Globalisierung wäre eine sozial integrative Partei, wie es die SPÖ einmal war, mehr denn je gefragt – als Teil einer europäischen Parteifamilie. Die SPÖ muss sich, will sie eine Zukunft haben, neu definieren. Der Ausgangspunkt: Für welche Teile der Gesellschaft spricht sie eigentlich? Für das von Abstiegsängsten geschüttelte Kleinbürgertum, das sich gegen jede Form von Zuwanderung wehrt – oder für die wachsende Schicht von aufstiegsorientierten, sozial mobilen, von höherer Bildung geprägten Menschen? Für das "Proletariat", von dem niemand sagen kann, ob es als "Klasse" überhaupt (noch) existiert – oder für "alle arbeitenden Menschen", damit für alle, also letztlich für niemanden? Kann sich die SPÖ, kann sich die Sozialdemokratie überhaupt freimachen von den Illusionen, die aus der Vergangenheit kommen – etwa von der Illusion der Existenz einer "Basis", die (selbst wenn es sie gibt) immer älter und immer schmäler wird? Die SPÖ könnte dies – wenn sie sich nicht nur verbal, sondern real als Teil einer transnationalen, einer die nationalen Verengungen sprengenden Partei versteht. "Modernisierung" – die Formel, mit der Bruno Kreisky und Olof Palme, Willy Brandt und Tony Blair vor Jahrzehnten der Sozialdemokratie Europas die größten Erfolge gebracht haben – "Modernisierung" ist nicht mit den Inhalten von gestern, sondern mit denen von morgen zu füllen. Die Werte können dieselben bleiben – Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Die Konkretisierung dieser Werte muss neu formuliert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Streitschrift ist von einem geschrieben, der sich sowohl als Insider als auch als Outsider versteht: Insider, weil er seit Jahrzehnten mit vielen befreundet ist, die er als SozialdemokratInnen schätzt und respektiert; Outsider, weil er selbst nie der Sozialdemokratischen Partei beigetreten ist; Insider, weil er vieles von dem verstehen gelernt hat, was die Sozialdemokratie bewegt; Outsider, weil er sich immer wieder geärgert, ja empört hat über das, was die real existierende Sozialdemokratie macht – und, mehr noch, was sie unterlässt. Die Streitschrift ist somit eine Gratwanderung zwischen verschämter Liebeserklärung und kaum verborgener Kampfansage.
1. Warum wir die Sozialdemokratie mögen müssen
Welche andere Parteienfamilie Europas, welche andere Parteitradition kann es sich zugutehalten, in der schrecklichen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weder den verführerischen Neutönern à la W. I. Lenin in die »Diktatur des Proletariats« gefolgt zu sein, noch der Illusion der Personalisierung der Macht à la Benito Mussolini? Welche andere österreichische Partei als die SPÖ kann für sich beanspruchen, immer den Grundsätzen der pluralistischen, der liberalen Demokratie treu geblieben zu sein? Wer, wenn nicht die Sozialdemokratie, versteht es, einen der gesellschaftlichen Gleichheit verpflichteten ökonomischen Veränderungsanspruch mit der Garantie politischer, das heißt vor allem individueller Freiheitsrechte zu verbinden – und das über eine Zeitspanne von fast eineinhalb Jahrhunderten?
Die Sozialdemokratie ist der »dritte Weg«, ein »Weder-noch«. Sie war und ist eine klare Absage an den schrecklich gescheiterten Versuch, über die Zwischenstationen einer »Diktatur des Proletariats« und eines »real existierenden Sozialismus« eine perfekte Gesellschaft zu konstruieren. Sie ist ebenso eine Absage an einen Sozialdarwinismus, der auch in seiner liberal-demokratischen Variante auf dem Recht des Stärkeren beharrt, Schwächeren diktieren zu können. Die Sozialdemokratie baut aber auch auf einem »Sowohl-als-auch«: Sozialdemokratie, das ist das Beharren auf einer »offenen Gesellschaft« und damit die Ablehnung eines latent totalitären Utopismus. Sozialdemokratie ist aber ebenso der in Politik umgesetzte Antrieb des Samariters, der überall dort hilft, wo Hilfe konkret nötig ist. Nicht zufällig nennt die SPÖ ihre karitative Vorfeldorganisation »Arbeiter-Samariter-Bund«. Das alles ist Sozialdemokratie – in ihrem Anspruch. Und auch wenn sie diesen Anspruch oft nicht erfüllt hat, hat sie ihn auch nicht prinzipiell aufgegeben. Sie ist ihm treu geblieben.
Anders als die anderen Parteienfamilien des europäischen 20. Jahrhunderts hat die Sozialdemokratie ein demokratisch »reines Gewissen«. Die kommunistischen Parteien optierten für das sowjetische Modell, das mit Gewalt und Terror den Sozialismus herbeizwingen wollte. Auch wenn einige Prominente aus den Reihen der Sozialdemokratie wie Otto Grotewohl in der Phase der Gründung der DDR, Zdenek Fierlinger in der Tschechoslowakei oder Erwin Scharf in Österreich zu Kommunisten wurden, zog die Sozialdemokratie immer einen deutlichen Trennungsstrich gegenüber solchen ÜberläuferInnen. Und sozialdemokratische PolitikerInnen wurden – wie andere DemokratInnen auch – vom kommunistischen Staats- und Parteiapparat in Ost- und Mitteleuropa rigoros verfolgt. Das verbindet die Geschichte kommunistischer Systeme mit den Systemen des faschistischen Typs – beide verfolgten, folterten und ermordeten SozialdemokratInnen. Dass die Sozialdemokratie eine solche Gemeinsamkeit von Lenin und Mussolini, von Stalin und Hitler provozierte, das ist ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Sozialdemokratie.
Die konservativ-christdemokratischen Parteien hatten nach 1945 Probleme, ihre punktuellen Allianzen zu rechtfertigen, die sie in den 1920er und 1930er Jahren eingegangen waren: mit autoritären und mehr oder weniger faschistischen Strömungen. Sie mussten die zumindest zeitweise Unterstützung Mussolinis und Salazars und Francos und Petains und Horthys durch viele ihrer ParteigängerInnen rechtfertigen. Dass die Abgeordneten der katholischen Zentrumspartei 1933 im deutschen Reichstag dem Ermächtigungsgesetz (und damit dem Ende der Demokratie) zustimmten, das kann ebenso wenig vergessen werden wie das klare »Nein« der SPD zu dieser Schein-Legalisierung der Zerstörung der Weimarer Republik. Und dass die Gründer der Österreichischen Volkspartei durchwegs Repräsentanten des autoritären, halbfaschistischen »Ständestaates« waren, der ja in seiner Gesamtheit ein Konstrukt der Führung der Christlichsozialen Partei war, das ist ein historischer Ballast, von dem die Sozialdemokratie frei ist.
Die europäische Sozialdemokratie wird zu Recht mit dem demokratischen Sozial- und Wohlfahrtsstaat britischer und schwedischer Prägung identifiziert, der nach 1945 die lebenswerteste Gesellschaftsordnung entwickelte, die Europa je erfahren hat. Und diese Ordnung hat auch einen österreichischen Akzent: Die österreichische Sozialdemokratie war eine wesentliche Akteurin beim Aufbau des Systems der Sozialpartnerschaft, das die Verteilung ökonomischer Güter auf friedlichem Weg unter Herstellung einer »Win-win«-Situation regelte. Freilich: Die Verlagerung des Klassenkampfes von der Straße auf den Verhandlungstisch konnte nicht von der SPÖ und dem unter sozialdemokratischer Führung stehenden Gewerkschaftsbund allein vorgenommen werden. Die Voraussetzung war, dass auch die »andere Seite« – die »bürgerliche« Österreichische Volkspartei und die Verbände der ArbeitgeberInnen – den Pragmatismus der kleinen Schritte, des »Social Engineering« ebenso akzeptierten. Was den einen die Absage an das Modell eines ungebremsten, eines ungebändigten Kapitalismus war, das war der Sozialdemokratie die Absage an die »sozialistische Revolution«; und zwar auch an die, die anders als im russischen Oktober gewaltfrei und parlamentarisch agieren wollte. Die Sozialdemokratie war erfolgreich, wenn sie den Fortschritt in kleinen Schritten und mühsam ausgehandelten Kompromissen zu erreichen versuchte. Und sie war erfolgreich, weil sie diesen Weg auf der Grundlage des demokratischen Rechtsstaates ging.
Die Verdienste sozialdemokratischer Parteien für den Aufbau und die Stabilisierung der Demokratie in Europa sind unbestritten. Aber unbestritten sind auch die Verdienste Athens um die Entwicklung des Demokratiemodells der »Polis«. Unbestritten sind auch die Verdienste Roms um den Aufbau eines umfassenden Rechtssystems, das in vielem als Laboratorium des modernen Rechtsstaates gelten kann. Das Athen des Perikles ist allerdings Vergangenheit wie die Römische Republik. Historische Verdienste allein sichern keine Zukunft. Sie können auch als Zeichen dafür gelten, dass es Zeit ist, eine Periode für beendet zu erklären. Ist die Sozialdemokratie – trotz oder wegen ihrer unbestreitbaren Leistungen für Gesellschaft und Politik und Kultur – reif für das Museum? Was hat die Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts noch an Fortschrittsperspektive zu bieten, wenn viele der sozialdemokratischen Erfolge selbstverständlich geworden sind – und vielleicht gerade deshalb der Zeitgeist nicht mehr von John Maynard Keynes’ »Weg der Mitte«, sondern von Friedrich Hayeks demokratischer, aber militant vorgetragener Absage an diesen Weg der Mitte geprägt ist? Hat die Sozialdemokratie sich selbst überflüssig gemacht – gerade durch ihre Erfolgsbilanz, die sie für die Jahrzehnte nach 1945 aufzuweisen hat?
2. Warum wir von der Sozialdemokratie enttäuscht sein müssen
Ralf Dahrendorfs Diagnose von 1983 hat viel für sich, als er vom »Ende des sozialdemokratischen Zeitalters« schrieb. Die Sozialdemokratie hat in Europa – jedenfalls im demokratischen Europa – die gesellschaftliche Richtung vorgegeben. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass die pluralistische, die liberale Demokratie sich in jeder nur denkbaren Hinsicht der »Volksdemokratie« des eben nicht demokratischen Sozialismus überlegen zeigte. Die Menschen – alte und junge, ArbeiterInnen und Studierende, Frauen und Männer: Wenn sie die dafür erforderliche Freiheit hatten, zogen sie in den Jahrzehnten nach 1945 von Ost nach West – und nicht von West nach Ost. Der »Eiserne Vorhang« war nicht dazu da, »Agenten des Imperialismus« abzuwehren. Er sollte die Massenflucht in die westlichen Demokratien verhindern. Dieses eindeutige Urteil der Geschichte war auch ein Verdienst der Sozialdemokratie.
Aber deren Ära ging – so Dahrendorf – bereits dem Ende zu, als die UdSSR implodierte. Der Verlust an sozialdemokratischer Hegemonie war nicht das Produkt der Erfolglosigkeit sozialdemokratischer Parteien. Die Sozialdemokratie verlor an politischer Deutungshoheit, weil viele ihrer substantiellen Erfolge selbstverständlich geworden waren: eine fast flächendeckende soziale Sicherheit auch in Form einer umfassenden Gesundheits- und Altersvorsorge, ein zumindest bescheidener Wohlstand für fast alle und – ganz wesentlich – die Garantie der individuellen Freiheiten, die noch eine oder auch zwei, drei Generationen zuvor mühsam zu erkämpfen und zu verteidigen waren. Den meisten Menschen in den (westlichen) Demokratien Europas war es am Ende des sozialdemokratischen Zeitalters materiell besser gegangen als je zuvor, und sie hatten sich noch nie so frei und selbstbestimmt fühlen können.
Wegen dieser Erfolge der »westlichen«, der liberalen Demokratie schien die Sozialdemokratie in den 1980er Jahren die Definitionsmacht über das politische Geschehen zu verlieren: Die Ära Kreisky war Geschichte, die Ära Mitterrand neigte sich ihrem Ende zu. In Europas Demokratien wehte nach wie vor ein demokratischer Zeitgeist; aber der wehte nun von rechts. Margaret Thatcher war die Chefingenieurin dieses neuen Zeitgeistes. Die Sozialdemokratie hatte ihre Schuldigkeit getan. Und weil sie dafür (mit)verantwortlich war, dass politische Demokratie und soziale Sicherheit selbstverständlich geworden waren, schien die Sozialdemokratie überflüssig zu werden.
Was tun? Bei der Suche nach einer Antwort genügt es, daran zu erinnern, was da alles noch ausständig ist – über die Erfolge der Regierungen Attlees und Palmes, Kreiskys und Mitterrands hinaus. Die Sozialdemokratie war ja noch vieles schuldig geblieben – vor allem die Erfüllung einer Forderung, die in dramatischer Sprache 1848 für die »Proletarier« von Marx und Engels formuliert worden war: Die Vereinigung der arbeitenden Menschen »aller Länder«, die nichts zu verlieren hätten als »ihre Ketten«. Dass Ende des 20. Jahrhunderts die »Proletarier« mehr zu verlieren hatten als »ihre Ketten«, das war erreicht. Aber das andere Ziel blieb in weiter Ferne – die Überwindung nationaler Verengung.