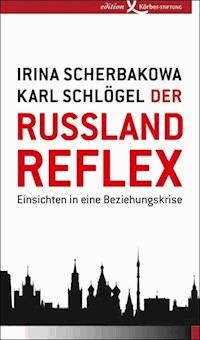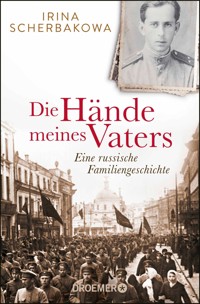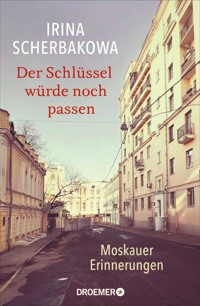
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch der renommierten und vielfach ausgezeichneten Historikerin, Publizistin und Schriftstellerin Irina Scherbakowa "Eines der 10 besten Sachbücher 2025" Deutschlandfunk Kultur, 3.12.2025 In »Der Schlüssel würde noch passen« erzählt Irina Scherbakowa von den kurzen Jahren der Perestroika,. Sie berichtet vom Alltag und vom politischen Aufbruch in Moskau und auf dem Land zu Beginn 1990er-Jahre. Sie beschreibt die ungewohnte Freiheit und wie die Menschen mehr schlecht als recht damit umzugehen lernten. Scherbakowas Thema ist auch ihre bis heute andauernde aktive politische Tätigkeit und das scheinbar unaufhaltsame Abgleiten Russlands in die Diktatur. Ihre beeindruckenden Moskauer Erinnerungen sind dicht verwoben mit der Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert und ihrem lebenslangen Kampf gegen Staatsterror und für die Erinnerung. Irina Scherbakowa ist eine der bedeutendsten russischen Oppositionellen. Sie ist Mitgründerin der Menschenrechts-Organisation Memorial, die 2022 mit dem Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Das autobiografische Sachbuch schließt damit an »Die Hände meines Vaters« an, das 2017 ebenfalls bei Droemer erschien. *** »Das Buch führt durch mehr als siebzig Jahre eines bewegten Intellektuellenlebens und russischer, vor allem Moskauer Zeitgeschichte.« Kerstin Holm in der FAZ, 4.11.2025 »Und obwohl ich wusste, dass es vorbei ist, hatte ich beim Packen doch nicht das Gefühl, für immer zu gehen.« Irina Scherbakowa im Interview mit Alice Bota und Alexander Kauschanski, DIE ZEIT Nr. 47, 6.11.2025 »Irina Scherbakowa gibt eine persönliche und detaillierte Antwort auf die Frage, wie der russische Staat im 20. Jahrhundert seine Bürger missbraucht hat und wie er das weiterhin tut, solange die alten Verbrechen nicht aufgearbeitet sind.« Süddeutsche Zeitung »Diejenigen Russinnen und Russen, die wie Irina Scherbakowa immer eindeutig für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eingetreten sind, die dabei großen Mut bewiesen und persönliche Risiken in Kauf genommen haben – sie sind nicht Widersacher der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Putins brutalen Krieg. Im Gegenteil, sie sind Seelenverwandte und Mitstreiter in unserem gemeinsamen Kampf für eine friedliche, freiheitliche und demokratische Zukunft Europas.« Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich der Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises 2022für internationale Verständigung und Versöhnung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Irina Scherbakowa
Der Schlüssel würde noch passen
Moskauer Erinnerungen
Aus dem Russischen von Jennie Seitz und Ruth Altenhofer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Irina Scherbakowa erinnert sich an den Alltag in Moskau, den politischen Aufbruch in Stadt und Land während der Perestroika und dann nach dem Ende der Sowjetunion. Sie beschreibt die ungewohnte Freiheit und wie die Menschen mehr schlecht als recht damit umgingen. Gleichzeitig blickt sie zurück auf die Gründungszeit von Memorial, jener Organisation, die sich der Aufarbeitung der Stalinschen Verbrechen widmet. So verbindet sie erzählerische Rückblenden mit ihrem andauernden und unermüdlichen Kampf für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.
Irina Scherbakowa gelingt mit ihrem neuen Buch ein beeindruckendes Stück engagierter Exilliteratur, das an ein Land erinnert, das es nicht mehr gibt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog: Dinge, die niemand mehr braucht
Kapitel 1: Verbrechen ohne Strafe
Ein ehrenwertes Haus
Mord in Borowitschi
Der Labrador und die Einbrecher
Schattenwirtschaft und »Spekulanten«
»Ich bin die Mafia!«
Unvorstellbare Summen
Kapitel 2: Krim – Die Büchse der Pandora
Sommer 1957
»Es verpasst viel Glanz und Gloria, wer nie war in Jewpatorija«
Es blieben nur die Namen
Die Steine von Koktebel
Die andere Krim
Die Krim ist nicht unser
Kapitel 3: Tanja
Schriftstellerkinder
»Die Wolokolamsker Chaussee«
»Ich lache mich lieber selbst aus«
Warten auf Veränderungen
Harte Zeiten
»Ein aufrichtiges altes Weib«
Vorahnung
Kapitel 4: Zeit des Umbruchs
Der »Vorarbeiter« der Perestroika
Die neue Universität: Höhenflug und Fall
Schlittenweise Post
Onkel Petja, der Kalmücke
Der Dorflehrer – ein russisches Schicksal
Kapitel 5: Gegen den Strom
Stalins Kochbuch
Der lange Schatten der Angst
Ein neuer Blick auf die Vergangenheit
Damit beginnt Geschichte
Der Wettbewerb als Barometer
Kampf um die Deutung
Druck von allen Seiten
Bildteil
Kapitel 6: Sammeln und bewahren
In der Enge
Gräber, Listen und das »Gift der totalitären Archive«
Familienbande in Zeiten des Terrors
Das weibliche Gedächtnis
Kapitel 7: »Welch eine Höllenschaukel«
Agnessa
Tanz auf dem Vulkan
Mit geschlossenen Augen
Angst
Das Ende
Im Gulag
Schuld und Erinnerung
Kapitel 8: Schiff der Narren
Die Silvesternacht und ein Geschenk von Jelzin
Ein Märchen von E.T.A. Hoffmann
Die Petersburger kommen
Sie waren nie weg
Die »stabilen« Nullerjahre
Signale
»Behüten Sie Russland«
Trügerisches Tauwetter
Proteste und »ausländische Agenten«
Kapitel 9: Liquidierung
Die putinsche Schimäre
Restauration und Rekonstruktion
Wo waren wir die letzten acht Jahre?
»Solange dieser Tag noch nicht gekommen ist«
Die Vorboten des Krieges
Memorial wird liquidiert
Schyschaky
Krieg
Epilog: Gibt es Hoffnung?
»Bitter wie Karbidstaub ist die Berliner Tristesse«
Dank
In Erinnerung an meine Eltern
Prolog
Dinge, die niemand mehr braucht
Wenn mich jemand fragt, ob ich Sehnsucht nach Moskau hätte, reagiere ich allein auf das Wort allergisch. Das Gefühl, das mich beim Gedanken an diese Stadt befällt, die so lange meine Heimat und die meiner Familie war, ist nur schwer zu greifen. Vielleicht ist es eher eine Mischung aus Trauer und Verdrängung. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich eine Scheu vor Fotos aus meinem früheren Leben habe, zumindest, wenn ich selbst darauf zu sehen bin. Und wenn mich Facebook an ein Ereignis vor fünf oder zehn Jahren erinnert, habe ich – im Gegensatz zu manch anderen – kein Bedürfnis, es zu teilen.
Viele von denen, die ihre Heimat verlassen haben, um sich im Westen oder in Israel niederzulassen, haben mitgenommen, was sie konnten. Unser altes Leben ist dagegen in Moskau geblieben. Man kann es weder wiederbeleben noch imitieren, indem man sich mit vertrauten Gegenständen umgibt. Die Spuren einer fast hundertjährigen Moskauer Familiengeschichte, zumal gleich zweier Familien, lassen sich nicht in zwei Koffern verstauen. Und selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, einige Sachen aus unserem Zuhause einfach hierherzuzaubern, nach Berlin oder Israel, wo unser Alltag auf wackeligen Beinen steht, ich wüsste nicht, wofür ich mich entscheiden, nach welchen Kriterien ich etwas auswählen sollte. In Moskau hatte alles seinen Platz, alles war aufgeladen mit einer Bedeutung, hatte einen Bezug zu den Menschen, die diese Dinge einst besessen hatten, und die nach ihrem Tod zu mir gelangt waren. Andere waren unmittelbar mit mir, meinem Mann, meinen Kindern und Enkelkindern verknüpft.
Manchmal fragen mich Freunde, ob sie mir etwas aus unserer Wohnung in Moskau mitbringen sollen, ein paar Bücher vielleicht oder ein ganz bestimmtes Buch. Als ließe sich damit jenes Gefühl des Friedens wiederherstellen, das mich in Moskau beim Anblick der vertrauten Ledereinbände immer erfasst hat. In unserer Wohnung gab es nie genug Platz für all die Bücher, die ich von meinen Eltern übernommen hatte und die ich selbst kaufte oder geschenkt bekam, ganz egal, wie viele Regale ich aufstellte und wie oft ich aussortierte. Jetzt entdecke ich manchmal in Antiquariaten einige dieser vertrauten Bücher, Ausgaben deutscher Werke aus dem 19. Jahrhundert, wie sie bei uns in der Moskauer Wohnung in den obersten Regalreihen standen. Als ich kürzlich in einem Antiquariat einen Erzählband von Jean Paul sah, musste ich daran denken, auf welchem Weg mein Exemplar zu mir gefunden hatte.
Im Herbst 1971 begleitete ich den Schriftsteller Franz Fühmann anlässlich des 150. Geburtstags von Dostojewski als Dolmetscherin. Wie damals üblich, hatte der sowjetische Schriftstellerverband eine Gruppe von Literaten aus den »sozialistischen Bruderländern« zu den Festivitäten nach Moskau und Leningrad eingeladen. Persönlich war ich Fühmann bis dahin nicht begegnet, aber die Texte seines Erzählbands »Das Judenauto« hatten mich sehr beeindruckt. Fasziniert las ich, wie ganz normale Schüler zu überzeugten Nazis wurden. So wie Fühmann selbst. Später übersetzte ich einige seiner Erzählungen ins Russische.
Fühmann passte nicht so recht in die offizielle Delegation, er wirkte wie ein Sonderling. Er erzählte zum Beispiel immer, wovon er geträumt hatte, und führte sogar ein Traumtagebuch. Ich habe viele deutsche Schriftsteller als Dolmetscherin begleitet, sowohl aus dem Westen als auch aus dem Osten, aber bei keinem habe ich je so eine starke Reaktion auf alles beobachtet, was das Gedenken an den Krieg betraf. Ich wusste, dass er bei Stalingrad gekämpft hatte und in sowjetischer Gefangenschaft gewesen war. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn überredet habe, mit der gesamten Delegation den Piskarjowskoje-Friedhof im damaligen Leningrad zu besuchen, auf dem fast 500000 Opfer der Leningrader Blockade liegen. Er blieb vor dem Tor im Bus sitzen, weil er nicht genug Kraft hatte, diese Gedenkstätte zu betreten, so sehr spürte er die deutsche Verantwortung als seine eigene. Das war lange bevor die Tragödie von Leningrad überhaupt in das kollektive Bewusstsein der Deutschen rückte, was recht spät geschah.
Während der Fahrt nach Leningrad hatten wir viel über Literatur geredet. Fühmann war ein leidenschaftlicher Leser, und ich hatte gerade an der Moskauer Lomonossow-Universität mein Diplom zur politischen Satire bei Kurt Tucholsky verteidigt. Ich begeisterte mich damals für die deutsche Romantik, und Fühmann motivierte mich zu einer eingehenderen Beschäftigung damit. Wieder in Berlin, schickte er mir zwei Kisten mit alten Ausgaben deutscher Klassiker: Jean Paul, Kleist, Chamisso, E.T.A. Hoffmann. Wann immer ich die hellbraunen Ledereinbände mit den goldenen deutschen Titeln in meinem Bücherregal stehen sah, hatte ich an Fühmann denken müssen.
Hätte ich dieses eine Buch von Jean Paul mitnehmen sollen? Sollte ich es mir jetzt mitbringen oder schicken lassen? Was würde das ändern? Selbst wenn unsere ganze riesige Familienbibliothek mit den Tausenden von Bänden hierhergezaubert würde, wäre ihre Bedeutung eine andere, weil unser Leben ein anderes ist. In Moskau nahmen allein die Werke, die mein Vater geschenkt bekommen hatte, eine ganze Regalwand ein. Er war Literaturkritiker, und seine Freunde – Schriftsteller und Dichter, die man später als die »Sechziger« bezeichnen würde – hatten ihm stets ihre neuesten Werke mitgebracht, signiert, versteht sich. In diesem großen Regal standen Werke von Konstantin Simonov, Daniil Granin, Wasil Bykov, Bulat Okudschawa, Ales Adamowitsch und vielen anderen, die über den Krieg geschrieben haben. Nur einen Band habe ich mir tatsächlich zuschicken lassen: Wassili Grossmans »Stalingrad« (»Sa prawoje delo«) von 1950, mit einer Widmung für meinen Vater. Als er Anfang der 1960er-Jahre für die Literaturnaja Gaseta arbeitete, wollte er ein Kapitel aus dem zweiten Teil »Leben und Schicksal« (»Schisn i sudba«) darin abdrucken lassen. Daraufhin schenkte ihm Grossman sein Erstlingswerk. Doch aus den Veröffentlichungsplänen wurde nichts: Das Manuskript wurde 1961 bei einer Hausdurchsuchung durch den KGB konfisziert und konnte erst 1987 publiziert werden. Dieser Roman gehört zu den wichtigsten Büchern in meinem Leben, er lag in den schwersten Minuten auf meinem Nachttisch.
Die paar Dutzend Bücher, die ich in Berlin besitze, erinnerten zumindest am Anfang an jene zufälligen Lektüresammlungen, die Krankenhauspatienten nach ihrer Genesung zurücklassen: russische Klassik, die Freunde in Deutschland aus ihrem Bestand aussortiert hatten, Bücher über Russland, die mir ihre deutschen und russischen Verfasser schenkten, diverse Krimis, eine russische Ausgabe von Freuds »Einführung in die Psychoanalyse«, die ich mal im Vorbeigehen auf der Straße gefunden und mitgenommen habe, und Nadeschda Mandelstams Memoiren »Das Jahrhundert der Wölfe«, mit einem sehr vertrauten Porträt von ihr auf dem Buchcover. Ich habe diese deutsche Ausgabe aus dem Jahr 1975 einmal bei ihr zu Hause gesehen, irgendjemand musste sie ihr aus Deutschland mitgebracht haben. Wenn ich das Buch in die Hand nahm, war es wie ein Wiedersehen, fast so, als hätte sie mir persönlich einen Gruß geschickt.
Und abgesehen von den Büchern? Welche Möbel sollte ich mir herbeiwünschen, welche Gegenstände, die über hundert Jahre den Mitgliedern unserer großen Familie gedient hatten und bei mir gelandet waren, als diese Menschen von uns gingen? So wie der riesige Schreibtisch aus dem frühen 20. Jahrhundert – eine Anschaffung der ältesten Schwester meiner Großmutter, als sie sich mit ihrem Mann 1916 in Moskau niederließ. Der Kindertisch meiner Schwiegermutter oder die große Kommode mit dem Spiegel, ebenfalls aus der Zeit der Jahrhundertwende, die wir vor vierzig Jahren aus der Gemeinschaftswohnung, einer sogenannten Kommunalka, in der Soljanka-Straße geholt haben. Dort lebten seit den 1920er-Jahren die Urgroßmutter meines Mannes und ihre unverheiratete Tochter, Tante Nadja, die ihr Leben lang als Leiterin der Katalog-Abteilung der Staatlichen Historischen Bibliothek gearbeitet und vermutlich nie auch nur einen Zettel weggeworfen hat. Dem Parteiarchiv hat sie allerdings nur die Korrespondenz zwischen Lenin und ihrem ältesten Bruder Lew Krizman übergeben.
Lew Krizman, der noch vor der Revolution an der Universität Zürich in Chemie promoviert hatte, wurde Bolschewik und freundete sich mit Leo Trotzki an, der ihn im Wiener Exil besuchte. Er war ein Vordenker der sowjetischen Planwirtschaft und Politik des sogenannten Kriegskommunismus, der die totale Abschaffung des Geldes und die Konfiskation der Lebensmittel von den Bauern vorsah. Diese Pläne mündeten in die Bauernaufstände von 1920, die um ein Haar den Fall des bolschewistischen Regimes herbeigeführt hätten. Ein Jahr später entschied sich Lenin gegen den Kriegskommunismus, und Onkel Ljonja, wie man ihn in der Familie meines Mannes nannte, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der Staatlichen Planungskommission »Gosplan«. Er wohnte im berühmten Haus an der Uferstraße in Moskau, das viele Regierungsmitglieder und hochrangige sowjetische Funktionäre beherbergte. Die meisten von ihnen wurden später verhaftet. Onkel Ljonja starb 1938 eines natürlichen Todes, ganz anders als sein Bruder Wiktor, der während des Bürgerkriegs ein sogenannter Roter Kommissar war und später einen hohen Posten in der Flugindustrie besetzte. 1938 wurde er verhaftet, der Spionage angeklagt, gefoltert und durch Erschießung hingerichtet. Damals kein ungewöhnliches Ende für linksradikale Irrwege. Und doch erstaunte mich, wie der ältere Bruder, der zehn Jahre in der Emigration verbracht hatte, zum führenden Kopf einer Wirtschaftspolitik werden konnte, die jede Idee von Markt und Geldaustausch radikal ablehnte, und der jüngere, ein ausgebildeter Ingenieur, als Roter Kommissar in Diensten von Grigori Kotowski Angst und Terror verbreiten konnte.1 Keiner der Brüder hat Nachkommen hinterlassen, und alles, was von ihnen geblieben ist, bewahrte ich in meiner Wohnung in Moskau auf.
Was soll man ferner mit einer zweihundert Jahre alten Schreibkommode tun, in deren Geheimfach ich eines Tages einen goldenen Ehering fand? Sie hatte einst einer berühmten russischen Schauspielerin gehört. Und was mit den Bildern? Manche sind sehr groß, wie zum Beispiel zwei Porträts, die Boris Birger Anfang der 1970er-Jahre von meinen Eltern sowie von mir und meiner Schwester gemalt hat. Birger gehörte zu den Künstlern, die als Nonkonformisten bezeichnet wurden, weil ihre Werke nicht dem Kanon der offiziellen Kunstdoktrin des »Sozialistischen Realismus« entsprachen. Nachdem Birger gegen die Verhaftung regimekritischer Intellektueller protestiert hatte, wurde er aus dem Künstlerverband ausgeschlossen, seine Gemälde durften nicht mehr ausgestellt werden. Zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren schuf er eine ganze Reihe von Dissidenten-Porträts – Andrej Sacharow, Warlam Schalamow, Nadeschda Mandelstam. Meine Eltern waren mit ihm befreundet, und so wurden auch wir Teil dieses dissidentischen Kosmos. Hätte ich die Bilder mitnehmen sollen? In meine kleine Mietwohnung im Prenzlauer Berg, in der kaum ein paar Möbel Platz finden und von der ich nicht weiß, wie lange ich dort überhaupt bleibe?
Die Moskauer Wohnung mitten im Zentrum, mit Blick auf die Kreml-Türme, in der meine Familie seit 1944 gelebt hatte und in der ich geboren wurde, steht zum Verkauf. Innerlich habe ich mich von ihr verabschiedet. Und doch lässt mich ein Gefühl nicht los, als würde jemand oder etwas den Verkauf verhindern wollen. Sämtliche Verhandlungen mit potenziellen Käufern platzen bislang aus diesem oder jenem Grund. Unsere eigene Wohnung am Oktjabrskoje Pole, dem »Oktober-Feld«, in der wir seit 1973 lebten und in der unsere Kinder aufgewachsen sind, hatte ich allen Sticheleien meines Mannes wegen dieses unsinnigen Unterfangens zum Trotz im Herbst 2021, drei Monate vor unserer Emigration, renovieren lassen. Genau wie unser Sommerhaus in Schyschaky in der ukrainischen Oblast Poltawa, in der Hoffnung, nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder dort Urlaub machen zu können, so wie wir es siebzehn Jahre lang getan hatten. Jetzt wohnt dort eine Familie aus einem Dorf bei Charkiw, das von russischen Bomben zerstört wurde.
In jenem Herbst 2021 kämpfte ich mit der Renovierung auch gegen eine innere Unruhe an, die seit der Pandemie von mir Besitz ergriffen hatte. Ich habe viel über die spanische Grippe gelesen, die Anfang der 1920er-Jahre Millionen von Menschen das Leben kostete. Über Typhus, der in Russland während des Bürgerkriegs wütete und an dem meine Ururgroßmutter starb. Doch das war alles so ewig her, dass ich mir unmöglich vorstellen konnte, dass wir heute genauso machtlos gegen ein Virus sein könnten wie vor hundert Jahren. Aber es war wie in einem grausamen Märchen: Erst kam die Pest, dann der Krieg. Mein Mann, der schon immer gesagt hatte, man dürfe in Russland nichts besitzen, von dem man sich nicht jederzeit trennen könnte, sollte recht behalten. Dennoch war unsere Abreise für ihn noch schwerer als für mich. Wenig später erfuhren wir von Freunden, dass in unserer verlassenen Wohnung wie aus dem Nichts ein Brand ausgebrochen war, gefolgt von einem Rohrbruch. Wie durch ein Wunder seien fast alle Bücher und Bilder unversehrt geblieben. Nur meine Hoffnung, dass wir irgendwann dorthin zurückkehren, schwindet immer mehr.
Meine Freunde in Russland möchten mir von Herzen etwas Gutes tun, indem sie mir wenigstens Fragmente meines alten Lebens schicken. Wenn diese aus ihrem Kontext gerissenen Gegenstände dann in Israel oder Berlin ankommen – Schmuckschatullen, Silberlöffel, eingewickelt in alte Spitzendeckchen, die meine Großmutter gehäkelt hat –, wirken sie wie deplatzierte Bruchstücke unserer langen Moskauer Familiengeschichte. Einmal schickte mir jemand zu Silvester zwei uralte Väterchen-Frost-Puppen, wie man sie sowjetischen Kindern unter den Tannenbaum zu stellen pflegte, und eine Kiste mit altem Baumschmuck, der noch aus der Kinderzeit meiner Mutter im Hotel Lux stammte. Dieses Gebäude in der Twerskaja-Straße war ab 1921 das Gästehaus der Kommunistischen Internationalen; bis zum Ende des Krieges und der Auflösung der Komintern wohnten hier vor allem politische Emigranten und Parteifunktionäre. Vergangenes Jahr habe ich also mit dem Schmuck anstatt einer Tanne wie in Moskau die Palme vor unserem Haus in Israel geschmückt, wo ich seither den Jahreswechsel verbringe. Es war ein reichlich absurder Anblick. Genauso fremd und sinnlos wie Christbaumschmuck an einer Palme wirken diese zufälligen Dinge, von denen meine Freunde sich erhoffen, dass sie mich an Zuhause erinnern mögen.
Das Einzige, was halbwegs Sinn ergibt, sind unsere Familienarchive, die nach und nach eintreffen. Vielleicht werde ich irgendwann die Zeit finden, Ordnung hineinzubringen, damit unsere Enkel etwas damit anfangen können. Auch wenn sie die Briefe, die ihre Vorfahren vor 120 Jahren geschrieben haben, wahrscheinlich nicht mehr lesen können werden. Seit dem Wohnungsbrand ist alles durcheinander, und jetzt finde ich in den Päckchen und Paketen, die mir gebracht werden, die absonderlichsten Mischungen: ein Album mit Fotos, die der Großvater meines Mannes, ein Militärarzt namens Alexander Susmanowitsch, 1916 an der Front bei Smorgon, dem »russischen Verdun«, gemacht hat. Es sind sehr hochwertige Aufnahmen, auf denen man jedes Detail erkennen kann, selbst die Inschrift »Kameradengrab für die Opfer des Gasangriffs 1916«. Die Leica, mit der sie gemacht wurden, liegt zusammen mit seinen Medizininstrumenten irgendwo in den Tiefen der zusammengeschobenen Schränke in Moskau.
Zwischen Briefen, die mein Großvater 1937 an meine Großmutter ins Hotel Lux schrieb, während links und rechts Freunde und Nachbarn verhaftet wurden, taucht plötzlich die blaue Mütze eines Kämpfers der spanischen Republikanischen Volksarmee auf: 1937 war mein Großvater als Kommissar in eine neue Militärschule in den Kaukasus geschickt worden, wo man spanische Kampfpiloten ausbildete. Meine Großmutter war immer der Meinung, das habe ihm das Leben gerettet, weil er ausgerechnet zur Zeit des Großen Terrors und der Massenverhaftungen in der Komintern nicht in Moskau war. Oder die unangebrochene Schachtel Papirossy – eine Sonderedition speziell für die Teilnehmer des XVII. Parteitags 1934 – zwischen den immergleichen Briefen, adressiert an die Gorkistraße 33 in Moskau, Hotel Lux. Mein Großvater war passionierter Raucher, aber diese Schachtel hat er aufbewahrt. Ich vermute, es ist das einzige erhaltene Exemplar, denn über die Hälfte der Delegierten dieses Parteitags wurde später auf Stalins Befehl erschossen. Es tauchten auch Dokumente auf, die lange als verschollen galten, zum Beispiel die Geburtsurkunde meiner Urgroßmutter, sodass ich jetzt weiß, wie ihre Eltern geheißen haben.
Aber selbst wenn ich all diese Dokumente und Fotos eines Tages fein säuberlich sortiert, akkurat beschriftet und in kleine Schubfächer gepackt habe – welche Bedeutung haben sie, wenn die Menschen, mit denen sie verbunden sind, nicht mehr leben? Welchen Sinn haben sie, wenn niemand mehr ohne lange Erklärungen weiß, was eine unangebrochene Zigarettenschachtel aus dem Jahr 1934 bedeutet? Oder der Brief an Wiktor Krizman, in dem seine Mutter ihn wegen seines Leichtsinns und der vielen gebrochenen Herzen tadelt, den sie aber nie abgeschickt hat, weil ihr Sohn in jenen Tagen verhaftet wurde. Seine Frau, die er zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen hatte, sollte später trotzdem als Ehefrau eines Volksfeindes im Lager landen. Mein Schreibtisch bei Memorial stand viele Jahre lang neben einem Regal, in dem Kisten mit den kopierten FSB-Ermittlungsakten der Hinrichtungsopfer in Moskau standen und wo unter dem Buchstaben »K« auch Krizmans Karteikarte mit dem Erschießungsdatum zu finden war.
Es sind nicht Bücher, Bilder oder Möbelstücke, die mir heute fehlen. Was mir fehlt, ist etwas, das ich so viele Jahre bei Memorial erleben durfte: das unausgesprochene gemeinsame Verständnis für die Bedeutung von Dingen, dafür, welche Geschichte mit einem Schreibtisch aus dem Hotel Lux verbunden war, mit einem Brief, mit einer Schachtel Zigaretten.
Wir haben uns bei Memorial unzählige Jahre damit befasst, die Geschichte der Menschen hinter solchen Gegenständen ans Licht zu holen, sie dem Vergessen zu entreißen. All die Jahre hatten wir in dem festen Glauben gelebt, dass die Menschen erschüttert sein würden, wenn sie endlich die Wahrheit erfahren würden – über die Millionen Opfer und ihr entsetzliches, tragisches Schicksal, das diese in Gefängnissen und Lagern erwartete. Wir glaubten, dass sie sich danach nie wieder würden vorstellen können, jemals zu einer Diktatur zurückzukehren oder sich gar danach zu sehnen.
Seit dem 24. Februar 2022, als der große Krieg begann und ich Russland verlassen musste, habe ich mich oft gefragt: Waren wir naiv, daran zu glauben? Hätten wir als Historiker nicht erkennen müssen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn man nur vorübergehend Lehren aus der Vergangenheit zieht, wenn sie nicht fest verankert sind, sondern nur allzu leicht revidiert werden können, zugunsten eines revisionistischen Imperialismus, eines neu erstarkten aggressiven Nationalismus? Ja, wir haben versucht, die Katastrophe mit der Schreibmaschine aufzuhalten,1 wie Erich Kästner über Kurt Tucholsky schrieb, der 1934 im Exil Selbstmord beging. Aber unsere Warnungen verklangen wie die Prophezeiungen der Kassandra, dazu verdammt, ungehört zu bleiben. Der Friedensnobelpreis, den Memorial International im Dezember 2022 nach seiner Liquidierung erhielt, sorgte weltweit für Aufsehen. Für Putin und sein Regime war es nur ein weiteres Zeichen dafür, dass wir vermeintlich vom Ausland gesteuert wurden; dass wir mit unserem Erinnern an die dunkle Vergangenheit das glorreiche große Russland beschmutzen würden.
Wenn ich heute daran denke, mit welchen Hoffnungen Memorial 1989 gestartet war, welche Hoffnungen die Menschen in Ost wie West zu dieser Zeit gehegt haben, frage ich mich immer wieder: Wie konnte es bloß dazu kommen, dass aus diesen großen Hoffnungen verlorene Illusionen wurden?
Kapitel 1
Die Erinnerung an die 1990er-Jahre spaltet die russische Bevölkerung in zwei Lager. Für die einen war es eine Zeit, die von Zerstörung, Chaos, Arbeitslosigkeit, Armut und um sich greifender Kriminalität geprägt war, während sie für die anderen Freiheit und sich plötzlich eröffnende, nie zuvor gekannte Möglichkeiten bedeutete.
Als Gorbatschow 1985 Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU wurde, begann in den folgenden Jahren mit Glasnost (»Offenheit«) und Perestroika (»Umbau«) eine neue Zeit. Gorbatschow bekannte sich zu den Fehlern der Partei seit Stalin, zu den Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs wie dem Massaker von Katyn; der Regimekritiker Andrej Sacharow wurde aus der Verbannung nach Moskau zurückgeholt, und der marxistische Wirtschaftstheoretiker Nikolai Bucharin2, der im Zuge der stalinschen Säuberungen erschossen worden war, wurde rehabilitiert, und im Dezember 1988 erklärte Gorbatschow in einer Rede vor der UN-Generalversammlung in New York den Kalten Krieg für beendet. Ein Jahr später fiel die Berliner Mauer.
Auch mein Leben veränderte sich schlagartig. Endlich konnte ich mit meiner Arbeit zu den stalinistischen Repressionen und zum Gulag-System an die Öffentlichkeit treten. Nur wenige Jahre zuvor hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich Vorträge an Universitäten halten, ins Ausland reisen und Bücher veröffentlichen würde, und schon gar nicht, dass ich in Geheimarchiven würde recherchieren können, die nun endlich zugänglich gemacht wurden.
All diese neuen Möglichkeiten ließen für mich damals die kleinen und großen Beschwerlichkeiten dieser turbulenten Zeit in den Hintergrund treten. Die wirtschaftlichen Probleme, die selbst in unserem vergleichsweise gut situierten Bezirk in Moskau das Hintergrundrauschen bildeten, das Aufkommen von Organisierter Kriminalität und Gewalt und die im Rückblick vielen Anzeichen, dass es im Land Kräfte gab, die gegen die Öffnung agitierten. Da war die Gewalt, mit der man im Januar 1991 im litauischen Vilnius versuchte, die Unabhängigkeit der baltischen Staaten zu verhindern. Der Augustputsch in Moskau im selben Jahr, als Gorbatschow und seine Frau Raissa drei Tage lang auf der Krim unter Hausarrest standen, während Teile des Militärs und der kommunistischen Partei versuchten, Gorbatschow abzusetzen und das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Später dann, im Herbst 1993, die Verfassungskrise, als der Konflikt zwischen Jelzin und dem Obersten Sowjet mit Schüssen auf das Weiße Haus endete. Hier, im Sitz des russischen Parlaments, hatten sich die Reformgegner verschanzt und offen zum Putsch aufgerufen. Wenige Wochen später die Niederlage der Demokraten bei den Parlamentswahlen und der Sieg der ultranationalistischen LDPR (»Liberal-Demokratische Partei Russlands«), der Partei des Rechtspopulisten Wladimir Schirinowski, der seinen Wählern vom Fernsehbildschirm aus das Blaue vom Himmel versprach: den Männern gesicherte Arbeitsplätze, der russischen Armee Unbesiegbarkeit und jeder einsamen Hausfrau das ersehnte Eheglück. Es war eine Farce; ich konnte nicht glauben, dass jemand dieses populistische Geschwafel ernst nehmen konnte. Aber ich täuschte mich gewaltig: Schirinowski sollte bis zu seinem Tod 2022, als vieles andere längst in Vergessenheit geraten war, eine äußerst aktive und sehr laute Stimme in der russischen Politik bleiben.
Kaum ein Jahr später, im Dezember 1994, brach der erste Tschetschenienkrieg aus, den viele für die letzten Zuckungen des auseinanderbrechenden Sowjetimperiums hielten. Aber dieser Krieg, der in zwei Teilen geführt wurde und insgesamt beinahe zehn Jahre lang andauerte, trug massiv zum Erstarken von Putins Macht bei und machte Russland in vielem zu dem, was es heute ist.
Trotz dieser vielen alarmierenden Zeichen war mein Glas, wenn ich mich an jene Zeit erinnere, eher halb voll als halb leer.
Mit den Wirtschaftsreformen, die 1992 endlich ins Rollen gebracht wurden, kamen die Privatwirtschaft und das Kleinunternehmertum. Wie die Pilze schossen Banken aus dem Boden; einstiges Staatseigentum, von dem nicht ganz klar war, wem es gehörte, wurde aufgeteilt; man spekulierte mit sogenannten Vouchern, einer Form von Wertpapieren. In Moskau trieben Banden ihr Unwesen, benannt nach den Bezirken, in denen sie aktiv waren: Orechowskaja, Solnzewskaja, Ismajlowskaja … In ihren Reihen fanden sich nicht nur Kriminelle, die von Moskau damals magisch angezogen wurden, sondern auch Militärangehörige, die aus der schrumpfenden Armee entlassen wurden, und »Afghanen« – Rückkehrer aus dem Afghanistankrieg, diesem sinnlosen, blutigen Gemetzel, das 1989 nach zehn Jahren mit dem Abzug der sowjetischen Truppen geendet hatte. Verroht und traumatisiert, in Afghanistan auf den Geschmack von Drogen gekommen, bildeten diese Männer häufig den harten Kern der kriminellen Gruppierungen. In den Zeitungen und im Fernsehen wimmelte es von Berichten über die »organisierte Kriminalität«.
Vertretern dieser Schattenwelt konnte man in den Neunzigern auch im Ausland begegnen. So zum Beispiel in Berlin, wo ich 1995 einige Monate im Rahmen eines Forschungsstipendiums verbringen durfte. Eines Abends saß ich mit meinem Mann und unserer jüngsten Tochter in einem chinesischen Restaurant am Kurfürstendamm, als sich am Nachbartisch fünf seltsame Gestalten niederließen, die aussahen, als seien sie einem Gangsterfilm entsprungen. Allesamt trugen sie himbeerrote Sakkos, damals die »Uniform« der russischen Unterweltbosse. Die Jackentaschen standen seltsam ab, es hätte mich nicht gewundert, wenn aus einer der Griff einer Pistole hervorgelugt hätte. Die Männer diskutierten ungeniert laut mit jemandem per Satellitentelefon. Es ging um Schutzgelderpressung. Schließlich unterbrach einer von ihnen – offenbar der Anführer – das Geschäftstelefonat und kommandierte: »Hol mal das Schlitzauge her! Ich will Pelmeni!« Dann wandte er sich wieder dem Telefonat zu und setzte zu einem dermaßen derben Gefluche an, dass ich beinahe aufgestanden wäre, um ihn zur Räson zu bringen. Aber mein normalerweise so unerschrockener Mann hielt mich zurück und sagte leise: »Lass uns schnell essen und verschwinden. Mit solchen Typen sollte man sich nicht anlegen, auch nicht in Berlin …«
Unsere zweite Begegnung mit einer »Rotjacke« hatten wir in Moskau; es war eine beängstigende Situation mit einem überraschenden Ausgang. Wir waren mit unserem alten Schiguli spätabends auf dem Heimweg von der Datscha und hielten an einer Tankstelle. Wir konnten uns höchstens eine halbe Tankfüllung leisten; das Geld, wenn wir überhaupt welches hatten, war stets knapp bemessen. Als mein Mann ausgestiegen war, um nachzusehen, ob das Tankwarthäuschen, in dem man bezahlen musste, überhaupt besetzt war, klopfte jemand grob an das Fenster auf der Beifahrerseite. Ich schreckte hoch und erblickte einen Mann in einem himbeerroten Sakko, sichtlich angetrunken.
»Wo is’n dein Alter?«, fragte er ruppig durch das Fenster, das ich zögerlich ein wenig nach unten gekurbelt hatte. Es war stockdunkel, keine Menschenseele weit und breit.
»Ich brauch ’n Kabel«, lallte er heiser. »Mir ist die Batterie abgeschmiert.« Er deutete auf einen schwarzen Mercedes, der mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen war.
Zum Glück kam mein Mann gerade wieder zurück zu unserem Auto; schon auf dem Weg dorthin rief er mir zu, dass die Tankstelle leider geschlossen habe. Erst dann sah er den Kerl am Beifahrerfenster stehen. Und wieder hatten wir Glück. Mein Mann konnte ihm helfen und die Batterie überbrücken. Als er erleichtert einsteigen wollte, griff der Typ in seine Tasche und holte einen Packen Hundertrubelscheine heraus. Mein Mann weigerte sich entschieden, das Geld anzunehmen. Nach einigem Hin und Her stieg der Typ in seinen Mercedes, kurbelte im Losfahren das Fenster herunter und warf mir das Geldbündel geschickt durch das Beifahrerfenster in den Schoß. »Vielleicht hast du’s ja nicht nötig, aber deine Alte bestimmt!«, rief er noch und raste davon.
So weit war es mit uns schon gekommen, dass wir uns von so einer schmierigen Gestalt mit Geld bewerfen lassen mussten. Eigentlich ziemlich erniedrigend. Doch die ganze Szene war dermaßen absurd, dass wir laut loslachten, die nächste Tankstelle ansteuerten und die folgenden Tage fröhlich auf seine Kosten lebten.
In jenen wirren Zeiten waren Raubüberfälle, Mord und Erpressung praktisch an der Tagesordnung. Aber ich war trotz allem guter Dinge; die neuen Möglichkeiten und Arbeitsperspektiven lenkten mich vom harten Alltag ab. Dabei war Moskau, das in den 2000er-Jahren zu Glanz und Glamour aufsteigen würde, damals grau und trist, mit schlecht beleuchteten Straßen und heruntergekommenen Treppenhäusern, in denen nie das Licht anging, weil die Bewohner die Glühbirnen für den Eigengebrauch entwendeten. Denn wie alles andere waren auch banale Dinge wie Glühbirnen damals Mangelware. Das änderte sich erst langsam, als Anfang 1992 die Reformen kamen und mit ihnen die Waren. Einmal entdeckte ich auf dem Markt zwischen allerlei Krempel durchgebrannte Glühbirnen und fragte den grimmigen, unrasierten Verkäufer, wer die denn bitte schön kaufen würde. Er sah mich an, als wäre ich schwer von Begriff, holte dann aber zu einer Erklärung aus: Die ganz besonders Anständigen würden die funktionierenden Glühbirnen, die sie in der Arbeit mitgehen ließen oder im Treppenhaus aus den Fassungen schraubten, durch kaputte ersetzen. Das leuchtete mir ein.
Ich kannte damals niemanden, der nicht überfallen, Opfer eines Einbruchs oder eines Autodiebstahls geworden wäre, wenn nicht persönlich, dann zumindest im Familienkreis. Täglich wurden in Moskau im Schnitt hundert Autos gestohlen. Meine Freundin erwischte es sogar zweimal hintereinander, direkt vor ihrer Haustür. Mit Kleinigkeiten wie einem am helllichten Tag von der Schulter gerissenen Rucksack (so bei meiner ältesten Tochter) oder gestohlenen Portemonnaies und persönlichen Gegenständen im Nachtzug von Moskau nach Sankt Petersburg (bei Freunden von uns) konnte man niemanden schockieren. Höchstens damit, dass die Opfer in diesem Fall überzeugt waren, man habe ihnen etwas in den Tee getan, woraufhin sie in einen komatösen Schlaf sanken und nicht mitbekamen, wie jemand die von innen verriegelte Abteiltür aufbrach. Wir hatten uns dermaßen an diese Zustände gewöhnt, dass eine meiner Kolleginnen von Memorial sich einmal in der Metro bei einem Taschendieb entschuldigte, der sich an der scharfkantigen Verpackung ihrer Herztabletten den Finger aufgeschlitzt und laut aufgeschrien hatte. Und mein Schwager hinterließ auf unserer Datscha immer eine Notiz für ungebetene Gäste, dass sie doch bitte keine Kerzen anzünden und das Licht ausmachen sollten, wenn sie wieder gingen.
Aber es passierten auch weniger harmlose Dinge. Einmal besuchte ich meine Freundin in einem für die damaligen Verhältnisse respektablen Haus, aber weiter als in den Eingangsbereich kam ich nicht: Auf der Türschwelle lag eine blutüberströmte Leiche. Die Szene kam mir absurderweise so alltäglich vor, dass mir automatisch das Wort »Schussverletzung« in den Sinn kam – man hörte es schließlich ständig in den Nachrichten. Die Miliz, wie die Polizei damals noch hieß, ließ mich nach einer kurzen Befragung bald wieder gehen und wollte zum Glück nie wieder etwas von mir. Der Mord wurde nie aufgeklärt, genau wie viele andere solcher Fälle.
Die Gewalt machte auch vor unserer Haustür nicht halt. In dem Gebäude wohnten die Mitarbeiter des Kurtschatow-Instituts, des wichtigsten Atomforschungszentrums des Landes, das nur wenige Gehminuten entfernt lag. Weil mein Mann dort in einem Labor gearbeitet hatte, das zur Kernfusion forschte, lebten wir seit den 1970er-Jahren in diesem Haus. Die Institutsleitung war auf der gegenüberliegenden Straßenseite untergebracht, in Häusern, die deutsche Kriegsgefangene in den Nachkriegsjahren gebaut hatten, während am Institut parallel an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet wurde. Aus unseren Fenstern im dritten Stock war nur der Park hinter der Institutsmauer zu sehen, und man konnte sich kaum vorstellen, dass sich dort mehrere Atomversuchsreaktoren befanden.
Die allgemeine Krise war auch am Kurtschatow-Institut zu spüren. Die Gehälter blieben aus, die Forschung wurde auf Eis gelegt. Unser Haus verarmte mitsamt seinen Bewohnern. Doch das bewahrte auch sie nicht vor Einbrüchen und Überfällen. Im Stockwerk über uns wohnte eine immer freundliche und gut gelaunte Chemiedozentin an der Moskauer Staatlichen Universität; sie wurde im Aufzug erstochen, ohne ersichtlichen Grund – zu holen war bei ihr nichts. Unsere Tochter Mascha, die genau in diesem Moment mit dem Hund die Wohnung verlassen wollte, dann aber einen Moment innegehalten hatte, um sich den Schnürsenkel zuzubinden, hatte unglaubliches Glück. Sie sah den Täter nur noch von hinten, wie er die Treppe hinabeilte. Mehr, als dass er schwarz gekleidet war, konnte sie der Miliz nicht mitteilen.
Ein ehrenwertes Haus
Ein beliebter Witz jener Zeit ging so: »Stehen zwei Killer im Hausflur und warten auf ihr Opfer. Eine Stunde vergeht, zwei. Da sagt der eine zum anderen: ›Wo bleibt der denn nur? Ihm wird doch hoffentlich nichts zugestoßen sein?‹«
Eine ähnlich schwarzhumorige Geschichte ereignete sich im Haus meines besten Freundes aus Kindertagen. Er lebte im Zentrum von Moskau an der Kreuzung Neuer Arbat und Gartenring. In der Nachbarwohnung, die vor der Perestroika noch ruhige Zeitgenossen bewohnt hatten, ging es plötzlich heiß her. Wenn wir zu Besuch kamen, teilten wir uns den Aufzug oft mit seriös wirkenden Männern zwischen dreißig und fünfzig, die wie Banker oder Abgeordnete der Staatsduma aussahen. Wir hatten keinen Zweifel, dass es sich um ein illegales Bordell für hochrangige Kundschaft handelte. Laut Gesetz waren Zuhälterei und der Betrieb von Bordellen verboten.
Auch das Treppenhaus wurde bald an Etablissement und Klientel angepasst: Die Wände erhielten einen Anstrich in Dunkelgrün und Gold, die Fensterbank zierte eine hässliche pseudoantike Vase. Mein Freund grämte sich angesichts dieser Nachbarschaft nicht allzu sehr, er meinte völlig zu Recht, dass die Security-Leute, die das Etablissement bewachten, seine Wohnung gleich mit im Auge behalten würden. Gewöhnliche Diebe würden sich jedenfalls nicht mehr hierher verirren.
Aber eines Tages fanden wir die Tür zu dieser Nachbarwohnung polizeilich versiegelt vor. Mein Freund berichtete, was vorgefallen war: Er war mit einer Erkältung zu Hause, als er im Treppenhaus plötzlich Lärm hörte. Als er nachsehen wollte, was los war, klingelte es auch schon an seiner Tür. Er machte auf und sah, dass das ganze Treppenhaus voller bewaffneter Männer war – einfache Milizionäre und Leute von OMON, der Sondereinheit der russischen Nationalgarde, mit schusssicheren Westen und Maschinengewehren. Vor seiner Tür stand ein Mann in Zivil. Er zeigte meinem Freund seinen Dienstausweis, entschuldigte sich für die Störung und fragte, ob er sich irgendwo hinsetzen dürfe, um das Protokoll zu erstellen. Mein Freund führte ihn in die Küche, wo der Mann nicht nur seine Zusammenfassung schrieb, sondern auch freimütig erzählte, was vorgefallen war: Drei Milizionäre aus dem Moskauer Umland hatten von dem illegalen Bordell Wind bekommen und wollten eine Scheibe abhaben. Sie beschatteten das Haus, passten einen Moment ab, in dem die Wachleute kurz ihren Posten verließen, drangen in die Wohnung ein und verlangten Geld. Empört, dass sich irgendwelche dahergelaufenen Bullen so dreist aufführten, riefen die Mädchen ihre »Kryscha« an, was so viel wie »Dach« bedeutet und Kriminelle meint, die gegen Geld Schutz bieten. Ohne deren Schutz hätte das Etablissement keinen Tag lang überlebt. In diesem Fall war die »Kryscha« niemand Geringerer als der Moskauer OMON, der sofort in voller Montur losstürmte. Sie hämmerten an die Tür und drohten damit, die erfolglosen Erpresser an Ort und Stelle zur Strecke zu bringen. Als diese den Ernst der Lage begriffen, wählten sie das geringere Übel und riefen die Miliz. Und so fand sich vor der »Freudenwohnung« ein gutes Dutzend Ordnungs- und Gesetzeshüter aller Couleur zusammen.
Der Ermittler staunte über die Dummheit der Provinz-Bullen, die so naiv in die Falle getappt waren. Zum krönenden Abschluss dieser possierlichen Geschichte bat er unseren Freund um eine Tüte für ein wichtiges Beweisstück – eine Polizeikelle, wie sie die Verkehrspolizei benutzte, um vorbeifahrende Autos anzuhalten. Polizeilicher »Autostopp« war damals eine weitverbreitete Methode, um sich ein kleines Zubrot zu verdienen. Irgendein an den Haaren herbeigezogenes Vergehen, von dem sich der beschuldigte Autofahrer gegen Bares sofort freikaufen konnte. Offenbar hatten die Provinzler, bevor sie im Bordell aufkreuzten, noch schnell die Gelegenheit genutzt, um sich mit dieser Kelle an einer der lukrativsten Kreuzungen Moskaus direkt vor dem Haus zu positionieren – an der Straße, die von den elitären Vorstadtsiedlungen zum Kreml führt.
Wie das Ganze für die Pechvögel ausging, verschweigt die Geschichte. Die Wohnung stand daraufhin jedenfalls lange Zeit leer, bevor sie mit neuen Bewohnern zur alten Respektabilität zurückkehrte.
Mord in Borowitschi
Wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, wird mir bewusst, dass ich die schrecklichste Geschichte, die wir erleben mussten, jahrelang verdrängt habe. Schrecklich nicht zuletzt ob ihrer Sinnlosigkeit, denn die Motive für diese Tragödie liegen völlig im Nebel.
Die Geschichte reicht weit zurück: 1943, noch zu Kriegszeiten, hatte meine Großmutter einen kleinen Jungen aus dem Waisenhaus bei sich aufgenommen. Sein Vater war an der Front gefallen, die Mutter verhungert, und das Kind mit seinen drei Jahren so schwach, dass es nicht laufen konnte. Meine Großmutter, eine sehr resolute Frau, war fest entschlossen, den Jungen aufzupäppeln, und das gelang ihr auch. Er wuchs heran, ging studieren, wurde Bauingenieur, heiratete und gründete eine Familie, mit der er in Duschanbe, Tadschikistan, lebte. Beruflich erfolgreich, privat glücklich, alles schien sich nach dem schwierigen Start ins Leben zum Besten zu wenden. Doch dann starb sein Sohn, der in den 1970er-Jahren geboren wurde, an einem Herzfehler. Die Eltern hatten ihn nach Moskau gebracht und diverse Krankenhäuser konsultiert, aber die Medizin war damals einfach noch nicht so weit, die Ärzte konnten nichts ausrichten. Ein wenig Lebensfreude schien wieder einzukehren, als zwei gesunde Töchter geboren wurden. Nastja, die jüngere, war ein liebes, argloses, fröhliches Mädchen. Doch dann geriet die Familie mitten hinein in die Krise, die mit dem Zerfall der UdSSR einsetzte.
Das fadenscheinige Konstrukt der sogenannten Völkerfreundschaft, das in Wirklichkeit nur in Form der vergoldeten Skulpturen im berühmten Springbrunnen auf dem WDNCh-Gelände3 und im Text der sowjetischen Hymne existierte, bröckelte an allen Ecken und Enden. Eine dieser Ecken war Tadschikistan, eine der ärmsten Republiken Zentralasiens. Hinter der Fassade des scheinbaren Wohlstands am Rande des Sowjetimperiums verbargen sich eine korrupte Regierung, wachsende soziale Spannungen, Armut und Rückständigkeit der ländlichen Bevölkerung. Anfang der 1980er-Jahre häuften sich Meldungen über Selbstverbrennungen von Frauen. Viele von ihnen fristeten ein so entrechtetes und elendes Dasein, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sahen als dieses unvorstellbar qualvolle Ende.
Im darauffolgenden Jahrzehnt entbrannte in Tadschikistan ein regelrechter Krieg zwischen verschiedenen Clans und kriminellen Gruppierungen; aus dem Untergrund kamen Islamisten dazu. Im Herbst 1992 wuchsen sich die Konflikte zu einem Bürgerkrieg aus. Der verheerende Krieg in Afghanistan diente als Katalysator: Er schwappte über die tadschikische Grenze. Der Bürgerkrieg in Tadschikistan, der bis 1997 andauerte, forderte Zehntausende Opfer, manche Schätzungen gehen von weit über 100000 aus. Wie andernorts wurden auch die blutigen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Duschanbe von Pogromen gegen Russen und Armenier begleitet, die in ständiger Angst lebten. Viele dieser Armenier, oftmals Familien, waren 1990 vor den gewaltsamen Unruhen in Baku (damals die Hauptstadt der Aserbaidschanischen SSR) hierher geflüchtet, nun drohten ihnen auch hier Tod und Verfolgung. Die wenigen, die blieben, versuchten, ihre Identität zu verbergen. Auch ein Großteil der russischen Bevölkerung floh. Millionen von Menschen verließen aufgrund der Unruhen die ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien und im Südkaukasus und suchten in Russland Zuflucht. Doch obwohl sie ethnische Russen waren, empfing sie niemand mit offenen Armen, im Gegenteil, sie waren Fremde, und dazu noch – angesichts der grassierenden Arbeitslosigkeit – Konkurrenten. Für diese Menschen war es äußerst schwer, Wohnraum und Arbeit zu finden.
Mit jener Flüchtlingswelle kam auch die Familie des Pflegesohnes meiner Großmutter aus Duschanbe. Sie ließ sich in Borowitschi nieder, einer mittelgroßen Stadt mit 50000 Einwohnern im Nordwesten von Russland. Während des Zweiten Weltkriegs war hier die Front verlaufen, Menschen aus dem belagerten Leningrad waren hierher evakuiert worden, es gab Lazarette und Filtrationslager für Soldaten der Roten Armee, die sich aus deutscher Kriegsgefangenschaft befreien konnten, sowie das »Lager 270« für deutsche Kriegsgefangene.
Die Familie hatte sich für Borowitschi entschieden, weil dort ein entfernter Bekannter ein Baustoffwerk leitete, das selbst in jenen Krisenzeiten in Betrieb war. Er hatte ihnen eine Wohnung, ein kleines Stück Land und eine gute Anstellung versprochen. Die Frau fand Arbeit als Mathematiklehrerin an der Schule. Auch wenn sie nach dem warmen Süden Schwierigkeiten hatten, sich an das Leben im Norden zu gewöhnen, lebten sie sich mit der Zeit ein. Bis sie das einholte, vor dem sie aus Duschanbe geflohen waren.
Eines Tages erhielten wir einen Anruf aus Borowitschi. Nastja sei tot. Wir konnten es nicht fassen. Die Tat war so grausam wie sinnlos, der Hergang mysteriös. Nastja war auf die Schule gegangen, an der ihre Mutter unterrichtete. Sie besuchte zusammen mit anderen Dreizehn- und Vierzehnjährigen die siebte Klasse. Als sie am Tag ihres Todes nach dem Unterricht nach Hause gehen wollte, stellte sie fest, dass ihre Schuhe weg waren. Nach sowjetischem Brauch mussten in Schulen Hausschuhe getragen werden, damit man den Straßenschmutz nicht in die Klassenräume trug. Ständig gab es Scherereien mit diesen Wechselschuhen, ständig wurden sie vergessen oder gingen verloren. Einmal kam meine älteste Tochter mit einem Stiefel und einem Pantoffel an den Füßen von der Schule nach Hause.
Während Nastja nach ihren Schuhen suchte, erzählte ihr jemand, ein Mitschüler habe sie mitgenommen. In Hausschuhen tappte sie zu ihm nach Hause – und geradewegs hinein in eine Falle. Die Ermittlungen jedenfalls kamen zu dem Schluss, dass der Mitschüler sie auf diese Weise zu sich gelockt habe, um sie zu töten. Sie wurde stranguliert. Anzeichen für sexuelle Gewalt gab es keine, genauso wenig irgendein anderes Motiv. Aber wie konnte ein Gleichaltriger, der kaum größer war als sie, mitten am helllichten Tag eine solche Tat begehen? Wie hatte er es geschafft, ihre Leiche in einen Sack zu packen und auf einem Schlitten auf die Mülldeponie zu verfrachten? Es war unbegreiflich. Man wusste nur, dass die Mutter des mutmaßlichen Täters die Stadtapotheke leitete und in der Kleinstadt Einfluss hatte.
Zur Beerdigung kamen viele Menschen, der Fall sorgte selbst vor dem Hintergrund der »wilden Neunziger« für Aufsehen. Der mutmaßliche Täter, der zwei Wochen vor seinem vierzehnten Geburtstag stand und nicht strafmündig war, wurde in ein Heim für Schwererziehbare außerhalb der Stadt eingewiesen. Damit war der Fall erledigt. Echte Ermittlungen gab es keine, auch Nastjas Eltern konnten nichts erreichen. In der Stadt machten schaurige Gerüchte die Runde, dass der wahre Mörder einer nationalistischen Gruppierung entstamme, die die Tat verübt habe, um sich an den Zugezogenen zu rächen, die den Einheimischen angeblich die Arbeit wegnahmen.
Keine Fernsehserie, kein Krimi über Mordfälle in der russischen Provinz, die es später massenhaft gab, konnte je die erdrückende Atmosphäre in Borowitschi wiedergeben. Als meine Mutter und ich im Winter 1999 nach einer langen Zugfahrt frierend ankamen, um an Nastjas Beerdigung teilzunehmen, war Trostlosigkeit das vorherrschende Gefühl. Borowitschi war arm und heruntergekommen wie die meisten postsowjetischen Kleinstädte. Während Moskau sich in dieser Zeit langsam erholte, spiegelten hier die ganze Atmosphäre, die bröckelnden Fassaden, die kaputten, mit grauem Schneematsch bedeckten Straßen all die Schrecken des Zerfalls. Die zwei Tage, die wir dort verbrachten, waren wir wie erstarrt vor Grauen. Dieser Mord schien im schlimmsten Sinn symbolisch: Die Familie war vor der Gewalt in Tadschikistan nach Russland geflohen, nur um hier von der Gewalt in ihrer brutalsten Form eingeholt zu werden – an einem Ort, an dem sie Schutz gesucht hatten.
Der Labrador und die Einbrecher
Ein paar Jahre später sollte auch meine Familie Opfer der alltäglichen Gewalt werden, wenn auch mit weniger tragischem Ausgang. Das Datum dieser Geschichte, die später zu einer skurrilen Begegnung führte, hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt: Es war im Oktober 2002, an dem Tag, als eine Gruppe tschetschenischer Terroristen während einer Vorstellung des Musicals »Nordost« Hunderte Geiseln nahm.
An jenem nasskalten Herbstabend lief ich spät nach einer Veranstaltung nach Hause. Ich war schon fast da, als mein Handy klingelte. Meine sechzehnjährige Tochter Lisa brachte nur einen Satz heraus: »Mama, wir wurden ausgeraubt.« Ich erinnere mich nur bruchstückhaft daran, wie ich das letzte Stück des Weges bewältigte und die Treppen in den dritten Stock hinaufflog. Die Tür zur Wohnung stand offen, drinnen herrschte Chaos. Der Inhalt sämtlicher Schränke war auf dem Fußboden verstreut. Die Tür war nicht aufgebrochen worden; Lisa hatte sie den Einbrechern eigenhändig geöffnet. Als es klingelte und sie fragte, wer da sei, hörte sie: »Die Maler, wir waren nur kurz Müll wegbringen.« Die Täter wussten ganz offenbar, dass in diesen Tagen Handwerker bei uns ein und aus gingen, weil wir die Wohnung gerade renovieren ließen. Sie waren zu dritt, alle in schwarzen Jacken und schwarzen Strickmützen, die sie sich tief in die Stirn gezogen hatten.
Trotz des Schocks hatte Lisa einen klaren Kopf bewahrt und so vielleicht Schlimmeres verhindert. Sie händigte ihnen das ganze Geld aus, das wir in der Wohnung hatten; genau aus diesem Grund wusste sie immer, wo es lag. Kreditkarten besaßen wir damals noch keine. Es waren Euroscheine, offenbar etwas ganz Neues für die Diebe, die die Banknoten erstaunt begutachteten. Die einzigen anderen Gegenstände von Wert in der Wohnung waren Gemälde und Bücher, aber von denen hatten sie glücklicherweise keine Ahnung. Sie begnügten sich mit meinem Schmuck und ein paar anderen Kleinigkeiten, die ihnen wertvoll erschienen, und verschwanden.
Wir hatten pures Glück, dass sie »nur« Einbrecher und keine Mörder waren. Sie hatten Lisa zwar gefesselt und bedroht, nachdem sie ihnen das Geld ausgehändigt hatte, aber offenbar nicht mit der Absicht, ihr Schlimmeres anzutun. Vielleicht wollten sie auch einfach nur schnell wieder verschwinden. Unser Labrador Trim hatte sich genau richtig verhalten. Als die Einbrecher sich daranmachten, meine Tochter zu fesseln, hielt er das in seiner gutmütigen Naivität für ein Spiel und brachte den Verbrechern umgehend seinen Ball. Wer weiß, was passiert wäre, hätte er gebellt und die Zähne gefletscht, womöglich hätten sie ihn umgebracht, und Lisa wäre noch schwerer traumatisiert worden.
Ich rief sofort die Polizei, und bald drängten sich Einsatzkräfte und Ermittler in unserer verwüsteten Wohnung; offenbar waren die Sicherheitskräfte aufgrund der Geiselnahme in erhöhter Alarmbereitschaft. Sie traten sich ziemlich unbeholfen gegenseitig auf die Füße und verwischten so vermutlich die paar Spuren, die die Einbrecher hinterlassen hatten. Die Befragung wirkte wie ein schlechter Witz; Lisa hielt sich kühl und distanziert, als wäre das alles nicht mit ihr passiert. Auf die Frage, womit ihr die Diebe gedroht hätten, erwiderte sie nur: »Was meinen Sie wohl, womit Banditen jungen Frauen drohen? Ich habe außerdem morgen früh eine Prüfung, ich muss ins Bett.«
Nach einer Weile gingen sie, allerdings nicht ohne uns eine schriftliche Erklärung abzunehmen, dass wir am nächsten Tag zwecks Personenbeschreibung auf die Wache kommen würden. Es war das erste Mal, dass ich bei der Erstellung eines Phantombilds dabei war, diesmal am Computer. Lisa tat sich schwer, besondere Merkmale zu beschreiben, zumal alle Täter Mützen getragen hatten. Recht viel mehr, als dass sie vom Äußeren her einem damals vorherrschenden Klischee entsprachen, konnte sie nicht sagen: Sie waren vom Typ her »Kaukasier« – ein üblicher Sammelbegriff für sämtliche Migranten aus dem Süden. In den Neunzigern strömten nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Kriminelle aus den kaukasischen Republiken nach Moskau und schlossen sich je nach ethnischer Zugehörigkeit zu Banden zusammen, die verschiedene Lebensbereiche unter ihre Kontrolle brachten: Die einen nahmen sich der Märkte an, die anderen der Banken, die Dritten der Hotelbranche. Diese hier plünderten offenbar Wohnungen.
Noch lange Zeit später zuckte Lisa zusammen, wenn sie Männer mit »kaukasischem« Äußeren und schwarzer Kleidung sah. Vom Kopf her verstand sie natürlich, dass es falsch war, jemanden aufgrund von äußeren Merkmalen zu verdächtigen. Aber das Trauma, das sie erlebt hatte, ging viel tiefer, als wir uns das damals vorstellen konnten.
Die Fahndung lief natürlich ins Leere. Aber nach einer Weile rief die Miliz wieder bei uns an: Lisa solle bei einem Ermittler namens Saitschikow vorsprechen, weil sie minderjährig war, in Begleitung eines Erwachsenen. Ermittler Saitschikow – ein junger Mann um die dreißig im adretten Tweed-Anzug – empfing uns gut gelaunt. Die Einladung hatten wir seiner Beförderung zu verdanken, er wollte die »hängenden« Fälle abschließen. Er war vom Bezirksermittler zum stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt aufgestiegen. Das alles ließ er uns wissen, kaum hatten wir einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Die Wand über seinem Schreibtisch zierte ein großes Poster mit einem zähnefletschenden Wolf. Ich hätte beinahe laut losgelacht, denn Saitschikow heißt übersetzt etwa »Herr Hase«. Als er merkte, dass mein Blick auf dem Poster hängen geblieben war, erklärte er: »Ein Geschenk von meinem Schwiegervater, er ist ein hohes Tier bei der Staatsanwaltschaft.« Und offenbar gesegnet mit einem feinsinnigen Humor.
Um unseren »hängenden Fall« zu den Akten legen zu können, musste uns Saitschikow ein paar Fragen stellen. Die Antworten kommentierte er rege – ein gelinde gesagt unkonventionelles Vorgehen. Das ganze Gespräch war im Grunde ziemlich komisch. Als Lisa zum wiederholten Male die Tat in allen Einzelheiten beschrieb, empörte er sich über die Friedfertigkeit unseres Labradors: »Und das soll ein Hund sein? Wozu haben Sie den überhaupt? Also unserer hätte sicher niemanden ins Haus gelassen«, posaunte er und präsentierte stolz ein Foto auf seinem Computer. Das Bild zeigte eine hübsche Brünette, offensichtlich seine Angetraute, neben einem riesigen Mastino Napoletano.
Nicht nur unseren nichtsnutzigen Hund bedachte er mit einem ironischen Kommentar, auch die Diebe. Als Lisa auf die Frage, welche CD in ihrem gestohlenen Discman gewesen sei, mit »Schostakowitsch« antwortete, rief er amüsiert aus: »Na, die werden sich wundern!«
Nun kam ich an die Reihe. Einmal mehr sollte ich die gestohlenen Gegenstände aufzählen, auch wenn die Liste längst vorlag. »Bei mir muss alles seine Ordnung haben«, sagte Saitschikow. All das noch einmal durchzugehen, schmerzte, denn unter dem geklauten Schmuck waren auch Stücke meiner Großmutter, Ringe, die meiner verstorbenen Schwiegermutter gehört hatten … Mir war klar, dass ich die Sachen weder jemals wiedersehen noch dass überhaupt jemand nach ihnen suchen würde. Also erledigte ich diese Formalität so rasch wie möglich, damit wir endlich gehen konnten. Doch als ich schließlich erleichtert aufatmete, klickte Ermittler Saitschikow, der meine leidige Liste umständlich mit einem Finger in den Computer getippt hatte, aus Versehen auf »Löschen« anstatt auf »Speichern«, und die ganze Arbeit löste sich vor unseren fassungslosen Augen in Luft auf. Aber selbst das konnte seine Laune nicht trüben, ganz im Gegensatz zu mir, die ich um ein Haar in das Gefluche eingestimmt hätte, das aus dem Büro nebenan zu uns herüberdrang. Saitschikow hingegen zeigte sich von seiner wohlerzogenen Seite und entschuldigte sich für seine Kollegen: »Da arbeitet die Kripo«, sagte er. »Sie wissen ja, wie das ist.«
Ich zählte also zähneknirschend noch einmal alles auf, dann wünschten wir ihm viel Erfolg für seinen neuen Posten und wollten gerade gehen, als es an der Tür klopfte.
»Na, wenn man vom Teufel spricht«, sagte Saitschikow zu einem Mann, der weitaus weniger gestriegelt und lebensfroh wirkte. »Das ist mein geschätzter Kollege aus dem Nachbarbezirk. Die haben da gerade eine Bande geschnappt, auch so Kaukasier. Vielleicht erkennt Ihre Tochter einen davon wieder?«
Ich bereute augenblicklich, dass wir nicht längst verschwunden waren, aber es war zu spät. Der Kollege schlug ein Fotoalbum auf und hielt es Lisa unter die Nase: »Haben Sie einen von denen schon mal gesehen?« – »Wenn Sie die nicht so zugerichtet hätten, könnte ich das vielleicht beantworten«, bemerkte meine Tochter trocken. Und tatsächlich, die Gesichter auf den Fotos waren dermaßen grün und blau geschlagen, die Augen so zugeschwollen, dass die eigene Mutter sie nicht wiedererkannt hätte.
Saitschikow fasste den Tathergang kurz für den Kollegen zusammen, woraufhin der Lisa lobte, dass sie den Tätern das Geld ausgehändigt hatte. Er erzählte, dass in seinem Bezirk ein Mädchen gefoltert worden sei, weil sie nicht wusste, wo das Geld versteckt war. »Sie können also wirklich von Glück sprechen«, resümierte Saitschikow fröhlich. »Mein Rat: Schauen Sie jeden Tag in den ›Dienstabschnitt‹ [Kriminalchronik], vielleicht erkennen Sie ja jemanden wieder. Und klappern Sie die Pfandleihhäuser ab, wer weiß, vielleicht tauchen die Sachen dort auf.« Damit wandte er sich von uns ab und seinem Kollegen zu: »Hast du meinen neuen Schlitten schon gesehen?« – »Du meinst den VW, der draußen steht?«
Wir sahen den schicken Wagen, als wir aus dem Gebäude heraustraten. Auffallend viele Vertreter der »Staatsgewalt« fuhren damals glänzende Karossen aus dem Westen …
Schattenwirtschaft und »Spekulanten«
Im Januar 1992