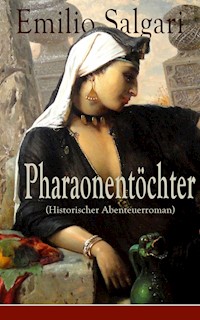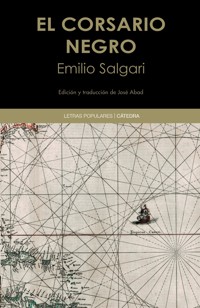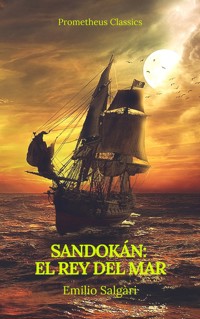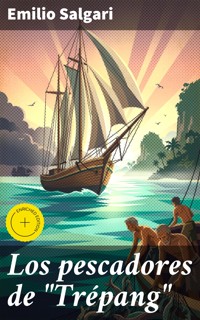1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In "Der schwarze Korsar" entführt Emilio Salgari die Leser in die spannende Welt der Piraterie des 17. Jahrhunderts. Mit seinem unverwechselbaren, lebendigen Schreibstil und einer Fülle von actionreichen Szenarien schafft Salgari ein atmosphärisches Werk, das den Leser in die Karibik, zwischen Heldentum und Verrat, eintauchen lässt. Die Geschichte folgt dem faszinierenden Charakter des schwarzen Korsaren, der nicht nur nach Rache strebt, sondern auch für die Freiheit der Unterdrückten kämpft. Diese Mischung aus Abenteuer, historischem Kontext und einem ausgeprägten Sinn für das Unbekannte macht das Buch zu einem herausragenden Beispiel der Abenteuerliteratur des späten 19. Jahrhunderts. Emilio Salgari, ein italienischer Schriftsteller, wurde 1862 in Verona geboren und war bekannt für seine Fantasiewelten voller exotischer Schauplätze und unkonventioneller Heldenfiguren. Sein eigenes, oft von der Realität geprägtes Leben erforderte ein großes Maß an Vorstellungskraft, das in seinem Werk deutlich wird. In einer Zeit, als die Romantik und das Epos in der Literatur vorherrschten, verknüpfte Salgari Abenteuerromantik mit sozialen Themen und schuf so ein Werk, das weit über die bloße Unterhaltung hinausgeht. "Der schwarze Korsar" ist eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Abenteuer und die tiefgründige Analyse menschlicher Motivationen interessieren. Mit seinen historischen und emotionalen Tiefen bietet dieses Buch nicht nur Spannung, sondern auch eine Reflexion über Freiheit und Gerechtigkeit. Salgaris Meisterwerk ist ein unverzichtbares Zeugnis für Liebhaber klassischer Abenteuerromane. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der schwarze Korsar (Piraten Abenteuer)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen dem Schimmer tropischer Gewässer und dem Schatten ungeschriebener Gesetze entfaltet sich der unerbittliche Schwur eines Einzelnen, der im Namen der Ehre jede Gefahr der Karibik herausfordert, um einer Welt der Willkür eine persönliche, messerscharfe Gerechtigkeit entgegenzusetzen, und der dabei lernt, dass Freiheit und Pflicht, Maskierung und Wahrhaftigkeit, Mut und Maß zugleich Magnet und Prüfstein sind, während das Grollen der Kanonen, das Wispern der Brandung und die unablässig wechselnden Winde eine Bühne bereiten, auf der jeder Schritt auf Leben und Tod wiegt und der nächste Kurs stets mehr verheißt, als er verspricht.
Der schwarze Korsar ist ein klassischer Abenteuer- und Piratenroman des italienischen Autors Emilio Salgari, angesiedelt in der Karibik des 17. Jahrhunderts und erstmals 1898 in Italien veröffentlicht. Als Teil seines weit verzweigten See- und Räuberzyklus verbindet das Werk historisches Kolorit der Freibeuterzeit mit der dramatischen Zuspitzung populärer Erzählkunst des späten 19. Jahrhunderts. Salgari, der durch Serienhelden wie Sandokan berühmt wurde, entwirft hier eine eigenständige Piratenmythologie, die europäische Leserinnen und Leser bis heute fasziniert. Die deutsche Ausgabe bewahrt den markanten Titelhelden, dessen schwarze Erscheinung und strenge Ehrenvorstellung das Gesicht eines schillernden, zugleich unerbittlichen Korsarenzeitalters prägen.
Die Ausgangslage ist klar und zugespitzt: In den Häfen der Freibeuter, wo Bündnisse in Tavernen geschmiedet und auf Decks gebrochen werden, tritt ein unergründlicher Kapitän auf, dessen Name bereits genügt, um Routen zu ändern. Ein persönlicher Konflikt zwingt ihn, eine riskante Unternehmung zu beginnen, die Sturmfahrten, Grenzübertritte und Begegnungen mit rivalisierenden Mächten einschließt. Erzählt wird in einer getragenen, aber spannungsgeladenen dritten Person, die nah an der Handlung bleibt und doch den Blick für Atmosphäre, Geräusche und Gesten schärft. Der Stil ist bildkräftig und rhythmisch; Kapitel bauen konsequent aufeinander auf, tragen deutliches Tempo und setzen dramaturgische Klammern ohne Effekthascherei.
Der Ton verbindet waghalsige Tatkraft mit romantischem Ernst: Auf offener See wechseln wütende Gefechte mit lautlosen Manövern, in Küstenstädten prallen höfische Etikette und rauer Kodex aufeinander, und in den Mangroven herrscht das Gesetz der Spur und des Schweigens. Spannung wächst aus Verfolgungen, Hinterhalten und dem präzisen Takt seefahrerischer Entscheidungen, bei denen Wetter, Strömung und Mut Faktoren derselben Rechnung sind. Salgaris Prosa entfaltet eine leuchtende Farbenpalette – Fahnen, Laternen, Uniformen, das matte Schwarz des Helden – und hält zugleich Distanz, die dem Geschehen eine fast legendenhafte Kontur verleiht, ohne den physischen Einsatz der Figuren zu vernebeln.
Zentral sind Themen von Ehre und Vergeltung, Rechtsbruch und Gerechtigkeit, Loyalität und Verrat. Der Roman erkundet, was ein persönlicher Schwur unter Bedingungen kolonialer Machtordnungen bedeutet, in denen Gesetz und Gewalt oft identisch erscheinen. Der Schwarze Korsar agiert in einer Grauzone: Er ist Gesetzgeber für seine Mannschaft und zugleich Gejagter der Reiche, deren Flaggen er herausfordert. Die See fungiert als Schwelle zwischen Identitäten, eine Bühne für Masken und Selbstentwürfe, die im Feuer der Entscheidung geprüft werden. Nicht zuletzt verhandelt das Buch den Preis von Führung – Verantwortung, Einsamkeit, Disziplin – und die Zerbrechlichkeit jedes Kodex, sobald Gefühle ins Spiel geraten.
Heute bleibt Der schwarze Korsar relevant, weil er Fragen bündelt, die über das Abenteuer hinausreichen: Wo endet Selbstjustiz, wo beginnt legitime Gegenwehr gegen korrupte Autorität? Wie belastbar sind Loyalitäten, wenn Ziele und Mittel kollidieren? Das Buch bietet eine Projektionsfläche, um über koloniale Gewalt, ökonomische Ausbeutung und die Verführungskraft des Freiheitsversprechens nachzudenken, ohne die Spannung zu mindern. Gleichzeitig wirkt seine serielle Energie modern: klar unterscheidbare Episoden, wiederkehrende Motive, starke visuelle Impulse. Wer sich auf Salgaris Welt einlässt, erlebt nicht nur Eskapismus, sondern auch ein Labor für moralische Entscheidungen, deren Echo über die letzte Seite hinaus anhält.
Als Schlüsseltitel im Werk Emilio Salgaris, der Generationen von Abenteuergeschichten geprägt hat, fungiert Der schwarze Korsar als kompakte, eigenständige Einladung in eine größere Erzählwelt – ohne Vorwissen zugänglich, doch reich an Verweisen auf ein fortgesetztes Piratenuniversum. Wer maritime Schauplätze, dichte Aktion und klare moralische Konflikte schätzt, findet hier einen verlässlichen Kompass. Zugleich eröffnet der Roman einen Blick auf die literarische Produktion um 1900, in der Tempo, Gefühl und Exotik zu einer wirkungsvollen Mischung wurden. So bleibt dieses Buch ein lebendiger Klassiker: geschliffen in seiner Dramaturgie, sinnlich in seiner Sprache und offen für neue Lektüren.
Synopsis
Der schwarze Korsar ist ein Piratenabenteuerroman des italienischen Autors Emilio Salgari, zuerst 1898 in Italien veröffentlicht und später vielfach übersetzt. Die Handlung spielt im karibischen Raum des 17. Jahrhunderts, in einem Umfeld rivalisierender Kolonialmächte und gesetzloser Seewege. Im Mittelpunkt steht ein italienischer Adeliger, der als Schwarzer Korsar gefürchtet ist und einen unbedingten Racheschwur leistet: Er will den mächtigen spanischen Statthalter zur Rechenschaft ziehen, den er für den Tod seiner Brüder verantwortlich macht. Salgari verbindet rasant erzählte Seefahrten, exotische Schauplätze und ein Ehrenethos der Freibeuter zu einer melodramatischen, zugleich strategisch geprägten Abenteuergeschichte.
Zu Beginn etabliert der Roman die Insel Tortuga als Drehkreuz der Bukaniere und den Ruf des Schwarzen Korsaren als kühlen, streng disziplinierten Anführer. Ein erster Vorstoß gegen eine schwerbewaffnete spanische Galeone demonstriert sein taktisches Geschick und die Loyalität der Mannschaft. Aus erbeuteten Informationen erfährt er mehr über die Machtbasis des verhassten Gouverneurs am Golf von Venezuela, insbesondere über dessen Schutzsysteme und Verbündete. Der Korsar bündelt Kräfte, wägt Risiken, setzt auf Geschwindigkeit und Überraschung. Der Ton der Erzählung verbindet nüchterne Planung mit romantischer Pose, während die Gegenspieler als harte, von imperialen Interessen getriebene Funktionäre erscheinen.
Im Zuge der Vorbereitung schließt sich der Schwarze Korsar mit anderen Freibeuterkommandanten zusammen, deren Interessen zwischen Beute, Ruhm und Fehden schwanken. Salgari schildert Verhandlungen, Bündnistreue und Verrat als fragile Balance, die in Seegefechten ständig neu verhandelt wird. Nach einer riskanten Jagd durch Untiefen und Riffe fällt den Piraten Material in die Hände, das Wege über Lagune und Seezugänge nach Maracaibo skizziert. Die Geografie wird zum Gegenspieler: Sandbänke, wechselnde Winde und Küstenbatterien erzwingen List statt roher Gewalt. Der Plan, die spanische Präsenz zu umgehen und das Herz der Macht zu treffen, nimmt feste Konturen an.
Eine längere Zwischenetappe führt an Land, als ein Teil der Mannschaft verschlagen oder gefangen wird und der Korsar eine Rettungsaktion wagt. Die Erzählung wechselt vom Deck in die tropische Wildnis: Sümpfe, Flüsse, Mangroven und dichter Wald verlangen Ausdauer, Orientierungssinn und improvisierte Taktik. Begegnungen mit indigenen Gruppen und wilden Tieren erweitern den Konflikt jenseits der kolonialen Frontlinien und unterstreichen den Survival-Charakter der Episode. Der Anführer beweist Härte und Fürsorge gleichermaßen, während seine Vertrauten die humorvollen, aber kompetenten Gegenakzente setzen. Am Ende stehen erneute Handlungsfreiheit, wertvolle Ortskenntnisse und das Bewusstsein, wie prekär jeder Vorteil in dieser Umgebung ist.
Als entscheidende Wendung tritt eine junge Adlige in die Handlung, die der Korsar unter dramatischen Umständen kennenlernt und in Sicherheit bringt. Zwischen beiden entsteht eine starke, aber gefährdete Nähe, die seine Selbstgewissheit erschüttert. Bald deutet sich ein Zusammenhang mit dem Erzfeind an, der die Tragweite seines Eids neu beleuchtet und das moralische Fundament des Helden prüft. Loyalität gegenüber Gefährten, die Pflicht zur Vergeltung und das Entstehen echter Zuneigung stehen unvereinbar nebeneinander. Salgari inszeniert daraus ein Spannungsspiel zwischen Maske und Identität, in dem Intimität, Geheimhaltung und Herkunftsfragen ebenso bedeutsam werden wie Pulver, Klingen und die Kontrolle über das Meer.
Der Weg zum Höhepunkt führt über eine kühne Operation gegen die befestigte Stadt am See, deren Zufahrten nur bei günstigen Winden und Wasserständen passierbar sind. Mit kleineren, wendigen Einheiten, falschen Flaggen und nächtlicher Tarnung versuchen die Korsaren, Batterien zu umgehen und die Garnison zu überraschen. In dieser angespannten Phase kreuzen sich persönliche und strategische Ziele: Der Gouverneur rückt in Reichweite, zugleich droht die empfindlichste persönliche Bindung des Helden zu zerbrechen. Entscheidungen über Gefangennahmen, Verhandlungen und Rückzug werden zu Prüfsteinen seines Ehrenkodex. Die Konfrontation ist unausweichlich, doch Salgari wahrt die Spannung bis in die letzte Bewegung.
Der schwarze Korsar endet ohne vollständige Befriedung der Gegensätze und bereitet die Fortführung im Antillen-Zyklus vor. Nachhaltig wirkt weniger die bloße Abenteuerlust als die Frage, ob ein absoluter Racheschwur mit menschlicher Bindung, Gerechtigkeit und Selbstachtung vereinbar ist. Salgari zeichnet den Piraten als tragischen, hochkompetenten Taktiker, dessen Größe aus Konsequenz, aber auch aus innerer Zerrissenheit erwächst. Der Roman verbindet maritime Technik, Kolonialkritik in Andeutungen und romantische Überhöhung zu einer Erzählung, die das Bild des edlen Freibeuters prägte. Seine Wirkung liegt in der Spannung zwischen Mythos und Moral, die den Leser über den letzten Kanonendonner hinaus begleitet.
Historischer Kontext
Emilio Salgaris Roman Der schwarze Korsar erschien 1898 in Italien und verlegt seine Handlung in die Karibik des späten 17. Jahrhunderts. Dort prägten das spanische Kolonialreich, rivalisierende europäische Monarchien und maritime Institutionen den Alltag. Die spanische Casa de Contratación kontrollierte den Silber- und Warenverkehr, während Konvois die Flotten schützten. Gegenüber standen Handels- und Eroberungsinteressen der Niederlande, Englands und Frankreichs, gestützt durch Kompanien wie die 1621 gegründete Niederländische Westindien-Kompanie. Zentren wie Tortuga, Port Royal und Maracaibo fungierten als Stützpunkte. Kaperbriefe, Seekriegsrecht und kirchliche wie zivile Behörden strukturierten Räume, in denen Salgari seine fiktiven Piraten agieren lässt.
Die Epoche der Bukaniere und Freibeuter erstreckte sich vor allem von den 1620er bis in die 1690er Jahre. Aus Jägern auf Hispaniola hervorgegangen, formierten sich multinationale Gruppen, die spanische Monopolansprüche herausforderten. Hintergrund waren fast ununterbrochene Kriege zwischen Spanien, Frankreich, England und den Niederlanden, in denen die Seewege zum Nebenkriegsschauplatz wurden. Die spanischen Schatzflotten segelten im Konvoisystem, was gezielte Überfälle begünstigte. Der Vertrag von Madrid 1670 sollte englische Übergriffe eindämmen und die Besitznahme Jamaikas anerkennen, doch die Praxis des Kaperns hielt an. Salgaris Schauplätze und Konflikte spiegeln diese Gemengelage aus staatlicher Lizenz, Beuteökonomie und imperialer Rivalität.
Der venezolanische Raum um Maracaibo bildet einen Kern des Schauplatzes. Der See von Maracaibo ist über eine enge Meerenge mit dem Karibischen Meer verbunden und wurde seit dem frühen 17. Jahrhundert mit Fortifikationen gesichert. Die Stadt war Umschlagplatz für Rinderhäute, Kakao und regionalen Handel; zugleich spielte der niederländische Stützpunkt Curaçao seit 1634 eine zentrale Rolle für den Schmuggel. Die spanische Verwaltung versuchte, diese Verkehre zu kontrollieren, stieß jedoch auf die geographischen und politischen Grenzen der Küste des Spanish Main. Diese Konstellation liefert den historischen Hintergrund für Überfälle, Blockaden und riskante Manöver, wie sie Abenteuerromane dramatisieren.
Zeitgenössische Chronisten wie Alexandre-Olivier Exquemelin veröffentlichten 1678 Berichte über die amerikanischen Seeräuber, die früh moderne Vorstellungen von Tortuga, Port Royal und berühmten Kapitänen prägten. Historisch belegt sind etwa Henry Morgans Unternehmungen gegen Portobelo (1668), Maracaibo und Gibraltar (1669) sowie der Angriff auf Panama (1671). Auch François l’Olonnais operierte in den späten 1660er Jahren gewaltsam an der venezolanischen Küste. Salgari griff auf derartige Quellenkompendien, Atlanten und Reiseberichte zurück und verortete seine fiktiven Figuren in diesem dokumentierten Umfeld. Er selbst bereiste die Karibik nicht, sondern arbeitete aus italienischen Redaktionen und Verlagen heraus mit sekundären Materialien.
Als Salgari schrieb, veränderten sich Italiens Lesegewohnheiten. Nach Einigung und Schulreformen wie dem Coppino-Gesetz von 1877 stieg die Alphabetisierung, und der Massenmarkt für Fortsetzungsromane wuchs. Zeitungen und Zeitschriften publizierten Abenteuerliteratur in Lieferungen, beeinflusst von europäischen Vorbildern wie Dumas und Verne. Verlage in Städten wie Turin und Mailand entwickelten preisgünstige Reihen. Salgari, 1862 in Verona geboren und später in Turin tätig, arbeitete unter hohem Produktionsdruck und belieferte dieses Segment kontinuierlich. Der schwarze Korsar erschien im Kontext dieser populären Kultur, die exotische Räume, Seefahrt und Technikbegeisterung in erzählerisch zugänglichen Formen verbreitete. Übersetzungen verbreiteten seine Stoffe rasch im europäischen Raum.
Rechtlich bewegten sich Freibeuter im 17. Jahrhundert zwischen Kriegführung und Kriminalität. Kaperbriefe erlaubten Privatpersonen, feindliche Schiffe im Namen einer Krone zu kapern; ohne solche Legitimation galten Akteure als Piraten und konnten verfolgt werden. Völkerrechtliche Debatten über freie oder geschlossene Meere – angestoßen durch Grotius’ Mare Liberum (1609) und Seldens Mare Clausum (1635) – prägten die Argumentationen. Der Vertrag von Madrid (1670) und spätere Friedensschlüsse versuchten, private Gewalt zur See einzuhegen, setzten ihr aber erst viel später international Grenzen. Diese rechtliche Grauzone bildet den Hintergrund für Loyalitäten, Befehle, Amnestien und Verratsvorwürfe in Seeräubergeschichten.
Die Gewaltgeschichte der Karibik umfasste Eroberungen, Zwangsarbeit und Sklaverei. Während Spanien seine Küsten und Städte befestigte, nutzten Rivalen und Händler das dichte Netz aus Häfen, Inseln und Riffen für Schmuggel und Raub. Zeitgenössische europäische Diskurse zeichneten die spanische Herrschaft häufig in der sogenannten Leyenda negra besonders negativ; buccanistische Quellen berichten jedoch auch Übergriffe der Freibeuter. Salgaris Gegenspieler, etwa der spanische Gouverneur Van Guld, sind literarische Figuren, die an die Amtsgewalt kolonialer Beamter erinnern, ohne reale Personen zu bezeichnen. Diese Konstellation erlaubt es, strukturelle Konflikte der Epoche zu zeigen, ohne dokumentarische Genauigkeit zu beanspruchen.
Als Abenteuerroman kommentiert Der schwarze Korsar seine Zeit doppelt: Er romantisiert die Hochphase der Karibikfahrten des 17. Jahrhunderts und verarbeitet zugleich Medien- und Lesepraktiken des späten 19. Jahrhunderts. Der Racheeid des Protagonisten – früh im Text etabliert – bündelt Themen wie Ehre, Treue und Gesetzesbruch, die in den historischen Rahmen von Kaperkrieg, kolonialer Ökonomie und konfessioneller Konkurrenz eingebettet sind. Salgaris Werk popularisierte diesen Kontext für ein Massenpublikum, ohne wissenschaftliche Geschichtsschreibung zu sein. Es fungiert damit als kulturelles Scharnier zwischen dokumentierten Ereignissen und literarischer Mythenbildung, die Europas Blick auf die Karibik nachhaltig prägte.
Der schwarze Korsar (Piraten Abenteuer)
Die Flibustier der Insel Tortuga
Inhaltsverzeichnis
Eine kraftvolle Stimme erscholl durch Dunkelheit und Wogengebraus[1q]. Sie rief einem auf den Wogen schaukelnden und sich mühsam vorwärts bewegenden Boote ein drohendes Halt zu. Die zwei Seeleute darin zogen die Ruder ein und schauten besorgt auf den riesigen Schiffsschatten, der urplötzlich aus den Fluten vor ihnen aufgetaucht war.
Beide Männer hatten markante, energische Züge, die durch den dichten, struppigen Bart noch kühner erschienen. Sie mochten wohl über die Vierzig sein. Ihre großen Filzhüte waren an vielen Stellen durchlöchert, und ihre zerrissenen, ärmellosen Wollhemden ließen die kräftige Brust sehen. Der rote Schal, den sie als Gürtel umgeschlungen hatten, war ebenfalls in miserablem Zustand, aber er enthielt ein Paar dicke, schwere Pistolen von jenem Ende des 16. Jahrhunderts gebrauchten Kaliber. Barfuß, mit Schlamm bedeckt, saßen sie in ihrem Kanu.
»Was siehst du?« fragte der eine von ihnen. »Du hast schärfere Augen als ich.«
»Ich sehe nur ein Schiff, kann aber nicht erkennen, ob Freund oder Feind, ob es von der Tortuga oder von den spanischen Kolonien kommt.«
»Nun, wer es auch sein mag – jedenfalls haben sie uns entdeckt, und werden uns nicht entschlüpfen lassen. Ein Kartätschenschuß würde genügen, um uns alle beide zum Teufel zu jagen.«
Jetzt erscholl dieselbe sonore Stimme von vorhin: »Wer da?«
Carmaux, der eine der Bootsleute, stieg auf die Bank und schrie aus Leibeskräften: »Wen die Neugierde plagt, der steige zu uns herab! Unsere Pistolen werden ihm antworten!«
Diese Entgegnung schien den Frager auf der Schiffsbrücke drüben nicht zu erzürnen. Im Gegenteil, er erwiderte belustigt: »Kommt nur herauf, ihr Helden! Die Küstenbrüder wollen euch ans Herz drücken.«
Die beiden Seeleute in dem Boot stießen einen Freudenschrei aus. »Die Küstenbrüder, also Freunde!«
»Das Meer soll mich verschlingen, wenn ich diese Stimme nicht kenne!« fügte Carmaux hinzu, der die Ruder wieder ergriffen hatte. »Nur einer ist so verwegen, bis zu den spanischen Festungen vorzudringen. Der Schwarze Korsar!«
»Donnerwetter! Ja, wirklich, er ist es!« sagte sein Gefährte aus Hamburg, mit Namen Stiller. »Aber was für eine schreckliche Nachricht müssen wir ihm bringen: Daß die Spanier nun auch seinen zweiten Bruder, den Roten Korsaren, an den Galgen gehängt haben! Vielleicht hoffte er, ihn noch zu retten. Wenn er ihn hängen sieht, wird er sich rächen wollen.«
»Und ich glaube, wir sind dabei, Stiller. Der Tag, an dem der verdammte Gouverneur von Maracaibo seine Strafe erleiden wird, soll der schönste Tag meines Lebens sein! Dann werde ich die beiden Smaragde, die ich in meine Hosen eingenäht habe, zu einem Schmause für die Kameraden spendieren. Sie müssen mindestens tausend Piaster bringen!«
Das Schiff, das man in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, befand sich jetzt nur noch ein halbes Ankertau von der Schaluppe entfernt.
Es war eins jener Freibeuterfahrzeuge von der Insel Tortuga, die Jagd auf die großen spanischen Kauffahrteischiffe machten. Letztere wurden oft ihrer Ladung beraubt, wenn sie Schätze aus Mittelamerika, aus Mexiko oder den Gegenden am Äquator nach Europa brachten. Die Flibustier[1]fahrzeuge waren gute, sehr stark bewaffnete Segler mit hohen Masten zur Ausnutzung der leichtesten Brisen. Sie hatten einen schmalen Kiel und ein sehr hohes Vorder- und Hinterteil. Zwölf lange Kanonen ragten mit ihren schwarzen Hälsen an Backbord und Steuerbord drohend empor, während auf der hohen Schiffsschanze zwei dicke Kanonen steckten, bestimmt, die Brücken der anderen Schiffe mit Kartätschenkugeln zu säubern.
Das Korsarenfahrzeug hatte sich back gelegt, um das Boot zu erwarten.
Am Bug sah man beim Lichte einer Schiffslaterne zehn bis zwölf Mann mit ihren Flinten schußbereit stehen.
Die beiden Kanufahrer ergriffen das Seil, das ihnen, zusammen mit einer Strickleiter, zugeworfen wurde, sicherten das Boot und zogen sich nun mit großer Geschicklichkeit in die Höhe.
Zwei Männer streckten ihnen die Flintenläufe entgegen, während ein dritter auf sie zutrat und ihnen mit einer Laterne ins Gesicht leuchtete.
»Wer seid ihr?« fragte er.
»Beim Beelzebub, meinem Schutzpatron!« rief Carmaux aus. »Erkennt ihr eure Freunde nicht mehr?«
»Ein Haifisch möge mich fressen, wenn das nicht der Biskayer Carmaux ist!« rief der Mann mit der Laterne. »Wie kommt es, daß du noch lebst, während man dich auf der Tortuga schon für tot hielt? Was? Da ist ja noch einer ...! Bist du nicht der Hamburger Stiller?«
»In Fleisch und Blut steht er vor dir«, antwortete dieser.
»Auch du bist dem Strang entgangen?«
»Ja, der Tod wollte mich nicht haben. Und ich dachte auch, besser noch einige Jahre leben!«
»Und wie steht's mit dem Kapitän?«
»Still, still«, sagte Carmaux leise.
»Du kannst ruhig sprechen! Ist er tot?«
»Bande, ihr! Seid ihr noch nicht fertig mit Schwatzen?« rief jetzt eine metallisch klingende Stimme.
»Donnerwetter! Der Schwarze Korsar!« murmelte Stiller mit einem Schreckensschauder.
Carmaux dagegen rief laut: »Hier bin ich, Kommandant!«
Der von der Kommandobrücke Abgestiegene schritt auf sie zu. Die Hand hatte er auf dem Kolben der ihm am Gürtel hängenden Pistole. Er war ganz schwarz gekleidet und mit einer Eleganz, die man bei den Flibustiern des Golfs von Mexiko sonst nicht fand. Letztere begnügten sich gewöhnlich mit Hemd und Hose und kümmerten sich mehr um ihre Waffen als um ihre Gewänder.
Der Kapitän trug einen Kasack aus schwarzer Seide, mit Spitzen von derselben Farbe. Die auch aus schwarzer Seide bestehenden Beinkleider wurden durch eine breite, mit Fransen versehene Schärpe zusammengehalten. Hohe Stulpenstiefel und ein großer Schlapphut aus Filz, von dem eine lange, schwarze Feder bis auf die Schulter niederhing, vervollständigten seinen Anzug.
Auch das Äußere des Mannes hatte etwas von ernster Trauer an sich. Das marmorbleiche Gesicht stach seltsam ab von den schwarzen Spitzen des Kragens und der breiten Hutkrempe. Sein kurzer, schwarzer Bart war etwas gelockt und wie ein Christusbart geschnitten.
Es war ein schöner Mann mit regelmäßigen Zügen und der hohen, leichtdurchfurchten Stirn, die dem Antlitz etwas Melancholisches gab. Die kohlschwarzen Augen unter den langen Brauen blitzten zuweilen in einem solchen Feuer auf, daß sie selbst dem unerschrockensten Flibustier Furcht einflößten. Durch seine große, schlanke Gestalt, sein feines Benehmen und die aristokratischen Hände machte er den Eindruck eines Mannes von hoher Stellung. Vor allem merkte man ihm den Befehlshaber an.
»Wer seid ihr, und wo kommt ihr her?« fragte er die beiden Bootsleute.
»Wir sind Freibeuter von der Insel Tortuga, zwei Küstenbrüder«, antwortete Carmaux, »und kommen jetzt aus Maracaibo.«
»Seid ihr den Spaniern entwischt?«
»Ja, Kommandant!«
»Zu welchem Schiff gehört ihr?«
»Zu dem Roten Korsaren.«
Kaum hatte der andere diese Worte vernommen, als er auffuhr und die beiden mit sprühenden Blicken maß.
»Zum Schiff meines Bruders?« fragte er mit bebender Stimme.
Dann legte er einen Arm um Carmaux' Schultern und zog ihn fast gewaltsam zum Heck. Unter der Kommandobrücke wandte er den Kopf zu einem in straffer Haltung stehenden jungen Manne, seinem Oberleutnant.
»Wir wollen immer kreuzen, Morgan! Die Leute bleiben unter Waffen! Gebt mir sofort Nachricht, wenn sich ein Schiff oder eine Schaluppe naht!«
»Zu Befehl, Kommandant!« entgegnete der andere.
Der Schwarze Korsar stieg mit Carmaux in eine kleine Kabine hinunter. Dieselbe war behaglich eingerichtet. Eine vergoldete Lampe brannte, obgleich es an Bord der Piratenschiffe verboten war, nach neun Uhr abends noch Licht zu brennen.
Er wies dem Bootsmann einen Stuhl an und stand bleich, mit verschränkten Armen, vor ihm.
»Jetzt erzähle!« befahl er kurz. »Sie haben ihn getötet, meinen Bruder, den ihr den Roten Korsaren nanntet, nicht wahr?«
»Es ist so«, bestätigte Carmaux. »Sie haben ihn umgebracht, wie früher seinen anderen Bruder, den Grünen Korsaren.«
Ein heiserer, fast wilder Ton kam von den Lippen des Kommandanten.
Er führte die Hand zum Herzen und ließ sich in einen Stuhl fallen, indem er mit der Rechten die Augen bedeckte und laut aufschluchzte.
Dann aber sprang er auf, als ob er sich der Schwäche schämte. Die Erregung, die ihn für einen Moment ergriffen, war überwunden. Die Züge des marmornen Gesichts waren ruhiger, die Stirn freier geworden, aber in den Augen flammte es drohend.
Nachdem er mehrmals in der Kabine auf und ab gegangen, setzte er sich wieder und sagte: »Ich fürchtete schon, daß ich zu spät käme ... Sprich, haben sie ihn erschossen?«
»Nein, gehenkt!«
»Bist du dessen sicher?«
»Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen am Galgen gesehen.«
»Wann war das?«
»Noch heute nachmittag. Aber mutig ist er gestorben, Herr.«
»Rede!«
»Als der Strick ihn umschnürte, hatte er noch die Kraft, dem Gouverneur ins Gesicht zu spucken.«
»Dem Hunde?«
»Ja, dem flämischen Herzog van Gould.«
»Erst hat er einen meiner Brüder durch Verrat getötet und dann den zweiten gehenkt!« Der Kapitän knirschte mit den Zähnen. »Ich aber werde nicht eher ruhen, bis ich ihn und seine ganze Familie vernichtet habe!«
»Ja, es waren zwei der kühnsten Golfkorsaren!«
»Und die Stadt Maracaibo soll meine Rache spüren!« fuhr der Kommandant tonlos fort. »Ich lasse keinen Stein mehr dort, wo sie gestanden. Alle Flibustier der Tortuga und alle von San Domingo und Cuba sollen helfen ...! Erzähle weiter! Wie haben sie euch gefangengenommen?«
»Wir sind nicht mit Waffengewalt besiegt, sondern überrascht und verhaftet worden, weil wir wehrlos waren. Wie Ihr wißt, hatte sich Euer Bruder nach Maracaibo begeben, um Vergeltung zu üben für den Tod des Grünen Korsaren. Wir waren achtzig Mann, alle mutig und zu jedem Wagnis entschlossen. Aber wir hatten das schlechte Wetter nicht in Betracht gezogen. In der Mündung des Golfs brach ein furchtbarer Sturm los, jagte uns wie rasend von Klippe zu Klippe, bis unser Schiff jämmerlich zerschellte. Nur sechsundzwanzig von unseren Leuten gelang es, unter unendlichen Anstrengungen die Küste zu erreichen. Wir hatten keine Waffen mehr und waren auch körperlich in so übler Verfassung, daß wir nicht den geringsten Widerstand leisten konnten. Der Kapitän führte uns durch die Sümpfe am Strande, uns immer Mut zusprechend. Schon glaubten wir, einen Unterschlupf gefunden zu haben, fielen aber statt dessen in einen Hinterhalt. Leider waren wir auf dem gescheiterten Wrack von den Spaniern entdeckt worden. Dreihundert Soldaten, van Gould an der Spitze, umzingelten uns, griffen uns an und töteten alle, die sich widersetzten. Die andern wurden als Gefangene nach Maracaibo geschleppt.«
»Und mein Bruder war unter diesen?«
»Ja, Kommandant! Er hat sich mit dem einzigen Dolch, der ihm bei dem Schiffbruch geblieben, verteidigt wie ein Löwe, da er den Tod im Kampfe dem Galgen vorzog, aber der Flame hatte ihn erkannt! Als wir unter den Mißhandlungen der Soldaten und Beschimpfungen des Volks in Maracaibo ankamen, wurden wir zum Galgen verurteilt. Mein Freund Stiller und ich schienen mehr Glück zu haben als die andern Gefährten. Gestern morgen war es uns beiden in der Haft gelungen, unsern Wächter zu überwältigen und zu entfliehen. Von dem Dach einer Negerhütte, in der wir auf der Flucht Unterkunft gefunden hatten, haben wir das grausige Schauspiel der Hinrichtung eures Bruders und der andern Flibustier mit angesehen. Dann erhielten wir am Abend durch Hilfe des Negers ein Boot, mit dem wir über den Golf von Mexiko nach der Tortuga gelangen wollten. Das ist alles, Kommandant.«
»Wird mein Bruder noch heute am Galgen hängen?« fragte der Kapitän mit dumpfer Stimme.
»Drei Tage lang soll er da bleiben.«
»Und dann wird man ihn in eine Grube werfen?«
»Sicher.«
Nach einer Pause wandte sich der Korsar in verändertem Tone an Carmaux: »Hast du Angst?«
»Selbst nicht vor dem Teufel.«
»Du fürchtest auch nicht den Tod?«
»Nein, Kommandant!«
»Wirst du mir folgen?«
»Wohin?«
»Nach Maracaibo!«
»Wann?«
»Diese Nacht!«
»Sollen wir die Stadt angreifen?«
»Nein, dazu sind wir vorläufig nicht stark genug. Aber später wird Morgan zu diesem Zweck meine Befehle erhalten. Wir beide und dein Kamerad gehen vorerst allein.«
»Was gedenkt Ihr zu tun?«
»Die Leiche meines Bruders holen.«
»Seid auf der Hut, Kapitän! Ihr könntet dabei verhaftet werden!«
»Du kennst den Schwarzen Korsaren nicht.«
»Tod und Teufel! Er ist ja der kühnste Flibustier der Tortuga!«
»Geh jetzt und erwarte mich an der Schiffsbrücke! Ich lasse eine Schaluppe zurechtmachen.«
»Das ist nicht nötig, wir haben ja unser Boot. Das läuft wie der Wind.«
Ein verwegenes Unternehmen
Inhaltsverzeichnis
Carmaux gehorchte sofort, da er wußte, daß mit dem Schwarzen Korsaren nicht zu spaßen war[2q].
Stiller harrte seiner vor der Kajütenluke. Er stand mit dem Obermaat und einigen Flibustiern zusammen, die ihn über das unglückliche Ende des Roten Korsaren und seines Gefolges befragten. Sie entwickelten ihre Rachepläne gegen die Spanier von Maracaibo und besonders gegen den Gouverneur. Als der Hamburger hörte, daß das Boot zur Küste zurückkehren sollte, der man mit Mühe und Not entronnen war, murmelte er: »Dabei werden wir unsere Haut lassen müssen, Carmaux.«
»Bah, wir gehen ja diesmal nicht allein, der Schwarze Korsar fährt mit.«
»Dann hab' ich keine Sorge! Der Satansbruder kommt hundert Flibustiern gleich!«
Hierauf wandte sich Carmaux an den Obermaat: »He, Freundchen, laß drei Gewehre, Munition, ein paar Säbel und etwas Lebensmittel ins Boot legen! Man weiß nie, was einem zustößt und wann wir zurückkehren können.«
»Es ist schon geschehen«, antwortete der Angeredete. »Auch der Tabak ist nicht vergessen worden.«
»Danke, du bist wirklich ein Prachtkerl!«
Jetzt trat der Korsar hinzu. Er hatte noch sein Trauergewand an, hatte sich aber einen langen Säbel umgeschnallt und in den Gürtel ein paar Pistolen gesteckt, dazu einen jener langen, scharfen, »Misericordia[2]« genannten Dolche. Über dem Arm trug er einen weiten schwarzen Mantel.
Er näherte sich dem Vizekapitän Morgan auf der Kommandobrücke und wechselte einige Worte mit ihm. Dann sagte er kurz zu den beiden Flibustiern: »Los!«
Alle drei stiegen ins Kanu. Der Korsar wickelte sich in seinen Mantel und setzte sich an den Bug, während die Bootsleute wieder angestrengt zu rudern begannen.
Das große Schiff, die »Fólgore« Fólgore: Blitz, hatte sofort die Laterne gelöscht und war, die Segel nach dem Winde richtend, dem Boote gefolgt, indem es immer lavierte, um ihm nicht voranzulaufen.
Wahrscheinlich wollte der Vizekapitän seinen Befehlshaber bis zur Küste begleiten, um ihn bei Gefahr schützen zu können.
Der Kommandant hatte sich halb ausgestreckt und den Kopf auf die Hand gestützt. So verharrte er schweigend, aber seine Blicke, scharf wie die eines Adlers, schweiften unablässig an dem noch finstern Horizont entlang. Noch konnte er die amerikanische Küste nicht erspähen. Von Zeit zu Zeit wandte er sich nach seinem Schiffe um, das ihm in einer Entfernung von sieben bis acht Ankertauen folgte.
Stiller und Carmaux ruderten indessen das leichte, flinke Kanu über die Fluten, daß es nur so flog. Beide schienen jetzt ohne Sorge über die Rückkehr nach dem feindlichen Ufer zu sein, so groß war ihr Vertrauen zu der Kühnheit und Tapferkeit des Schwarzen Korsaren, dessen Name allein schon genügte, um alle Küstenstädte des mexikanischen Golfs in Schrecken zu setzen.
Da das Meer in der Bucht von Maracaibo glatt wie Öl war, konnten die beiden Ruderer jetzt schneller vorwärtskommen.
Der Ort lag zwischen zwei Landzungen eingeschlossen, die ihn vor den breiten Wogen des großen Golfs schützten. Da es dort keine steilen Küsten gab, trat selten Flutwasser ein.
Schon ruderten die beiden eine Stunde lang, als der Schwarze Korsar, der sich bisher kaum bewegt hatte, sich plötzlich erhob, um den ganzen Horizont abzusuchen.
Ein Licht, das nicht von einem Stern herrühren konnte, leuchtete in südwestlicher Richtung in minutenlangen Zwischenräumen.
»Maracaibo!« sagte er in dumpfem Ton, der einen innern Grimm verriet. »Wie weit sind wir noch entfernt?«
»Vielleicht drei Meilen«, antwortete Carmaux.
»Also werden wir um Mitternacht da sein?«
»Ja, Kapitän!«
»Liegen Kreuzer vor?«
»Ja, die Zollbeamten!«
»Die müssen wir natürlich vermeiden!«
»Wir kennen einen Platz, Kapitän, wo wir ruhig landen und unser Boot verstecken können. Es sind Sumpfpflanzen dort.«
»Also los!«
»Aber es wäre besser, daß Euer Schiff jetzt nicht so nahe käme, Kommandant«, meinte Stiller.
»Es hat schon gewendet und wird uns draußen erwarten«, entgegnete der Korsar.
Nach einigen Augenblicken des Schweigens begann er wieder: »Ist es wahr, daß ein Geschwader im See liegt?«
»Ja, das des Konteradmirals Toledo, der über Maracaibo bis Gibraltar Wache hält.«
»Aha, haben sie Furcht? Nun, der ›Olonese‹ befindet sich auf der Tortuga. Bald werden wir zusammen das Geschwader in den Grund bohren. Warten wir noch ein paar Tage, dann wird van Gould wissen, mit wem er es zu tun hat!«
Er wickelte sich von neuem in seinen Mantel, zog den Filzhut über die Augen und setzte sich wieder, indem er seine Blicke fest auf jenen glänzenden Punkt gerichtet hielt, der den Hafenleuchtturm anzeigte.
Das Boot nahm seinen Kurs wieder auf. Es wandte den Bug aber nicht der Mündung von Maracaibo zu, da es den Zollkreuzer umgehen mußte, der die Insassen sicher festgehalten und verhaftet hätte.
Nach einer halben Stunde wurde die nur drei bis vier Ankertaue entfernte Golfküste deutlich sichtbar. Das Ufer fiel sanft zum Meere ab. Es war ganz mit Sumpfpflanzen bedeckt, jener Vegetation, die meist an Wassermündungen wächst und das gefürchtete gelbe Fieber erzeugt. Weiterhin sah man unter dem Sternenhimmel dunkle Sträucher, aus denen riesige Blätterbüschel in die Luft ragten.
Carmaux und Stiller hatten die Ruderschläge verlangsamt. Sie näherten sich der Küste, indem sie jedes Geräusch vermieden und aufmerksam nach allen Richtungen ausschauten, als erwarteten sie eine Überraschung.
Der Schwarze Korsar saß schweigend, unbeweglich. Die drei Flinten, die er mitgenommen hatte, lagen zugriffbereit vor ihm, um jedes sich nahende Boot mit einer Ladung Schrot begrüßen zu können.
Es mußte Mitternacht sein, als das Boot inmitten der Sumpfpflanzen und verschlungenen Wurzeln landete.
Der Korsar hatte sich erhoben. Nachdem er die Küste genau beobachtet hatte, sprang er behend ans Land und band das Boot an einen Baum.
»Laßt die Flinten drin!« sagte er zu den beiden Ruderern. »Habt ihr eure Pistolen? Und wißt ihr, wo wir uns befinden?«
»Ja, zehn oder zwölf Meilen von Maracaibo entfernt.«
»Liegt die Stadt hinter diesem Wald?«
»Gerade am Rande desselben!«
»Können wir bei Tag hinein?«
»Unmöglich!«
»Also sind wir zu warten gezwungen.« Hierauf schwieg er, wie in Gedanken versunken ...
»Werden wir meinen Bruder noch finden?« fragte er nach einer Weile.
»Er sollte drei Tage auf dem Granadaplatz hängen!«
»Dann haben wir Zeit. Habt ihr Bekannte in Maracaibo?«
»Ja, einen Neger, der uns gestern das Kanu zur Flucht bot. Er wohnt am Waldessaum in einer einsamen Hütte.«
»Wird er uns auch nicht verraten?«
»Wir setzen unseren Kopf für ihn ein!«
»Gut! Vorwärts!«
Sie stiegen das Ufer hinauf, die Ohren gespannt und die Hände auf dem Knauf ihrer Pistolen.
Der Wald ragte vor ihnen auf wie eine dunkle Höhle: Baumstämme jeder Form und Größe mit ungeheuren Blättern, durch welche man das gestirnte Himmelszelt nicht mehr sehen konnte.
Bogenförmige Lianengehänge wanden sich rechts und links von den Palmenstämmen in tausenderlei Verschlingungen hinauf und hinunter, während am Erdboden unzählige miteinander verwickelte Wurzeln entlangkrochen, welche das Vorwärtskommen der drei Piraten sehr erschwerten. Sie waren gezwungen, weite Umwege zu machen, um einen Durchgang zu finden, oder sie mußten selbst Hand anlegen, um die Hemmnisse mit den Enterwaffen zu zerschneiden. Zwischen jenen tausend Stämmen liefen unstete Lichter hin und her wie leuchtende Punkte, welche ab und zu Strahlenbündel warfen. Bald tanzten sie auf dem Boden, bald im Blätterwerk. Jäh erloschen sie, um sich dann von neuem zu entzünden und wahre Lichtwellen von unvergleichlicher Schönheit zu bilden. Es waren die großen Leuchtkäfer Südamerikas. Bei ihrem Scheine kann man selbst die kleinste Schrift in einer Entfernung von mehreren Metern lesen. Drei oder vier dieser Tiere, in einer Kristallvase eingeschlossen, genügen zur Beleuchtung eines ganzen Zimmers.
Auch andere, wie Phosphor leuchtende Insekten schwirrten in Schwärmen herum.
Die drei Flibustier setzten schweigend ihren Marsch fort. Es war höchste Vorsicht geboten, da sie, außer den Menschen, auch die Tiere des Waldes zu fürchten hatten, die blutgierigen Jaguare und vor allem die Schlangen, besonders die Jararacaca genannten giftigen Reptilien, die man auch bei Tage schwer erkennen kann, da ihre Haut der Farbe der trockenen Blätter ähnelt.
So mußten sie schon zwei Meilen gegangen sein, als Carmaux, der als bester Kenner dieser Waldungen immer voranging, plötzlich stehenblieb und blitzschnell eine seiner Pistolen zog.
»Ist es ein Jaguar oder ein Mensch?« fragte der Korsar, ohne die mindeste Furcht.
»Es könnte ein Spion sein«, antwortete der Bootsmann. »In diesem Lande weiß man nie, ob man den nächsten Tag noch erlebt. Nur zwanzig Schritt von hier ist jemand vorbeigehuscht.«
Der Korsar bückte sich zur Erde und horchte aufmerksam, den Atem anhaltend. Er hörte ein leichtes Blätterrascheln, das aber so schwach war, daß es nur ein äußerst feines Ohr vernehmen konnte.
»Es wird ein Tiger gewesen sein«, sagte er, sich wieder erhebend. »Bah, lassen wir uns nicht so leicht erschrecken!«
Plötzlich blieb er bei einer Baumgruppe mit gigantischem Blätterwerk stehen. Sein scharfer Blick durchforschte die Dunkelheit. Das Geraschel hatte aufgehört, aber ein metallischer Ton, gleich einem tauben Gewehrschuß, drang an sein Ohr.
»Halt, es ist ein Spion hier, der den günstigen Moment abwartet, um hinterrücks auf uns zu schießen!«
»Möglich, daß man unsere Landung bemerkt hat«, sagte Stiller beunruhigt. »Diese Spanier haben überall Späher!«
Der Korsar suchte, mit der Pistole in der Hand, das Blätterdickicht ganz leise zu umgehen. Mit einem Sprung stand er einem Manne gegenüber, der sich im Gebüsch versteckt hatte.
Der Angriff des Korsaren war so ungestüm, daß der Späher, der gegen den Degenknauf des Gegners geprallt war, zur Erde fiel.
Carmaux und Stiller eilten sofort herbei. Sie nahmen ihm das Gewehr ab und setzten ihm die Pistole auf die Brust.
»Natürlich einer unserer Feinde!« sagte der Korsar, sich über ihn beugend. »Wenn du dich rührst, bist du des Todes!«
»Ein Soldat des verdammten van Gould!« rief Stiller. »Ich möchte nur wissen, warum du dich hier versteckst!«
Der Spanier, der von dem Angriff erst ganz verblüfft war, begann sich wieder zu erholen. Er machte Miene aufzustehen. »Carrai!« stammelte er. »Bin ich in die Hände des Teufels gefallen?«
»Erraten!« lachte Carmaux. »So werden wir Flibustier von euch genannt!«
Den andern überlief ein Schauder. Carmaux bemerkte es.
»Hab keine Furcht, Freundchen!« sagte er. »Den Teufelsstrick sparen wir uns für später auf, wenn wir im Freien den Fandango tanzen werden mit einem hübschen, festen Hanf um die Kehle!«
Dann wandte er sich fragend zu dem Korsaren um, der schweigend den Gefangenen betrachtete.
»Oder soll ich ihm jetzt mit einem Pistolenschuß den Garaus machen?«
»Nein!«
»Oder an einen Baumzweig hängen?«
»Noch weniger!«
»Vielleicht gehört er zu denen, die meinen Kapitän, den Roten Korsaren, an den Galgen gebracht haben!«
Bei dieser Erinnerung schoß ein Blitz aus den Augen des Schwarzen Korsaren, aber er erlosch sofort.
»Er soll nicht sterben, weil er uns lebend mehr nützen kann!«
»Dann wollen wir ihn gut binden!« riefen die beiden Piraten.
Sie nahmen die roten Wollbinden, die ihnen seitlich am Gürtel hingen, und drückten die Arme des Gefangenen zusammen, ohne daß dieser Widerstand wagte.
»Jetzt möchten wir auch mal sehen, wie du aussiehst!« sagte Carmaux.
Er zündet ein Stück Lunte an, das er in der Tasche hatte, und näherte sich damit dem Gesicht des Spaniers.
Der arme Teufel mochte kaum dreißig Jahre sein. Er war lang und mager wie sein Landsmann Don Quichote und hatte gleich diesem ein eckiges Gesicht mit grauen Augen und rötlichem Bart. Sein Anzug bestand aus einem Kasack von gelbem Leder, weiten, schwarz und rot gestreiften Hosen und hohen, schwarzen Stiefeln. Auf dem Kopfe hatte er einen Stahlhelm mit einer arg zerzausten Feder, und vom Gürtel hing ihm ein langes Schwert herab, dessen Scheide am Ende verrostet war.
»Beim Beelzebub, meinem Schutzpatron!« rief Carmaux lachend. »Wenn der Gouverneur von Maracaibo mehr von diesen Helden hat, so wissen wir, daß er sie nicht mit Kapaunen füttert, denn dieser hier ist ja mager wie ein geräucherter Hering. Ich glaube, Kapitän, daß es sich gar nicht der Mühe lohnt, ihn zu hängen.«
Der Schwarze Korsar berührte den Gefangenen mit seiner Degenspitze und sagte: »Jetzt sprich, wenn dir deine Haut lieb ist!«
»Die Haut ist schon verloren«, erwiderte der Gefangene trocken. »Ich werde ja nicht lebendig aus Euren Händen hervorgehen. Und wenn ich auch erzähle, was Ihr wissen wollt, bin ich ja doch nicht sicher, den morgigen Tag noch zu erleben.«
»Der Spanier scheint Mut zu haben«, meinte Stiller.
»Durch seine Antwort kann er begnadigt werden«, fügte der Korsar hinzu. »Los, willst du antworten?«
»Nein!« entgegnete der andere.
»Ich habe dir das Leben versprochen!« »Wer glaubt daran!«
»Wer? Weißt du auch, wer ich bin?«
»Ein Pirat!«
»Ja, aber man nennt mich den Schwarzen Korsaren!«
»Bei der heiligen Jungfrau von Guadalupe!« rief der Spanier erblassend. »Ihr hier? Wollt Ihr Euren Bruder rächen und uns alle vernichten?«
»Wenn du nicht sprichst, so werden alle umgebracht! Es soll kein Stein auf Maracaibo bleiben!«
»Por todos santos!« sagte der Gefangene, der sich noch nicht von seiner Überraschung erholt hatte.
»Sprich!«
»Ich bin dem Tode verfallen. Also wozu?«
»Der Schwarze Korsar ist ein Ehrenmann, und ein solcher hält sein Wort«, sprach der Kapitän feierlich.
»Gut, fragt mich aus!«