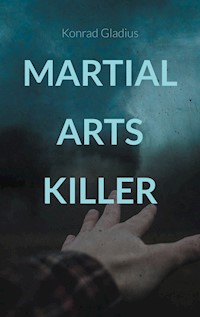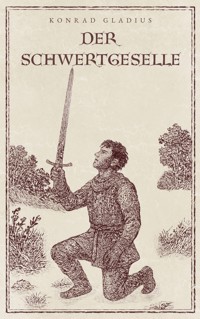
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eigentlich war die Reise, auf die sein Herr und Ludger sich begaben, geradezu alltäglich. Für die Prinzessin sollten Ritter und Knappe zusammen mit einem Dutzend Berittener das Ehrengeleit zu einer Taufe bilden. Doch der heimtückische Hinterhalt eines skrupellosen Feindes kostet viele der Bewacher das Leben. Ludger trauert um den toten Lehrherren und seine durch die Flucht aus der Schlacht verlorene Ehre. Dann erscheint ihm ein Zeichen am Nachthimmel und nur mit des Herren Schwert und seiner Entschlossenheit bewaffnet zieht er los, um die Prinzessin aus den Händen des Schurken zu befreien. Sein Abenteuer gestaltet sich jedoch anders als erwartet, denn nicht jede Fürstentochter verdient es, von einem Helden gerettet zu werden ... "Der Schwertgeselle" ist ein Roman für all jene, welche in die faszinierende Welt des Mittelalters eintauchen wollen. Neben detailgetreuen Beschreibungen der Lebensweise wird so manche mittelhochdeutsche Redewendung von ihren Ursprüngen her erläutert. Kampfkunstautor Konrad Gladius gewährt zudem einen tiefen Einblick in die Kampftechniken des alten Europa, die an Effektivität in der Schlacht fernöstlichen Kriegskünsten allemal ebenbürtig waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ludger
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1 – Ein bedeutender Sieg
Kapitel 2 – Treue, Ehre, Tapferkeit
Kapitel 3 – Ein Zeichen des Herrn
Kapitel 4 – Der Weg des Schwertes
Kapitel 5 – Dem Schurken auf der Spur
Kapitel 6 – Das Schwert eines Ritters
Kapitel 7 – Die Hexe und das Mädchen
Kapitel 8 – Von Recht und Hilfe
Kapitel 9 – Ein ungleiches Gespann
Kapitel 10 – Der Weg der Faust
Kapitel 11 – Eine Prinzessin zu retten
Kapitel 12 – Ein Ritter und sein Pferd
Kapitel 13 – Den Fluchtweg erstreiten
Kapitel 14 – Ein Gefecht der Worte
Kapitel 15 – Quer durch den Wald
Kapitel 16 – In eine Falle tappen
Kapitel 17 – Ein Stück Dorfleben
Kapitel 18 – Die Schwingen des Teufels
Kapitel 19 – Hals über Kopf
Kapitel 20 – Ein bekannter Gegner
Kapitel 21 – Die Barmherzigkeit eines Christenmenschen
Kapitel 22 – Standhaft gegen eine Übermacht
Kapitel 23 – Im Angesicht von Räubern
Kapitel 24 – Ein Geselle, der ein Meister werden will
Kapitel 25 – Das Herz eines Knappen
Kapitel 26 – Eine Lektion in Sachen Minne
Kapitel 27 – Eine Juncfrouwe zu schützen
Kapitel 28 – Gott und die Heilkunst
Kapitel 29 – Die Flucht in ein Patt
Kapitel 30 – Das Urteil Gottes
Kapitel 31 – Duell bis zum Ende
Kapitel 32 – Den Zweck treffen
Kapitel 33 – Nach Recht und Gesetz urteilen
Epilog
Schlusswort
Damatis Personae
Glossar
Über den Autor
Prolog
Blut und Schweiß, das ist der Geruch einer Schlacht. Ihr könnt euch sicher den Klang des Gemetzels vorstellen. Die schrilldumpfen Laute, wenn Stahl auf Stahl trifft. Das Knacken von Holz, aus dem einfache Schilde bestehen, und das helle Splittern der Spieße. Schwerer mag es euch fallen, die Kampfschreie und die gemarterten Todeslaute der Männer zu erahnen. Jenes erstickte Röcheln, wenn ein Brustkorb so durchbohrt wird, dass es seinem Besitzer nicht mehr möglich ist, auch nur den kleinsten Laut aus den Lungen entweichen zu lassen. Erschreckend für mich waren insbesondere die Klänge einer schweren, nicht unmittelbar tödlichen Verletzung. Ein Mann, dem der Arm aufgeschlitzt oder dem das halbe Bein durch einen Schwerthieb abgetrennt wurde, vermag auf eine Art zu schreien, die sich ins Gedächtnis einbrennt. Mit dem Geruch ist dies anders. Es ist so, als würde er ein Teil der Nüstern des Kämpfers. Blut und Schweiß überlagern alles. Weder riecht man noch die Bäume des Waldes oder die Ausdünstungen der Pferde. Selbst die eigenen Exkremente, welche an den Lenden hängen, scheinen jeden Gestank vermissen zu lassen. All das wird überdeckt von dem Odem, der direkt von den Pforten der Hölle auf das Schlachtfeld geweht wird.
Blut und Schweiß klebten an mir wie eine zweite Haut. Sie bedeckten Gesicht, Helm und Wams. Ich vermochte ihnen nicht zu entgehen. Der Geruch der Schlacht war ein Teil von mir geworden. Damals, an jenem Tage, im Sommer des Jahres 1221 nach der Fleischwerdung unseres Herrn. Mochte im Vergleich zu den Kriegen, in denen ich später noch zu fechten hatte, jenes Scharmützel geradezu lächerlich unbedeutend wirken, für mich war es das mitnichten. Niemals wieder sollte ich eine derartige Empfindung von Furcht, Tod und Niederlage wie an diesem vom Willen des Herrn geformten Tag verspüren. Es war die Stunde, in der mein Herr und Ritter im heldenhaften Kampf gegen eine Übermacht fiel. Es war der Augenblick, in dem ich, von Feigheit gepackt, Reißaus nahm. Jener Moment, wo ich den Schwur vergaß und das Versprechen brach.
Ich sah ihn aus sicherer Entfernung. Den Todesstoß mit der Lanze, der meinen Ritter aus dem Sattel hob, nachdem sein Hals durchbohrt worden war. Ebenso musste ich den hünenhaften Feind hämisch lachen sehen, der diesen meisterlichen Stoß ohne Helm geführt hatte. Der Schrecken erfasste die Glieder und ich wurde der eigenen Unvollkommenheit in einer Art gewahr, die mich widersinnigerweise mein baldiges Ende herbeisehnen ließ. Was nützt es schon, ein Feigling zu sein, wenn man sich den Tod wünscht?
***
Doch ich greife den Ereignissen vor. Ihr sollt zunächst einiges über mich erfahren, um zu verstehen, wie ich in eine derart verzweifelte Situation kam. Ihr müsst wissen, dass es der Herrgott mit mir recht gut gemeint hat. Ich wurde im Jahr 1205 des Herrn als zweiter Sohn des Freiherrn Ulrich II. von Reischach geboren. Der Vater benannte mich nach den Heiligen Ludger und Martin. Mit sieben Lenzen schickte er seinen Spross an den Hof des Herzogs von Teck. Auf der Teckburg wurde ich zum Pagen und begann damit meine Ausbildung zum Ritter. War ich zunächst noch gewohnt, von meiner Mutter erzogen zu werden, so übernahmen dies nun andere Wip, wie man zu jener Zeit die Frauen nannte. Die Frouwe, die Herrin des Hauses, sorgte für Zucht und Ordnung auf ihrer Burg. Sie bläute mir und den übrigen Pagen die höfischen Umgangsformen ein. Mehr als einmal gewann ich den Eindruck, dass sie es genoss, Macht über die werdenden Männer zu haben. Ich hatte mich jedenfalls nach feinen Manieren zu richten und den Herzog und die Frouwe bei Tische zu bedienen. Als zukünftiger Ritter sollte ich stets am Guten festhalten, was man Staete nannte und Mâze wahren, also Maßhalten. Das fiel mir wesentlich leichter als der höfische Umgang. Dieser war auf der Teckburg wichtig, denn die Herrschaften waren für ihre Milte bekannt. Gewänder, Pferde, Waffen und Schmuck stoben den Burgherren nur so aus den Händen. Sie zeigten ihre Macht durch Geschenke und Feste, an deren Durchführung wir Pagen mit allerlei Diensten für die Gäste beim Mahle stets beteiligt waren. In meinem Fall nicht immer so, wie es von mir erwartet wurde, denn ich fand an derlei Tun nie eine besondere Freude. Oft verschüttete ich den Wein, vergaß eine Verbeugung oder stieß aus Unachtsamkeit einen Teller hinunter. Doch so manche Maulschelle und Haeue mit dem Stock erleichterten das Lernen.
Das war auch nötig, hätte ich sonst vermutlich nie das Lesen und Schreiben auf eine Art beherrscht, wie es zu meiner Zeit nur einige wenige gebildete Ritter taten. Ebenso blieb für mich eine üble Qual das Französisch und Latein zu erlernen. Die Laute hatte schon bessere Meister gesehen, doch beim Musizieren erfüllte ich meine Pflicht und trug etwas zur Unterhaltung des Hofes bei.
Weniger Motivation benötigte es, um mich für das Reiten, das Bogen- und das Armbrustschießen zu begeistern. Ebenso übte ich mit Feuereifer das Ringen und den Faustkampf. Unübertroffen war ich aber bereits damals mit dem hölzernen Schwert. Schon recht bald vermochte keiner der anderen Pagen hier mit mir mitzuhalten. Das galt zumindest, solange wir ohne Holzschild kämpften. Versteht mich nicht falsch, auch mit dieser wichtigen Waffe vermag ich umzugehen. Doch lediglich mit dem Schwerte in den Händen, Kerl gegen Kerl, als Zweikampf unter freien Männern, da war ich unangefochten. Bisweilen übte ich schon damals stundenlang an dem hölzernen Pfahl an der Seite des Burghofs und hieb die aus Eichenholz gefertigte Klinge wieder und wieder dagegen. Für mich war es, als ob die Zeit stillstand und ich ganz bei mir sein durfte. Die Zeit stand jedoch nicht still und als ich 14 Lenze zählte, gab mich der Vater in die Obhut seines Freundes, des edlen Ritters Wilhelm von Riexingen, und die Ausbildung im Kriegshandwerk begann.
In einem feierlichen Gottesdienst ernannte mich der Priester am Altar zum Schildknappen. Als Zeichen hierfür erhielt ich ein geweihtes Kurzschwert und folgte Ritter Wilhelm von jetzt an auf Schritt und Tritt. Meine Aufgaben änderten sich schlagartig. Nun versorgte ich die Pferde des Rittervaters und pflegte seine Ausrüstung. Ich lernte zudem die Jagd kennen. Es ging auf die Pirsch, die Hetz- und die Treibjagd. Dabei zeigte er mir den dafür notwendigen Umgang mit Hunden und Falken.
An erster Stelle stand jedoch die Übung mit scharfen Waffen. Ich lernte vom Pferde aus zu kämpfen und mit der Lanze umzugehen. Für das Lanzenstechen erwies sich der Schildknappe als nicht besonders begabt. Ritter Wilhelm bezeugte mir, hier fortwährend nur Mittelmaß zu sein. Beim Tjosten auf einem Turnier würde ich, falls ich mich nicht anstrengte besser zu werden, sicher alsbald den Boden küssen, meinte er stets. Doch selbst er kam nicht umhin, von meinen Fähigkeiten mit dem Schwert beeindruckt zu sein. Und so verbrachten wir bald mehr Zeit auf dem Fechtplatz als auf dem Reiterfeld. Durch diese Übungen gewann ich schließlich das Vertrauen des Ritters und er ließ mich sogar auf seiner Türschwelle schlafen, um ihn des nächtens zu bewachen.
Ich war mir sicher, dass mein Herr mich, Ludger Martin von Reischach, zu einem gottgefälligen Rittersmann erziehen würde. Doch dies sollte nicht geschehen. Im entscheidenden Moment versagte mir der Mut und ich vergaß, was die Pflicht gegenüber meinem Herrn von mir verlangte. Ich hatte geschworen ihm zu dienen und seinem Befehl zu folgen. Ebenso war es demnach mir geboten, ihm beizustehen. Ich beraubte mich durch Feigheit damit bereits als Schildknappe aller künftigen ritterlichen Eren und lud schwere Schande auf mich. Das Ansehen des Knappen von Reischach stand in Gefahr, auf immer verloren zu sein. Niemals mehr könnte dieser ein Ritter werden. Doch dann erschien mir der Herrgott und sandte mir ein Zeichen. Von dieser Aventiure, meiner ritterlichen Bewährungsprobe, will ich euch nun berichten ...
Kapitel 1 – Ein bedeutender Sieg
Zu meiner Zeit wussten wir noch genau, wie der Wert eines Weibes gemessen werden musste. In erster Linie entschied ihre Schönheit darüber, ob es sich lohnte, für ein Wip zu kämpfen. Exotische Damen fielen auf und wurden daher von den Herren bevorzugt. Die Tochter eines portugiesischen, bretonischen oder schwedischen Fürsten war allemal eine hervorragende Partie hier in der Mitte des Sacrum Romanum Imperium, des „Heiligen Römischen Reiches“. Mehren konnte eine Frau ihren Wert noch durch die Heirat mit einem mächtigen Mann. Ihr fragt euch sicher, warum ich euch dies erzähle? Das ist recht einfach, weil meine erste Erinnerung an jene Ereignisse von einem Wip bestimmt sind.
Der damals größte und stärkste Schildknappe im Herzogtum hatte mit einer jungen Dame zu tun. Ja, mit dem, was ihr als 1,68 benennt, war ich fast genauso groß wie mein Ritter. Und ich war ebenso breit wie er. Sicherlich würden das dereinst die edlen Fräuleins schätzen. Das wusste ich schon in jenen Tagen und übte mich in der Minne. Aber dieses Weib, von dem ich euch jetzt erzähle, schien direkt aus der Hölle gekrochen zu sein, um die Männer um den Verstand zu bringen.
Es war die Prinzessin Coletta, Tochter des Herzogs von Teck, Konrad I., und ihm sein liebstes Kind. Ihre Mutter stammte von einem bretonischen Fürstenhof, was der Prinzessin mit den langen, schwarzen Haaren den außergewöhnlichen Reiz verlieh, den es benötigte, um den hohen Wert durch ihre edle Geburt passend hervorzuheben. Ja, die 19 Lenze zählende Coletta, die ihre Stellung sehr bewusst lebte, war eine echte Schönheit. Vielleicht sogar das schönste Weib, welches ich je erblicken durfte, und eine Furie, wie ich nie wieder eine erleben sollte. Vermutlich war dies einer der Gründe, warum sie immer noch nicht vermählt worden war.
Schon als Page hatte ich schnell gelernt, mich besser von der drei Jahre älteren Prinzessin fernzuhalten. Wir erzählten uns damals, dass einmal eine Hofdame aus Wut über die Behandlung durch jene Juncfrouwe eine einzelne Erbse unter ihrer Lagerstatt versteckte. Coletta vermochte daraufhin drei Nächte nicht richtig zu schlafen, bis die Erbse entfernt wurde. Später soll sich die Mär, also die Nachricht, über desen Umstand zu einer eigenen Saga, einer Erzählung, geformt haben.
Vom Herzog hatte mein Mentor Ritter Wilhelm den Auftrag erhalten, die immer noch unverheiratete Prinzessin schnellstmöglich zur Taufe ihrer neugeborenen Nichte zu eskortieren. Coletta besaß zwei ältere Schwestern, von denen die Erstgeborene die Kindheit überlebt hatte und nun mit einem Grafen vermählt war. Für gewöhnlich wäre es eine Reise von fünf Tagen zu dessen Stammsitz gewesen, doch wir waren angehalten, es in nur drei Tagen zu schaffen. Länger wollte man nicht auf die Prinzessin warten, damit der weibliche Täufling nicht vor dem Fest der Weiber zum Herrn geholt wurde. Zu meiner Zeit hatten Männer bei einer Tauffeier nichts zu suchen, müsst ihr wissen.
Da, wie gesagt, Eile geboten war, bestand das Geleit der Prinzessin nur aus Berittenen. Ritter Wilhelm und ich hatten noch vier Edelknechte des Grafen, Colettas Schwager, als Unterstützung dabei. Diese hatten die Botschaft von der glücklichen Geburt überbracht. Acht eigene Edelknechte sandte uns der Herzog mit. Bei einem Edelknecht handelt es sich übrigens um einen vollwertigen Reiterkrieger, der selbst keine oder zumindest noch keine Ritterwürde erlangt hat. 14 Mann zu Pferd war schon eine beeindruckende Streitmacht, um die Prinzessin und ihre beiden Hofdamen zu beschützen. Ihr werdet verstehen, dass wir aufgrund dieser Waffenstärke nicht fürchteten, dass einer der Edlen, der mit dem Herzog in Fehde lag, es wagen könnte, sich mit uns zu messen. Unsere Achtsamkeit schwand, da wir ja den Weg schnell zurücklegen wollten. Hinzu kam, dass wir zudem stetig von Nichtigkeiten abgelenkt wurden ...
***
Ich kann mich daran noch heute gut erinnern. Es war ein ausgesprochen heißer Sommertag. Auf der Schimmelstute, die ich ritt, hatte ich den Schild und die Lanze meines Herren dabei und war heilfroh, dass er entschieden hatte, ich möge mein knappes Kettenhemd in der Satteltasche verstauen. Wir waren bereits eineinhalb Tagesreisen vorangekommen und die kurze Mittagsrast lag just hinter uns. Die Stahlhaube mit dem normannischen Nasenschutz durfte ich ebenfalls abnehmen und hatte sie an meinen Sattel gebunden. An jener verästelten Weggabelung schweifte mein Blick gerade über die dicht beisammenstehenden Bäume des Waldes, durch den unser Zug ritt, als ich in meinem Rücken die fordernde, helle Stimme von Coletta vernahm.
„Ritter Wilhelm! Hättet Ihr die Güte, eine Rast zu befehlen“, kommandierte sie.
Ich blickte nach links zu meinem Rittervater, der seinen imposanten, geschlossenen Schlaghelm ebenfalls am Sattel befestigt hatte und jetzt mit den Augen rollte. Ihm ging die Prinzessin zumindest genauso auf den Geist wie mir.
„Euer Hochgeboren, wir sind doch gerade erst wieder aufgebrochen“, sagte der Ritter und versuchte sich dabei, so gut es ging, im Sattel der Juncfrouwe, der unverheirateten Herrin, zuzuwenden. „Wir können unser Ziel nicht rechtzeitig erreichen, wenn wir so häufig eine Rast einlegen.“
Ich ahnte, dass es nun zu einem erneuten Zwist kommen würde. Und ich sollte damit recht behalten.
„Mein Herr Ritter wird sicher bemerkt haben, mit welcher Eile ich aus diesem Grund die Wegzehrung heruntergeschlungen habe“, bekamen wir sofort zu hören. „Die Innereien arbeiten nun auf der Reise sehr gefällig und ich verspüre ein dringendes Bedürfnis, mich zu erleichtern. Ihr wollt doch sicher nicht, dass ich mich hier vom Pferderücken aus entleere?!“
Colettas Worte klangen auf mich wieder einmal wie eine Drohung und es war bezeichnend, dass ihre beiden Hofdamen giggelten wie Magedin, junge Mädchen, es eben tun. Die Reiter von Graf und Herzog hatten schnell gelernt, bei solchen Auseinandersetzungen zu schweigen, nachdem mein Ritter im Auftrag der Juncfrouwe nach einer spitzen Bemerkung meinerseits, es bei mir einmal richtig scheppern ließ. Ja, die Prinzessin hatte schon mehr Rechte als andere Damen in jener Zeit. Das verdankte sie ihrem herzoglichen Vater, dessen Lieblingskind sie nun mal war. Innerlich hoffte ich, dass sie bald einem starken Mann gegeben würde, der sie ordentlich durchbläuen sollte. So wünschte ich es mir.
„Natürlich nicht, Euer Hochgeboren“, fügte sich Ritter Wilhelm in sein Schicksal und befahl dem Zug, an der nächsten Weggabelung anzuhalten.
Eifrig redend ließen sich Coletta und ihre beiden Hofdamen von mir und Edelknechten aus dem Sattel helfen und begaben sich in die nahen Büsche. Während sie ihre Notdurft verrichteten, hörte ich die Kommandos meines Herrn nur zu deutlich:
„Sichert die Wege! Drei Mann an jedem Stück! Seid wachsam!“
Etwas verwirrt ob der plötzlichen Verschärfung schaute ich zu ihm.
„Herr, befürchtet Ihr hier einen Überfall?“, fragte ich.
„Dies ist ein dichter Wald, mein Junge“, antwortete mir Ritter Wilhelm. „Die Burg von Magnus, dem Starken, ist nicht fern. Wir müssen auf der Hut sein, wenn wir keine Überraschung erleben wollen.“
Ich nickte und suchte mit meinem Blick den Wald ab. Doch nicht die geringste, verdächtige Bewegung ließ sich ausmachen. In deutlicher Anspannung hielten wir Wacht.
***
Viel zu lange dauerte die Rast. In aller Seelenruhe begaben sich die drei Wiper schnatternd wie die Gänse wieder zu ihren Pferden und ließen sich in die Sättel helfen. Unser Zug formierte sich neu und wir setzten uns in Bewegung. Ich erinnere mich noch genau, wie ich nach einer Weile ausatmete und das Gefühl einsetzte, dass wir nun in Sicherheit wären. Da sah ich, wie in den Hals des Reiters vor mir ein Armbrustbolzen einschlug, sein Blut spritzte und er von der Wucht des Treffers, ohne einen Laut von sich zu geben, aus dem Sattel gekippt wurde.
Ein Überfall mit Armbrüsten! Solche Schusswaffen wollte die Kirche nur im Kampf gegen Heiden sehen. Was für eine feige und unritterliche Tat. Zugleich jedoch ein Vorgehen mit durchschlagendem Erfolg.
„Zu den Waffen!“, brüllte Ritter Wilhelm. „Ein Hinterhalt!“
Blitzschnell hatten wir unsere Helme auf dem Haupt, jedoch war die Falle bereits zugeschnappt. Während hinter uns schrille Schreie aus Weiberkehlen erklangen, brachen sie um uns herum aus dem Dickicht. Ich kann nicht sagen, wie viele Bolzen zuvor noch geflogen kamen, aber einige der Männer stürzten vom Pferd, bevor die Schlacht richtig begann. Ein Bolzen bohrte sich glücklicherweise in den Schild, als ich diesen meinem Herrn gerade überreichte. Das Geschoss hätte sonst mein Gesicht zerfetzt.
Ich riss mein Kurzschwert aus der Scheide und orientierte mich. Da war ein Waffenknecht des Feindes auch schon herangestürmt. Er führte einen langen Spieß mit beiden Händen und stieß diesen in Richtung meiner Brust. Mit hängender Spitze gelang es mir im letzten Moment, das Kurzschwert gegen den hölzernen Stiel der feindlichen Waffe zu schlagen und den Stoß so von mir weg zu lenken. Dafür musste ich mich im Sattel jedoch so weit zur Seite lehnen, dass ich fast das Gleichgewicht verlor. Dies machte sich der Angreifer zunutze. Mit einem Schritt überbrückte er die Distanz und fasste mit einer starken Linken meinen Gürtel. Sein kräftiger Zug riss mich vom Sattel und ich stürzte in Richtung Waldboden. Ich dankte dem Herrn dafür, dass wir derlei Unglück zu verhindern schon als Pagen immer und immer wieder geübt hatten. So wusste ich mich passend zu drehen und abzurollen und blieb unverletzt sowie kampffähig. Blitzschnell brachte ich die Beine unter mich und katapultierte den Leib in die Höhe. Gerade noch so vermochte ich mit einem Schritt nach rechts dem nächsten Stoße meines Gegners zu entgehen, da kam auch schon im nun einsetzenden Getümmel ein Axtschwinger des Feindes zu mir gestürmt. Das Kriegswerkzeug, welches er schwang, ähnelte einer Barte zum Fällen von Bäumen, nur war der Stiel um einiges Länger und erlaubte ihm somit einen wuchtigen Oberhau, der mir den vermeintlichen Holzkopf spalten sollte. Während ich nach rechts vorne aus seiner Angriffsrichtung wich, schlug mein Kurzschwert, welches ich jetzt mit beiden Händen führte, mit hängender Spitze von unten gegen den Stiel der Waffe. Sein Angriff ging fehl und nun war ich an ihn heran. Ohne zu zögern, hieb ich ihm mit vollem Körpereinsatz die Klinge in die ungeschützte, linke Halsbeuge und spaltete seinen Körper einen guten Spann tief. Sein Blut spritzte in einem Schwall in die Luft und besudelte mir Gesicht, Helm und Wams. Ich verschaffte mir etwas Raum und hatte einen kurzen Moment, um mich erneut zu orientieren.
Der Feind war uns an Zahl und Waffen weit überlegen. Auf einen der Unseren kamen sicherlich drei der Ihren. Auch wenn Ritter Wilhelm sein Langschwert mit der Entschlossenheit des Erzengels Michael auf die Köpfe der Angreifer hinabsausen ließ, so konnte dies nicht verdecken, dass wir auf verlorenem Posten kämpften. Unsere Schar war umstellt und ein Edelknecht nach dem anderen wurde niedergemacht.
Mein kurzer Moment der Orientierung hätte mich aus Unachtsamkeit um Haaresbreite das linke Bein gekostet. Der erste Gegner, welchen das Getümmel abgedrängt hatte, war jetzt wieder bereit und stieß mit seiner Waffe zu. Mit einem kreuzenden Schritt brachte ich das angegriffene Bein aus dem Weg und überbrückte gleichzeitig die Distanz. Mein beidhändig geführter Oberhau trieb dem Feind die Schneide des Kurzschwerts tief in den nur durch Leder geschützten, linken Oberarm. Sein Schreien vernahm ich nur am Rande. Von der Rechten aus gesehen war es ein waagrechter Hau mit der Rückhand, mit dem ich auf seinen Hals zielte. Er nahm jedoch seinen Kopf hinunter, sodass meine Waffe seitlich gegen seinen Helm schlug. Hier musste ein Schmied wohl ganze Arbeit geleistet haben. Zwar drosch ich seinen Kopf wie ein Bauer das Stroh, doch Winkel des Haues und Material meines Schwertes waren offenkundig nicht für diese Rüstung gemacht. Ich vernahm ein metallisches Klirren und Knacken und das Kurzschwert zerbrach. Es war ein Zeichen des Herrn. Er hatte mir jene geweihte Waffe genommen, um mir die Niederlage zu offenbaren. Einen kurzen Augenblick stand ich verständnislos mit der geborstenen Klinge in der Hand da. Ich sah noch, wie zwei Edelknechte vom Pferd geholt und erschlagen wurden. Und dann rannte ich wie ein Hase auf der Flucht vor dem Fuchse.
***
Meine Flucht weg von der Schlacht führte mich in den dichten Wald und einen Hügel hinauf. Einige Hundert Schritte später wandte ich mich mit dem geborstenen Kurzschwert in der Rechten um. Jetzt sah ich ihn. Er war ein Hüne von einem Krieger, fast 1,80 maß er vom Scheitel bis zur Sohle. Auf seinem schwarzen Streitross und mit dem modernen Topfhelm über dem langen Kettenhemd war er eine furchteinflößende Erscheinung. Sein Wappen zeigte einen schwarzen Bären, der mit einem roten Drachen auf blauem Grund kämpfte. Ich kannte jenes Wappen nur zu gut. Es gehörte Magnus, dem Starken. Der Name des Ritters bedeutete für alle Angst und Schrecken, die sich ihm im Kampf in den Weg stellten. Und bedeutend war er für seinen Lehnsherrn, den Markgrafen, der mit dem Herzog in Fehde lag.
Von seinem Platz aus donnerte die tiefe Stimme des Ritters über die Geräusche der bereits abebbenden Schlacht:
„Streckt die Waffen, Wilhelm, wenn Euch Euer Leben lieb ist!“
Ein kalter Schauder rann mir den Rücken hinunter. Nach allem, was man sich über diesen Ritter erzählte, machte er seine Drohungen stets wahr. Seine Mannen ließen in jenem Moment von den wenigen der unsrigen ab, die noch kampffähig waren, und die Schlacht ruhte.
„Stellt Euch mir zum Kampfe, Magnus!“, antwortete die dumpfe Stimme meines Herrn.
Magnus, der Starke, nahm seinen Helm vom Kopf und ließ diesen an einer Kette in seinem Rücken baumeln. Ich sah sein breites Grinsen in dem harten Antlitz mit den Narben und dem schwarzen Vollbart. Er trug noch einen Unterhelm auf dem Kopf, doch offenbar wollte er sich meinem Herrn mit ungeschütztem Gesicht stellen. Hierdurch zeigte er seinen Mut.
Ritter Wilhelm warf sein Langschwert in hohem Bogen in den Wald und es fiel ins Gebüsch. Ich habe erst später verstanden, warum er dies tat. Dann griff er seine Lanze, die hinter dem Sattel meines reiterlosen Pferdes schräg emporragte, und trabte auf den Weg.
Magnus tat es ihm gleich. Beide senkten die Spieße und zielten damit aufeinander. Einen kurzen Moment herrschte Stille in Wald, als alles Lebende den Atem anzuhalten schien, dann preschten sie los. Ein Lanzenstechen Mann gegen Mann ist etwas für ein Turnier oder für eine Heldensaga. In einem Zweikampf sieht man es nicht alle Tage. Wie ich euch bereits erzählte, war ich in dieser ritterlichen Disziplin nicht gerade mit viel Talent gesegnet. Mein Herr vermochte schon so manchen Wettstreit für sich zu entscheiden und galt für mich bis zu jenem Moment als unübertroffener Meister. Eben diesen fand er jetzt in seinem Gegner.
Der feindliche Ritter klemmte seine Lanze fest unter dem Arm an den Körper. Sein Streitross zeigte keinen Moment der Scheu. Es pflügte mit den gewaltigen Hufen den Waldboden. Während Magnus mit dem Schild Ritter Wilhelms Stoß zu seinem Gesicht ablenkte, fand die Lanzenspitze des Feindes ihren Weg an der Wehr meines Herrn vorbei. Direkt unterhalb des Schlaghelms sprengte es das massive Kettengeflecht und durchbohrte den Hals von Ritter Wilhelm. Es hob ihn aus dem Sattel. Wie eine aufgespießte Stoffpuppe glitt der leblose Leib meines Herrn vom Stiel der Lanze hinab. Magnus warf seinen Kopf in den Nacken und lachte, sodass es von den Bäumen widerhallte. Seine Mannen fielen mit lautem Jubelgeschrei in sein Lachen ein. Mindestens zwei der Edelknechte aus unseren Reihen nutzten die Gelegenheit für eine Flucht zu Pferde. Sie hatten, im Gegensatz zu mir, ihre Pflicht bis zuletzt erfüllt. Die Schlacht war verloren.
Jetzt wurde ich gewahr, dass ich die Beinkleider benässt hatte und auch andere Dinge zwischen den Schenkeln klebten. Mein ganzer Leib zitterte und ich war unfähig, mich zu bewegen. Wie ein Tier, das seinem Instinkt folgt, warf ich den bebenden Korpus hinter einen Busch. Aus sicherer Entfernung beobachtete ich durch die Zweige und Blätter hindurch, wie die Prinzessin Coletta und ihre Hofdamen von den Männern des Magnus gefangen genommen wurden. Noch nie hatte ich mich derart hilflos gefühlt, wie in jenem schicksalhaften Moment im dichten Wald.
Kapitel 2 – Treue, Ehre, Tapferkeit
Es war ein Pfahl, an den mich mein Herr stellte. Unsere erste Übungsstunde im Nahkampf, mehr als zwei Jahre vor dem Gemetzel im Wald, begann mit diesem runden Stück Holz im Boden. Wie ein künstlicher Baum ragte es fast zwei Schritt vom ausgetretenen Lehmboden des Übungsplatzes in den Himmel. Der Stamm einer Eiche war hierfür zu dem gut einen Spann durchmessenden Schlagziel geworden. Ich kann mich noch gut an die Worte von Ritter Wilhelm erinnern, als er mit mir vor dem mit Kerben und Dellen übersäten Pfahl stand.
„Höre mir gut zu, Ludger“, sagte er. „Dies ist von heute an dein bester Freund und zugleich dein größter Feind. Du wirst jenes Stück Holz lieben und du wirst es hassen und an beidem wirst du recht tun.“
Ich fixierte mit meinem Blick das mir aus der Pagenzeit vertraute Übungsgerät und versuchte, so gut es mir möglich war, ein ernstes und entschlossenes Gesicht zu zeigen.
„Vor mehr als 1000 Jahren haben die Legionäre des römischen Kaisers genau auf diese Weise ihre Fähigkeiten im Nahkampf erworben“, erklärte Ritter Wilhelm weiter. „Sie führten ihr Gladius, ihr Kurzschwert, zusammen mit einem sehr großen Schild. Monatelang haben sie immer wieder die gleichen Übungen ausgeführt, bis sie für den Einsatz in der Schlacht bereit waren. Behalte das im Geiste, wenn du nun den Kampf mit Schwert und Schild übst.“
Ich nickte und beobachte neugierig, wie mein Herr den Schild und das kurze Schwert ergriff. Er beugte seine Knie, um einen tiefen, sicheren Stand zu erlangen. Dann führte er mit der Linken die Schutzwaffe vor seinen Körper und so hoch, dass er gerade noch über deren Rand zum Pfahl zu schauen vermochte. Seine linke Schulter zeigte auf den Stamm. Jetzt legte er die Klinge des Kurzschwertes auf die Kante des Schilds und nahm seinen Oberkörper leicht nach vorne.
„Dies ist deine kampfbereite Wehr“, schärfte er mir ein. „Du eröffnest nicht mit einem Hau oder Stich, sondern mit einem Stoß.“
Kraftvoll drückte er sich mit dem hinteren, rechten Bein nach vorne, nahm dabei die linke Schulter noch etwas weiter vor und ließ den Schild wuchtig gegen das Holz des Pfahls knallen. Einen einfachen Mann hätte dieses Rammen sicher bereits umgeworfen, dachte ich in jenem Moment.
„Nun folgt der Stich zum Haupt des Feindes“, sagte Ritter Wilhelm.
Er stieß mit der mittlerweile etwas hinter dem Schild lauernden Klinge zu. Dabei bildeten seine Hüfte und der Oberkörper eine Einheit. Er brachte mit ihrer Hilfe die rechte Schulter vor, sodass der Angriff einiges an Wucht erhielt. Der Stamm vibrierte und die Spitze der Waffe drang sogar einen Fingerbreit in das harte Holz ein.
„Jetzt ist dein Feind entweder tot oder deiner gewahr“, führte er weiter aus. „Nun gilt es seinen Stand zu brechen.“
Während er mit dem Schild gegen den Pfahl drückte, ging er leicht mit dem rechten Bein zur Seite und brachte das Linke zurück. Dann schlug er einen Hau von oben kommend unter dem Schild gegen das Übungsholz. Ich konnte einige Späne erkennen, die durch die Luft stoben.
„Das sollte ein Treffer an der Rückseite des Knies sein“, erklärte mein Herr. „Jetzt gilt es den Kampf zu beenden.“
Erneut drückt er fest mit dem Schild gegen den Pfahl und ließ die Paradewaffe tiefer gleiten. Dann kam sein linker Fuß wieder vor und er stieß das Schwert nochmals in das Holz. Man musste mir nicht erklären, dass dies ein Todesstoß gewesen wäre.
Ritter Wilhelm brachte die Wehr hoch und das linke, vordere Bein drückte ihn, unterstützt von einem Stoß mit dem Schild von dem Pfahl weg. Er blieb einen Augenblick mit erhobener Schutzwaffe stehen, auf der wieder die Klinge zum Stich bereit ruhte, und senkte dann beide Kampfeswerkzeuge.
„Das ist deine Übung, mein Knappe“, befahl er und schaute mir dabei genau in die Augen. „Führe es einige Tausend Male aus und man kann mit dir etwas anfangen.“
***
Wie ich euch bereits sagte, habe ich schon in der Pagenzeit den Umgang mit Schwert und Schild erlernt. Zumindest glaubte ich das. Mit den leichten Holzschilden und den ebenfalls aus gewachsenem Material geformten Waffen hatte ich etliche Stunden pro Tag und Woche geübt. Doch jetzt, mit echtem Kriegswerkzeug, für die Hände eines Mannes geschmiedet, war dies etwas vollkommen anderes. Bald atmete ich schwer und die Schultern schmerzten, aber Ritter Wilhelm kannte kein Erbarmen bei den Exerzitien.
„Schone dich nicht, mein Knappe!“, brüllte er, wenn ich im Eifer nachzulassen drohte. „Die Legionäre zur Zeit der Fleischwerdung unseres Herren hatten einen viel schwereren Schild und auch ihr Gladius war schwer. Sei fest in deinem Willen zum Sieg und lasse dich nicht von einem Stück Holz bezwingen!“
Ja, mein Herr wollte, dass ich tapfer werde. Wie das Wort, das „fest“ oder „schwer“ bedeutet, schon sagt, sollte ich unüberwindlich werden. Der Entschluss dazu musste in meinem Geiste reifen. Um dies zu unterstreichen half ihm ein geschnitzter, fingerdicker und armlanger Stock, den er bei sich führte. Insbesondere wenn ich beim Zurückweichen die Arme gar zu rasch sinken ließ, traf mich dieser mit großer Wucht und Wirkung am Kopf, Rücken oder Gesäß. Der Fürsorge meines Herrn sei es gedankt, dass er bei Haeuen auf mein Haupt nicht die ganze Kraft seiner Arme hineinsteckte. Die Schmerzen lehrten mich schneller als jedes mahnende Wort, dass ich kampfbereit bleiben musste, selbst wenn ein Feind vermeintlich schon besiegt schien. Für diese Lektion bin ich noch Jahrzehnte später dankbar gewesen, bewahrte sie mich doch mehr als einmal vor dem Tode.
***
Es kam der Abend jenes ersten Tages am Pfahl, an dem ich meinem Herrn die folgende Frage stellte:
„Herr, was zeichnet einen wahren Ritter aus?“
Ich war mir bewusst, dass meine Frage ungewöhnlich sein musste. Immerhin war ihre Antwort etwas, das mich schon am Anfang der Erziehung zum Ritter als Page tagtäglich begleitet hatte, ohne dass ich bereits in der Waffenausbildung als Schildknappe gewesen wäre. Ritter Wilhelm blickte mich daher zunächst recht verwundert an.
„Warum fragst du das, Ludger?“, kam seine Gegenfrage. „Hat dies dir noch niemand gesagt?“
„Doch schon, Herr“, antwortete ich wahrheitsgemäß. „Ich habe die Antwort bisher nur von einer Frouwe an einen Knaben bekommen und sehne mich nun nach der Antwort von meinem Rittervater als einem Mann.“
Ritter Wilhelm lächelte und schüttelte dabei den Kopf.
„Das ist weise und zugleich anmaßend von dir, Ludger“, sagte er und ich befürchtete schon weitere Haeue, doch dann erfüllte er meine Bitte. „Ein wahrer Ritter missachtet nie die Triuwe und strebt nach Ere. Deshalb trachtet er danach, in seinem Denken und Tun tapfer zu sein. Das Ansehen seiner Mage, also seiner Eltern und aller Ahnen, ist ihm heilig. Ebenso wie seine eigene Ere. Dafür gilt es immer zum gegebenen Wort zu stehen und jeden Eid einzuhalten. Insbesondere dem Lehnsherren ist er verpflichtet, bis zum Tode treu beizustehen. Hierzu muss er fest im Willen und Glauben sein. Wanken und Weichen sind für den tapferen Recken ein Graus. Lebe nach diesen Regeln und du wirst ein wahrer Ritter sein.“
Damit hatte mein Herr alles gesagt. Die Formel schien so einfach: Sei ehrenvoll, treu und tapfer! An diese Weisung erinnerte ich mich mehr als zwei Jahre später im Wald. Ich erkannte, wie schwer es in Wirklichkeit war, jene Worte mit Leben zu erfüllen.
Kapitel 3 – Ein Zeichen des Herrn
Das Fleddern von Leichen ist eine Tätigkeit, die zum Recht des Siegers gehört. Für einen Ritter ist es unwürdig, dieses Anrecht selbst auszuüben. Dafür hat man Niedere in den eigenen Reihen, welche die Schinderarbeit verrichten. Dennoch behagt es mir auch heute, nach unzähligen Schlachten, immer noch nicht, wenn es jemand tut. Das hängt sicher mit jenem Anblick zusammen, den ich damals im Wald hatte. Die Waffenknechte von Magnus, dem Starken, hielten sich nicht mit dem Federlesen auf. Sie raubten den Erschlagenen alles, was nicht niet- und nagelfest war. Unter dem „Federlesen“ verstanden wir übrigens die Sitte, höhergestellten Menschen Federn und was sonst noch so in der Luft herumschwirrte von den kostbaren Gewändern zu klauben.
Mein toter Herr und die totgeschlagenen Edelknechte mochten nicht viele Münzen bei sich gehabt haben, jedoch war ihre Bewaffnung und Rüstung, darunter die Schwertscheide meines Rittervaters, von Wert. Am wertvollsten waren die drei adligen Mädchen. Diese giggelten mit einem Male nicht mehr so wie auf der Reise, sondern senkten den Blick und schwiegen. Dem gegebenen Wort nach hatten sie von Magnus und seinen Mannen nichts zu befürchten. Das verkündete er ihnen gegenüber deutlich. Ein Übergriff hätte die Fehde nur weiter angeheizt und vielleicht das Lösegeld geschmälert. Dennoch waren Coletta und ihre Hofdamen nicht erpicht darauf, die Schar von fremden Waffenträgern zu provozieren. Es mochte fast eine halbe Stunde vergangen sein, bis sich der Zug des Siegers mit reicher Beute vom Platz des Überfalls entfernte. Ich wartete noch einmal so lange, bis ich mich aus meinem Versteck wagte.
***
Ich steckte das zerbrochene, geweihte Kurzschwert in den Gürtel und stolperte mit wankenden Beinen zum toten Leib meines Herrn, den die Angreifer achtlos an den Wegesrand geworfen hatten. Allein diese ungewöhnliche Tat, die Magnus, dem Starken, die Aussicht auf ein Lösegeld für den Leichnam verwehrte, sprach von deutlicher Verachtung.
Sie gingen sicher davon aus, dass alsbald Truppen des Herzogs hierherkommen und die Toten bergen und dieses Zeichen verstehen würden. Das mochte zwar stimmen, aber es konnte unbenommen großer Eile dauern, bis hier die ersten Reiter eintreffen würden. Es musste bis dahin ausgeschlossen werden, dass ihn oder einen der Edelknechte ein wildes Tier holen könnte.
Ich fiel vor dem Leichnam meines ritterlichen Herrn auf die Knie. Trotz aller Stärke, zu der ich erzogen wurde, ergriff große Trauer mein Herz und die Augen füllten sich mir mit Tränen. Es dauerte einige Herzschläge, ehe ich mich so weit gefangen hatte, dass ich den blutüberströmten Leib zu einer Stelle des Weges zu ziehen vermochte, die mir geeigneter für das Warten anmutete. Dort bettete ich Ritter Wilhelm mit zerrissenen Kleidungsteilen in einer Art, die mir für ihn würdiger erschien. In ähnlicher Weise verfuhr ich mit den übrigen Gefallenen. Nach dieser Arbeit nahm ich einen zurückgebliebenen und von Blut benetzten Wasserschlauch und trank gierig einige Schlucke, so als ob ich der Wüste im Heiligen Land entkommen wäre. Dann setzte ich mich auf meinen verschmierten Hosenboden in die Nähe der Toten und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
Die Gedanken begannen zu kreisen. Würde mich jemand unter Eid fragen, wie der Kampf abgelaufen wäre, so müsste ich gestehen, aus Panik viel zu früh geflohen zu sein. Nun gehörte ein Schildknappe zwar an den Rand des Schlachtfelds, jedoch durfte er bei einem Überfall weder Tod noch Teufel fürchten. Die Pflicht verlangte von einem Knappen, tapfer zu sein. Ich hatte durch meine Flucht versagt. Das geborstene Kurzschwert war nur eine Ausrede. Ich trug zudem einen Dolch mit mir und die erschlagenen Feinde hatten ebenfalls Waffen für mich mitgeführt. Vielleicht wäre es uns sogar gelungen, das Blatt zu wenden, wenn ich nur entschlossen weitergekämpft hätte. Zumindest wäre es ruhmreicher gewesen, kämpfend in der Schlacht zu fallen, als jetzt mit nassen Hosen hier zu sitzen. Die Pflicht gegenüber dem Herzog, Prinzessin Coletta und Ritter Wilhelm blieb durch mich unerfüllt. Meine Versprechen waren gebrochen. Der Schildknappe Ludger Martin von Reischach hatte auf ganzer Linie versagt und sich für die Würde eines Ritters bis in alle Zeiten als nicht befähigt erwiesen. Vermutlich durfte ich noch darauf hoffen, in ein Kloster gegeben zu werden, um als Mönch meine Schuld vor Gott durch ein Leben in Kontemplation abzubauen. Die Gedanken marterten mich und so kauerte ich etliche Stunden auf dem Waldboden.
***