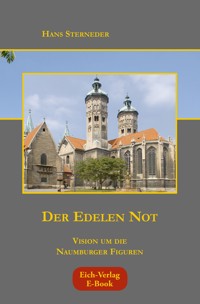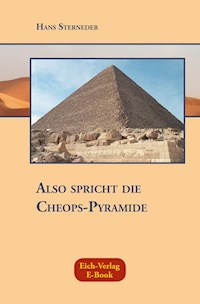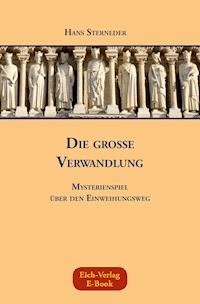12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klaus Einsiedel ist der uneheliche Sohn einer Bauernmagd und eines Rittergutsbesitzers. Er wächst auf in der Tagelöhnerhütte seiner armen Großmutter, doch mit siebzehn Jahren übersiedelt er auf das Schloss des reichen Großvaters und wird hineingestellt in die strahlend kultivierte Atmosphäre seines Vaterhauses. Ihm wird nicht nur die Geborgenheit seiner endlich vereinten Familie zuteil, er verkehrt nun auch in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Er taucht ein in die berauschende Welt der Künste und saugt die Schönheiten von Dichtung, Musik, Malerei und Architektur in seine Seele. Glück, Freude und Seligkeit bestimmen sein Leben. Doch dann wendet sich sein Schicksal erneut. Hans Sterneder bezeichnete diesen Roman als seine genaue Lebensgeschichte. Mit der ihm eigenen Sprachschönheit erzählt der Dichter von den Ursprüngen seines späteren Künstlerlebens. Ein Roman voller Anmut und Liebreiz. Ein Hochgenuss für jeden Sterneder-Liebhaber und jeden Literaturbegeisterten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Sterneder
Der seltsame Weg
des Klaus Einsiedel
Roman
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2018
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2010
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlagfotos: © clearlens - Fotolia.com / © Fyle - Fotolia.com
Umschlaggestaltung, Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-47-2
Meiner lieben
Marianne Streuer
zur Erinnerung
an schöne Zeiten
Erstes Kapitel
Der große Bauernhof ist wie ausgestorben. Kein Mensch, kein Laut weder im Hof noch hinten im Garten. Der Hund liegt schlafend in der schattigen, kühlen Toreinfahrt, die buntscheckige Katze döst mit abwesenden Augen auf ihren eingezogenen Pfoten auf der Hausbank. Selbst der alte Hahn steht wie dumm zwischen seinen Hennen. Wie flüssiges Gold rinnen die Sonnenstrahlen über den dicken aufgebauschten Halsschmuck seines lichtgelben Gefieders.
Nur die zwei uralten Lindenbäume, die im weiten vierkantigen Hof zwischen der Haustür und dem hohen Misthaufen stehen, scheinen mit der sengenden Glut zufrieden, denn es strömt ein derart honigsüßer Duft aus ihren bräutlichen Kronen, dass das ganze Gehöft schwer davon ist.
Fünfhundert Jahre stehen sie auf dem Hof, verschwenden sie ihren Duft, schenken sie ihren Honig, heilen sie mit ihren Blüten die Gebresten von Herrenleuten und Gesinde.
Sie und der riesige Holderstrauch, der hinten an der Mauerwand beim großen, blauen Scheunentor steht. Aber sie sind viel älter. Sie sind so alt wie das Gehöft. Der Stammvater des Hofes, der auf dem Rodland den ersten Stein zu dem Haus gelegt, hat auch sie in die Erde gepflanzt. Damals, als sie ganz zarte junge Reiser waren. Aber das ist lange her; auch für Lindenbäume.
Doch darum fragen sie heut nicht. Es ist wieder einmal so weit, dass sie zum Platzen überschüttet mit Blüten, zum Sichverlieren voll Liebe sind.
Das muss auch die Magd Magdalena Thormayr in ihrem Blut fühlen, denn ihr Fenster ist weit offen und die ganze Kammer betäubend voll mit der betörenden Süßigkeit des starken Duftes.
Immer wieder hält sie inne und streicht mit der Hand über das Auge und die Schläfe.
Über die Schläfe der Magdalena Thormayr hätte so mancher Bauernsohn und Knecht brennend gern gestrichen, und sogar der eine und der andere reiche Großbauer hätte um die Liebe und den Besitz dieser Magd sein angetrautes Weib und seine Ehre gelassen. Aber Magdalena Thormayr hat trotz ihrer blühenden Jugend die Blicke alle nicht gesehen und die heißen und begehrenden Worte nicht gehört.
Viele Jahre sind so hingegangen. Viele Jahre. Freudenreiche Jahre erst; o ja, mein Gott, so freudenreich! Kummervolle Jahre dann und Notjahre; warum soll sie es nicht bekennen! Sie war ja so jung und gesund. Sagten die Mannsleute ihr nicht aberhundertmal, dass sie wie Milch und Blut sei! Und die Kühneren, dass sie nachts sie sich im Bett wünschten. Und wenn sie sich manchmal, sonntags vor dem Kirchgang, vor den Spiegel gestellt und betrachtet hatte, dann konnte sie selber ganz traurig werden. Und hin und wieder stieg ihr der Jammer bis in die Kehle, dass sie sich auf den Bettrand setzen oder auf das Linnen werfen und wild aufschluchzen musste. Denn ihr Blut war so stark. So stark, dass die andern Mägde und die Bauerntöchter des Dorfes, wenn sie elend waren, sagten: „Komm, Magdalena, setz dich neben uns, dann wird uns leichter!“
Sie wusste nicht, was es war, und auch die andern hatten keine Erklärung dafür. Aber es war so: Wenn Magdalena Thormayr neben einen Kranken sich setzte, so wurde er gesund.
„Das ist, weil sie so schön ist“, sagten die Männer.
Doch auch die kranken Tiere, die sich sonst lautlos verkrochen, drängten hilfesuchend an sie, wenn sie es nur irgendwie erreichen konnten. Vollends unklar aber blieb ihr, wieso auch Topfpflanzen sich unter ihrer Pflege sichtlich erholten und rasch zu neuem Lebensmut kamen, die schon auf und daran gewesen, dürr zu werden.
Die seltsame Magd wusste nur, dass ihr ganzer Körper so heiß war, dass sie selber oft erschrak.
So gingen die Sommer und Winter, einer um den andern, dahin; dahin über das Dorf und die Feldbreiten. Die Mägde heirateten, die Burschen kämpften mit ihrem Herzgram und warfen sich dem Trunk, der Schwermut oder einem Frauenzimmer in die Arme.
Und auch über sie ging die Zeit. Aus dem zwanzigjährigen Mädchen war längst eine Dreißigerin geworden, und immer noch waren das Morgenlicht und der Schein des Mondes ihre einzigen Liebhaber.
Aber die Schönheit war ihr geblieben. Sie war so schön geworden in ihrer prangenden Reife, dass die Männer sagten: „Nun ist sie noch begehrenswerter wie als Mädchen!“
„Du hast leicht lachen!“, sagten die Bauern weit aus dem Gau herum, wenn sie mit dem fünfzigjährigen Matthias Haiderer zusammentrafen, der seit zwei Jahren Witwer war.
„Du hast die leibhaftig’ Medizin für Leib und Seel auf deinem Hof!“
Und er, verzagt: „Was hilft dir die best’ Medizin, wenn du sie nicht trinken kannst!“
Ja, sie wusste, wie sehr der Bauer sie zu seinem Weibe begehrte, sie sah seinen Ernst, fühlte seine Liebe und wurde nachts, wenn sie auf ihrem Lager lag und die Einsamkeit ihres Lebens sie überfiel, gepeinigt von den Vorstellungen, dass sie die reichste Großbäuerin des Ortes werden könnte. Weibtum und Einsamkeit wüteten oft derart in ihr, dass sie vor Not in das Kopfpolster biss oder aus dem Bette sprang, nach dem Kruzifix griff, das ihr Vater selig in der Sterbestunde geküsst, und sich mit nackten Knien auf die roten ausgetretenen Bodenziegel warf und zu beten begann, dass es nur so über ihre Lippen strömte. Inbrünstig drückte sie dabei immer wieder das Kreuz an ihr heiß pochendes Herz, und der Heiland und die gute Mutter Gottes erhörten sie jedes Mal. Wie ein Stein fiel sie dann ins Bett.
Tagelang aber ging sie wie eine Traumwandlerin umher.
O Gott, wie konnte das Leben doch schwer sein! Und sie betete zum Herrgott, er möge alle Not von ihr nehmen und sie hässlich und vor der Zeit alt werden lassen. Gott aber schien sich gerade an ihrer Schönheit und Gesundheit besonders zu freuen, und so musste sie weiter leiden und kämpfen; denn der redliche Bauer harrte und warb geduldig weiter um sie.
Sie, die in der Einfalt ihres reinen Gemütes nicht wusste, dass Gott immer verzeiht, wo etwas aus Liebe geschah, trug schwer unter ihrem Leben und wähnte, er habe ihr ihre einstige Sünde immer noch nicht vergeben. Das gab ihr eine gewisse Scheu, ein versunkenes Nachinnengekehrtsein. Aber es schien, als ob gerade dies Ungewollte eine ganz besondere Anziehung auf die Männer ausübte, so dass manche von ihr wie besessen wurden.
Sie aber konnte und konnte all dem Werben nicht nachgeben.
So aussichtslos ihre Hoffnung auch längst geworden war – mein Gott, warum musste gerade ihr das geschehen –, sie wartete und wartete.
Wartete mit der Kraft der Verzweiflung, der ganzen Macht der Hoffnungslosen.
„Schau, Leni, es hot jo doch koan Weart meahr … Find’ di’ drein! Gib noch!“, hatte ihr die Mutter das letzte Mal wieder zugeredet, als sie in großer Herzensbekümmernis mit ihr geredet.
„Muadda, i’ koun ’hn net loss’n“, hatte sie darauf schluchzend entgegnet. „Du woaßt jo, wia guat ear sei’ Lebtog za miar g’west is!“
„Dös is jo woahr, da Hearrgood woaß’s, oba was hülft’s diar denn!“ Und heftig auffahrend: „Da Olte gibt jo dou’ sei’ Leb’n long net noch! Dear is wiar a Stoan!“
Und Klaus, der danebengesessen, hatte bei diesen Worten der alten Frau die Fäuste geballt, dass die Knöchel fast aus der Haut sprangen.
Ja, er hasste den Alten, hasste ihn derart, dass die Magd darüber geradezu erschrak, wenn sie diesen Hass in seinen Augen sah.
Sie aber konnte den Alten, der in seinem unerbittlichen Stolz ihr ganzes Leben zerstörte, nicht oder doch längst nimmer hassen. Sie hatte ihn längst begreifen, verstehen gelernt – wenn auch mit tausend Wunden! … Sie war ja doch nur eine Magd! Eine ganz gewöhnliche Bauerndienstmagd war sie!
Aber so sehr ihr das auch bewusst war und zugleich die Unerfüllbarkeit ihrer Sehnsucht, mit dem vereint zu sein, den sie liebte und dem sie in ihrem unbewussten Heldentum ihr ganzes Leben hinopferte – sie konnte nicht anders! Sie wartete und wartete. Und wenn sich ihre Sehnsucht auch bis in den Tod nicht erfüllte, so wollte sie bis in den Tod treu bleiben! Treu ihrer Liebe.
Da kam heute am Sonntagmorgen der Briefträger mit einem Eilbrief auf den Hof. „Für Magdalena Thormayr“ hat er gerufen, und die Stimme des alten Landboten hat ihr derart ins Herz geschlagen, dass ihre zuckende Hand den Melkeimer umstieß. Denn sie hockte gerade an einer Kuh, den Kopf mit dem bunten Tuch an die Weiche des Tieres gepresst.
Bebend nahm sie den Brief. O du mein Gott, es war seine Schrift! Seine heißgeliebte kleine, zarte, ein wenig zittrige Schrift!
Schwankend wie eine Betrunkene war sie dem Stall zugetaumelt, dass die Holzschuhe laut aufklapperten.
Als die weißhaarige Mutter des Hofbauern nach geraumer Weile in den Stall kam, weil die Magd die Milch heute nicht in die Küche brachte, fand sie diese wie geistesabwesend im Winkel beim Kälberverschlag auf dem Stroh sitzend, steil an die Mauer gelehnt, die Faust mit dem Brief im Schoß liegend. Aus ihren Augen rannen Tränen um Tränen. Die Greisin legte die Hand auf ihre Schulter, doch die Magd nahm es nicht wahr. –
Und nun, die Turmuhr hat eben zuvor die dritte Stunde geschlagen, steht Magdalena Thormayr in ihrer Kammer und nestelt sich ihre besten Kleider an den Leib. Sie putzt sich geradezu heraus, schlingt um den Hals die breite fünfreihige Granatkette mit der breiten goldenen Perlenschließe, die er ihr als Allererstes zu ihrem Namenstag geschenkt, legt sorgfältig das kostbare zinnoberrote Fransentuch mit den reichen Blumenstickereien, das er ihr vor nun fast sechzehn Jahren gebracht, um ihre runden, festen Schultern, aus denen ein so wundervoller Nacken wächst, dass Maler ihn gesucht haben würden. Greift noch einmal prüfend an die zöpfegebändigte Fülle ihres kastanienbraunen, glänzenden Haares, das in ein paar allerliebsten Ringeln von der glatten, klaren Stirne nach den Brauen strebt, als wollte es die rehbraunen Augen liebkosen, und langt dann aus der Schublade ein schneeweißes Taschentuch. Hüllt in dieses sorgfältig den Brief und nimmt dazu, sie tut es ohne zu denken, das Gebetbuch, und so, zum Gehen fertig, steht sie wieder wie angewurzelt in der Kammer. Ihre Augen sind ganz nach innen gekehrt. Nur das Atmen ihres vollen Busens verrät, dass Leben in ihr ist.
Oh, und wie viel Leben in ihr ist! So viel, dass sie vor Freude und Erregung darüber fast erstarrt!
Mit einem Ruck liegt sie in den Knien vor dem Muttergottesbild am Kopfende ihres Bettes, und über ihre bebenden Lippen stoßen statt eines Gebetes immer nur die nämlichen Worte:
„Mein Good, o du mein Good, is ’s denn woahr! Dearf i’ ’s denn glaub’n, dearf i’ ’s denn wiarkli’ glaub’n!?“
Und die Hände hochhaltend zum Bild:
,,O du heilige Muadda Maria, du gnad’nreiche Füarbittarin, so host du mei’ Fleh’n wiarkli’ earhört!“
Nach einem tiefen Neigen ihres Kopfes erhebt sie sich von den Fliesen.
Wie sie aber über die Schwelle ihrer Kammer schreitet, legt sich eine Verklärung über ihr Antlitz, wie wenn sie in den Armen eines Geliebten läge.
In der großen, geräumigen Küche sitzt die Greisin im Lehnstuhl beim Geranienfenster und liest mit der Brille auf der Nase im Gebetbuch.
„Na, Leni, du host di’ jo heut’ außaputzt grod orndli’ wiar a Braut!“, meint die Alte wohlgefällig.
„Jo mei’, ’s kunnt jo leicht sei’, Groußmuadda!“, entgegnet das Mädchen mit einem strahlenden, kinderglücklichen Lächeln, wie es die Alte all die langen Jahre an ihr nicht gesehen. Ein brennendes Rot liegt auf ihren Wangen.
„I’ kimm valleicht heit’ spod z’ruck, Groußmuadda; oba d’ Seffi mocht’ d’ Oarbat füar mi’!“
Die Alte nickt. „Gehst zu deina Muadda ummi?“
Die Magd bejaht.
„Na, nocha grüaß’ ma s’ olle zwoa schön! Kimm guad wieda hoam!“
Aufmerksam blickt die Greisin dem Mädchen nach über den Hof.
Lang sinnt sie zwischen den grellroten Blüten durch in die bienendurchsummten goldgelben Kronen der alten Linden hinein.
Zweites Kapitel
Mit hurtigen Schritten geht die Magd durch das Dorf. Beim letzten Haus, wo der weißköpfige Flickschuster Anselm Ramauf mit seinem Stelzfuß in der Sonne hockt, erwarten sie die alten Kirschbäume mit ihrem knallroten funkelnden Lachen in den breiten Kronen. Eine ganze Weile gehen die großen fruchtschweren Bäume mit der Magd, sind schweigsam und halten ihre breiten schattigen Schirme über den Scheitel der Schreitenden. Aber Magdalena Thormayr merkt heute nicht den Liebesdienst der alten Freunde.
Draußen im Feld liegt die Sonne wie ein brennendes Scheit. Leise gehügelt dehnt sich die weite Flur.
Keine Seele in den Dörfern ringsum weiß mehr, dass hier unzählige Gräber des Bronzemenschen liegen. Besonders das Dorf jenseits der Hügelkapelle im Kessel steht auf einer einzigen Gräberstätte. Der alte Bauer Georg Altmaier ist vor einem halben Jahrhundert beim Graben eines Kellers auf Krüge, Scherben und Knochen gestoßen. Aber Altmaier ist ein schwerfälliger Mensch und hat die schöngeränderten Schalen zerschlagen und das Skelett mit seinen schweren Bauernstiefeln zertreten. Nur die große Steinplatte hat er beachtet. Feierabends sitzt er mit seinen Enkelkindern auf ihr an der Hausmauer. Der einzige, der von den Dingen weiß, ist der uralte Schäfer Wendelin Osterloh. Aber der redet nicht. Was tot ist, soll seinen Frieden haben!
Fern stehen ringsum die Berge. Sie wissen mehr von all dem. Sie haben das alles gesehen einst. Wie die Urmenschen hier hausten; wie sie gelebt, gejagt, geliebt haben, und wie sie gestorben sind. Und sie haben gesehen, wie die Feuer der Brandgräber hoch aufflammten in der Nacht. Es ist lange her. Auch für Berge. Aber die Dorfbewohner nehmen sich nicht Zeit, sich stundenlang in ihren Schatten zu legen und bloß zu lauschen. Die Menschen hier müssen an ihr Tagwerk denken und an das Wetter und das reifende Korn. Oder sie schauen begehrlich auf das Brustmieder oder die Schürze der Jungweiber. Der Bauer ist das Säen gewohnt. So können es die Berge ihnen nicht sagen. Hinter den dunstigen Südbergen ragen die hohen Ketten der veilchenfarbenen Alpen in das wolkenlose Blau des Himmels.
Wie ein springendes Feuer flammt das zinnoberrote Halstuch der Hastenden durch das Gold der regungslos stehenden Kornfelder.
Ihr Fuß streift immer wieder die stachligen Stauden des Hauhechels, die sich weitüber in die Wagengeleise neigen. Vergebens zeigen die Bocksbartpflanzen der Eiligen das selig-brünstige Liebesglück ihrer gespreiteten, gelbleuchtenden Schöße. Die Magd sieht dies alles nicht. Sie sieht nicht die trunken vereinten, rot-schwarz gefleckten Falter, die ganz versunken in ihr Glück wie ein großes Band die krumme Feldstraße säumen, hört nicht das helle Gezwitscher der Schwalben, die immer wieder in steilen Kurven sich aus schwindelnder Himmelshöhe fallen lassen und bei ihren kreisenden Bögen fast den wehenden Rock des Mädchens streifen.
Das Gebetbuch mit dem weißen Tuch ans Mieder gepresst, hat sie nur Blick für den Hügel im Osten, der mitten in den Feldbreiten liegt und auf seinem Rücken eine schneeweiß schimmernde Kapelle trägt, die ringsum das ganze Bauernland beherrscht.
Erst als sie am Fuß des Hügels steht, hält sie eine Weile inne, wendet sich nach ihrem Dorf, das ganz fern am dunkelgrünen Waldsaum liegt, wischt mit dem Handrücken über die perlende Stirn, und plötzlich legt sich ein frohes Lächeln über ihre ebenmäßigen Züge. Mit einem tiefen Seufzer, der befreiend klingt, steigt sie den Hang hinauf.
Und nun hat sie mit einem Mal Augen für alles, sieht jeden bunten Kelch, jede Grasrispe, die dunklen Grillen- und Mauselöcher im spröden Boden, greift bald da, bald dort auf eine Blüte und vermag sich plötzlich wieder auf jene andere Art zu freuen, die ihrem Leben so lange fern gewesen – wieder so, wie sie sich als junges, glückseliges Mädchen freute, wenn er bei ihr war und sie mit ihm im blühenden Grase saß, das Herz bis zum Zerspringen voll mit Liebesglut.
Nun sitzt sie oben im Schatten der Muttergotteskapelle, die Röcke sorgfältig geglättet auf die nämliche Weise, wie sie das von Kind auf bei ihrer Mutter gesehen, den Blick angestrengt auf das Dorf mit dem dicken Zwiebelturm gerichtet, der sich wie eine wehrhafte Burg aus dem Gewirr der roten alten Dächer hebt.
Und die Zeit versinkt.
Es ist der Hochsommertag von einst, an dem sie als siebzehnjähriges Mädchen zum ersten Mal mit ihm auf diesem Hügel gesessen, flammend von heißer Liebe und überfließend von Zärtlichkeit.
O so lebendig steht alles vor ihr, wie wenn sie es eben erst erlebte. Fiebernd vor Glück wartet sie oben auf der Hochstraße bei der alten Ziegelei, die blumige Seidenschürze über den blauen Rock gebunden und das goldene Ringlein mit dem roten Stein, das er ihr nach ihren ersten seligen Liebesstunden geschenkt, am Finger. Heimlich versteckt sie es sonst die ganze Woche durch, damit der kostbare Schmuck ja nicht ihre Liebe verrät. Und es ist ja so schwer, so bitter schwer, stumm zu bleiben und das Geheimnis zu bewahren, wenn das Herz beinah zerspringt vor Liebesseligkeit und Liebesstolz! Sie, die Jungmagd, das Kind der ärmsten Tagelöhnerin ihres Heimatdorfes, geliebt, mit der ganzen heißen Inbrunst überschüttet, von ihm, um den sich alle reichen Bürgermädchen im ganzen Gau landein, landaus die Köpfe schier schief drehten – und der doch keine sah, keine mochte – nicht einmal die stolze Tochter des gewaltigen Bezirkshauptmannes, die so oft auf das Gut kam, sondern nur sie liebte, nur ihr seine schöne, zarte und so unendlich feine Liebe schenkte.
Ja, es war alles so wunderbar schön, so beglückend wie ein Märchen, von dem man wusste, dass es gar nicht sein konnte, dass es erträumt sein musste.
„Du, Leni“, hatte ihre Mutter eines Tages gesagt, als sie noch nicht sechzehn Jahre alt war, „du muaßt hiatzt in ’n Dienst.“ Und sie hatte bei dieser Enthüllung ihre Mutter ruhig angesehen, wie das bei armen Kindern ja so selbstverständlich ist, und hatte nur genickt.
„Oba i’ möcht’, dass d’ es guat triffst“, war ihre Mutter fortgefahren, „und drum woll’n ma nächst’n Sunnta’ üba’n Bearg geh’n noch Einsiedel auf d’ Hearrschaft. I’ kenn’ den Vawolta vom Hearnn Rittaguatsbesitza recht guat und ear mi’ aa. So möcht’ i’, dass ear di’ onschaut und einstöllt, woan’s d’ eahm passt.“
Und so waren sie am nächsten Sonntag in aller Herrgottsfrüh hinüber gewandert über den Berg und durch die lange, uralte Lindenallee auf das Gut zugeschritten. Doch wie sie durch die mächtigen Kronen den gewaltigen zweistöckigen Bau des efeuumwachsenen Herrschaftshauses gesehen, hat ihr Herz mit jedem Schritt schneller zu pochen begonnen. Als sie aber vollends über die Brücke kamen, denn der Sitz war eine alte Wasserburg, und durch den großen Torbogen den Gutshof betraten, haben die Beine ihr den Dienst aufsagen wollen. Denn der ringsum im Viereck von Wirtschaftsgebäuden und Stallungen umstellte Hof war so riesengroß, dass man, wie ihr schien, das ganze Heimatdorf hineinstellen konnte. Wie angenagelt stand sie und hätte vor Schüchternheit die Füße wohl kaum voreinander gebracht, wenn die Mutter sie nicht entschlossen bei der Hand gefasst und vorwärts gezogen hätte. Sie war ja bisher kaum aus dem Dorf gekommen und hatte nur immer gehört, der Schmied im Orte wäre der reichste Mann. Doch wie gewaltig lag dieses Haus da! Dass es einen fast erdrückte! Die vielen Fenster! Drei endlose Reihen übereinander! Und die Haustür! Da lagen ja wahrhaftig zwei Löwen davor, wie bei ihnen daheim manchmal die Katzen, und auf ihren Rücken standen zwei mächtige Säulen, die ein großes, grünspanenes Dach trugen.
Die Tür stand offen, das weiß sie heute noch genau, denn sie hatte plötzlich Todesangst, jetzt und jetzt würde der gnädige Herr heraustreten und sie beide vielleicht recht unwirsch anfahren, was sie denn sonntags in aller Früh auf seinem Hofe suchten.
Aber Gott sei Dank, es zeigte sich niemand, und auch kein großer böser Hund kam herausgesprungen, wie sie sich vorstellte, dass er auf solch ungeheurem Gut sein müsste.
Es blieb alles reglos, nur aus einem Fenster des ersten Stockes flossen weiche, warme Orgeltöne eines Chorals, die sie erst jetzt wahrnahm, in die Stille des Hofes. Wer sie wohl spielte? Es hatte für sie beinah etwas Unheimliches: zu wissen, da war ein Mensch, der nur aufhören und ans Fenster treten brauchte und sie dann sehen würde.
Aber da waren zwei uralte Lindenbäume, links und rechts vor dem Hauseingang, die mit ihren breiten Kronen nach dem Grünspandach griffen und mit den Ranken des wilden Weines spielten, der beinah das ganze Herrenhaus überspann. Die Bäume machten sie ruhig, ohne dass sie wusste weshalb.
Das alles konnten nur Augenblicke gewesen sein, denn die Mutter war entschlossen weitergeschritten auf eine Pforte des Seitenflügels zu, die offenstand. Dunkle Kühle empfing sie im großen, rotgeziegelten Flur und ein mächtiger Bernhardiner hob den Kopf nach ihnen. Er schien sie aber als gute, ehrliche Menschen zu spüren, denn er blieb ruhig auf den Fliesen liegen.
Und dann standen sie beide vor dem Verwalter, einem großen, breitschulterigen Mann mit angegrauten Schläfen. Wie ein Riese stand er vor ihnen, und sie weiß, wie sie innerlich vor Scheu zusammenschrumpfte, zu einem Nichts, das er wohl überhaupt nicht mehr bemerken konnte.
Die Mutter neben ihr aber war unbegreiflich tapfer und brachte ihre Bitte so freimütig vor, wie wenn sie mit einem Bauern des Heimatdorfes spräche.
Erst als sie ausgeredet hatte und Stille eintrat, zog ihr etwas den Kopf in die Höhe, und ihr befangener Blick huschte über das Antlitz des Gewaltigen.
Breitbeinig, den Kopf zu ihr hinuntergesenkt, schien er sie mit Zufriedenheit zu mustern.
Ja und dann kam es knapp, aber freundlich von seinem bärtigen Munde: „Ist recht, Thormayrin, Euer Dirndl ist aufgenommen! Kann am nächsten Ersten einstehn!“
Dass sie vor Freude ganz taumelig war, das weiß sie noch genau, und auch dass der große Bernhardiner, der bei der Tür stand, plötzlich seinen Kopf ganz ungestüm an sie drängte, wie wenn er sagen wollte: Du, ich weiß genau, wie sehr du dich freust, denn ich habe alles vernommen und ich freu mich ebenfalls, dass du zu uns kommst, denn ich mag dich leiden! Aber dann, als sie wieder über den sonnüberflossenen Hof gingen – da geschah es!
Da trat wirklich aus der großen Tür eine kleine, zarte Frau in dunkelweinrotem Seidenkleid heraus, und sie hörte nur, wie ihre Mutter flüsternd hervorstieß: „Jesus na, d’ gnädige Frau! Schnell, handküss’n!“
Und schon stand sie vor der hohen, eben aus dem Schatten der Linden tretenden Frau, deren gütiges Gesicht von leise angegrautem Haar umrahmt war, und presste ehrfurchtsvoll ihre Lippen auf die feine Hand.
Sie weiß, sie wird diese gute, sanfte Stimme ihr Leben lang nicht vergessen.
„Ach, Sie sind es, Thormayrin! Das ist schön, dass man Sie auch wieder einmal sieht. Und das ist wohl Ihr Kind?“
Und Mutter bejahte, berichtete Grund und Erfolg ihres Kommens, und die hohe Frau nickte gütig und sah sie so liebevoll an, dass es ihr jetzt noch stark in die Seele fährt wie an jenem Morgen.
Wie die Gutsherrin dann die Hand hob, auf ihren Scheitel legte und warm über ihn streichelnd sagte: „Nun, mein Kind, das freut mich aber! Dann komm mit Gott in unser Haus!“ – da ist es ihr grad gewesen, wie wenn die Himmelmutter selber von ihrem Postament in der Kirche daheim heruntergestiegen und auf sie zugekommen wäre.
Wie alles noch weiter ging, das ist ihr nie mehr bis ins Einzelne bewusst geworden. Sie weiß nur, ein alter Leierkastenmann war da auf halber Höhe, einen großen Blumenbuschen unter der Filzschnur, winkte ihnen zu und drehte gutgelaunt ein paar Dudeltöne aus seinem Kasten, und die Schwalben schossen immerzu wie närrisch um sie beide herum, als sie mit hurtigen Füßen den Hang hinaufstiegen, als wollten sie zeigen, was sie für Kunststücke vermochten, und hatten doch keine Ahnung, dass ihr Herz noch viel toller vor Freude in ihrer jungen Brust herumsprang als Werkelkastenlaut und Vogelleib im Morgenlicht.
Oder haben sie am Ende um ihre Seligkeit gewusst und sind sie deshalb so aufgeregt gewesen? …
Sinnend schaut Magdalena Thormayr in die Weite.
Und dann ist der große Tag gekommen, wie sie aus ihrem Dorf ging und mit ihren Habseligkeiten auf dem Herrschaftshof einzog. Die erste Nacht hat sie nicht schlafen können vor Freude, Staunen und Erregtheit. O, sie erlebte es so deutlich, wie sie immer wieder ans Fenster treten und hinausschauen musste auf den schlafenden Hof.
Aber die Arbeit auf einem so großen Gut lässt zum Sinnieren keine Zeit, und da sie ehrgeizig war und lieber ins Wasser gegangen wäre, ehe sie ertragen hätte, dass auch bloß der Schimmer einer Klage aus dem Munde der Altmagd an das Ohr der Herrin gedrungen wäre, die sich viel um Küche, Hof und Garten kümmerte, so geschah es, dass alles gleich von erster Stund an voll mit ihr zufrieden war, und der Schlaf sie tagtäglich schon bei ihrer Kammertür empfing und ihr kaum Zeit ließ, sich zu entkleiden.
Das Glückseligste aber, das den ganzen Tag ihr junges Herz durchschwang und sie jeden neuen Morgen mit Ungeduld erwarten ließ, waren die Morgenandachten auf dem Gut.
Um neun Uhr, wenn die Früharbeit getan war, versammelte sich das weibliche Gesinde im sogenannten blauen Zimmer der Herrin.
Ihr wird jetzt noch ganz wirblig vor den Augen, wenn sie an die Pracht dieses großen Zimmers denkt, das mitten in der Flucht einer Zahl anderer Räume lag, zu denen die Türen offenstanden, so dass man einen huschenden Blick in all die Herrlichkeiten tun konnte.
Mein Gott, dass man so wohnen konnte! Es erscheint ihr heute noch immer nicht anders: Der allergnädigste Herr Kaiser in Wien konnte es nicht schöner haben!
Und wiewohl seither fast an die achtzehn Jahre vergangen sind, lebt alles, jedes einzelne Möbelstück, jedes Bild, jede Vase und Decke so unauslöschlich in ihr wie eine große, unvergängliche Sehnsucht.
Ja, sie brauchte nur die Augen zuzumachen und es stand jeder Gegenstand zum Greifen deutlich vor ihr.
Und wieder, wie so oft all die bitterlange Zeit, überfiel es Magdalena Thormayr so heftig, dass sie die Augen schließen musste.
So saß sie regungslos, den Kopf mit den dicken Flechten an die Kapellenmauer gelehnt.
Am Harmonium sitzt die kleine, zierliche Herrin, leise den Kopf mit der schmalen, feinen Adlernase nach den Händen gesenkt, die gefaltet im Schoße liegen. Nun heben sich diese Hände ganz leise, wie sich der Morgenwind vom Wald löst, die Finger berühren die Tasten, und die feierlichen Weisen eines Chorals fließen durch die lautlose Stille. Vielleicht, dass der Ruf eines Knechtes oder der Huf eines Rosses in die Weise dringt – aber das gehört ja zum Morgengebet.
Und nun heben sie die Blätter und singen zu den Orgeltönen die Strophen des Kirchenliedes, welche die Herrin ihnen ansagt. Deutlich hört sie ihre helle, junge Stimme unter den andern heraus.
Sie stehen im Halbkreis um das Harmonium und das große, schwarzfunkelnde Klavier herum, auf dem in weiter, wundervoll geschliffener Kristallschale helle Rosen duften.
Hinter dem Klavier, seiner Frau gegenüber, steht, leicht angelehnt, die schlanke, hohe Gestalt des Gutsherrn Georg Einsiedel, das Lied mit fester, tiefer Stimme mitsingend.
Nun lösen sich die Finger von den Tasten. Liegen wieder im Schoß. Unmerkbar verklingt der letzte Ton. Und ebenso behutsam langt die ringgeschmückte Manneshand nach dem schwarzen Buch, hebt es hoch, schlägt es auf, und das übermäßig schmale, durch den schütteren Schnurr- und Kinnbart noch mehr verlängerte Antlitz, mit zwei stahlblauen, festen Augen zwischen einer kühn geschwungenen Hakennase, wird vollends feierlich.
Eindringlich, mit klarer, gemessener Stimme, so dass jeder Satz mit seinem vollen, lebendigen Sinn den Weg in ihre Herzen findet, liest er die Epistel aus dem Buch.
Mit angehaltenem Atem lauscht sie seinen Worten, und ihr ist zumut wie in der Kirche. Sie hört kaum das Amen, mit dem er das Buch schließt und weglegt.
Und wieder sind die warmen, sanften Töne des Harmoniums da, und inbrünstig fällt sie mit ein in die Melodie des Schlussgesanges.
Wie eine vom Himmel rieselnde Segnung hüllen die letzten Akkorde die Schweigenden ein.
Eines Abends ging es um den Esstisch, der junge Herr sei wieder daheim. Der gnädige Herr selber habe ihn am Nachmittag mit den beiden Fuchsen von der Bahn abgeholt.
Wer das wäre, der junge Herr?
Der Sohn der Herrschaften; ihr einziges Kind.
Aus dem Gespräch erfuhr sie weiter, dass er draußen in Deutschland, in Heidelberg, auf der Universität studiere, Klaus heiße und so arg gescheit sei. So gescheit, fiel die kornstrohblonde Agnes ein, dass einem gar nichts einfalle, wenn er mit einem spreche.
Und die Mägde rätselten weiter darüber, ob er noch immer so unheimlich schlank oder wohl etwas fester geworden wäre übers Jahr.
„Der ist im Vorjahr so schlank gewesen“, erklärte ihr die Altmagd, „dass uns allen ganz Angst und Bang war.“
„Ja, und sauber ist er, sag ich dir“, fiel die zweite Jungmagd ein. „Wie ein Fürst so fein!“
„Er geht aber auch gekleidet, wie ein Fürst nicht feiner angezogen sein kann.“
Sie war ganz Ohr und errötete fast, als es ihr die Frage herausstieß, wie er denn aussehe.
„Das kann man nicht einmal gut sagen, denn das wirst du ja doch schon längst bemerkt haben, wie auffallend gleich die Gesichter von der gnädigen Frau und vom gnädigen Herrn sind.“
Und auf ihre andere Frage, wie alt er sei, wurde ihr geantwortet: neunzehn Jahre.
Als sie hernach in ihrer Kammer im Bett lag, war sie ganz seltsam erregt, sie wusste selbst nicht warum. Wohl aus lauter Neugierde auf den jungen Herrn.
Und plötzlich ertappte sie sich bei dem Gedanken, ob er sie auch je einmal bemerken und ein Blick auf sie fallen würde. Doch sie wies sich gleich selbst zurecht; was fiel ihr nur ein! Sie war ja nur eine Magd und obendrein die jüngste und geringste.
Nein, was einem doch für närrische Gedanken kommen konnten, wenn man so jung und dumm war wie sie und obendrein nicht schlief.
Und sie warf sich auf die Seite und war wohl bald eingeschlafen. –
Der Hahn aber hatte noch nicht seinen ersten Morgenschrei getan, als sie schon aus dem Bett war. Weit lag sie im Fenster, lauschte in die regungslose Ruhe und sah über die hohen Wipfel der Parkbäume in das sich immer goldener verfärbende Morgenlicht.
Als sie sich wusch, kam ihr von ungefähr das in den Sinn, was sie noch nie getan ihr ganzes Leben lang: Sie stellte sich vor den Spiegel und besah ihren jungen Körper und erkannte zum ersten Mal die Schönheit ihres Leibes und erschauerte im Tiefsten.
Es war gut, dass der große Bernhardiner unten im Hofe aufbellte. Wer weiß, wann sie sonst zu sich gekommen wäre.
Beim Strählen der Haare prüfte sie ihr Gesicht, aber sie konnte es nicht schelten; es war wie Milch und Blut und wahrlich schön geformt.
Fertig angekleidet, stellte sie sich nochmals vor den Spiegel, sah sich tief in die Augen und schüttelte ernst den Kopf. Aber in diesem verwunderten, rügenden Kopfschütteln lag ein langes Zwiegespräch. –
Schwer fuhr sich die an der Hügelkapelle sitzende Magdalena Thormayr über das Gesicht: Mein Gott, wie lebendig doch alles wieder wurde! Wie unvergesslich, unauslöschlich alles vor ihr stand bis ins Kleinste!
Ein tiefer Seufzer löste sich von ihrer Brust.
Und dann, dann war der Augenblick gekommen, wo sie wie jeden Morgen mit den andern Mädchen und Mägden die schwere, dunkle Eichentreppe von der Halle hinaufstieg und mit leiser Neugier in das Musikzimmer trat.
Und da stand er, schmal und hoch, das Profil der Tür zugekehrt, zwischen seinen beiden Eltern.
Ihr Fuß blieb fast stecken; sie wusste nicht warum. Sie ahnte dortmals ja noch nicht, dass mit dieser Stunde ihr Schicksal sich zu erfüllen begann. Viele Jahre später, wenn sie über das ganze Geschehen und das so merkwürdige Gefühl jenes Augenblickes nachdachte – und wie oft hatte sie darüber nachgesonnen! –, kam ihr der Gedanke, dass in jenem Augenblick ihre Seele alles schon gewusst.
Dem Brauch des Hauses nach trat nun jede einzeln zu dem jungen Herrn und begrüßte ihn. Er gab jeder freundlich die Hand und sprach ein herzliches Wort. Waren es doch lauter alte, längst vertraute Gesichter.
Bei jeder Vortretenden schlug ihr Herz stärker. Das traf sie ganz unerwartet. Davon war gestern Abend im großen Gesindeessraum nicht geredet worden. Wie sollte sie das nur zu Wege bringen, sie, das junge Mädchen, das nie mehr einem Burschen die Hand gegeben, seit sie aus der Schule war – und nun gar erst dem jungen gnädigen Herrn! Und was das Allerschrecklichste war – selber hintreten zu ihm! O du liebe Muttergottes, steht mir bei! Sie spürte, wie das Blut ihr zum Kopfe stieg und in den Halsadern hämmerte.
Und nun war sie an der Reihe. Aber sie hatte keinen Atem! Und wie sie es befürchtet: ihre Füße hafteten am Boden, versagten den Dienst. Freundlich waren die drei Gesichter auf sie gerichtet. Verwirrt und hilflos klammerte sie sich an die Züge der Herrin. Doch was war das! Man war ihr gar nicht böse?! Innig, mit ihrem mütterlichsten Lächeln – ja, es schien ihr, wie wenn eher Freude und Ergriffenheit in diesem Ausdruck läge – nickte ihr die Frau zu und sprach: „Na, nimm dir nur ruhig den Mut, Magdalena, und begrüß den jungen Herrn! Er freut sich ja darüber!“
Wie es geschehen war, das weiß sie nicht, aber da stand sie vor ihm und stammelte mit brennenden Backen ein paar Worte hin, wohl die nämlichen, die sie eben von den andern gehört, den Kopf vor Hilflosigkeit tief geneigt.
Und sie hätte wohl nie gewusst, ob er ihre dargebotene Hand in die seine genommen, wenn er sie kühl und flüchtig berührt hätte, wie sie es wohl verdient. Aber sie fühlte ihre Hand so warm und fest umspannt und gehalten, dass etwas wie ein großes Glück in ihr junges, reines Mädchenherz rann. Und dazu hörte sie seine freundlichen Worte, deren warmen Klang sie bis in ihren Tod nicht vergessen wird: „Nun, Magdalena, wollen Sie mich nicht auch ansehen?“
Und als sie darauf den Kopf hob und ihre Augen für einen Atemzug in den seinen irrlichterten, da schoss ihr ein solcher Strahl von Freude entgegen, dass er sie fast hinwegwehte.
Wohl hundertmal an diesem Tag hat sie in der Arbeit innegehalten und ihre rechte Hand besehen. Und als sie abends im Bette lag, sah sie so lange darauf, bis sie einschlief.
So begegnete sie ihm nun jeden Morgen bei der Andacht. Und wenn sie mit scheuem Herzen und Aufwendung aller Kraft den Blick unauffällig zu ihm huschen ließ, beim Wenden des Blattes oder der Verlesung der Epistel – immer lag sein Auge mit warmem Glanz auf ihr.
Es wurde ihr in diesen Tagen gar nicht klar, was eigentlich durch sie ging, und auch von seinen Blicken machte sie sich keine rechte Vorstellung – mein Gott, wie denn auch! Sie war ja doch nichts als eine gewöhnliche Magd. Sie nahm das Ganze in der Art, wie ein treues Tier, das die Liebesbezeugungen seines Herrn beglücken.
Doch dass sie an ihn dachte, ihre Gedanken immer wieder bei ihm ertappte, ob sie das wohl durfte? Aber er war ja so schlank und hübsch, und redeten denn nicht die anderen Mädchen auch von ihm?
So trug sie das Wissen um seine Blicke und ihr Ihnumdenken wie ein lichtes, heiliges Geheimnis in ihrem Herzen. –
Und als Magdalena Thormayr nun die Augen aufschlug und ins Dorf hinuntersah, lag ein Glanz über ihrem reifen, noch immer bildschönen Gesicht wie auf den Zügen einer Braut, die ihren Liebsten erwartet.
Ja, … und dann kam der Tag! Der Tag, um dessen hoher, lichter Seligkeit willen sie noch dutzende Male alles durchmachen, leiden und ertragen wollte, was diese fast zwei Jahrzehnte über sie gegangen.
Es war genau eine Woche später, nachdem der junge Herr ins Haus gekommen.
An die Stallungen schloss sich ein riesiger Park an, mit Hunderten uralter Eichen, Rüstern und Pappeln, die mit dem Bach, der den Wehrgraben speiste, über die weitgedehnte Rasenfläche bis hinaus in die Viehkoppeln gingen, wo die scheckigen Rinderherden weideten.
Ganz draußen, wo der Park in das Weideland überging und man den freien Blick über das weidende Vieh hinweg auf die weite, sanft gewellte Landschaft hatte, die ein einziges wogendes Kornfeld schien, das nur ab und zu von Zuckerrüben-, Erbs- und Kleefeldern durchbrochen wurde, befand sich unter den Kronen der letzten Baumriesen eine hochlehnige, weißgestrichene Bank, die halbkreisförmig um einen Tisch gebaut war.
Auf diese Bank zu – die der Lieblingsplatz der Herrschaften war, wenn die Sonne ihr letztes weiches Gold auf die fernen, veilchenblauen Gebirgszüge rieseln ließ und die stumm weidenden Rinder große, dunkle Schatten warfen, über ihnen flammender Himmel und farbenleuchtende Wolkenballen – führte von der Brücke des Baches weg, ein köstlicher Gang von Rosenbüschen, der mit einer einzigen Flut rosafarbener Blüten überschüttet war und sich hinter dem Ruheplatz zu einer weitübergreifenden Laube formte.
Am Tage vorher hatte ein schwerer Sturm gewütet, und so war sie von der Herrin beauftragt worden, dorthin zu gehen und die losgerissenen Ranken in Ordnung zu bringen.
Da, als sie mitten in der Arbeit war, legte sich plötzlich eine Hand auf ihr Haar, und als sie sich umdrehte, stand der junge Herr vor ihr.
Sie war ganz verwirrt darüber und kam sich obendrein wie ein ertappter Dieb vor, denn sie hatte den Augenblick an ihn gedacht. Sie war heute Vormittag gerade über den Hof gegangen, als er mit seinem Vater durch das Tor auf die Felder ritt, und war eben ganz versunken gewesen in die stolze Haltung, mit der er auf dem feurigen Pferde gesessen – und nun stand er ihr gegenüber.
Sie fühlte, wie ein Zittern über ihren ganzen Leib ging.
„Ich habe dir schon eine Weile zugesehen, Magdalena, und mich so sehr daran gefreut.“
Sie stand demütig vor ihm in großer Hilflosigkeit.
„Es war so wundervoll, wenn du dich strecktest und die Ranken hochbandest“, fuhr er fort.
Reglos hingen ihr die Arme am Leib herab.
Und er nach einer Weile des Schweigens, selber mit seinem Atem kämpfend:
„Weißt du denn auch, Magdalena, wie schön du bist! So schön wie die blütenüberschüttete Ranke selbst, die du eben hieltest!“ Und seine Hand, deren Beben sie fühlte, erneut auf ihren Scheitel legend:
„Du, ich freue mich so, dass du bei uns bist und mir mit deinem süßen Sein jeden Tag verschönst!“
Da ging ein merkliches Schüttern durch ihren Körper.
Er aber, als er das sah, legte den Arm um ihren Leib, zog sie sanft an sich und sagte immer wieder nur das eine: „Magdalena, meine liebe, kleine Magdalena!“
So standen sie lange Zeit, und während ihr Herz voll einer rätselhaften Bangnis und Glückseligkeit flog, dass es ihr fast aus dem Leibe sprang, fuhr seine feine, zarte Hand immer wieder über ihre Wange, dass ihr war, als müsse sie vergehen und weghauchen wie Maienschnee in der Sonne.
O Gott, wie viel tausendmal hat sie sich seit jener fernen Stunde Rechenschaft geben wollen, wie das alles nur weiter gekommen, wie es denkbar gewesen, dass in ihrer großen Scheu der selige Mut des Liebens aufgewacht. Sie hat es nie ergründet.
Sie weiß nur, dass er plötzlich ganz behutsam seine Hand unter ihr Kinn schob, ihren Kopf hob, so dass sie ihm in die Augen blicken musste. Weiß, wie ihre Augen wirr herumirrten, schließlich aber unter seinen Koseworten festen Halt in seinen leuchtenden, zärtlichen Sternen fanden und sie sich willig und ganz darein vergehend den ersten, langen, heißen Kuss ihres Lebens auf die vollen frischen Lippen geben ließ.
Und dann hat er sie zur Bank geführt und in nimmer endenden Küssen in seinen Armen gehalten. Und sie kroch an seine Brust wie ein eidottergelbes Küchlein unter die wärmenden Flügel der Gluckhenne. Und sie hätte wohl alles für einen unbeschreiblich himmlischen Traum gehalten, wenn er die Küsse nicht immer wieder unterbrochen, sie von sich gehalten und ihr mit einer Ergriffenheit, die sie selber ganz andächtig machte, gesagt hätte: „O du, wie schön du bist! Weißt du denn überhaupt, du liebes, süßes Mädchen, wie schön du bist!“
Sie aber hat kein Wort auf all seine Liebkosungen zu reden vermocht; nur ansehen und halten, das war das Einzige, was sie konnte.
Und sie hielt ihn mit einer lnbrunst, wie wenn sie ihn ihr Leben lang nimmer lassen wollte.
Er fühlte die Liebesmacht ihrer Umarmung, denn er flüsterte, seine Wange heiß an die ihre gepresst: „Ja, halte mich fest, wie ich dich halten werde in alle Ewigkeit, du meine liebe, holde Liebste du!“
Es muss wohl eine bange Frage bei aller Seligkeit in ihren Augen gelegen haben, denn plötzlich wurde er sehr ernst und sprach mit einer Feierlichkeit, die ihr durch den Körper bebte: „Ich habe all diese Tage eines nur denken können: dich! Morgens, wenn ich aufstand, warst du mein erster Gedanke; ich sah dich überall, ja in jedem Blütenkelch, wenn ich mit Vater über die Felder ritt; und nachts, wenn ich zu Bett ging, bist du vor mir gestanden und hast mich leise angelächelt. Mein erster Blick, der dich traf, war schon Liebe, und ich werde dich lieben, solange ich lebe! Das höre und grabe es tief in dein Herz …“
Zwanzig Jahre fast sind seit jenem Schwur vergangen – o was für Jahre! –, aber sie hat dieses Wort keinen Tag vergessen, hat es keinen Augenblick bezweifelt, ist ihm keinen Atemzug lang untreu geworden.
Und sie trank seine Worte in sich, dass es ihren jungen Leib spannte vor Lust.
Als sie sich endlich auf die Zeit besannen, stand die Sonne stark im Westen; auf ihren Körpern lagen viele rosafarbene Blütenblättchen.
Diese Nacht hat sie vor Jubel kein Auge zugetan.
Sie konnte immer nur das eine denken: „Das also war Liebe! Wie glücklich bin ich!“ Und dieses: „Wie habe ich ihn lieb, wie hab ich ihn lieb!“
Am andern Morgen fiel ihr fast vor Verwirrung das Notenblatt aus der Hand, als sie seinen Blick auffing.
Es war nicht leicht, sich unauffällig zu treffen. Sie konnte es sich nicht anders denken: Es musste ein guter Engel liebevoll über ihnen wachen, denn immer wieder ergab sich ganz unerwartet eine Gelegenheit – und kaum war diese günstig, war auch schon der Geliebte da!
So war jeder Tag zum Zerspringen voll mit Liebe und Sehnsucht und beladen mit brennendheißen Küssen. Aber sie hätte es sich nicht zu sagen vermocht, was sie seliger durchlohte: seine Küsse und die wundervoll zarte Art, mit der er sie koste, oder die Worte, die er zu ihr sprach.
Ungefähr vierzehn Tage später hatte sie ihren freien Sonntag, den sie bisher jedes Mal benützt hatte, um ihre Mutter aufzusuchen.
Am Vortag hatten sie ausgemacht, sich oben auf der Bergstraße bei der alten, halbverfallenen Ziegelei zu treffen.
Der Tag war glühend heiß, aber so sehr die Sonne auch auf dem Fruchtland brütete, was war das gegen das Feuer in ihrem Herzen. Der wilde Thymian duftete so verwirrend, und die blauen Glockenblumen schellten und läuteten, dass die Schmetterlinge wie trunken in der Luft herumtaumelten. Und als sie den Geliebten dann plötzlich aus den letzten Bäumen der großen Lindenallee hervorkommen sah, sprang ihr Herz, dass sie laut hätte aufjubeln mögen.
Es war nur ein großer, dichter Heckenrosenstrauch oben auf der Höh. Doch ohne auch nur einen Augenblick sich zu besinnen, ging er auf den blütenumdufteten Busch zu und rief lachend:
„Kleiner Vogel, komm heraus aus deinem Nest!“
Mit weitgebreiteten Armen stand er vor dem alten Strauch.
Wie zwei Kinder sind sie dann den Höhenzug auf der andern Seite hinuntergesprungen, die heiße Sonne nicht fühlend, engumschlungen durch das segenschwere Bauernland geschritten, nicht anders als das junge Blut in den Dörfern rundum, und waren liebesselig den Kapellenhügel heraufgestiegen.
Genau an derselben Stelle, auf der sie jetzt saß, hatten sie sich damals ins Gras gesetzt, und das Erste war wieder ein langer Kuss gewesen. Sie weiß es unter all den unzähligen Küssen deshalb so genau, weil es zugleich so spaßig war. Denn als sie, ihn bei der Hand nehmend, den Mund öffnete, um zu sagen: „Sieh, da drunten liegt mein Heimatdorf“, rief er scherzend: „Ei, freilich, das habe ich gerade gewollt!“, und erstickte so den Laut im Kusse. So tat er eine ganze Weile, bis sie unter seinem Ungestüm fast nach Luft zu schnappen begann. –
Und die Magd versinkt so ganz in das Glück jener fernen Zeit, dass sie die Wonnen jedes Augenblickes noch einmal neu erlebt.
In seliger Vergessenheit saßen sie lange Zeit, schweigsam Körper an Körper gedrängt, Kopf an Kopf, in innigster Umarmung.
Auf einmal sagte sie:
„Sieh, das ist mein Heimatdorf! Da unten bin ich geboren!“
Und er ernst:
„Ja, Magdalena, wie seltsam ist das! Da sind wir beide Kind gewesen, haben gespielt, sind größer geworden, herangewachsen, und fast nur der Hügel hat uns getrennt. Wir sind jedes sicher oft auf ihm gesessen, ja vielleicht war sogar noch das Gras warm vom Körper des andern – und wir haben nichts voneinander geahnt! Er aber, der Hügel, hat dich gekannt und mich gekannt – und hat wohl in seiner Klugheit längst gewusst, dass einmal der Tag kommen würde, wo wir gemeinsam auf ihm sitzen und ein seliges Liebespaar sein würden. Du, wie wundersam doch das Leben ist!“
Und sie nach einer Weile, mit dem Arm weisend:
„Siehst du das kleine, winzige Häuschen am Ende des Dorfes? Dort, wo die großen Bäume stehen? Dort haust meine Mutter und da bin ich aufgewachsen.“
Und wieder nach einer kleinen Pause, die Worte beinah hervorstoßend:
„Die winzige Hütte und dein Elternhaus! O Klaus – was kann ich dir sein?“
Er, tief gerührt sie an seine Brust ziehend und mit aller Kraft pressend:
„Liebe, du, Liebste – wie du nur so reden magst!“
Sie aber, unverrückt fortfahrend:
„Was wird mein Los sein? Jetzt liebst du mich vielleicht, weil ich jung bin. Einmal aber wirst du mich nimmer lieben, wirst erkennen, dass ich arm und dumm und ungebildet bin und gar nicht zu dir passe … Und dann werde ich einsam sein, verlassen – eine ausgestoßene, unglückliche Magd!“
Hastig nahm er ihren Kopf in seine Hände und sprach, seine Augen tief in die ihren senkend:
„Kleine Närrin, du! Denkst du, dass der Morgentau je bangt, ob er die Natur erquickt; oder die Sonne sich quält, ob sie die Kreatur beglückt? Sie beide wissen zutiefst in sich, dass sie urhaft notwendig sind! Und sieh, so notwendig wie Sonne und Tau der Kreatur, so notwendig bist du mir! Bist wie sie: Wert aus dir selbst. Du musst dich nicht erst plagen, musst nicht erst etwas werden wollen, um etwas zu sein. Bist das Höchste, was ein Mensch sein kann: – Freude! Die schöne, reiche, liebeströmende, lebenweckende Freude! … Und fragst du, warum? Weil du das Höchste bist, was ein Mann ersehnen kann: – ein echtes, weibliches Weib! Wie sollte ich dich da je lassen können!? So wenig wie ein Geschöpf die Sonne! Du mein Licht, meine Freude, meine Sonne du!“
Und sie verstand ihn und schlang ihre blühenden Arme um seinen Hals.
Und sie versanken in die hohe Seligkeit ihrer Liebe.
Drittes Kapitel
Als sie ins Dorf kommt, tönen ihr ringsum Grüße und Zurufe entgegen. Die Schatten der Gehöfte liegen schon breit nach Osten zu über die Straße und in ihrer Kühle hocken die jungen Bäuerinnen und die runzeligen Altmütter mit bauschigen Röcken, steif wie Mumien, auf den Torbänken. Ab und zu auch ein alter Ahn unter den Weibern, von der Sorte, die gewohnt war, auch in rüstigeren Tagen sich frei- oder unfreiwillig dem Kommando der Eheweiber zu fügen.
Magdalena Thormayr aber weiß den Strick, den die Neuigkeitslüsternen immer wieder die Straße hinauf um sie werfen wollen, rasch abzustreifen.
„Host d’ös G’sicht g’sehg’n?“, tuschelt es auf jeder Torbank hinter ihr her.
„Jo göi’! I’ hob’s aa glei’ bemirkt! Gonz vawond’lt is s’ heid“ … „Dös is mo jo von iahr oll dö Joahr hear goar net g’wöhnt, wo s’ ollwei’ so earnst is!“ … „Jo, recht host d’! Grod van G’sicht obag’sprunga is s’ iahr, d’ Freud’!“ … „Eh woahr, grod wiar a Hochzeitarin hot s’ ausg’schaut!“ … „Nou sogts es zwoamol! Wear woaß!“ … „Wäar iahr eh z’ vagunna! Is a rechtschoffas Weib und a bildsaubas aa dazua!“ … „Ob ’s am End’ doch ’n Haidererbauarn ’s Jowoart geb’n hot? ’s hoaßt, dass ear si’ dö Diarn in Koupf g’setzt hod“ … „Do sitz at s’ eh guat! Dös is goar aa reicha!“
„Jou Muadda, do host recht“, krächzt der alte Hasenegger drein, „oba i’ moan, da Baua sitzat do noch vüi’ bessa! Do war i’ glei’ noch aa z’ hob’n dazua!“ Und er blinzt ganz verschmitzt mit seinen kleinen Augen!
„Geh’, du olta Kasperling!“, wirft ihm die Alte zu, „du host auf sou’ junge Weibaleut noch z’ denka! Sei froh, dass d’ noch kriachen konnst, du olta Schüpp’l! Schaut’s oaner hear! Wonn ear auf d’ Nocht in Bett liegt, do seufzt ear und stöhnt ear, dass ’s zan Gooderborma is, und hiatz hätt’ ear an solchan Ubamuad“ Die Alte stemmt die dürren Arme in ihre Hüften und plustert sich, sich entrüstet stellend, wie eine Henne auf.
Und er, auf das schallende Gelächter der jungen Weiber: „Jo mei’, woaßt d’ denn aa, woarum i’ sou seufz’!? Valleicht valongt ’s mi’ noch sou oana Bettewärmarin, wia dö Lena oane wär!“
Und die Greisin, das Gesicht in finstere Falten ziehend und mit der rechten Faust gegen ihn drohend:
„Dass d’ miar oba hiatz glei’ stüll bist, du olta Sünda! Miaßt m’ jo in meini olt’n Tog noch schamen! War jo noch schöna, wonn a sou a olta Hiasl noch gocklig wuard!“
So und ähnlich geht es hinter der Magdalena Thormayr her. Wo aber ein Bursch im offenen Haustor lümmelt oder ein Bauer auf dem Weg zum Wirtshaus ist – da sind die Gedanken ganz andere!
Hastig steigt die Magd die Böschungsstufen zum Häuschen hinauf. Hinter dem Holzzaun stehen in hohen Schäften, wie alle Jahr’ um diese Zeit, die bunten Malven in hellem Wetteifer mit den funkelnden, kupfervitriolblauen Blütenrispen des Rittersporns. Vom Boden herauf strömt der wohlige Duft der Löwenmäulchen.
Das Pförtchen hinter sich schließend und durch den Vorgarten schreitend, öffnet sie vorsichtig und lautlos die Tür. Die kleine Feuerküche mit dem pechschwarzen Rauchabzug ist leer. Ebenso die Stube. Nur die alte Perpendikeluhr tickt in die sonndurchflossene Stille, deren Strahlen zwischen den roten Geranienköpfen sich in den Raum drängen und die köstlichen Muster auf den blankgescheuerten, mit weißem Sand bestreuten Fußboden zeichnen.
Einen Augenblick bleibt sie in der Stube stehen. Es ist immer das Gleiche. Blitzblank! Die Tür nach dem Hof ist offen.
Und als sie nun in den Türrahmen tritt, wird ihr Gesicht vollends strahlend; denn hinten im Garten unter dem großen Birnbaum erblickt sie die beiden. Die Mutter mit dem Rücken am Baume lehnend, wie immer nähend; er auf dem Bauch im Grase liegend und lesend.
Regungslos genießt sie geraume Zeit das trauliche Bild, dann geht sie auf den Zehenspitzen zu den beiden. Erst als sie schon unter dem Apfelbaum steht, hebt die Alte den Kopf, lässt das Nähzeug in den Schoß sinken und ruft mit frohem Gesicht:
„Jo du bist do, Leni!“
Wie der Liegende, ein Bursch von ungefähr siebzehn Jahren, dies hört, reißt es ihn mit einem Ruck herum.
„Dös is oba schön, Muadda, dass d’ doch noch kemma bist! Miar horn grod davoarn von diar g’red’t, ob’s d’ wohl heit am End goar net ummakimmst!“
Und sie, strahlend vor Glück sich zwischen beiden niederlassend:
„Freili’ bin i’ kemma!“ Und auf das Buch weisend: „Muaßt vül lerna, göi? Wos tuast d’ d’nn grod?“
„G’schicht! Woaßt d’, va dö vül’n Kaisa und dö Kriag’ und wos sunst ollas auf de Wölt g’scheg’n is’!“
Sie nickend: „Do muaßt oans schon an Kopf horn, göi?“
„Woaßt as jo eh, in viarzehn Tog san d’ Ferien, do moch’n dö Professa hiatzt dö groß’n Priafungen.“
„Jo, dö gonz’n Tag’ hear und hear schou huckt ear va früah bis spod üba dö Büacha, grod wiar a Bruadhenn’ üba dö Oar!“
„Sunst wär i’ da aa a weng entgeg’n gonga, Muadda!“, sagt der Sohn, sich herzlich an seine Mutter wendend.
Und die Alte drauf:
„Jo, wia g’sogt, grod davoarn homa va diar g’red’t. Wo nuar heit dei’ Muadda bleibt, hob’ i’ za eahm g’sogt, und da Klaus hot g’moant, dass ear om Dunnastog zu diar ummig’schaut hätt’, wonnst net kemma wa’st.“
„No, hiatzt bin i’ jo do!“
„Jo, hiatzt bist d’ do! Aba woarum bist d’nn heit so spod dron?“
Magdalena Thormayr greift, ohne ein Wort zu sagen, nach ihrem Gebetbuch, nimmt den Brief heraus und hält denselben mit schlecht verhohlener Glückseligkeit mit der Rückseite gegen die beiden.
Die besinnen sich keine Sekunde, sondern sagen wie aus einem Munde:
„Vom Vodda?!“ … „Vom Klaus?“
Magdalena nickt freudestrahlend.
„Was schreibt er denn, Muadda?“
Und als die Befragte noch immer den Mund nicht auftut, die Alte:
„Nou, sou spann uns doch net sou auf d’ Folta! Geht’s eahm denn mit da Krankheit leicht bessa?!“
„Gonz wos onders! Gonz wos onders! Wos vül vül Schöners!“
„No höar, du mochst uns jo gonz narrisch! Wos noch vül Schöners? Wos kunnt d’nn dös sei’?!“
Und der Sohn, erregt die Hand auf den Arm der Mutter legend:
„So red’ doch, Muadda!“
Da kommt es wie ein Sturzbach über ihre Lippen:
„Da Vodda schreibt, ear hot sein Voddan endli’ umstimma kinna …“
„Was!?“, schreit der Sohn, dass es durch den Garten hallt. Sein Gesicht wird totenbleich.
Die Mutter nickt: „In einer Woch’n schou is d’ Hochzeit … in einer Woch’n schou san ma gonz bei eahm!“
Auch die Alte bringt kein Wort aus dem Munde. Er bewegt sich wie bei einer Stummen. In Strömen brechen Tränen aus ihren Augen.
Klaus entreißt der Mutter den Brief und liest mit fiebernder Erregung. Das Blatt zittert in seiner Hand.
Es ist ganz still mit einem Mal im Garten.
Die Magd sitzt wie zu einem Fest; unablässig laufen der Alten dicke Tropfen über die Wangen.
Aber der Junge wird mit dem Brief nicht fertig. Regungslos ist sein gesenktes Haupt in das Blatt gebannt. Er sitzt gekrümmt, als drücke ihm eine Zentnerlast den Kopf in die Brust. Vier Augen sind groß auf ihn gerichtet.
Endlich wischt die Großmutter mit Fingern und Handrücken ihr Gesicht ab und fordert den Enkel auf, ihr den Brief vorzulesen.
Er scheint sie gar nicht zu hören. Aber die Alte muss reden, muss ihrem übervollen Herzen Luft machen.
„Dear Monn, dear liabe Monn!“, strömt es aus ihrer tieferfüllten Brust.
„Dös Glück! Na, dass i dös noch darleb’n dearf! … Thormayrmuadda, hot ear oft g’sogt, wonn ear in dö früahern Joahr za miar ins Häus’l kemma is – sö glaub’n goar net, Thormayrmuadda, wiar gearn ols i’ dö Leni hob! … Bis in den Tod loss’ i’ net van iahr, hot ear g’sogt … und hiatzt is ’s woahr woarn!“
Bei diesen Worten brechen auch der Magd die Tränen aus den Augen. Kein Wort aber kommt über ihre zuckenden Lippen.
„Und längst woahr g’mocht hätt’ ear’s, wonn ear nach sein’ Studie net sou schreckli’ kronk woarn wa’, dass ma olli mitanond glaubt horn, ear stiarbt.
Z’ vül g’wochs’n, horn dö Doktan g’sogt, z’vül g’wochs’n wär’ ear.
Oba trotzdem, i’ loss ma’s net nehma: Dös is ’s net g’west! Kränkt hot ear si’ z’vül! Dös is ’s g’west! Und dö vül’n Kränkungan horn sö auf sei’ Brust g’schlog’n! …
Und aa, dass du net dahoam blieb’n bist, wia ear ’s woll’n hot! Jo, jo, Leni, dös hot eahm vül Kumma g’mocht, dass d’ in Dienst gang’n bist!“
„Muadda, i’ hob net anders könna. I’ hätt’ mi’ g’schamt vor seini Eltern, sou müaßig dahoam umanandsitz’n … und dann weg’n dö Leit’ im Dorf … I’ hob eahna aus dö Aug’n müass’n!“
Beide Frauen sind stumm.
Nach einer Weile, während die Tochter wieder an den Lippen der Mutter hängt, der Enkel aber irgendwo in der Welt ist, nur nicht dort, wo sein erstarrter Körper war, hebt die Alte wieder an:
„Sö wiss’n jo goar net, wos i’ füar an Kumma hob’, Muadda, hot ear oft za miar g’sogt, wiar ear wieda g’sund woar und aus Agypt'n z'ruck g'west iso. Sö wiss'n ’s jo goar net, hot ear g’sogt. I’ oba hob’s schou g’wisst! I’ hob eahm’s jo aus ’m G’sicht oba les’n kinna!“
Und bitter aufbrausend:
„Und on oll unsan Kumma is der olte Dickschäd’l schuld, der stoanhoarte! … Dear woaß jo goarnet, wos ear uns oll’n an’tan hot!“
Und fast im selben Augenblick schon wieder in helle Freude umschlagend: „Na, sou wos! I’ konn’s jo noch goar net glaub’n! Es is jo wiar a Traam! Jo grod wiar a Traam!“
Und nach einer Weile: „Denk diar nuar, Leni: Hiatzt brauchst di’ nimma rackern und nimma kränk’n! Hiatzt seid’s olle drei ollweil z’somm, bist Frau – Schlosshearrin!“
Da wird die Magd feuerrot vor Glück und Scham und als müsse sie sich verbergen, steckt sie rasch ihre Hände unter ihr zinnoberrotes Brusttuch.
,,I’ hob’ Ongst, Muadda, wonn i’ ollas bedenk! I’ und dö zwoa olt’n, feinen Leit’ – i’ pass jo goar net hin zu eahna!“
Die alte Frau begütigend: „Sei nuar ruahig, Lenarl! Unsa himmlischa Vodda wiard schou aa dös richti’ mocha! … Und nocha: Es is’ jo dei’ Monn bei dir!“
Das scheint der Magd Ruhe und Freude wiederzugeben.
Und ihre Hand auf die ihres Kindes legend, gleichsam als wollte sie Stütze suchen bei ihrem gebildeten Sohn, und ihn rüttelnd:
„Jo, sog’, Klaus, du redst jo koa Wort! Freust di’ denn goar net?“
Da hebt der Junge den Kopf und starrt für eine Atemzugslänge auf die beiden. In seinen Augen ist etwas, als erwache er aus einem tiefen, schweren Schlaf. Wie ein aufgeschrecktes Wild springt er auf die Beine und rennt, ohne auch nur einen Laut von sich zu geben, unter den Obstbäumen durch hinaus in die Felder.
Fassungslos starren die Frauen ihm nach, bis er ihren Blicken entschwunden. –