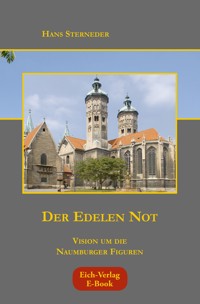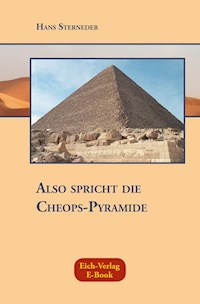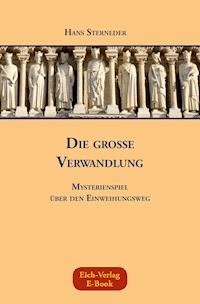12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erfolg von Sterneders Erstling, der schon in den ersten vier Jahren fünf Auflagen erreichte, erklärt sich nicht zuletzt durch die dichterische Gestaltungskraft seines Schöpfers und seiner tiefempfundenen, lebendigen Liebe zu seiner österreichischen Heimat. In der ihm eigenen unnachahmlichen Art schafft Sterneder liebenswürdige Figuren, kraftvolle Bilder und eine wunderbare Geschichte. Um es mit Ida Bon-Ed zu sagen: „Das Buch ist ein Idyll.“ Erzählt wird die Geschichte des jungen Wolf Hess, seine Kindheit bei der Großmutter in einem kleinen Bauerndorf, seine Lehr- und Studienjahre und schließlich sein Reifen zum anerkannten Schriftsteller und Gelehrten, der schlussendlich sein erstes selbstverfasstes Buch in Händen hält: „Die Wiederkehr des Heiligen Gral“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Sterneder
Der Bauernstudent
Roman
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2018
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2011
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlagfotos: © Lucina - Fotolia.com
Umschlaggestaltung, Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-50-2
Meiner über alles geliebten Mutter
1.
Heulend tollten die Winde über das kleine Dorf. Es waren stürmische Märztage. Schon über eine Woche kam der Föhn lärmend und polternd von Süden über die hohen Berge. Seit Abend war der Sturm umgesprungen und brüllte und schrie nun von Norden über die Ebene her.
Bellend sprang er durch die sternhelle Nacht, um die Häuser und Gehöfte herum, auf die Dächer hinauf, ritt eine Weile auf dem First, sich dann wieder in die Straßen stürzend, um mit scharfen Pfoten den Sand aufzuscharren und hoch in die Luft zu schleudern.
Dann wieder verkroch er sich tückisch, lauerte mit gierigen Augen und kam mit einer Wut angesprungen, so heftig, so unerwartet, dass es schien, als risse er alles nieder.
Das war ein Heulen und Bellen, ein Pfeifen und Knarren und Quieken und Poltern und Kreischen, dass man sein eigenes Wort nicht hören konnte. Kaum hatte man den Mund geöffnet, riss es einem schon der rasende Sturm aus den Zähnen.
Im unteren Dorfe hatte einer seine Bodentür nicht verschlossen. Der Knecht vergaß es wohl, als er Heu für die Pferde herabholte. Das war eine Nachlässigkeit, und die mochte der Sturm nicht leiden. So sprang er gerade gegen sie an. Ein paarmal sprang er so gegen sie, doch als sie sich nicht rührte, hielt er ein, schlich in die Seite – hei! und nun bekam er sie zu fassen! Wie sie schrie! Wie sie in den Angeln quiekte! Immer wieder schlug er sie mit dröhnendem Gepolter in die Pfosten.
Dort hatte einer die Dachluken nicht geschlossen! Ich will euch Ordnung halten! Und wohl zwanzig Hunde sprangen in das Heu und Stroh und wühlten mit scharfen Pranken.
Dann wieder fegten sie durch die Dorfstraßen, rüttelten an den Fenstern und pressten ihre feuchten Nasen an die Scheiben, dass sie leise knisterten.
Die Bauern hatten die Lichter ausgelöscht und lagen längst in ihren Ehebetten. Nur oben im Dorfe brannte noch ein Licht in einem kleinen Hause. Das machte die Winde neugierig. So sprangen sie fort um das Haus.
Die Turmuhr hatte längst die Mitternachtsstunde geschlagen, doch das Licht brannte noch immer. Regungslos saß die Heßin am Lager ihrer Tochter. Breit kroch ihr Schatten über das rotgestreifte Bettzeug die Wand hinauf.
Krampfhaft hielt das Mädchen die Hand der Mutter umklammert. Immer wieder traten ihr dicke Schweißperlen auf die fieberheiße Stirn. Wie ein Wurm krümmte sie sich. Es mussten arge Schmerzen sein, die sie litt, denn schreckhaft entstellte sich ihr schönes junges Gesicht. Doch keinen Augenblick wandte sie den Blick von ihrer Mutter. Zuckend riss es ihr die Hand auf und ab, die die Alte hielt. Hernach war es vorbei. Mit müdem, bleichem Gesicht lag sie in den Polstern. Sogar die Augen fielen ihr zu. Tief gekrümmt, als trüge es eine schwere Last, saß das Weib am Bett. Stumpf waren ihre Gedanken, so stumpf wie die Schatten dort in der Ecke. So brütete sie vor sich hin. Manchmal hob sie den Kopf und horchte nach dem Winde.
Gegen drei Uhr war es Zeit. Hastig nahm sie ihr dickwollenes Umhängetuch, legte es über Kopf und Schultern und eilte die sternhelle Straße hinab. Der Sturm sprang von allen Seiten an ihr in die Höhe und lief gegen sie an, dass sie sich vorneigen musste, um nicht umgeworfen zu werden. Wie Fahnen schlugen ihre Röcke. Sie hatte nicht weit; beim fünften Haus blieb sie stehen und hämmerte mit ihrer knochigen Faust ans Fenster. Eine kleine Weile, und die alte Anna Finckh kam aus der Tür. Sie hatte gewusst, dass es heute Nacht sein würde, und sich mit den Kleidern ins Bett gelegt.
*
„Is's schou sou*) weit?“, schrie die Hebamme. Barbara Heß nickte. Eilig kämpften sich die beiden Weiber durch den Sturm.
Stunde um Stunde verging, doch das Mädchen konnte nicht gebären. Immer ärger kamen die Wehen, immer lauter schrie sie auf – o wie sie schrie, viel lauter als der Sturm! Ihr schönes Gesicht glühte im hellen Fieber, die Augen glänzten wie zwei Feuer.
„Schtearb'n mecht i, schtearb'n“, wimmerte sie fortwährend, „i holt's nimma aus! Schtearb'n – – – Schtearb'n …“
„Weg'n dem muaß oan's net glei schtearb'n wolln, Purgi“, beruhigte die Finckhin die Kranke. „Sou is's schou vül'n gonga, und i hob' s' nou olwei' duarchibrocht.“
Immer wilder ging der Atem der Kranken, immer wirrer wurden ihre Reden. Dazwischen Schreie wie von einem gepeinigten Tier.
Als das die Heßin hörte, bekreuzigte sie sich. Unaufhörlich bewegte sie den Mund im Gebete. –
Als es zu dämmern begann, kam das Kind.
Als es zu dämmern begann, war das siebzehnjährige Mädchen tot. Still haben sie das arme Mädchen zu Grabe getragen, hart fiel die Märzerde auf den schlichten Sarg. Das waren bittere Zeiten für Mutter Heß!
In aller Herrgottsfrüh, am Tage Josef des Nährvaters, hasteten Barbara Heß und die korpulente Angererbäuerin mit einem dicht vermummten Bündel noch vor dem Morgenläuten der Kirche zu. Dort und da wandte ein früher Kirchengänger den Kopf nach ihnen. Aber der junge Morgenwind, der eben von den Wäldern über die Flur ins Dorf gestiegen kam, war neugierig und wollte wissen, was im Bündel war. Als er ein winzig kleines Menschenwürmlein drinnen fand, kam der Schelm über ihn und er blies dem Schläfer in die Nasenlöcher.
Als der Säugling darauf zu niesen begann, was die hastende Angererbäuerin hörte und mit einem herzhaften „Helf Gott!“ begleitete, sprang der Wind die Straße hinab und hielt, während er weiter hinuntertrollte, Ausschau nach neuerlichem Schabernack.
Vor dem Taufbecken im Gotteshaus sah die kleine Heidenseele, die mit aller Sorgfalt in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wurde, mäuschenstill mit vergissmeinnichtblauen Augen auf den alten, die Zeremonien vollziehenden Priester.
Nach der Frühmesse, nachdem er in der Sakristei den weißen Chorrock abgelegt hatte, holte der weißköpfige Pfarrer Bonifazius Altmann aus dem gewaltigen Barockschrank, in dem die jahrhundertealten, abgegriffenen Schweinslederfolianten standen, das letzte Taufmatrikelbuch heraus, schlug es auf und schrieb mit seiner noch immer klaren und schönen, nur ein wenig zitterigen Schrift hinein: Täufling: Wolfgang, unehelicher Sohn der verstorbenen Walpurga Heß.
So war nun die Wittib allein mit dem Säugling. Das Kind aber schrie stundenlang. Es war, als hätte es die Schreie seiner toten Mutter im Ohr. Und die Großmutter konnte nicht um ihn sein. War sie doch Witwe und musste verdienen. Nun erst recht! So war es denn ein Glück, dass sie in den Linnauerleuten liebe Nachbarn hatte. Die Großahne, ein altes weißköpfiges Weiblein, das schon manches Kind in ihrem Leben großgezogen hatte, nahm sich untertags, wenn die Heßin bei den Bauern in Arbeit stand, des kleinen Knäbleins an.
Zeitweilig, wenn das Kind gar zu arg im Nachbarhaus schrie, humpelte die Achtzigjährige hinüber, brachte es in Ordnung oder gab ihm zu trinken. Bevor sie ging, steckte sie ihm noch den Zuzl ins Mäulchen, ein Leinwandfleckchen mit eingebundenem, in Kaffee getauchtem Brot, das sie vorerst in ihrem zahnlosen Mund gehörig weich mummelte. Wie gierig der Kleine daran zu saugen begann! Leise machte sich die Alte sodann wieder davon.
So lag das Bübchen mutterseelenallein im Hause und hörte nichts in seiner Wiege als das kreischende Ticken der alten Pendeluhr.
Abends aber, wenn die Großmutter aus der Arbeit kam, nahm sie den kleinen Jungen aus dem Korb und wiegte ihn behutsam in ihren Armen. Wie er sich darüber freute! Und sie redete viel zärtliches, täppisches Zeug auf ihn ein, wie das Mütter in ihrer überquellenden Liebe immer tun, band ihn auf und ließ ihn mit den Füßen strampeln. Dabei bemühte sich das kleine Menschlein auch wohl, seine Zehlein in den Mund zu bekommen. Wie warm der Großmutter Lachen klang, wenn ihm dies gelungen war.
Ja, Großmutter Heß hat wieder lachen gelernt. Hart und schwer ist bisher ihr Lebensweg gewesen; zwei Männer hat man ihr auf den Gottesacker getragen. Zwei brave Männer obendrein! Sie ist aber nicht verbittert geworden, die harte Schicksalsfaust hat sie nicht kleingekriegt. Wohl hat sie ihr den Rücken fast nach vorn gebeugt, doch sie hat bald wieder den Kopf zu heben begonnen. Voll tiefem Vertrauen hat sie auf ihren Heiland geschaut und auf die teure, segensschwere Heimaterde – und da ist sie wieder steil und gerade gegangen wie in ihren besten Jahren. Weil sie aber ein tiefes Gottvertrauen in sich barg und alles in Seine Hände legte, empfing sie auch gefasst, was aus ihnen kam, und hat sich so bis in ihre ältesten Tage ein frisches Herz und ein schönes volles Lachen bewahrt. Das Lachen, das da sagt: Wir sind in Gottes Hand.
So freute sie sich denn bald aus vollem Herzen des Bübchens.
Vier Wochen nach der Taufe war Ostern. Am Ostersonntag, nachdem Barbara Heß aus der Frühmesse heimgekommen war und nach dem Kind gesehen hatte, ging sie unter den wärmenden Strahlen der Sonne ins goldgrüne Gras hinaus und pflückte beim fröhlichen Sang der Meisen, Zeisige und Rotkehlchen und dem schmelzenden Geflöt der gelbschnabeligen Schwarzamseln einen köstlichen Strauß Frühlingsblumen.
Heimgekommen, reihte sie alle die dunkelblauen Veilchen, hellen Leberblümchen, schneeweißen Buschwindröschen, eierdottrigen Hahnenfüße und Butterblumen sowie die kleinen rotgeränderten Gänseblümchen um das süße Köpfchen ihres kleinen Enkelbuben, legte ihm ein großes herzförmiges Blatt auf die linke Brustseite und zwängte ihm eine langstielige, mehliggelbe Himmelschlüssel in das verklammte Fäustchen.
So tat sie, während vom Turm die Glocken zur frohgemuten Auferstehung jubelten und mit ihren hellen Tönen den Ostersegen über das Dorf ausschütteten, den ihnen der Heilige Vater in Rom auf ihren Heimflug mitgegeben und den sie eifrig über die schneegekrönten Gipfel und eisigen Firne der Alpenkette nordwärts getragen hatten.
Sie sang dazu das Lied: „Der Heiland ist erstanden, befreit von Todesbanden“ und bat dabei den neuerstandenen Heiland, dass er das kleine Büblein da in der Wiege segnen und ihm ein leichteres Leben schenken möchte, als es die Sippe der Heßleute und der Neumayrs, aus denen sie selbst ersprossen war, allzeit gehabt hatten.
Und sich auf das Büblein niederbeugend, das mit himmelblauen Augen und roggengelbem Haarflaum in seinem bunten Blumenkrönlein mit der Himmelschlüssel im Fäustchen regungslos auf sie sah, so dass die einsame Frau nicht wusste, ob dies aus Freude an den Blumen oder ihres Osterliedes wegen war, küsste sie es herzhaft, machte ihm die heiligen Zeichen des Kreuzes auf Stirnchen, Mund und Brust und sprach dazu: „Im Namen Gottes des Vaters, sei allzeit gesund; und des Sohnes, führ immer einen Lebenswandel, dass Gott dich gern als Seinen Sohn ansieht; und des Heiligen Geistes, find dich im Leben gut zurecht und sei von Ihm geführt zu einem guten End', Amen!“
Seht, so ist Barbara Heß, die Taglöhnerin, das arme Weib, das ihr Lebtag nichts anderes gehabt hat, als ihre fleißigen Hände, ihren frohgemuten Sinn und ihre Frömmigkeit und nie etwas davon wusste, dass sie in ihrer Seele eine Dichterin war.
Als der Sommer kam und die Sonne warm auf die Felder schien, tat sie das Kind morgens in einen Korb und führte es auf einem Karren ins Freie. Hier stellte sie den Korb in den blumigen Wiesenrain, deckte ein Tuch darüber und ging an die Arbeit. Da hörte das Kind wieder den Sang der Vögel und das lustige Lachen der Taglöhner.
So ging der Sommer hin und immer mehr wuchs der Kleine aus der Wiege. Großmutter nahm ihn oft auf den Arm und ging mit ihm in den Stall zu den Ziegen. Wie da seine Hände bebten vor Lust und Freude, wenn die braven Tiere meckerten. Mit gierig gekrallten Fingern und stoßendem Körper verlangte er sie zu greifen. Da stieß er dann jedes Mal Laute aus, dass die Geißen verwundert den Kopf in die Seite legten und nach dem Buben guckten, der der Großmutter schier vom Arm springen wollte.
Oder sie führte ihn zu ihren Blumen. Es waren Großteils Pelargonien und Fuchsien, die beliebten Topfpflanzen aller Bauerndörfer, die in allen Farben prangten. Die Blumen waren ihre Freude. Auf stufenartigen ansteigenden Treppen standen sie an der Schmalseite des Ziegenstalles, die nach dem Häuschen wies. Wie all die bunten Farben dem Kleinen in die Augen sprangen! Fiebernd verlangte er nach ihnen. Gab sie seinem Drängen nach und hielt sie ihn zu den Blüten, patschte er blitzschnell in das lockende Wunder und begann mit krampfigen Fingern zu wühlen und zu zausen, bis das letzte Blättchen seinen Fäusten entglitt.
An Sonntagen waren sie gewöhnlich hinter dem Hof, im Gras des ansteigenden Obstgartens. Da saß Barbara Heß. Den geblümten Rock hochgeschürzt, lehnte sie an einem der Baumstämme. Der Kleine hockte in ihrem Schoße und Großmutter ließ ihre dunklen Augen bald auf den segensschweren Fluren, bald auf den nahen, niederen Bergzügen ruhen. Wie der Wald lockte! Und wie blau der Himmel war. In ihm hingen die Lerchen und ließen ihr helles Jubilieren wie Rosenkranzperlen auf die Erde niederrieseln. Wie köstlich still war es. Echte Dorfsommersonntagsstille. Zeitweilig unterbrach das kurze Gekläff eines Hundes den Frieden. Das war alles.
Wie ausgewechselt war das Kind. Hatte es früher ununterbrochen geschrien, so spielte es nun stundenlang, ohne nur das Mäulchen zu verziehen.
So konnte die Großmutter ungestört ihren Gedanken nachgehen. Viel dachte sie an die tote Mutter ihres Enkelkindes. Was war die einst für ein schmuckes, frohes Mädchen gewesen! Den ganzen Kopf voll Lieder und übermütiger Streiche. Sie sah auf das niedere Schindeldach des Nachbarhauses, das so tief in ihrem Hof hing, dass man sich draufsetzen konnte. Wie oft war das schelmische Ding mit bloßen Beinen das Dach hinaufgeklettert wie eine Katze. Wie die Sonne jetzt auf das Dach sprang! Es war ein heißer Tag. Behaglich puddelten sich die Hühner in den Sand des Hofes. Mit Wohlgefallen sah sie eine Weile dem Federvolk zu, dann sinnierte sie weiter.
Auf den First des Daches hatte sich eine Amsel niedergelassen. Schwermütig flötete sie ihr Lied. Lange ließ die Heßin den Blick auf dem Vogel haften. Plötzlich flog er davon. Lautlos schlich eine semmelgelbe Katze über das Dach des Nachbarhauses. Leise beugte sich die Heßmutter über den Kleinen, der gerade hohes Gras abrupfte, strich ihm ein paarmal mit der schwieligen Hand über das Haar, herzte und küsste ihn und sprach vielliebe gute Worte in sein waches Seelchen hinein. Mit hellen Augen lachte er zu ihr auf und wollte durchaus die ihren haben. Fortwährend griff er danach. Da blies ihm Großmutter in die Nase. Das aber mochte er gar nicht leiden. Wild fuchtelte er mit beiden Fäustchen herum und presste sie tollpatschig in sein Gesicht. So spielten sie eine Weile; hernach setzte sie ihn wieder auf ihren Schoß.
Allmählich kam der Abend aus den Bergen gestiegen, schritt über die Felder und trat ins Dorf. Nun stand Mutter Heß auf und machte sich daran, die Geißen zu füttern und zu melken. Bald darauf war es im Hause still. Tief gingen die Atemzüge der beiden Schlafenden. Nur die alte Perpendikeluhr hielt treue Wacht.
Durch die laue Sommernacht klangen die eintönigen, schwermütigen Lieder der Burschen.
2.
Als die Herbststürme kamen und das bunte Laub von den Bäumen schüttelten, musste der Bub wieder im Hause bleiben. Geduldig saß er in der stillen Stube, die für ihn voll tausend Wunder war. Auf allen vieren kroch er über die mit weißem Sand bestreute Diele. Bald langsam und bedächtig, bald in voller Eile. Dass das nur möglich war! Grunzlaute stieß er vor tiefem Behagen aus. Dann setzte er sich nieder und bedachte die Sache. Was doch der Mensch für ein Wunderding war. Was der alles konnte! Nein, es war nicht zu glauben! Und um sich's zu beweisen, dass es doch so sei, ließ er sich wieder auf die Hände und begann von Neuem zu kriechen in allen Gangarten.
Später hat er sich unter das Bett geschoben und die Geheimnisse seines Dunkels erforscht. Auch an den Spucknapf, der ungebraucht mit mehligen Sägespänen in der Ecke steht, noch aus der Zeit des Urahns her, ist er geraten und hat seinen Inhalt untersucht. Und was es da nur für spaßige Risse im Boden gab! Da konnte man die Finger hineinstecken und die ganze Stube entlang schieben. So sah er mit seinen klugen blauen Augen in seiner Welt rastlos herum, wie Kinder es tun, die alles selber erobern müssen. Einmal hatte Großmutter vergessen, die Tür des Wäschekastens zu schließen. Sie stand wohl nur eine Handbreit offen; aber als der Blick des Kleinen auf ihn zu ruhen kam, sah er sofort, dass da etwas nicht in Ordnung war, kroch hin, machte bedächtig und mit Verwunderung die Tür auf und begann mit immer mehr wachsendem Staunen Großmutters Wäsche auf den Boden zu häufen. Was doch so ein Ding alles in seinem Bauche barg! Ob ihm das Großmutter zum Essen gegeben hatte? Und ob er nun wohl Hunger hatte? Wie groß so ein Bauch war! Er muss dortmals arg ins Sinnen gekommen sein, denn als Barbara Heß heimkam, lag er im Kasten drinnen und schlief.
Später einmal hat er auch den Perpendikel der alten Stockuhr zu fassen gekriegt, und als darauf das ewige Gekreisch aufhörte, brachte er es richtig mit dem Ding da in Zusammenhang.
So kam und ging der Winter. Und als es Frühjahr wurde, lief der Bub und hatte basse Freude darüber. Was die Großmutter glücklich war! Wenn er nun allein in der Stube spielte und die warmen Sonnenstrahlen hell durchs Fenster tanzten, bekam er jedes Mal Lust, sie zu fangen. Von der Seite schlich er sich gegen sie und tappte nach ihnen. Weil er sie so aber nicht bekam, wollte er höher hinauf; und so kroch er mit vieler Mühe auf die alte Truhe beim Fenster. Wie er da hinaussah, erblickte er im Hofe die scharrenden Hühner, und das Verlangen, mit ihnen zu spielen, ließ ihn das Fangen der goldenen Seilchen vergessen. Wie der Knirps hinuntergekommen ist, das weiß er selber nicht. Er hat eine Weile geheult, hernach hat er sich auf die Hühnerjagd gemacht. Es ist ihm sauer geworden. Er hat geschimpft; oh, er hat viel geschimpft in seiner unverständlichen Art an jenem Tage! Verdrossen hat er sich auf den Staffel gesetzt und ist eingeschlafen. Die Hauskatze hat mit eingezogenen Pfoten neben ihm gewacht.
So fand ihn Barbara Heß, als sie abends aus der Arbeit kam. –
Und die Zeiten gehen und kommen.
Der kleine Wolfgang hat längst seine ersten Höschen bekommen und schon ein Paar wirklicher schöner Schuhe an den Absätzen schief getreten. Die Hände tief in die Hosensäcke gebohrt, die Füße breitspurig auseinandergestellt, so steht er in Hof und Garten und guckt in die Welt.
Oh, die Welt sah ganz anders aus von der schwindelnden Höhe zweier Schuhabsätze! War Großmutter einmal weiter weg in Arbeit, musste der Bub zu Hause bleiben. Er spielte dann im Hof, machte wohl auch die ersten Versuche, aufs Nachbardach zu klettern – eine Katze hatte ihn dazu angeregt – oder er schlüpfte den Regengang auf der anderen Seite entlang.
Diese Schlucht zwischen den beiden unbemörtelten Hausmauern aus Feldsteinen und roten Ziegeln war eine ganze, gruselige Welt für sich. Was es da an großen, verstaubten Spinnennetzen, alten, hochbeinigen, gespenstisch zappelnden Spinnen, toten Fliegen, laufenden Käfern mit schwarzen, glänzenden Buckeln, grauen Mauerasseln unter den roten Ziegelbrocken und langen, träg sich fortschleppenden Regenwürmern gab, das war gar nicht auszuschöpfen. Die reine Gruselkammer war dieser schmale Schlupf.
Hatte er sich durch ihn jedes Mal hindurchgeforscht und durchgeschauert, stand er vor einem Zaun mit einem bunten Gärtchen davor, und über dieses weg sah er auf die Straße und die nächsten Bauernhäuser. Hier lungerte er oft lange Zeit und sah, was sich im Dorfe zutrug.
Abends stand er jedes Mal auf dem Feldweg oben, der den Garten von dem Ackerland trennt, und spähte mit blanken, himmelblauen Augen über den weiten Feldkreis bis an die dunklen hohen Wälder. Hier hielt er nach der Großmutter Ausschau. Und wenn er sie kommen sah, er erkannte sie schon aus der Ferne, lief er ihr mit gehobenen Armen entgegen, schob seine kleine Hand in ihre, und lebhaft plaudernd stapfte er mit ihr dem Hause zu.
Oft nahm ihn die Alte auch mit ins Feld. In jener Zeit ist er zum ersten Mal mit einem Wagen gefahren und hat auch die Wunder der großen Bauernhöfe gesehen. Wie der Vierjährige die Augen aufriss, wenn ihn Barbara Heß den Kuhstall mit seinen vielen Tieren sehen ließ und er all das Futterraufen, Mantschen und Kettenklirren erlebte! Und dann die Rosse! Die gewaltigen Rosse, die wie Berge vor ihm standen, nein, wie Gebirge, und wie grollende Donner schnaubten und wie Blitze stampften. Wie der Kreuzschnabel im Käfig beim alten Flickschuster sprang sein Herz jedes Mal vor Lust und Schaudern in seinem Brustkasten herum, wenn er im Stall vor den Rossen stand.
Und die vielen Schweine! Großmutter hatte gar keine Kühe und Schweine. Wenn er einmal groß ist, dann will er auch Kühe und Schweine haben. Und ein Ross, ein ganz großes Ross. Auf das wird er sich mit der Großmutter setzen und durch die Welt reiten.
Aufmerksam sah er dem Knecht beim Anspannen zu – ja, das musste alles besehen sein, wollte man wissen, wie es dabei zuging! Und bald darauf rasselte der Leiterwagen los mit Knecht, Buben, Großmutter und den übrigen Arbeitsleuten. Das waren stets lustige Fahrten.
Draußen, während Großmutter arbeitete, hockte er sich auf den Wegrain, sah ihnen zu oder trieb sich spielend auf den Ackergrenzen herum. Besonders gern setzte er sich mitten in die prangenden Wiesen, fügte bunte Blumen zu einem Strauß zusammen, guckte in die Sonne und wurde es nicht müde, auf die hohen Bergriesen zu sehen, die tief in das reine Blau des Himmels ragten. Und weil ihm nie jemand törichtes Zeug vorsagte, kannte er auch kein Bangen. Ruhig nahm er jeden Käfer und Wurm in die Hand und spielte mit ihm. Da bekam er auch einmal eine Ameise zu fassen. Doch sie verstand keinen Spaß und biss zu. Das aber erschien dem kleinen Wolf, der nie einem Tier Leid zufügte, als arger Frevel; kaltblütig suchte er das krabbelnde Tierchen aus dem Grase, nahm es zwischen die Finger und drückte es platt. Seither quetschte er jede Ameise tot, die er sah. Großmutter hat er davon nie etwas gesagt. Später, als er groß war, hat er seine Kindertorheit sehr bereut und vorsichtig seine Stiefel über jede Ameisenstraße gesetzt, der er begegnete.
Ein andermal fand er das erste Grillenloch. Ohne Bedenken steckte er den Finger in die kleine Erdbehausung. Weil diese aber keinen Grund bekam, riss er einen langen Halm ab und steckte ihn in das Loch. Wie der Halm hineinkroch! Das wollte ja kein Ende nehmen! Entsetzt prallte er zurück. Ganz kalt lief's ihm für einen Augenblick über den Rücken. Ja, was war denn nur das! Ein schwarzer kleiner Teufel kam aus dem Dunkel der Höhle gefahren, mit zwei gewaltigen Hörnern vorn am Kopf. Doch der Schreck verging, und als das Tierlein die Gelegenheit benutzte, um in das Loch zurückzukriechen, begann er es mit aller Hingebung von neuem herauszukitzeln.
Hei, wie der schwarze Teufel springen konnte! Das war eine feine Jagd! Was waren die Käfer dagegen doch für plumpe Kerle! Seitdem hatte er eine Leidenschaft: Er konnte kein Grillenloch sehen, ohne sich nicht eilends nach einem Halm umzutun und mit der gesammeltsten Aufmerksamkeit seinem Jagdgeschäfte nachzugehen. Stundenlang kroch er die der Abendsonne zugekehrten Ackerböschungen ab und delogierte, delogierte. Einmal, mitten in der Arbeit, trug sich's zu, dass zwei Grillen bei ihrem unfreiwilligen Wandergang zu nahe aneinandergerieten – und eh sich's der Junge noch versah, waren sie im wärmsten Handgemenge. Ja, konnte denn so etwas auch vorkommen? Wolf traute seinen Augen nicht. Wie sie gegeneinander sprangen! Wie sie sich schüttelten und bissen! Das war ja toll! Heiß ging es her. Lange währte der Kampf. Plötzlich legte sich der eine auf den Rücken und streckte die Beine. Der wollte sich wohl verstellen! Vorsichtig nahm er ihn bei einer der hochgestreckten, stahlbläulich schimmernden Schienen. Nein, es war ihm voller Ernst; leblos hing er in der Luft. Wie sein glattes Körperchen in der Abendsonne glänzte!
Und dann kam mit einem Schlag das ganz Wunderbare. Irgendwo begann eine Grille und alle stimmten sofort wie auf ein verabredetes Zeichen mit ein, so wie in der Kirche beim Hochamt, wenn die Geiger und Flötenbläser zum Konzert ansetzen, und im Nu war das ganze Land in den süßen, sanften Schleier eines einzigen Grillengezirps eingewoben.
Dann legte sich der kleine Bub mit angehaltenem Atem auf den Bauch und lauschte mit vor Andacht klopfendem Herzen auf die Töne, die ringsum zwischen Gras und Blumen aus den sonnenwarmen Böschungen quollen.
So hat sich Wolf manche Stunde vertrieben. Kaum dass er die Großmutter hörte, wenn sie vom Felde her zum Jausenbrot oder zur Heimfahrt rief. In diesem ständigen Auf-sich-angewiesen-Sein wuchs er innig mit der Scholle und ihren tausend Schönheiten und Wundem ineinander und bekam ein Auge für Dinge, die anderen Menschen oft ein Leben lang verborgen bleiben. Und weil er so mit einem ewigen Verwundern in den hellen Augen zur Mutter Natur kam, gab sie ihm mit vollen Händen. Ihm unbewusst noch, legte sie schon dortmals einen Schatz in seine Brust, der später stark sein Leben und seine Entwicklung bestimmen sollte: eine große, tiefe Liebe zur Natur und seiner Heimaterde.
*
Der Winter war streng. Halbe Tage lang blieb Wolf im Bette liegen und verkroch sich unter dem schweren Federbett. Ganz geduldig blieb er darin liegen und jagte die Gedanken nur so vor sich her. Wenn es ihm aber einmal langweilig zu werden begann, streckte er behutsam das nackte Bein in die kalte Stubenluft, sich auf diese Art die Versicherung holend, dass es doch nirgends so schön sei, als unter der hohen wohligen Federlast. Ja, es war zu behaglich in Großmutters breitem Bett! So blieb er bis Mittag liegen, dann und wann den Kopf wie eine große Weinbergschnecke behutsam aus dem riesigen Federngehäuse reckend und in das tolle Treiben der Schneeflocken blinzelnd. Um elf kam die Alte aus der Arbeit; da musste er aus dem Bett. Ein wenig schnappernd und zitternd, stand er mit hängender Kinnlade und vorgeneigtem Körper in der Stube und war ganz gedankenarm. Nur manchmal ließ er einen Fluch los. Doch zerriss er ihn vorsichtig zwischen den Zähnen. Waren die Geißen gefüttert, verließen sie beide das Haus. Wolf ist viel in Kuhställen gesessen den Winter durch. Zu Hause war es kalt in der Stube – Großmutter musste Holz sparen –, in den Ställen aber war es warm, dunstig warm. Und in einer Ecke lehnten sicher ein paar Bündel Stroh, die legte er nebeneinander und streckte sich darauf. Nun sah er den Tieren zu. Oh, man konnte manches sehen, wenn man stundenlang regungslos hinter den Rücken der Kühe lag. Gedankenloses und Drolliges und hin und wieder auch solches, was gerade nicht sonderlich schicklich, aber notwendig schien. Und wie angenehm der Geruch war! Sagte nicht Großmutter stets, der Kuhgeruch sei gesund? In vollen Zügen atmete er ihn ein. So lag er in den Ställen durch den Winter.
Als der März wieder mit seinen Winden von den Bergen her angestürmt kam, wurde der Knabe fünf Jahre. –
Es war um die Zeit der Obstbaumblüte. Die Wiesen und Gärten standen im frischen Grün, an den Zäunen dufteten die Veilchen, die Vögel sangen dazu ihre schmetternden Lieder, und wo es nur immer anging, durchwirkte der Löwenzahn die grünen Teppiche mit seinen prachtvollen Goldstickereien.
Da kam eines Tages Barbara Heß' zweite Tochter aus der Stadt. Diesmal nicht auf Besuch; sie blieb. Wolf sah die beiden oft mit verweinten Augen. Besonders am ersten Abend hatte Großmutter viel geweint. Weil er aber keine rechte Antwort auf seine Fragen bekam, ließ er es. Tagsüber war er nun mit der Tante zusammen. Die kam ihm höchst seltsam vor. Stundenlang konnte sie in der Stube sitzen und vor sich hinstarren, immer unverwandt auf einen Fleck. Oder sie nahm den Kleinen plötzlich in ihre Arme, drückte ihn fest an die Brust und fing zu weinen an. So bekam Wolf, der Tränen nicht leiden mochte, eine immer größere Scheu vor dem Mädchen. Schließlich ging er gar nicht mehr in die Stube. Den ganzen Tag trieb er sich draußen herum.
Es mochte etwa am zehnten Tage sein, seit das Mädchen heimgekommen. Im Garten standen die Apfelbäume im feenhaftesten Rosakleide. Bald, nachdem Großmutter das Haus verlassen hatte, schickte das Mädchen den Buben ins Dorf hinunter zum Krämer. Er trottete behaglich die sonnige Straße hinab und war froh, aus dem Hause zu sein. Er machte es sich auch gar nicht eilig. Bei jedem Hoftor sah er hinein, blieb wohl auch eine Weile stehen, blickte den Ochsenwagen nach und betrachtete die Kinder, die zur Schule gingen. So kam er endlich zum Krämer, stellte sein Verlangen und machte sich auf den Heimweg. Ob heuer die roten Pfingstrosen wieder so schön blühen würden und die hohen Malven an der Mauer und die Stöcke mit den fliegenden Herzen, dachte er, als die Tür des kleinen Vorgartens ins Schloss fiel. Rasch trat er in die finstere, brandig riechende Küche, auf deren offenem Herd über einem schwachzüngelnden Feuer der große angerußte Kupferkessel an der alten Kette hing. Weißglänzend schimmerte das dicke Rauchpech am uralten, mächtigen Trambaum auf, als das Licht des Tages in das Dunkel huschte. Wolf sah herum. Die Tante war nicht hier. In der Stube war sie auch nicht. Auch im Hofe nicht. Vielleicht war sie in den Ziegenstall gegangen. Die Tür war von außen geschlossen. Wo mochte sie nur sein? Ratlos sah Wolf vor sich hin.
Da kam ihm ein Gedanke. Sie konnte in den Garten gegangen sein. Hier, mitten in all dem Osterwunder, er traute seinen Augen kaum, sah er das Mädchen an einem über und über mit Blüten besäten Apfelbaum hängen. Leise schaukelte ihr Körper am untersten Ast hin und her. Entsetzt starrte der Kleine auf die Tote, und doch sah er die Bienen ruhig von Blüte zu Blüte fliegen – er hatte vielleicht noch nie so gut Bienen von Blüte zu Blüte fliegen sehen! –, hörte das Lied der Vögel, und sogar den braunen Käfer sah er den Stamm hinaufklettern. Oh, es entging ihm nichts! Und dennoch sah sein Auge ununterbrochen mit weit geöffnetem Blick auf die Erhängte. Es schien, als ob das Grässliche seine Sinne vervielfacht hätte. Darauf aber packte ihn ein derartiges Entsetzen und eine solche Angst, dass er wie ein kopfscheu gewordenes Fohlen mit schlagender Brust so wild durch den Hof fegte, dass er die in der Sonne brütenden Hühner beinahe niedergetreten hätte. Wie ein abgeschnellter Bolzen flog er, am ganzen Leibe zitternd, durch Stube und Feuerküche hindurch und auf die Dorfstraße hinaus, dieselbe in wildem Galopp hinab und zum Dorf hinausbrechend, dass eine riesige Staubfahne hinter ihm nachwehte. Draußen sprang er wie ein gehetzter Hase querein über Wiesen und Äcker, bis er die arbeitende Großmutter gewahr wurde, der er mit gestikulierenden Armen und keuchender Brust unverständliche Laute entgegenschrie.
Als die Heßin den rasend feldein laufenden Buben sah, eilte sie ihm, von furchtbarer Ahnung gepackt, mit schlagender Brust entgegen, schon von weitem seine gellenden Schreie vernehmend: „Groußmuadda, d' Nani hengt am Baam!“
Die Leute sahen, wie sie die Hände über dem Kopf zusammenschlug und dann zu laufen begann, dass der kleine Bub ihr kaum zu folgen vermochte.
Den ganzen Weg wimmerte und jammerte sie in sich hinein, dazu laut schluchzend: „Nani, wos hast denn 'ton, wos hast denn deina olt'n Muadda on'ton!“
Doch als sie im Garten stand, kam kein Wort des Vorwurfs mehr über ihre Lippen. Unaufhaltsam strömten ihre stillen Tränen. Nur manchmal ein Röcheln, das klang, als steinige jemand ein Tier tot. Wie ihr aber die Nachbarsleute das Mädchen vom Baum heben halfen und es im Grase lag, stieß die Unglückliche einen Schrei aus, so furchtbar und gellend, dass es schien, als entwiche mit ihm die Seele. Bewusstlos stürzte sie über die Tote. Als das der kleine Wolf sah, meinte er, nun wäre auch die Großmutter gestorben, und in seiner grenzenlosen Angst begann er zu schreien und an ihr zu zerren und sie zu bitten, sie möge doch aufstehen, möge nicht sterben, ihn nicht allein lassen, dass es allen Umstehenden eisig kalt bis zum Herzen stieg.
Und Barbara Heß hörte den armen Jungen. Sie raffte sich auf und drückte ihn krampfhaft an sich. Nun stand sie wieder fest und steil. Sie war ja nicht ganz geschlagen, nicht ganz verlassen. Gott hatte ihr ja den lieben Buben gegeben.
Regungslos saß sie die ganze Nacht bei der Toten. Der Bub war nicht von ihrer Seite wegzubringen gewesen und nicht von ihr gewichen und schließlich zu ihren Füßen eingeschlafen.
Was mag Barbara Heß in jener Nacht gedacht haben? Endlos war sie, und immer wieder flog Bild um Bild ihres harten, schweren Lebens an ihr vorbei. Alles, alles hatte ihr der Tod genommen: die drei Männer erst und nun die Töchter. Nur der Bub zu ihren Füßen unten war ihr geblieben. In Bitterkeit schrie es in ihrem Innern auf: Willst du mir auch den noch nehmen? – Dann aber erschrak ihre fromme Seele aufs Tiefste, und die Hände wie schützend über das schlafende Enkelkind haltend, faltete sie sie zu heißem Gebet, Gott arg angehend, den Kleinen in Seine Hände legen zu dürfen und ihr dies Letzte, das ihr noch geblieben sei, ein Lebtag zu behüten und zu lassen.
Und endlos ging die Nacht. Was war das dort? Hing dort nicht ihre Tochter am Baum? Das war doch alles nur Spuk! Ihr Kind lag ja vor ihr im Bett, starr und kalt. Aber doch, sie sah es ganz deutlich: Leise bewegte sich die gestreckte Gestalt hin und her. Ging denn der Wind? Sie spürte doch nichts. Und was war das? Um des Himmels willen! Krochen da nicht hässliche schwarze Raupen den Stamm hinauf? Immer neue! Endlos an Zahl! Wie scheußlich sie sich bogen! Hatten die Eile! Wie sich ihre Rücken krümmten! Nun schoben sie sich den dicken Ast hinüber, an dem ihre Tochter hing. Was sollte das, heiliger Gott, was sollte denn das! Schon spannte sich die erste die Schnur hinunter. Ein eiskalter Schauer ging über Barbara Heß. Heftig bogen sich ihre Schultern nach vorn. Nur noch einen Augenblick und die Raupe würde ihre hässlichen nackten Füße auf den Kopf der Toten setzen. Und dann würden sie alle kommen, alle würden sie dasselbe tun, alle ihre nackten Beine auf den Kopf ihrer Tochter setzen.
Entsetzt schlug sie die Hände vor das Gesicht. Und wie sie so dasaß, die Hände in die Augen gedrückt, wusste sie es: die Schande, die Schande! Nun kamen sie erst, die peinigenden, nagenden Gedanken. Wie sie sich ins Herz fraßen und bohrten! Was muss die Frau in jener Nacht gelitten haben! Sie, die nie auch nur einen Heller unrecht erworben, die ihre Kinder ordentlich und gottesfürchtig erzogen hatte, musste das an ihrer Tochter erleben! Dass sie sich doch im Mutterleib an der Nabelschnur erhängt hätte, wie Tiefenböck Lenas kleiner Wurm! Dann aber sah sie das Mädchen vor sich, wie es so frisch und froh mit ihrer Schwester durch die Kindheit gesprungen war, immer gut und lieb und brav. Und wie schön sie hatte singen können! Wie ging doch gleich ihr Lieblingslied, das sie so schwermütig weich zu singen verstand?
Ich ging im Walde so für mich hin,
Um nichts zu suchen, das war mein Sinn …
Ja, das war's! Deutlich schien es der Alten, als höre sie das feine, süße Kinderstimmchen. Wie aus weiter Ferne kam's – wohl vom Garten her. Sie würde es sicherlich besser vernehmen, wenn die alte Stockuhr nicht so laut ginge. Immerfort tönte ihr das Lied im Ohr. Fern, fern und doch so deutlich. Lang saß sie so da, lauschend den Kopf vorgeneigt. Hernach bat sie Gott inbrünstig, Er möge ihr die harten Worte verzeihen. Nein, nein, es war doch zu schön gewesen, dass sie zwei solch liebe Dinglein besessen hatte!
Und wieder wanderten ihre Gedanken zu dem kleinen Wolf, der still und ruhig zu ihren Füßen schlief, und noch einmal ging sie Gott hart an, ihn ihr gesund zu erhalten und gut und brav.
Draußen graute es allmählich. Regungslos wie ein Bildstock saß Barbara Heß.
Im Stall begannen die Ziegen zu meckern. Entschlossen stand sie auf; die Geißen sollten zu ihrem Recht kommen. Dabei wurde auch Wolf munter. Schlaftrunken wischte er die Augen; dann stand auch er auf den Beinen. Großmutter hantierte in der offenen Feuerküche, hell züngelten die Flammen um den Feuerkessel. Wolf, der zu ihr herausgeschlichen war, sah sie eine Weile mit großen Augen an. „Wos denn, Woifarl?“, fragte sie mit müder Stimme.
„Groußmuadda“, flüsterte das Kind beklommen, „deine Haar san ganz weiß.“ Ja, Barbara Heß' Haar war über Nacht schneeweiß geworden, obwohl sie erst einundvierzig Jahre zählte. –
Einige Wochen nach dem Begräbnis bekam Wolf seinen ersten Freund. Er saß wieder einmal allein im Garten oben und sah über die Felder weg, die hohen Berge hinauf. Da stand mit einem Male ein Bub vor ihm, der ungefähr in seinem Alter sein mochte. Braun wie Bernstein guckten ihm die hellen Augen aus dem Kopf, das blonde Haar hing ihm ein wenig wirr in die Stirn. Wie Wolf hatte er nichts als Hose und Hemd am Leibe. „Du, wem g'hörst d'n“, begann der Braunäugige.
Wolf maß den Frager, dann gab er trotzig zurück: „Geht dös di wos o'?“
„Wem's d' g'hörst, mecht i wiss'n!“, drohte der andere.
„Neamd!“, kam es patzig aus Wolfs Munde.
„Du, schpül' di nöt, i kimm sunst owi und hau di!“
„Hau mi!“, rief Wolf, vom Boden aufspringend.
Als er oben auf dem Weg stand, begann der Fremde zu lachen. „I mog ja goar net raffa. Es is ja nuar a G'schpoas g'west! I bi da Schnöllinga-Koarl; wear bist d'nn du?“
„I bi da Heß-Woif!“
„Ja so, und bist du da dahoam?“
„Ja.“
„I bi duart ob'n dahoam, wo da rodi Raupfong hearschaut.“
„Wos is d'nn dei Vodda?“, fragte Wolf Heß.
„Nachtwochta.“
„Nachtwochta? Gölt, da is a nocha dear, dear wos in da Nocht schreit?“
„Ja, dös is mei Vodda.“
„Und wos is d'nn da deini?“, fragte der Schnellinger-Bub wieder.
„I hob koan Voddan.“
„Du host koan Vodda?“
„Na!“
„Nou, oba a Muadda wiarst dou' hom?“
„Naa, dö hob i aa net.“
Der andere sah ihn misstrauisch an:
„Geh, glaubst i bi deppat! Wen hätt'st d'nn nocha denn?“
„D' Groußmuadda!“
„D' Groußmuadda? Sunst hä'st d' nocha neamd?“
„Na.“
„Dös kon i net glaub'n.“ Und sich lebhaft überstürzend, als wäre ihm etwas besonders Helles eingefallen, um die Wahrheit herauszubekommen:
„Sog': Da Heargood soll mi schtroffa, wonn 's net woahr is! Siagst, dös traust da net!“
Darauf Wolf laut und ein wenig ärgerlich:
„So loss' mi dou' red'n!“ Und mit der größten Gelassenheit der Welt:
„Da Heargood soll mi schtroffa, wonn 's net woahr is!“
Zwei kugelrunde Bernsteinaugen spähen großmächtig erstaunt auf ihn und lebhaft sprudelt's in hellsten Tönen von den Lippen des Nachtwächterbübleins:
„Du, du host oba a Todsind', wonnst mi o'g'log'n host! Nocha kimmst in d' Höll'! Mei Muadda hot 's g'sogt! Dass d' as woaßt!“
Über das Gesicht mit den Vergissmeinnichtsternen zieht es verächtlich:
„Auf d' Höll' scheiß i!“
Der andere aufgeregt dazwischenbrüllend, dass er ordentlich in die Höhe zappelt:
„Au, au, hiatzt host a Todsind!“
„Jou, an Dreck hob i, oba koa Todsind! Weg'n da Höll' hot oans koa Todsind net. Dass d' as aa woaßt, dös sog da i!“
Darauf die weitaus gläubigere Entgegnung:
„Nou jou, oba dass oans hoit nuar a Groußmuadda hätt' …“
„Muaßt as eh net glaub'n. Es hot da jou neamnd g'schofft, dass d' as glaub'n muaßt!“
Ein letztes langes, ein wenig zages „no jou-u“ ließ sich noch vernehmen, dann wussten beide, woran sie waren, und weil sie fühlten, dass sie sich vertragen konnten, wollten sie miteinander auf die Wiese hinaufgehen und Blumen pflücken. Munter wanderten sie die Feldraine entlang im hohen Gras, immer zwischen Klee-, Kartoffel- und Kornfeldern. Wacker schritten sie aus; es war ein beträchtliches Stück bis zu den Waldwiesen. Endlich hatten sie die schönen saftgrünen Hänge erreicht. Über und über waren diese mit bunten Blumen besät. Dazwischen standen vereinzelte Birken mit schlanken weißen Stämmen, und am Waldesrand lag ein mächtiger Busch Heckenrosen. Von der Höhe herab klang das Schellengebimmel der weidenden Kühe.
Emsig stapften die beiden Buben in den Wiesen herum, große Sträuße roter, gelber und blauer Blumen pflückend, wobei ein freudiges Leuchten über ihre Augen ging, wenn sie eine neue Blume fanden. Plötzlich blieb der heitere, übermütige Karl Schnellinger überrascht stehen und rief: „Au, au, a großa Heihupfa, a greana!“
„Je, je, a greana Heihupfa!“
„Warum muaß d'nn dear sou großi Aug'n hom?“, wandte sich Karl an seinen Gefährten.
„No woaßt d', dass a siacht!“
„Dass a siacht, moanst d', muaß a sou großi Aug'n hom? Kuntat a sunst leicht net sehg'n?“
„Na“, gab Wolf breit zurück, als hätte er das aus Büchern studiert.
„Oh, do schau, hiatzt hupft a!“
„Fong' 'hn,'n Heihupfa!“, trumpfte Wolf auf, der des andern Scheu bemerkte.
„I trau mi net!“, gab der freimütig zu.
„Woarum d'nn net?“
,,Jo woaßt, wei a mi beiß'n tuat; woaßt, de groß'n grean Heihupfa tan fest beiß'n, nocha muaß ma schtearb'n“, wollte Karl Schnellinger seinem Freunde glaubwürdig machen.
„Hi, hi“, lachte Wolf, „sei net sou dumm. Do muaß ma goar net schtearb'n!“
„No, woarum tuast 'hn nocha denn du net fonga, wonnst di net fiarchst?“
„Geh', wear sogt diar d'nn dös, dass i mi fiarcht? I fiarcht mi jo goar net!“
„Ui je, hiatzt mocht a's mit di Flieg'l a sou! Schnöll, fong 'hn, sunst fliagt a davo'!“
Beide gehen vorsichtig auf die Heuschrecke los. Dicht vor ihr bleiben sie stehen. Gespannt blicken sie auf den grünen Gesellen; fragend lugt er zu den Abenteurern hinauf. Oben auf einer Birke sitzt eine Kohlmeise und lacht. Da macht der Grüne: hupf, hupf, über Gras und Blümlein. Aufmerksam blicken ihm die Buben nach. Er ist nicht weit gesprungen; er scheint heute träge zu sein. Oder hat er keine Angst vor den beiden?
Behutsam kommen sie wieder heran.
„Siagst, dass da 'hn nöt z'fanga 'traust“, spottet Schnellinger.
„Wear traut si' hn' nöt z'fonga?“, gibt Wolf gereizt zurück.
„Du!“
Da beugt sich Wolf Heß zum Springer nieder, krümmt die Finger zur Zange und meint: „Sog nou amoi, dass i mi net trau!“
„Na, du traust di aa net!“
Auch der Heuhupfer muss so geglaubt haben, denn er blieb ruhig hocken. Schwupp! Und der kühne Jäger hatte ihn mit Daumen und Zeigefinger hinter dem Kopf gefasst.
In heller Verwirrung zappelte der grüne Optimist in der stolz gegen den Himmel gehobenen Hand Wolf Heß'.
Der Bernsteinäugige riss Maul und Augen weit auf. Patzig lachend hielt ihm der kühne Jäger das heftig zappelnde Insekt vor die Nase. Karl wich ängstlich zurück. Wolf drängte ihm nach, fuchtelte ihm mit dem gespenstischen Tier weiter bedrohlich vor dem Gesicht herum und fragte den ungestüm Abwehrenden:
„Hiatzt sog', hob i mi traut oda net?“
Karl sah seinen Gefährten bewundernd an:
„Jo, du host di eh traut! Oba hiatzt gib a Ruah und hör auf mit dem Viech, und schmeiß 's furt!“
Wolf aber fühlte, dass er sein Heldentum noch ein wenig auskosten müsse, und es auch für den andern gut sei, wenn dieser sich gründlich einpräge, was er für ein Kerl sei, und so begann er, ihm erneut mit dem aus Leibeskräften aufbegehrenden Tier, so dass ihm heimlich dabei selber ganz ungut wurde, an den Leib zu rücken.
Der Zurückweichende wehrte mit beiden Händen ab und schrie:
„Hiatzt hörst oba auf, sunst renn i diar davo! Oba nocha siagst mi dei gonz' Leb'n nimma!“
Und plötzlich listig die Hand nach dem Dorf streckend:
„Hörst as? Host as g'hört? D' Muadda hot g'schriean! Hoamkemma miaß ma. D' Muadda woart scho auf uns!“
Wolf sah nach der Sonne, die noch hoch am Himmel stand, schüttelte lachend den Kopf und sagte:
„Lughaub'n, mi kriagst net dron, d' Muadda wort' nou long net!“
Dann aber warf er die Heuschrecke hoch in die Luft. Als das Tier die Freiheit spürte, spannte es die grünen Deck- und die zarten Glasflügel, dass sie wie pures Silber in der Sonne glänzten, und flog mit großem Gesurr durch das Himmelsblau.
Gegen Abend sind sie fröhlich singend, mit großen Blumensträußen ins Dorf hinuntergestiegen.
Karl Schnellinger ging gleich noch mit; er wollte das Haus und die Großmutter kennenlernen. Erst besahen sie sich sachkundig die Geißen, wobei sich Karl über die großen Euter wunderte, hernach führte ihn Wolf zu den vielen Blumentöpfen. Die gefielen Karl besonders. So etwas gab es bei ihnen zu Hause nicht. Nachdem er auch einen Blick in den Schuppen getan, wollte er die Stube besehen. Dazu aber musste Wolf hinten anschieben; so kam er das Fenster hinauf. Gemächlich mit dem Bauch auf dem Fensterbrett liegend, besah er sich den Raum. Er war sichtlich davon befriedigt.
Später lernte er auch die Großmutter kennen, und weil ihm auch sie gefiel, kam er nun täglich. Großmutter sagte der gute schelmische Bub, der vor Heiterkeit strotzte, ebenfalls zu, und sie war froh, dass Wolf, der bisher sehr zurückhaltend gewesen war, sich ihm, wie es schien, mit ganzem Herzen angeschlossen hatte. Er war ihr ohnehin zu ernst gewesen für sein Alter, und sie selber konnte seit dem Tod ihrer zweiten Tochter nimmer lachen und scherzen wie früher. Deshalb sah es die Alte mit großer Befriedigung, dass die beiden bald unzertrennliche Freunde wurden. Von früh bis spät steckten sie beieinander, krochen auf das Nachbardach oder in den Regengang, spielten im Hof und lagen stundenlang träg in der Sonne. Auch im Dorfe selbst trieben sie sich viel herum. Am liebsten aber waren sie draußen in den Feldern oder unten beim Bach. Häufig gingen sie auf den Acker hinaus, wo Großmutter arbeitete. Stundenlang waren sie dann hinter den Grillen her. In jedes Loch guckten sie, in alle Winde lugten sie. Es war ein liebliches Bild, wenn die beiden barfüßigen Buben, nur mit kurzer Lederhose und Hemd bekleidet, auf dem Feldrain standen und in die Abendsonne blickten.