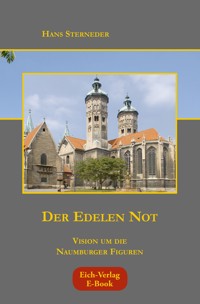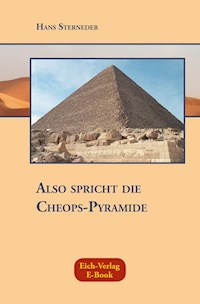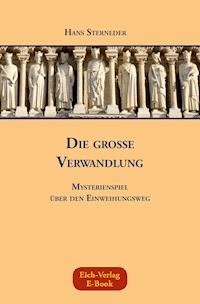12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Roman vom Walzbruder Beatus Klingohr ist Hans Sterneder ein Meisterwerk der Landstreicher-Literatur gelungen. In prächtigen Bildern lässt er den Leser eintauchen in die schillernde Welt der Landstraße des 19. Jahrhunderts. Himmel und Hölle erlebt Beatus Klingohr auf seiner Suche nach dem „Wunderapostel“ und immer wieder kreisen seine Gedanken um den Sinn des Lebens, die Geheimnisse der Natur und - um Gott. „Der Sonnenbruder“ (Erstauflage 1922) wurde von der Kritik zu einem der besten Landstreicher-Romane seiner Zeit erhoben. Erzählt wird die Geschichte des Walzbruders Beatus Klingohr, den ein Schicksalsschlag auf die Landstraße treibt und der sich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Wunderapostel macht. Im Mai 2008 hat der Eich-Verlag in Werlenbach/Westerwald seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Der im November 2007 gegründete Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, das literarische Werk des österreichischen Dichters und Mystikers Hans Sterneder (1889-1981) neu aufzulegen und fortzuführen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Sterneder
Der Sonnenbruder
Roman
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2018
© 2008 Thomas Eich-Verlag, Werlenbach
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlaggestaltung: Lisa Schamschula
Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-42-7
Dem besten Freunde und liebevollen Förderer,
ERNST HAUSAMANN
in Heiden (Appenzell), Schweiz, in Liebe.
Erstes Kapitel
Es war um die Stunde, in der die Märchen lebendig werden.
Ein heißer, strotzender Julitag hatte vom Lerchenstieg bis zur Sonnensinke mit seiner ganzen Glut über der Chiemseelandschaft gebrütet und schickte sich nun allgemach an, zur Ruhe zu gehen. Das Sonnenrad hatte sich dabei so heiß gelaufen, dass es mit einem Male zu brennen begann. Das rief einen ungeheuren Aufruhr an der gewaltigen, azurblauen Himmelsglocke hervor, denn in hingebendster Anbetung waren ganze Scharen mächtiger, weißballiger Wolken dem göttlichen Gestirne gefolgt, teils um ihm Verehrung zu bezeugen, teils um ihm kühlende Schleier zu reichen. Und nun brannte die Sonne und lohte derartig gewaltig, dass selbst die größten Wolken wild aufgrellten und die Flammen des brennenden Rades das traumhafte Weiß der Himmelsschiffe in glutendes Rot verwandelten. Die kleinen Segler und Boote jedoch, die sich zu nah ans Lichtrad gedrängt hatten, waren im Augenblick prangend vergoldet. Über den ganzen Himmel warf sich der Feuerschein und erhellte die Kuppel des göttlichen Domes mit jenem erhabenen, feierlich stimmenden Licht, wie es ehrwürdige gotische Gotteshäuser erfüllt, wenn sie vom duftenden Schein unzähliger Wachskerzen durchflutet sind. Und was sich am Himmel in grandioser Farbenpracht abspielte, das fing der unübersehbare Spiegel des auengesäumten Sees auf, so dass es aussah, als hätten Scharen von Bergmännchen verborgene Tore am Boden des Sees geöffnet, aus denen die Flammen ihrer unterirdischen Erzessen brachen. Der östliche Teil des Sees aber wurde von dem Gestirn des Tages in einen so gewaltigen Goldschatz verwandelt, wie ihn kein Fürst der Welt, selbst nicht einer aus den Sagenländern des Orients, besaß.
Jedes Wesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, war von diesem Geschehen erfüllt und es schien plötzlich, als hielte die ganze Natur den Atem an.
Es ging wie ein Beten über die Erde und den Himmel. Und nachdem das inbrünstige Gebet beendet war, stimmte jedes Geschöpf, nach Art und Können, in einen brausenden Choral ein, der so wundersam klang, dass es war, als ob Gottvater selber spräche.
Und so war es auch.
Er hatte sich im Weltenraume zurecht gesetzt und die Erde als Seinen Fußschemel genommen. Und so kam es, dass es in dieser Stunde seltsam feierlich auf der Erde war. Und dass ein Lobpreisen und Danken von diesem kleinen Gestirn aufstieg wie von keinem andern in dieser Stunde. Und wie hätte es auch anders sein können, da doch Gottvater seine Füße auf ihm ruhen ließ!
So war denn Sein Leuchten am Himmel und auf allen Wassern, ein Singen und Flöten und Schmelzen von jedem Gezweig und ein derart berauschendes Honigduften aus allen Kelchen, dass selbst die Schmetterlinge ganz trunken wurden und verwirrt von Blüte zu Blüte taumelten, ohne sich setzen zu können.
Fische stiegen an die Oberfläche und wollten vor Freude Kringel in die bewegungslose Goldfläche stoßen, hielten aber immer wieder im letzten Augenblick inne, so groß war ihre Verehrung vor dem feierlichen Gesetz der Harmonie, das auf den Wassern lag.
Die uralten Bäume in den weit sich dehnenden Auen, die besonders am Nordufer des Sees tief in das Sumpfland hinausgedrungen waren, hielten ihre starken Arme dem Schöpfer entgegen, auf dass Er die unzähligen Nester segne, welche die Vögel in ihr Gezweig gebaut und in denen sie mit Glücksschauern, die unter der Rinde bis zu ihren Wurzeln hinabrieselten, die zweite halbflügge Sommerbrut wussten, tausend neue, selige, noch ungesungene Lieder ahnend.
Als dies der Ewige sah, ging ein leises Lächeln über Seine Züge.
Da begann im Süden der Firnkamm der Alpenkette überirdisch zu leuchten wie die Edelsteine am Gralskelch von Montsalwatsch.
Tiefer und tiefer rollte das brennende Rad, doch leuchtender und prangender wurden die Farben am Himmel.
Es war wie ein berauschendes Feuerwerk, wie ein Fest der Götter. Und so war es auch.
Denn es war der Scheidegruß, den die Majestät der Sonne der betrübten Sternbrüdergemeinschaft des Krebses gab, in der sie einen Monat lang geweilt und aus der sie in dieser Nacht für elf lange Monate scheiden würde, um kommenden Tages ihre Regierung bei den Lichtfürsten des königlichen Löwen anzutreten.
Das aber erfüllte die Gestirne des Krebses mit wehem Schmerze, denn wer kann den Hohen von sich gehen sehen, ohne unruhig zu werden! Und so gab der leuchtende Gott seinen trauernden Gastgebern im Weltenraum dies bitterfeierliche Scheidefest.
Doch die Göttlichen wissen, wann es genug ist.
Und so kam es, dass sich der Gott des belebenden Lichts leise, fast unmerklich aus dem brausenden Feste zog, als alle Chöre noch tönten und alle Lichtkünste noch lohten.
Allgemach aber brannte Kerze um Kerze am großen Himmelssaale ab.
Doch siehe, mit einem Male kam ein erneutes Aufglühen aus dem Grunde des Sees, so feierlich, so unaussprechlich, dass jedes Wesen, das den Ewigen Vater erkennen konnte, wusste, dass seine wahre Heimat nicht hier auf Erden sei und der Allmächtige über den Räumen der Welten auf den Heimgang aller seiner Kinder harre.
Täglich um diese Stunde, wenn das Sonnengold zu zerfließen beginnt, harrt der See auf ein zauberhaft schönes Bild über sich. Siehe, da ist es wieder! Goldgeränderte Seerosen hauchen über ihn. Es ist eine im hellen Widerscheine des Lichtes märchenhaft dahinschwebende Schar von Silberreihern, die den nördlichen Auen zustreben, deren hohe Eichenbäume ihre Horste bergen. Wie weißballige Wolken, deren Ränder mit goldigrotem, grellem Schimmer eingesäumt sind, ziehen sie über den farbentrunkenen Abendhimmel, mit gelassenen Ruderschlägen ihren Schlafbäumen zusteuernd, die langen Stelzen zurückgestreckt, den Hals weit nach hinten gelegt, so dass der blendend leuchtende Silberschmuck der Schopffedern leise im Luftzuge weht.
Geisterhaft gleiten sie über den klaren, dunklen Augenstern des Sees, bis sie mit lautem Freudengekreisch und heftigem Flügelschlag in ihren Horsten einfallen.
Die Bäume und Blumen am See, deren Wurzeln im Wasser stehen, spüren die Erregung und freuen sich mit. Grüßend lispeln die Erlen, unauffällig überzittert es die schmalen Blättchen der Weiden. Ein Rudel Blässenten, die im dichten Gewirr einer breiten Seerosensiedlung gründeln, hebt die Köpfe und eine von ihnen, der alte Erpel, steilt den grünblau schillernden Kopf in die Höhe.
In der Nähe der Blässenten stochert ein Regenpfeifer am kurzgrasigen Ufer, so geschäftig, dass er der Einzige scheint, dem das Schauspiel entgeht.
Am Himmel sind allgemach die letzten Farben verglüht und majestätisch steht er mit wenigen, stetig zerfließenden Wolken in seiner Einsamkeit.
Waren die stolzen Segelschiffe des Luftmeeres in die Tiefe gestürzt? Hatten sie sich unmerklich heruntergesenkt in die breiten Auen des Sees?
Fast konnte man es glauben, denn rings von allen Ufersäumen wogte und kroch es behutsam in weißfahlem Hauche heraus, allmählich dichter werdend, sich hebend, bewegend, dort Sträucher umtanzend, hier den langen Schilfbusch überschleiernd, dabei sich ständig verdichtend und als bewegliches Tuch über das Wasser spannend.
Mild und klar hatte sich der Abend über den Chiemsee gesenkt.
Ein leiser Wind kam und strich kühlend durch die heiße Luft. Wie ein wohliges Seufzen ging es um den ganzen See. Drückend hatte die Glut des Tages auf allen Bäumen gelegen, nun holten die Kronen zum ersten Mal tiefen Atem. Wohlig durchrieselte es sie von den Blattspitzen über das feine Geäder bis tief in die Wurzeln, und was der eine Baum fühlte, war auch des andern Erleben, denn sie, die Treuen, die sich nicht hatten entschließen können, die Anhänglichkeit zur Mutter Erde gegen rastlose Unstetigkeit einzutauschen, wie es Mensch und Tier getan, bildeten noch immer jene schöne, tiefe Kindes- und Brüdergemeinschaft, wie sie in den Urtagen herrschte. Und so war es gekommen, dass die Unsteten, jedes auf eigene Faust, den Kampf ums Leben führen mussten, während sie, die Schweigsamen, Beharrlichen treu im mütterlichen Boden hafteten und sich ebenso wenig voneinander zu trennen brauchten, wie sie sich nicht von der großen Mutter gelöst hatten und darum noch im glücklichen Besitz der Allseele waren, die ihnen jenes tiefste, nur ihnen gemeinsame Wissen vom Wohl und Wehe des Bruders bewahrte.
Und die Tiere, die den Pflanzen nähergeblieben sind als die Menschen, können diese stille, aber wunderbare Sprache lautloser Empfindungen verstehen und werfen ebenfalls ihr Glück und Leid in dieses große Raunen, das bei ihnen bereits Schrei und Ton ist. So ist also ein tiefes Verstehen zwischen Bruder Tier und Bruder Pflanze.
Leise und kühlend strich der Abendwind über die Wasser des Chiemsees, wehte in die stillen Buchten hinein, bewegte den hauchzarten Blütenflor weißer, ins Grün schimmernder Blätter gebetteter Seerosen und verfing sich in einem dichten Wald von Schachtelhalmen, die mit ihrem zierlichen und wundersamen Bau jedes Menschenauge entzückt hätten. Weich und zart lispelnd wiegten sich die geschmeidigen Blätter der Weiden, die vielfach weit über das Ufer hinaus hingen, in erregtem Tanz, während die Blütenrispen der gliedersteifen Rohr- und Schilfhalme unwillig gegen diese anstrengende Bewegung aufraschelten.
In all dem Pflanzengewirr der verschwiegenen Bucht blinkt eine freie Stelle, aus der das kristallklare Wasser wie ein heiteres, beredtes Auge glänzt, in dem die breiten Dolden des gefleckten Schierlings und die federleichten und waghalsigen Winden, die gar nicht hoch genug an den Stängeln der andern dem Lichte entgegenklettern konnten, ihr Spiegelbild schauen.
Und immer wieder steigen dazwischen die hauchzarten Nebelfrauen aus dem Wasser und tanzen ihre lockenden Reigen.
Über ihnen kreisen und tollen ganze Ballen von Mücken mit ihren winzigen, wie sonnbeschienene Schneesplitter leuchtenden Flügeln; summen dazu ihr heiteres Abendlied und haben ihre besondere Wonne daran, sich immerzu bis dicht über den Wasserspiegel zu senken, von wo sie sich ständig brodelnd emporschrauben. Im raschelnden Schilfgestänge singen und flöten die Rohrsänger und emsige Zwergdommeln klettern unter leise flatternden Blättern. Zwischen den hohen Halmschäften aber plätschern und tauchen Enten und immer wieder kommen neue Trupps angeflogen, die mit lautem Geklatsch auf den stillen Spiegel der Bucht fallen, so dass die kleinen, zierlichen Wasserhühner erschreckt aus ihrer beschaulichen Behaglichkeit aufrappeln und flügelschlagend über das Wasser rennen. Und die Ringe verzittern in immer weiteren, unmerklicher werdenden Kreisen und wieder liegt der See in seiner feierlichen, großen Harmonie, der Gemeinschaft alles Lebens eine leise Ahnung gebend von der Erhabenheit des Vaters aller Dinge.
Und horch, da tönt in diese große Ruhe ein unbeschreiblich holder Klang, von Liebe redend und von Frömmigkeit, der Freude in die Herzen trägt und Zuversicht, Bekümmerte laben und Starkschaffende zur Demut gemahnen will, ein Klang, der vom Segen der Arbeit redet und von der Glückseligkeit heimatlicher Geborgenheit und der den Menschen und allen Geschöpfen sagen will, wie arm und wertlos ein Leben sei, das nicht in den tiefen, innigen Glauben frommer Gottesfurcht gebettet ist.
Es ist das Läuten des Angelusglöckchens, das alle Abende um diese Stunde vom Turme der Fraueninsel über die andächtigen Wasser zittert, während die stummen Klosterfrauen in inbrünstigem Gebete knien und alle die Gnade Gottes erahnen und am Saume erfassen lässt, die reinen Herzens sind.
Der Friede sei mit euch, geht es raunend über den See in das Land hinaus und: Meinen Frieden gebe ich euch, spricht es wieder. Ach, so ihr den Frieden habet, habt ihr den Schlüssel zur ewigen Glückseligkeit. Lasset den Kampf, lasset die Müh, löst euch vom Leid und löst euch von irdisch vergänglicher Lust! Suchet nur eines und gehet ihm nach: Suchet den Frieden eurer Herzen! Denn sehet, so ihr diesen Frieden habet, habet ihr Gott. So ihr aber Gott gefunden habet und in ihm lebet, ist das Himmelsreich euer. Darum berget euch warm in die Falten des Mantels der Liebe unseres Herrn und Gottes.
Und nun war es, als ob der große Prediger Luft einsöge, um weiterzusprechen, doch er sprach nicht mehr, er hatte geendet und kein Wort drang mehr in die tiefe, lauschende Andacht.
Am Himmel ist längst das letzte Licht des Sonnenwiderscheines verblasst und immer blauer, immer satter wird sein Grund.
Der Tag ist müde geworden, hat sich lang und behaglich hingestreckt und zieht die Hülle des Abends fester um sich. Und diese Hülle ist so wundervoll weich, so weich wie nichts sonst.
Aus dem Holz klagen Waldeulen, Dommeln brummen und trommeln im lispelnden Rohr und immer wieder klingeln Enten über das laue Wasser. Die Seerosen haben die Augen geschlossen und schlafen. Zwischen ihnen und draußen im weiten Spiegel ziehen und streifen dickleibige Karpfen, schnalzen und klatschen übermütige Lachsforellen, die unermüdlich in die Luft schnellen, und wenn sie einander begegnen, machen sie mittels ihrer Brustflossen halt, bewegen den Schwanz, treiben das Wasser mit ihren Rudern bald stärker, bald schwächer, nähern sich dicht oder drängen die Wellen ihres Elements mit der Breitseite des Körpers zueinander und führen so mit dem ständig wechselnden Druck des wellenden Wassers, den sie mit ihrer empfindlichen Seitennaht aufnehmen, eine höchst geheimnisvolle Sprache miteinander.
Da plötzlich warnt es vom Walde her.
Ein Buntspecht ist’s, der Bedrohliches sah und es meldet. Und die Krähen, die in den buschigen Kiefern sitzen, nehmen das Signal auf und quarren und kreischen aus wütendem Halse. Da weiß alles ringsum, dass ein tödlicher Feind naht! Greinend verducken sich die Meisen mit kurzem, hellem „Terretet“ und unermüdlich stoßen die Grasmücken, die ständig wachen Warner, ihr hartes „Teck, teck“ aus, das so spröde klingt, als schlügen dörfische Buben steinharte Kiesel aneinander.
Alles, was sich zuvor noch so lebhaft und laut auf dem Wasser, am Ufer, drinnen im Röhricht und auf allen Ästen von Strauch und Baum schreiend und schnatternd, singend und lockend geregt hatte, ist wie von der Erde verschluckt und selbst das ganze Froschvolk sitzt zuckend vor Aufregung, mit angstblöden Augen unten am Boden der seichten Ufer.
Das alles, vom Signalschrei des Buntspechtes an, die ganze Kette der Warnungsrufe durch, geschah in der Spanne kaum zweier Atemzüge und schon ist der grausame, unheimliche Würger in den Frieden des Sees eingebrochen.
Totenstille herrscht plötzlich. Aus der Dämmerung löst sich gespenstisch ein braunes Ungeheuer, das mit brennenden Augen und gewaltigen Schwingen wie ein Schatten über die Aukronen fällt, geisterhaft lautlos den Schilfswald überhuscht, kalten Todesschauer hinter sich lassend, wie ein Pfeil über den See hinausschießt, mit Riesenschlägen über das Wasser klafternd, mit einem Male rüttelnd in der Luft steht und sich dann zum Ufer wendet, wo es hinter den Schleiern einiger nebelumtanzter Weiden verschwindet.
Doch die Geschöpfe des Sees wissen, dass der Feind noch zwischen ihnen ist. Kein noch so leiser Seufzer dringt aus geängstigten Kehlen. Zu groß ist das Grauen vor dem tückischen Unhold. Wo der Schatten seiner Schwingen hinfällt, lähmen Angst und Schreck jede Bewegung.
Jeden Abend bricht der gefiederte Tod um die Stunde der ziehenden Nebel in den Frieden des Sees und jeden Abend holt er seine Opfer. Hass und Entsetzen vereint alle Tiere im weiten Umkreise gegen den furchtbaren Würger und gegen keinen haben sie einen so ausgedehnten Späherdienst eingerichtet wie gegen ihn. Alles was Haare, Federn oder Schuppen hat, ist gegen ihn vereint.
Listig die Nebelschleier als Deckung nutzend, taucht er plötzlich an der Uferwiese der Bucht auf, saust gegen die riesige Eiche hin, auf der zuvor der Mäusebussard blockte, zieht mehrmals kreisende Ringe um ihre weitauslegende Krone, hebt sich höher und höher und ist plötzlich zerronnen zum Punkt. Und dann ist wohl irgendein Vogel gekommen und hat es gefressen, das hässliche, scheußliche Insekt! So hat wohl der kleine Junghase geträumt, der sicher im Versteck hockte und der zu schnell wieder Mut bekommen hatte wie alle die, die Träumer sind. Lustig hoppelt er aus der geschützten Stelle, die Hinterpfoten ordentlich vor Behagen emporwerfend.
Jählings war da ein wildes, wuchtiges Brausen über ihm in den Lüften, dass es klang wie von brechenden Schwungfedern und die Luft dabei pfiff.
Dicht über dem Boden reißt der Räuber die weiten Schwingen auseinander, steckt stoppend den gespreiteten Schwanz nach unten, und den abgeschwächten Sturz in eine wunderbar unnachahmliche Kurve überleitend, greift er im Fluge das Häslein und trägt es mit katzenähnlichem Triumphgeschrei über die Wiesen davon.
Alles am See ist wie vom Alp erlöst.
Jedes weiß: Für heute ist Ruhe; heut kehrt sie nimmer zurück, die grausame, unheimliche Rohrweihe.
Eine Nacht lang haben sie Ruhe vor ihr.
Wer von ihnen aber mag morgen in ihre Fänge geraten? Doch die Tiere sind anders geartet als die Menschen. Zu sehr lieben sie die Freiheit ihres Lebens, als dass sie lange Trübem nachhingen. Morgen wird ja doch nur geschehen, was ihre große Mutter über sie verhängt hat.
So wispert und huscht es, piept es und klatscht und gluckst es bald wieder tausendfältig in hellster Lebensfreude und Rührigkeit im Weichbild des Sees.
Oben am Himmel aber prangen die ersten Sterne. Schnell bricht nun die Nacht herein. Eine wundersame, zauberhafte Julinacht. Keine lärmende, störende Farbe, blau, alles, alles blau. Samtblau. Ruhig und gleichmäßig atmen die Bäume; im ersten süßen Schlummer liegen die Blumen. Im Traume fühlen sie das leise Beben der Wurzeln ihrer großen Geschwister, nehmen sie unbewusst an ihren Reden teil.
„Brüder“, beginnt die uralte, gewaltige Eiche langsam und feierlich zu raunen, „heute ist wieder jene gnadenvolle, heilige Nacht.“
„Wir wissen es, Bruder“, wellt und strömt es von allen Seiten durch die Erde zu ihr. „Und wir warten auf sie.“
„So ist es gut, dass ihr es wisset“, fährt die Gewaltige fort. „Achthundert Jahre stehe ich nun schon hier und es ist kein Bruder mehr im ganzen Seebann aus jener ersten Zeit; ich bin der älteste, darum darf ich zu euch reden.“
„Du sollst es, Bruder, wir bitten dich.“
„Achthundert Jahre wurzle ich hier und ihr alle habt euch um mich geschart, habt Liebe, Vertrauen zu mir getragen und mich zu eurem Führer erwählt. Durch alle Jahre gehen die Ströme eures heißen Strebens zu mir. Da hat es dem Ewigen gefallen, mich zu eurem Lehrer zu machen.“ Die Eiche schwieg eine lange Weile, dann sprach sie weiter. „Heute nun wieder ist jene segenvolle Nacht, die Nacht des Aldebaran, und in wenigen Stunden wird sie sich erfüllen; wird das Sternbild der Gnade sich auf den Himmel drehen. Wohl denen, die den Tag wissen! Wehe denen, die ihre Seele auch in diesen Stunden der Rede des Ewigen Vaters verschließen! So höret ein Großes! Hohe Gnade ist uns widerfahren! Ein Heiliges soll in dieser Nacht geschehen: Wir werden einen Elf bekommen, der uns mit lieben Händen aufwärts führt, aufwärts zu Gott.“
„Oh, Bruder, weiser Vater, o sag, ist es möglich, verstehen wir dich recht?“, so bebt es von allen Seiten zu ihm.
„Ja, Brüder, ihr habt mich recht verstanden. In dieser Nacht, unter der Gnade des Aldebaran, wird ein holder, zarter Elf meinem Leibe entsteigen. Diese Nacht noch wird uns ein Helfer werden, der uns erlöst!“
Da ging ein Beben der Freude und Ehrfurcht durch die Erde, so stark, so machtvoll, dass jeder tagwach wurde, und bald ward die Gnade, die den Eichen widerfahren sollte, rings um den ganzen See offenkundig. Die Bäume sagten es den Vögeln, die in ihrem Gezweig hausten, die Blumen lispelten es erregt den Insekten zu und jene, die im Wasser standen, teilten es dem großen, feuchten Elemente mit, das die freudige Kunde wieder an die Fische weitergab.
Rasch verbreitete sich die Botschaft. Sie alle fühlten, welche Nacht heute war, und warteten auf das Erscheinen der leuchtenden Worte des Schöpfers, die er als funkelndes Sternbild auf das Himmelszelt schreiben würde. Die tiefblaue Nacht ist bis zum Rande erfüllt von fiebernder Freude. Dazu raschelt leise der ewig aufgeregte Wind im Rohrwald, die Schilfsänger stimmen das allerwunderlichste ihrer Lieder an und die große Rohrdommel trommelt ihr raues, schwerfälliges „Ü-prump, ü-prump“ in die Nacht hinaus.
Es ist ein Fluten und Wogen von Lauten, ein Schwirren und Huschen und Wischen von flatternden Schatten und webenden Schemen wie in einem weltenrückten Zauberwald. Da, plötzlich, scheint ein Wahnsinniger in den unheimlichen Spukwald gebrochen zu sein, denn bald von dieser, bald von jener Krone tönt sein scheußliches, markerstarrendes Hohngelächter, so klagend und unheimlich, so langgezogen, heulend und wimmernd, dass es ist, als trieben böse Dämonen ihr widerwärtiges Spiel. „Huu-huhuhu, huhu“ ächzt, jammert und klagt es aus finsterer Höhe, noch einmal und noch einmal, und erstirbt, verendet in einem kläglich-erbärmlichen, endlos ausstöhnenden „Hu-u-u-u“. Und nun hebt es von drüben an. Peinvoll, martervoll, und legt sich bleischwer auf die Seele. Es ist der Totenvogel, der munter geworden ist! Bald hier, bald dort ertönt sein Wimmern und Seufzen, von irgendwo, aus einem Ort, den man nicht ergründen kann, und plötzlich streicht ein weicher, leiser Flügel vorbei, langsam und geisterhaft, dass Entsetzen die Seele erfüllt, denn so kann nichts Irdisches fliegen!
Und das Gespenst mit seinem fratzenhaften, von rundem Federkranz umsäumten Gesicht huscht niedrig am Boden dahin, schlägt hier eine Grille, dort eine Maus und drüben unterm Huflattichblatt einen Frosch.
Und während eines dieser unheimlichen Geschöpfe jagt, scheint das andere die Tiere zu bannen, denn ununterbrochen tönt das schaurig ersterbende Klagen durch die Aufinsternis, beharrlich durchbrochen vom wütenden, laut aufbegehrenden „Kuwiff, kuwiff“ des Steinkauzes.
Wie Erlösung aus der Unterwelt, in die die Lichter der Himmelspforten brechen, flutet unerwartet eine magische Helle in das webende Düster der dunklen Unheimlichkeit.
Gleißend steht die Scheibe des Vollmondes am östlichen Horizont.
Unmerklich steigt sie empor, wie ein übervolles Füllhorn ihre Lichtströme auf die Erde gießend. Wie eine Silberplatte glitzert die Fläche des Sees; gespensterhaft spiegeln sich in ihr die schwarzen Schatten der wiegenden Binsen. Bleich liegt der Glanz des Mondes auf dem Röhricht. Wo seine Zauberstrahlen die Nebeltücher treffen, beginnen sie zu wellen, sich zu bewegen, zu steigen, werden sie durchsichtiger und sind mit einem Male zerflossen, ganze Landzungen aufschimmernder Seerosen freigebend, die von den Kräften des magischen Gestirns aus den unterirdischen Gärten der Nixen gehoben scheinen. Weich wie eine junge Katze mit samtenen Pfötchen spielt sein helles Licht mit den Blättern, rieselt die Äste und Stämme hinunter und weckt manchen Kleinwicht aus seinem Versteck in der Rinde.
Es ist zehn Uhr nachts.
Wie ein Zauber hat das Aufgehen des Mondes auf die Natur gewirkt. Geheimnisvolle Kräfte sind mit einem Schlage entbunden und durchfließen die Erde, das Wasser, die Luft, und Höhe und Tiefe scheinen in ein riesiges magnetisches Feld verwandelt.
Und alle Kinder der Mutter Natur, Steine, Pflanzen und Tiere, wissen davon und freuen sich ihrer Geschwister aus der Hauchwelt, die nun bis zum ersten Sonnenstrahl in Erscheinung treten und zu ihnen kommen dürfen, solange die starken, magischen Ströme, durch den mächtigen Willen des gewaltigen Zauberers Mond gesammelt und wieder verteilt, durch die Räume fließen.
Alle Wesen des Sees wissen von dem beherrschenden Einfluss, den der Mond auf die Zeugung und Erhaltung ihres Seins hat.
Dies wusste vor allem auch die alte, erfahrene Eiche und so ward ihr offenkund, dass in der heutigen Nacht der Eichenelf in ihr sich gebären würde.
Auch die Tiere empfinden dies instinktiv und werden von einem aufwirbelnden, leidenschaftlichen Lebensdrang erfüllt.
Von den taufeuchten, schimmernden Wiesen des Fruchtlandes fließt mit einem Male eine derartige Welle von Grillengezirp herein, dass der See einen Augenblick benommen den Atem anhält.
Es ist, wie wenn plötzlich Türen zu einem unsichtbaren Musiksaal geöffnet worden wären.
Dann aber stimmen die Rohrsänger, wie wenn sie in offenen Wettbewerb mit der großen Symphonie der Ebene treten wollten, mit gesteigerter Kraft erneut ihr Konzert an und es ist ein brausendes, hinreißendes Hohelied der Schöpfung selber, in welchem sie keinen Ton vergessen, durch den ihre Mitbrüder sich äußern. Und so klingt es bald wie das Knarren der Bäume und Rascheln des Schilfs, das Klatschen der Wellen, Schnalzen der Fische, dann wieder das Schilpen des Spatzen und das Miauen des Bussards! Und nun scheint ein Star zu pfeifen! Plötzlich flötet eine Amsel hinein und nun ruft gar ein Kuckuck dazu! Steht die Welt auf dem Kopfe? Die Tagsänger haben doch zu schweigen des Nachts! So ist es ja auch, nur die drolligen Kobolde im Rohrwald nehmen sich die Freiheit, sie ein wenig nachzuahmen.
Und mitten hinein in dieses Doppelkonzert, das See und Flur sich geben, schallt plötzlich laut und glockenklar der alles übertönende, heimatwarme Schlag der Wachtel vom Felde her: „Pickwerwick, pickwerwick.“ Wohl ein Dutzend Mal. Dann setzt er aus. Und nun antwortet eine zweite Wachtel und bald tut aus der Ferne eine dritte mit. Mit einem Mal ist die ganze Flur ein einziges Wachtellied.
Feierlich zieht der Mond dabei höher und höher am Himmel seine leuchtende Bahn.
Beinah taghell ist die Nacht. Morgen soll er in das Luftzeichen des Wassermanns eintreten. Da übt das Sternbild des Steinbocks noch einmal all seine Macht aus, die ihm durch die saugende Wirkung des vollen Mondes gegeben ist. Immer stärker werden die magnetischen Ströme, die sich auf die Erde ergießen.
Und siehe, während die Vögel musizieren und die Blumen berauschend duften, werden plötzlich die schönsten Märchen der Menschen lebendig.
Ringsum entsteigen unzählige spannlange Gnomen der Erde, wie an ersten kühlen Herbsttagen unvermittelt die unirdischen Blüten der Zeitlose aus den Wiesen sprießen, trippeln geschäftig zu Blumen und Sträuchern, legen ihre kleinen Arme um sie und liebkosen sie. Und findet einer der Wichte einen schlaftrunkenen Schmetterling, nimmt er ihn behutsam in seine Hände und freut sich an ihm, wie sich Kinder freuen an hellen, glänzenden Dingen. Dort wieder hockt einer bei einem großen, glatt geschliffenen Kieselstein, nickt und redet unausgesetzt auf ihn ein, wie wenn ein Wesen in ihm wäre, und siehe, plötzlich entschwebt dem Stein ein kleines Wölklein, eine ungemein zarte, ätherfeine Gestalt: ein Berggeist, die Seele des Steins, der sich zum Erdmännchen setzt, und endlos wissen sie nun zu erzählen von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen. Viele scheinen zu spielen, manche nach etwas zu suchen, und bald dort, bald da steht einer, der den bärtigen Kopf im Nacken hat und zum gestirnten Himmel emporguckt. Am liebsten aber reden sie mit den Blumen und liebkosen sie. Immer wieder geraten sie in hellen Jubel, klatschen die Hände zusammen, winken einander und knien verzückt nieder, wenn sie neuerlich ein honigschwerer Duft betört, der aus einem Blütenkelch strömt, und ganz glückselig können sie werden, wenn sie im weichen Staubgefäßebettchen ein kugelrundes Käferchen entdeckt haben.
Tiefe Andacht aber scheint sie zu erfüllen, wenn sie in einem der Blütenwunder den runden, glashellen Diamanten der Nacht finden, den unsichtbare Nebelfrauen hineingelegt haben.
Mit ganz besonderer Ehrfurcht jedoch stehen sie vor Blumen, die weiße Blüten tragen. Denn sie wissen, dass Weiß die heißbegehrte Farbe jeder Pflanze ist, die Farbe der Vollendung, der Erfüllung, der sie alle zustreben, und dass jene, die sie zu entwickeln vermag, die Auserwählte ist, der die andern in ihrem Umkreis, die von einer gemeinsamen Allseele durchflossen sind, ihre Kräfte und all ihr Trachten zuwenden, um sie zur Schönsten zu machen; denn nur durch die Hilfe aller, die zur Verkörperung einer Gesamtseele gehören, ist es möglich, dass die durch ihre Sehnsucht und Liebe Herausgehobene zur vollen Entwicklung kommt. Und die Erdmännlein wissen sehr wohl, dass diese höchstentwickelte Blume die Wesenheit der gesamten Schwestern an sich genommen hat und in sich trägt und dass ihr die hohe Gnade geworden ist, Meisterin und Lehrerin aller Übrigen zu werden. Sie wissen, dass in dieser weißen Schwester der Elf sich verkörpern wird, der die Aufgabe hat, ihre zurückgebliebenen Geschwister, die ihr zum Höchsten verholfen haben, ebenfalls zum Höchsten zu führen.
Und diese weißen Führerinnen halten gerne lange und tiefe Gespräche mit den Brüdern der Erde, um ihre Erfahrungen zu vertiefen, denn viel ist es, was jede Blume wissen muss, um den Zweck ihres Seins richtig zu erfüllen, das nicht allein in der Lebenssaftbereitung, dem Zellenbau und im Blühen und Fruchtbilden besteht, sondern dem großen, alles umschließenden Gesetze sich einzuordnen hat, das neben vielem andern das Ansammeln von Heilkräften in Wurzeln, Stiel und Blättern oder das Bereiten der Nährstoffe für die Insekten befiehlt.
Doch die zwergenhaften Kinder der Erde sind nicht die Einzigen, die die Seenacht beleben. Plötzlich teilt sich die schlafende Seerosenhalde und aus der stahlblauen Flut heben sich Kopf, blendende Schultern und wonnige Brüste eines überirdisch schönen Weibes. So verharrt die Wasserfrau zwischen den Blüten, die Rosen des Wassers mit gertenschlanken Händen umspielend.
Da bemerkt ihr Auge, wie es den klaren, ruhigen Spiegel des Sees betrachtet, auf dem die Sterne des Himmels liegen, das berückende Funkeln Atairs im Adler, der wie ein Leuchtkäfer in märchenhaften Südseenächten glüht. Und die betörende Nixe überkommt Verlangen, sich den schimmernden Käfer in das weit über den Nacken hinabfließende Haar zu setzen. Hurtig schwimmt sie hinaus, doch wie groß ist ihre Verwunderung, als sie dicht vor dem strahlenden Sternkäfer steht und ihn nicht greifen kann. Dafür taucht seitlich vor ihr eine zweite holdselige Schwester auf und so gleiten sie nun eine Weile gemeinsam in lieblichstem Spiel durch die Wellen. Dann aber, des Spielens müde, nimmt das erste Weib seinen Weg zur Bucht, wo die alte achthundertjährige Eiche steht und der große, glatte Kieselstein liegt, und steigt in wundervoller Schönheit des Leibes ans Ufer. Laut rauscht der Baum auf und die schöne Undine hebt die Hand und erwidert den Gruß.
Wie überrascht ist sie aber, als sie neben dem vertrauten Stein den mit dem Erdmännlein in ein Gespräch vertieften Berggeist sieht.
„Die Harmonie des Ewigen sei in uns!“, grüßt sie die beiden.
„Die Liebe der Menschen komme zu uns!“, entgegnet der Berggeist. „Du bist überrascht, Schwester, dass du meine Stunde erfüllt siehst“, fährt er freundlich fort.
„Ja, Bruder Stein, das bin ich; doch ich freue mich mit dir. Aber ich fürchte, dass ich euch störe.“
„Wie könntest du dies, holde Schwester; wir Kinder unserer großen Mutter haben nicht das Geringste, das uns voneinander trennt. Komm und setz dich neben mich, wie du es so oft getan hast in mondhellen Nächten. Und höre, was unser Bruder spricht!“
„Du stelltest eben die Frage, wie es unten in der Erde sei und wie wir Erdmänner dort hausen können“, begann der Gnom. „So wisse denn, dass es sich bei uns mit der Erde ebenso verhält wie bei unserer Schwester Undine hier mit dem Wasser. Der Ewige hat vier Elemente geschaffen und ebenso wie unsere großen Geschwister, die Sylphen und Windgeister, in der Luft leben und die Salamander im Feuer, ebenso lebt unsere Schwester im Wasser und lebe ich in der Erde. Und du musst das so verstehen, dass ganz dasselbe, was für jene die Luft oder das Feuer ist, für uns Wasser oder Erde ist: unser Element, in dem wir leben können. Und so wie die andern Geschwister sich in ihrem Element bewegen, so können wir es in unserem.“
„Wie soll ich dies Letztere richtig verstehen, Bruder?“, fragt der Berggeist.
„Als du noch Stein warst, da war dein Leib grobstofflich, grobstofflicher noch als der der Menschen. Nun, da du alle Erfahrungen deines Steinlebens gesammelt und dich aus der Materie befreit hast wie unser rauschender Bruder drüben, der heute Nacht noch einen Elf gebären wird, fühlst du alle Schwere von dir genommen und deinen Leib so feinstofflich, dass ihn kein gewöhnliches Menschenauge erschauen kann – es wäre denn ein Mensch, den die ganze Liebe und der ganze Glaube seines Herzens inbrünstig zu Mutter Natur hinzieht und dem sie dann die Schleier von seinen Augen nimmt, damit er die verborgenen Welten und Kräfte sieht, die der Schöpfung Urgrund sind.“
„Ja, wahrlich, Bruder, ich fühle mich so leicht, wie ich das all die Tausende von Jahren nicht gekannt habe, in denen ich in diesem See und an seinem Ufer lag und die Erfahrungen von Wasser, Erde und Luft, von Sonnenglut und Kälte sammelte.“
„Und siehe, so hat es Gott gefallen, keines der von Ihm geschaffenen Elemente ruhen zu lassen, auf dass Seine Allmacht offenkundig sei, denn klein wäre der Ewige, wenn Er nicht imstande gewesen, alle vier Elemente mit Seinem Odem zu erfüllen, wie Er jenes so herrlich belebt hat, in dem die Menschen sich bewegen. Hat Er darum einen Raum feinstofflich gemacht, so schuf Er in ihm die Wesen grob von Stoff, und war anderorts der Raum zu grob, dann schuf Er die Kreatur desto feiner. Wir Erdmännchen nun haben ein grobes Element, darum müssen wir selber so fein sein, um ungehindert hindurch zu können wie der Strahl der Sonne, der in unsere Behausungen dringt.“
„Wie ist das seltsam, wie ist das unausdenkbar groß“, sprach der Berggeist langsam mit tiefer Feierlichkeit.
Und nach einer Weile des Schweigens: „Was mag der allmächtige Vater mit mir noch vorhaben.“
„Des sorge dich nicht, Bruder, denn was es auch sei, unseres Vaters Ratschlüsse sind weise und gut. Und solltest du je durch Leid gehen müssen, dann trage es willig, denn wisse, dass wir alle aufwärts müssen zu Ihm, dass aber für niemanden der Weg anders geht als durch die Pforte des Leides.“
„Die Harmonie des Ewigen sei in uns! Wahrlich, du hast recht geredet, Bruder“, rauscht es, und wie sie aufblicken, schwebt ein Wesen des Luftreiches über ihnen, eine mächtige Gestalt, weit über Menschenmaß groß.
„Wir grüßen dich, Sohn des Windes: Die Liebe der Menschen komme zu uns!“, antwortete der uralte, weise Gnom.
„Ach, Bruder, dass sich dein Gruß doch mehr erfüllte! Käme doch die Liebe der Menschen mehr zu uns! Aber ich, der ich ständig um sie bin, sehe besser, wie ihr Treiben ist und was ihr Sinnen erfüllt, ihr würdet es begreifen können, dass wir Söhne der Luft oft mit tiefem Zorn erfüllt werden über ihr törichtes, sinnloses Trachten und über sie wegfegen und mahnen, beschwören, drohen, heulen und toben, dass die Bäume brechen und ihre Häuser beben! Aber sie haben Augen, sehen unser Mahnen und verstehen es nicht, sie haben Ohren und hören es nicht. Der Allmächtige selbst hat Seine Sonne ans Firmament gesetzt – doch sie erkennen ihre wahre Heimat, das geistige Reich Gottes, nicht! Sie wühlen und hasten und jagen, sie sehen überall hinein, nur nicht in ihre Brust; sie spähen und horchen in alle Richtungen und hören nur auf die eine Stimme nicht, die doch so beredt aus jedem Blumenkelche spricht: auf die Stimme unserer großen, gütigen Mutter Natur! Morgen tritt der Mond in das Sternbild des Wassermanns, das Zeichen der Luft. Morgen wieder ist unser Tag. Morgen wieder wollen wir mit unserer ganzen Kraft zu ihnen reden und sie mahnen.“
„Bruder“, hob das weise Bergmännchen sehr ernst und versonnen an, „was du da über die Menschen sagst, ist tief bekümmerlich; aber sage mir das eine: Sind sie alle so? Mich deucht, es gebe doch viele unter ihnen, die mit heißer Inbrunst suchen, die ihre brennenden Augen immer wieder auf die Sterne des Himmels richten, wie die Verdurstenden nach jedem Wort der großen Mutter lechzen, und deren Liebe so stark ist, dass Tausende von uns in ihr Erlösung finden. Sag, ist es nicht so?“
„Es ist so, wie du sagst, Bruder“, entgegnete der Sylphe mit leiser Stimme.
„So wollen wir nicht klagen und verzagen, junger Luftgeist, denn diese wenigen werden Führer von vielen werden, und wenn es Gott gefällt, werden sie einst zahlreich sein, denn wisse, dass nichts seinen Weg nehmen kann ohne Gottes Willen. Das scheinbar Verworrenste ist weise und hat seine Ursache, nur wir haben nicht die Kraft, sie zu erkennen. Eines aber wissen wir alle: dass alles aus Gott ist und jedes wieder zu Ihm zurück muss. In des Allmächtigen Ratschluss allein aber stehet Sein Weg. Darum sorge dich nicht, Bruder, und quäle dich nicht, denn alles hat seine Zeit und Stunde, und was dir lang erscheint, ist nicht einmal ein Atemzug aus der Brust der Gottheit. Dies merke dir wohl. Schau die Sterne oben am Himmel und freue dich; denn solange diese Schutzengel am Firmamente stehen, kann kein Geschöpf ganz in die Irre gehen. Der Allmächtige hat sie vor die Tür der wahren Heimat all Seiner Kinder gestellt, damit wir den Weg finden zu ihr.“
Da bemerkten sie, dass sich ein großer Kreis andächtig lauschender Zuhörer um sie gebildet hatte. Holdleibige Nymphen in hauchdünnen Gewändern wie Nebel an frühen Herbsttagen; drollige, gutäugige Moosmännlein, längelang hingestreckt, die Faust unters langbärtige Kinn gestützt; ein paar Wesen zutiefst aus der Erde, aus dem Reiche des Feuers, die in dieser prangenden Vollmondnacht emporgestiegen waren, um die strahlende, funkelnde Himmlesscheibe anzubeten; und ganz zu äußerst, stehend und ständig zu rascher Flucht bereit, die scheuen Waldleute, die die Menschen Faune und Satyrn nennen.
Zwischen ihnen aber schwebten die lieblichen Kinder der Blumen, deren Gestalten wie zusammengeflochtene Mondfäden schimmerten. Ein Königskerzenelf war darunter, von so strahlender Schönheit, dass ein tiefes, heiliges Schweigen eintrat.
Und in dieses Schweigen der Liebe klang nun umso eindringlicher ein derartiges Gewirr von Stimmen und unaufhörlichem Flattern, Huschen und Flügelzucken, dass die mondhelle Nacht davon erfüllt war bis zum Rande. Und immer noch klagten und ächzten die Eulen und Steinkäuzchen aus verschwiegenen Baumkronen herab und zeitweilig, als wäre sie der Taktmeister dieses gewaltigen Chores, trommelte die Rohrdommel ihr dumpfes „Ü-prump, ü-prump“ in die Nacht.
Leise rauschen die Kronen der Bäume und sie schimmern ganz weiß, als läge silberner Tau auf ihnen. Sie genießen mit vollen Zügen die märchenhafte, laue Mondnacht; jedes Blatt atmet langsam und tief.
Am Himmel ist eine Pracht, wie sie nur die von allen Strömen des Lebens übervollen Hochsommernächte kennen. Einem Schleierbande gleich liegt die Milchstraße an der sattblauen Glocke. Atair funkelt und leuchtet, dass Sirius, der drüben über der Alpenkette steht, immer wieder sein bläulichgrünes Licht dreht und heftig aufzucken lässt wie ein zorniger Diamant. Deneb im Schwan singt Sphärenmusik in den Weltenraum und es ist ein so herrlicher Lobgesang auf den Schöpfer aller Welten, dass die unerforschliche Zahl der Sterngeister brausend mit einfällt und ein göttlicher Rhythmus das All durchschwingt. Und sie senden einander Ströme der Liebe, die sie umschlingen und tragen, und in wunderbarem Ebenmaß, wie es nur die Göttlichen vermögen, schweben und kreisen sie um den Erhabenen. Nur vereinzelt irrt eine unglückliche, ruhelose Seele, ein leiderfüllter Komet, durch den Sternentanz.
Doch Allvater ist so groß, dass Ihn selbst die göttlichen Sonnenfürsten und Sterngeister nicht zu schauen vermögen. Darum hat Er allgewaltige hohe Herren in Seine Himmel gesetzt: die Zentral-Sonnengötter, die ihnen Gebieter und Lehrer sind, sie führen, lenken und erhalten; die sie im Namen des Allerhöchsten schufen und wieder heimholen, wenn ihre Stunde gekommen ist.
Einer dieser unzählbar vielen hehren Fürsten, zu dem unsere Erde ihrerseits aufblickt wie zu einem Gott, ist die Sonne. Sie ist des Erdgestirns lebenströmender Vater und Herr. Unendliches wissend, so dass ihre Planetenkinder in Ehrfurcht zu ihr aufsehen, zieht die Sonne, einem strahlenden Gott gleich, ihre sichtbare Bahn.
Die zwölf Ältesten des Tierkreises haben das hohe Amt, sie Monat um Monat zu empfangen und zu beherbergen, ihr den Weg zu bereiten, sie zu geleiten und ihr die leben- und schicksalformenden Kräfte für die Erde mitzugeben. Groß ist ihr Amt und die zwölf Ältesten helfen ihr in tiefer Liebe.
Wie sollte es da anders sein, als dass die Sterngeister des Krebs-Ältesten heute Nacht beim Abschied des jungen Gottes trauern, jene des Löwen aber seinen Einzug in ihr Reich lobpreisend besingen und Regulus in seiner Freude so hell zu funkeln beginnt, dass Aldebaran im Stier alle Kraft zusammennehmen muss, um durch seinen Glanz nicht zu erblassen. So wütend leuchtet Aldebaran, dass er beinah die Milchstraße verbrennt! Hundert Millionen Sterngeister schreien auf in bedrängter Not. Da beginnt der Große Bär aufzuglühen und der Nordstern grellt so bedrohlich, dass die beiden ungestümen Sternfürsten sich bezwingen. Denn der Nordstern mit seinem unheimlichen, gewaltigen Bären hat eine große Macht über sie. Nur Aldebaran, der alle Kraft in sich hineinzieht, hängt oben am Himmel wie ein blutender Rubin. Regulus aber kann sich nicht gänzlich beherrschen; zeitweilig geht ein auflodernder Blitz durch die Nacht.
Acht mächtige Planetenfürsten, die den Hofstaat der Sonne bilden, kreisen ständig um sie, hierbei im mannigfachsten Wechselspiel ihrer Kräftespannungen in jedwedes Lebewesen der Erde ihren Willen gießend und jede Kreatur in den großen Kreislauf der Entwicklung ziehend. Der Gefürchtetste unter ihnen – Planet Saturn, der qualvolle Versucher, der Leidbringer, steht feierlich und ruhig im nachtdunklen Osten in der Brüdergemeinschaft der Fische, gleichmütig die Menschen, Saatkörnern Gottes gleich, in unermüdlichen Sieben läuternd.
Da, mit einem Male leuchtet Aldebaran in unbegreiflicher Herrlichkeit auf. Alljährlich einmal, in schweigender Hochsommernacht, strahlt das königliche Gestirn seine mitreißende Sehnsuchtswelle auf die Erde. Einmal im Jahre offenbart sich der Erhabene eindringlich aller Kreatur, damit auch in der sündigsten und zutiefst in die Irre gehenden nicht ganz der Funke des Göttlichen erlösche.
Und was diese Welle trifft, erfüllt sie mit tiefer Sehnsucht nach dem Übersinnlichen, Unaussprechlichen, das in ewiger, erhabener Einmütigkeit über allen Welten ruht, hebt sie hinaus aus der Gebundenheit alles Stofflichen und erfüllt es, und wäre es auf Atemhauches Länge und wäre es für die Kürze des Aufleuchtens eines Meteors, mit der Ahnung, dass unsere wahre Heimat nicht auf Erden ist und wir hier nur Wanderer sind, Weltenwanderer auf einem weiten, weiten Weg, dessen Ziel irgendwo da oben liegt in der Unendlichkeit, irgendwo in der Brust eines großen, unerfassbaren Etwas.
Und unten am See, in der Bucht, sitzen die lebendig gewordenen Märchen der Menschen und können ihre Blicke nicht vom Firmamente wenden, an dem ihre Brüder schweben. Da erreicht sie die Sehnsuchtswelle und erfasst sie so stark, dass der Berggeist und die Elfen nur mit Mühe ihre hauchzarte Astralform bewahren können, und erfüllt jede Pflanze und jedes Geschöpf mit tiefer Gottesahnung und Gottesehrfurcht. Und das Schweigen ist mit einem Male so groß wie das Weltall.
Und dann ist die Welle vorüber.
Die Stille aber dauert noch fort; selbst der unheimliche Totenvogel ist stumm.
In dieses Schweigen tiefster Erkenntnis alles Seins sah Mutter Natur mit weiten, offenen Augen.
Mutter Natur sah ständig so, ob das gleißende, funkelnde Schild des Taggestirns am Himmel stand oder die magischen Lichter der Nacht das Firmament schmückten, denn Mutter Natur kennt keine Zeit, und so kennt sie auch kein Ermüden.
Und die Große Mutter sah auf den Frieden des Sees und hub also an zu reden: „Gottes Liebe über euch, meine Kinder!
Groß ist die Gnade des Erhabenen in der heutigen Stunde, denn es hat Ihm gefallen, einen Menschenbruder in die stille Welt eures Seebereiches zu lenken, der viele von euch dereinst durch die Kraft seiner Liebe aufwärtsführen und erlösen wird.
Er liegt zurzeit in tiefem Schlaf. Er trägt großes Leid in seiner Brust und sein Sinn ist abgewandt vom Irdischen. Ich habe ihn lieb, euren leidenden Bruder.
Sein Herz ist bereit, das große Wunder aufzunehmen. Ich will dem Weglosen den wahren Weg, den Weg zum Heile der Seele führen und ihr, meine Kinder, ihr sollt mir helfen, ihm die geheimen Tiefen der Herrlichkeiten Gottes zu offenbaren. Er soll die Erkenntnis alles Seins erlangen, denn der Allmächtige hat in seine Hände und sein Herz die Zeichen geschrieben, dass er dazu auserlesen ist, dereinst wandeln zu dürfen mit seinem Gott.
Muntere Vögel ihr und ihr duftenden Blumen, rauschende Bäume und ihr scheuen Leute des Waldes; Wind du und du schweigsames Wasser mit deinen holdseligen Töchtern; Sterne, die ihr im dunklen Spiegel euch schauet, und ihr, ihr hauchzarten Kinder der Blüten, Berggeister und Söhne des Erdbereiches, euch allen sei es geboten: Offenbart euch von nun seinen schlummernden Sinnen, ob er wacht oder ruht, kommt mit eurer Reinheit zu ihm und weiset ihm im Schauen und weiset ihm in seinen Träumen den Hauch des göttlichen Atems in euch. Öffnet ihm allgemach die verschlossenen Sinne, die Augen, die vieles sehen und nicht die Wahrheit erschauen, die Ohren, die voll sind von den Klängen der Welt und dennoch die leisen, feinen Schwingungen nicht hören, in denen der Erhabene redet aus jedem Geschöpf.
Zeigt ihm, dass in allem der Funke des Göttlichen steckt, dass alles Offenbarung der Gottheit ist, jedes Geschöpf lebendigstes Sein, ob Amethyst, ob Kirschenblüte, ob kreisender Stern.
Was dem Menschen groß erscheint, ist klein vor dem Willen des Ewigen, und was ihm klein erscheint, ist größer, als dass er es zu erfassen vermag, so er sein Herz nicht tief legt in meine Brust.
Darum, meine Kinder, sollt ihr ihn führen. So spricht zu euch eure Mutter. Und nun lebet wohl. Die Harmonie des Ewigen sei in euch!“
In tiefer Andacht hatte alles den Worten der Großen Mutter gelauscht. Starke Erregung bemächtigte sich der Geschöpfe; jedes wollte den großen, schlafenden Menschenbruder sehen.
Da kam auch schon in hastender Überstürzung ein Elementarwesen mit winkendem Arm zu ihnen herangeeilt und teilte ihnen aufgeregt mit, dass es wisse, wo der große Bruder liege, den Mutter Natur ihnen allen zum Schutze empfohlen. Im Nu war die bunte Schar in Bewegung, der Elementargeist ständig ein paar Fußlängen voraus. Er führte sie um die Buchten herum, zwischen dichtem Gestrüpp und Gesträuch hindurch, an manchem gewaltigen, dickstämmigen Auriesen vorbei, und während sie eifrig dahinhasteten, huschte und schwebte es mit leisem Flügelschlag unausgesetzt über ihren Köpfen.
Ununterbrochene Züge von Vögeln schienen zum Schlafenden auf dem Wege zu sein. Das beschleunigte noch die Schritte der Eiligen, und als sie erneut an eine Bucht kamen, die einen weiten Blick in den spiegelglatten See hinaus bot, sichelförmig umschlossen von einer blumenübersäten Uferwiese, die mächtige Eichen, Ulmen und Kiefern umstanden, winkte ihnen der Elementargeist mit lebhafter Gebärde, und den Weg quer über die taufeuchte, mondlichtüberflossene Wiese nehmend, ging er gerade auf eine Buche zu, die so umfangreich an Stamm und dicht niederhängendem Laubdach war, dass sie selbst die Mondkinder der Mutter Natur überraschte.
Das Erste, das sie nun sahen, war aber nicht der Ruhende, sondern ein ganzes Gewimmel der seltsamsten Geschöpfe, die dichtgedrängt und lebhaft gestikulierend im dämmrigen Schatten der Baumkrone standen, einem fahlweißen Nebelgürtel gleich, der sich unter dem Schutze des Riesen auf die Waldwiese gelagert hatte.
Die Zweige der untersten Äste aber hingen derart voll mit Vögeln, dass es sie niederbog wie Obstbäume an überreichen Herbsttagen.
Darauf aber achteten unsere Ankömmlinge von der Eichenbucht wenig, denn zu groß war ihr Verlangen, den besonderen Schützling der Mutter Natur zu sehen. Ungestüm vor Führerwichtigkeit schuf das erregte Elementarwesen Platz zwischen den Schauenden, und da kein Raum mehr zwischen ihnen war, traten sie vor in den Kreis.
Da lag er nun dicht vor ihnen, der große Bruder Mensch! Längelang, mit übereinandergelegten Füßen, die Hände lose zu Boden hängend, der Kopf auf einem Ränzel ruhend, das an den gewaltigen Stamm gelehnt war. Das war also der Auserlesene, den ihre gemeinsame Mutter ihnen ans Herz gelegt und von dem sie gesagt hatte, dass sie ihn liebe. Er war klein an Gestalt, ein Menschlein nur, schlank und zart von Wuchs, mit ungemein durchseelten Händen. Jede Sehne, jede Ader hob sich stark und deutlich ab und die Finger der schmalen Hand waren lang und an den Spitzen schön gerundet. Unverwandt betrachtete das weise Bergmännchen diese Hände, die ihn angezogen wie etwas ganz Wundersames und die ihm viel erzählten vom Schicksal des Schlummernden, denn der uralte Gnom wusste, welch tiefen, wesenbestimmenden Einfluss die Gestirne des Himmels auf die Menschen nehmen und wie dieser sich offenbare in Form und Linien der Hände.
Erst als er sich genugsam daran satt gesehen, hob er den Blick zu den Zügen des Schlafenden empor.
„Mensch, Bruder Mensch“, ging es mehrmals stumm durch den Gnomen und er wusste in der Bewegung, die ihn ergriffen hatte, nicht, ob es mehr die Liebe oder die Rührung war, die ihm diese Worte entlockte. Immer wieder musste er sie denken und er konnte sich nicht halten, er musste bis dicht zum Kopfe des Schläfers gehen, dort niederknien und seine Hände segnend über ihn breiten. Da kam ein leiser Seufzer, der wie Befreiung klang, aus dem Munde des Ruhenden. Der Gnom aber blieb weiter auf den Knien liegen und schaute unverwandt in die Züge des großen Menschenbruders, der doch nur ein Menschlein war. Was war das für eine wunderbare Übereinstimmung zwischen Hand und Kopf! Überschmal war das Gesicht und die dünnrückige Nase bog sich scharf aus der Stirn heraus. Doch der Mund hatte das entscheidende Wort. Er war wie eine eingeschnittene Leidensrune. Dies gab dem Antlitz etwas Ergreifendes, denn der Schlafende konnte trotz dieser herben Leidensfurche kaum dreißig Jahre alt sein. „Ich habe ihn lieb, euren Bruder im Leid“, hatte Mutter Natur zu ihnen gesagt, und wahrlich, sie sahen es alle, dass tiefes Leid in das Gesicht dieses Bruders Mensch geschrieben war.
Längst war es nimmer Neugierde, die sie fesselte! Tiefes Mitgefühl und hindrängende Liebe war es, die sie alle gefangen hielt. Ja, dieser Bruder konnte dereinst viele von ihnen erlösen, das verspürten sie. Und sie wollten sich mit der ganzen Kraft ihres Vertrauens und ihrer Liebe zu ihm halten, damit die Schleier von seinen Sinnen fielen und er sehend und hörend würde.
Und sie ahnten nicht, dass ihre Gegenwart seinen schlafenden Sinnen sich offenbarte in wundersamsten, holden Kindermärchenträumen, wie sie der Reife seit Jahrzehnten nicht mehr geträumt hatte.
Ermutigt durch das Gebaren des erfahrenen Bergmännchens, waren auch die andern alle herangekommen und bald hockten und standen sie so nah um den Schlafenden, dass keine Handbreit Boden mehr um ihn war. Sogar auf seinen graugrünen Lodenhut hatten sich ein paar Elfchen gesetzt.
Nach langem Schweigen begann das Bergmännchen also:
„Es geht dem Morgen zu, meine Brüder und Schwestern, der Mond steht tief an der Schlafseite und die großen magischen Ströme beginnen schwächer zu werden. Ihr wisst, was unsere gütige Mutter sprach, und wir alle kennen unsere Aufgabe, wenn wir nun vor dem ersten Strahl der Sonne in unsere Reiche zurückkehren. Wir wollen mit unserer ganzen Hingabe ihrem Wunsche dienen, denn der Erhabene hat nichts Höheres in Seine Welten gesetzt als ein durch Leid edel geschmiedetes Menschenherz. In solchen Herzen bildet sich die Fähigkeit aus, den Weg zu Gott zurück zu finden, und solche Herzen sind die goldenen Tore der Erlösung für jede Erscheinungsform, die den Funken des Göttlichen in sich trägt. Doch muss das Leid tiefe, erkennende Liebe gebären, sonst war das ganze Werk Saturns vergebens, denn nur wer aus leidgeläutertem Herzen zur Liebe findet, trägt die Gottheit in sich. Darum lasset uns unserem großen Bruder die Liebe weisen, damit er sie aufnehme in sein geprüftes Herz.
Und nun ist unsere Zeit um; der Tag der Menschen will werden und unauffällig geht der Herr der Nacht zur Ruh. So lasset uns die Ströme der Sehnsucht auf den Schlafenden vereinen, auf dass sie ihm zum Heile werden!“
Da stand alles vom Boden auf und streckte segnend die Hände über den Schlummernden.
„Die Harmonie des Ewigen sei in uns“, klang es hierauf tief und feierlich. Der Mond hatte den Rand der Abendseite berührt und eh noch die Worte verklungen waren, waren wie durch Zaubermacht alle wundersamen Märchengestalten verschwunden, spurlos zerflossen und an der Morgenseite des Lebens begann der Himmel licht zu werden.
Der Morgenwind wehte mit einem Male von der Ebene her und rüttelte behutsam die Kronen der Bäume. Die grauweißen Tücher, die die Nebeljungfrauen bei absteigendem Monde wieder dichter gesponnen haben, begannen zu wellen.
Noch ist tiefe, nachtschlafende Ruhe ringsum. Nur im Osten wird der Lichtstreif heller. Und im Augenblick, als der Schöpfer am Himmel die ersten hauchzarten Farben versucht, erwachen die erdfarbigen Lerchen draußen im Felde. Und mit einem Male ist es, als würfen unsichtbare Hände Scholle um Scholle der heiligen Erdmutter in die klare, morgenfrische Luft. Und die aufflatternde Erde beginnt der nahenden Sonne ein jauchzendes, jubelndes Preislied zu singen, so hell und schmetternd, dass die Fülle der Fanfaren das ganze Himmelszelt durchwirbelt. Und höher und höher steigen die tönenden Perlen, werden zu Pünktchen und scheinen oben schwebend zu verharren.
Und siehe, da brechen sieghaft und den ganzen Himmel mit ihrem Glanze erfüllend die ersten goldenen Strahlen der Sonne hervor!
Da geht es wie ein brausendes Gebet durch die Lüfte des Morgens, erfüllt von seligem Trillern und schmelzendem Jubilieren. Und als das Gebet beendet ist, da beginnen die Pünktchen wieder größer zu werden und in sanftgeschwungenen Bögen kehren die zur Segnung aufgestiegenen, lobpreisenden Vögel zu ihrer Mutter zurück. Und sind nun wieder stumm und harren demütig.
Zweites Kapitel
Auf der mondsichelförmigen Uferwiese liegt weich und warm das Licht der Morgensonne. An jeder Blattspitze hängt eine glitzernde Tauperle. Weit geöffnet sind die Kelche der Blüten.
Unter dem äußersten Zweigrand der majestätischen Buche wuchert eine ausgedehnte Kolonie stark duftenden Waldthymians.
Seine Honigkelche strömen einen derart würzigen Duft aus, dass der Erwachende seine Augen weit öffnet. Wohlig streckt und dehnt er die Arme, tief den prickelnden Duft der versteckten Wiesenkinder einsaugend. Hierauf schnellt er geschmeidig auf die Beine.
Die niederhängenden Zweige der Buche auseinanderteilend, tritt der junge Mensch in das Licht des prangenden Sommermorgens. Die Zweige noch in den Händen, bleibt er stehen, wie geblendet von der Fülle des goldenen Lichtes. Seine Seele ist benommen von dem überwältigenden Lebensstrom, der in Düften und flammenden Farben, würzig durchwärmter Kühle in Himmelsbläue und Vogelgesinge auf ihn flutet. Ein Rieseln geht durch seinen Körper und strafft ihn derart, dass er beide Arme zur Sonne heben muss. Minutenlang steht er so, dann reißt er eilig die Kleider vom Leibe. Mit wenigen Schritten ist er am Wasser, und eh sich all das Bein- und Flossengewusel, das sich im seichten, sonndurchfluteten Uferwasser behaglich wärmt, noch recht ins Klare kommt, liegt der große Menschenbruder auch schon wohlig in der kühlen, erfrischenden Flut.
Unausgesetzt laufen Ringe in den glatten Spiegel hinaus, bis sie allmählich vergehen in der feierlichen Gleichmut des Wassers.
So weit die Wellen die Flut überkräuseln, wissen die Geschöpfe des Sees von dem Spiel des großen Bruders.
Es entgeht ihm dabei, dass hoch im azurblauen Äther ein winziger Punkt kreist, ein beutehungriger Fischadler, der mit alles durchbohrenden Augen das seltsame Wassergeschöpf prüft. Schließlich nähert sich dieses dem Ufer, watet durch gelbsternigen Hahnenfuß und wirft sich mitten auf der Mondsichelwiese ins duftende Gras. Wo ist ein Fürst auf Erden, der ein königlicheres Lager hat! Nicht satt trinken kann sich das Auge an all der buntleuchtenden Blütenpracht! Rauschende Auen sind die Vorhänge seines Lagers und die Bläue des Himmels, traumhaft durchwirkt mit bizarren japanischen Mustern, ist sein Baldachin. Aus den Faltenwürfen der Vorhänge aber fluten Wellen einer zauberhaft schönen Vogelmusik. Stare pfeifen und schlagen, Grasmücken hämmern, Sumpfmeisen kichern aus nickenden Weiden und laut wie der schmetternde Klang einer silbernen Tuba tönt glashell auf das gellende Signal des Zaunkönigs, dumpf begleitet vom Trommeln eines Buntspechtes, der seinen Wirbel schlägt.
Und der Mensch nimmt alles in sich auf und fühlt sich unendlich frei.
Stunden müssen vergangen sein, der ganze Vormittag, denn brütend steht die Sonne am Himmel, und nun wallen die Glockentöne von Frauenwörth über den See ins segenschwere Bauernland hinaus. Da rappelt sich der Traumverlorene auf, stützt den Kopf in die Hand und schaut hinaus in das gleißende Land. Er sieht, wie die Luft tanzt und wabert und wie fern draußen über dem See der Dunst des Mittags liegt.
Mit einem Male legt sich ein schmerzlicher Zug auf sein Gesicht.
Mehrmals schon umgaukelt ein farbenprächtiges Tagpfauenauge den Sinnenden. Jetzt ist es ihm bewusst geworden und mit Liebe folgt er dem sorglosen, unbekümmerten Gaukelflug des hauchleicht schwebenden Schmetterlings: Von Blüte zu Blüte flattert er, steigt torkelnd in die heiße Luft, fällt herab, zuckt wirre Wege und hält sich auf all seinen kunterbunten Flügen immer in seiner Nähe. Lange betrachtet er des Falters seltsames, unsinnig scheinendes Tun, aber plötzlich ist es ihm, als ob er den tiefen Sinn dieses Gaukelns verstünde. Wollte der liebliche Sonnenvogel damit nicht allen schwerblütigen und sich übermäßig mühenden Wesen sagen: „Was plaget ihr euch und was sorget ihr so! Lasst euch doch Zeit und gebet euch Frieden. Öffnet das Herz den Wundern des Tages. Denn nicht den Tag habt ihr zu versäumen, sondern die Seligkeit. Darum schauet auf mich! Wo mein Flügel schillert, ist gleich! Die Hauptsache ist nur, dass er schillert und ich somit lebe und dass ich die Stunden meines Seins, die Gott aus Seiner Hand mir fließen lässt, in ungebundener, innerer Freiheit und wacher Andacht verbringe. Denn wisse, Bruder, dass der wahre Sinn des Lebens das Wissen um das Leben ist!“
Ein schmerzliches Lächeln geht über die Züge des Sinnenden.
„Ach, lieber Freund, wie gut versteh ich, was du mir sagen willst. Aber bei dir ist so vieles anders als bei mir. Deine Brust ist frei und froh und unbeschwert. Du hast es leicht, unbekümmert in den Tag zu leben! Sei dem Schöpfer dankbar, dass du ein Schmetterling bist.“
Noch immer läutet die Glocke auf Frauenwörth.
„Du liebe und doch so grausame Ruferin, die mich so jäh aus meinem Traum gerissen! Fast hätt’ ich es einen Morgen lang vergessen, dass ich Mensch bin und dass es Menschen gibt! Warum ist es denen, deren Herz von Qualen zerfressen wird, nicht beschert, Tier werden und sich in die Brust der tröstenden Natur verkriechen zu können? Dass ich mich in einen Vogel verwandeln könnte!“
Und nach einer Weile, während die Glockentöne verklungen sind: „Doch ich will ja versuchen, mich aus der Welt der Menschen zu lösen; wie schwer aber ist es, wenn man das Gesetz des Menschen in seiner Brust trägt!“
Er wendet sich zu seinen Kleidern und zieht sich an. Nicht eilig. Dann greift er in die Hosentasche und nimmt seinen Geldbeutel heraus. Ein kurzes, mitleidiges Auflachen geht über sein Gesicht: „Ja, so stand es gestern schon. Es sind keine Wunder geschehen über Nacht. So wollen wir dich unseren Habseligkeiten einverleiben, du Symbol der Lehre des seligen, wundervollen Heiligen von Assisi. Dieser Lehre kann ich ja nun genugsam nachleben!“
Sich hierauf setzend, mit dem Rücken an den Stamm gelehnt, kramt er aus seinem Ränzel ein Stück Brot.
„Ja, das Ränzel, das Ränzel“, sagt er mehrmals mit warmer Freude, dabei mit der Hand liebkosend darüber streichelnd.
„Du weißt doch immer noch was zu geben! Bist ein rechter, kluger Sparmeister!“
Und während draußen auf See, Wiese und Au die Mittagsglut brütet, beginnt er hurtig seine Zähne in das Brot zu graben.
„Gestern war es noch reichlich. Heute geht es zu Ende. Ach ja, gestern, heute und morgen. Dass ich noch immer ans Gestern denke und mich so häufig mit dem Morgen plage! Lieber Freund, wie weit hast du es noch zum Vogel! Ob du’s wohl zuwege bringst, zu leben wie er: immer nur fürs Heute, ja, immer nur fürs Heute. Ob ich das wohl überhaupt erlerne? Die Vögel können’s und die Schmetterlinge vermögen es und der selige Bruder von Assisi, der konnte es auch. Aber der war auch ein Heiliger. Und den Heiligen gibt es sicher der Herrgott in Seiner Gnade.“