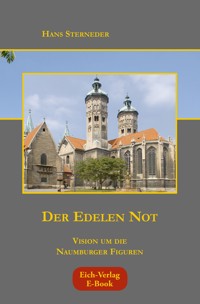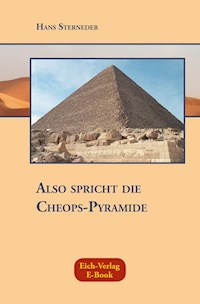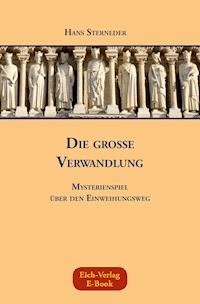12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Lange und verzweifelt hat Beatus Klingohr jenen fremdländischen Mann gesucht, den alle nur den Wunderapostel nennen und von dem er selber sich Linderung seiner tiefen Seelenwunden erhofft. Nun hat er ihn endlich gefunden und zieht an seiner Seite über die Landstraßen des 19. Jahrhunderts. Und Beatus erlebt Unglaubliches. Der Wunderapostel ist ein Meister aus dem Fernen Osten und enthüllt ihm Schöpfungsgeheimnisse, die nur wenigen Eingeweihten bekannt sind. Beatus vergisst seinen Schmerz und erlebt Befreiung und Erlösung von aller Schwere und allem Leid. Für ihn beginnt ein neues Leben. „Der Wunderapostel“ war Sterneders dritter Roman und die Fortsetzung seines Landstreicherromans „Der Sonnenbruder“. Er machte ihn vom fabulierenden Schriftsteller zum spirituellen Dichter, zum großen Mystiker des 20. Jahrhunderts und zum Künder des bereits heraufziehenden Wassermann-Zeitalters. Hans Sterneder ist mit seinem Einweihungsroman vom „Wunderapostel“ etwas Einmaliges gelungen: die Verschmelzung von hoher Literatur und tiefer Geistigkeit, die Einheit von Sprache und Erkennen. Nicht umsonst gilt er als Dichter des Menschheits-Urwissens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Sterneder
Der
Wunder
apostel
Roman
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2018
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2008
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlaggestaltung: Lisa Schamschula
Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-41-0
Meinem edlen Freunde
Valentin Zeileis
Schloss Gallspach, Oberösterreich,
in Liebe.
Erstes Kapitel
Glashell klingendes Morgenschweigen lag über dem Bannkreis des königlichen Dachsteins.
In urweltweisem Gleichmut ragten die vereisten Zinnen gegen den Himmel. In urweltweiser Ruhe hauchten sie ihren grimmen Atem auf die goldgrünen Frühlingsalmen. Eine Welle lebensfreudigster Naturkraft quoll aus dem heiligen Leibe der jungstarken Erde, sich mit dem Odem des Eises zu einem Elixiere verschmelzend, wie es den Magiern aller Zeiten in keinem ihrer Tiegel geglückt.
Mit klirrendem Schrei kreiste ein Wildadler um das Haupt des Dachsteins. Jeden Morgen, wenn die Sonne seine Gipfel vergoldete, stieg der Raubvogel auf und brachte ihm seinen Gruß. Es war ein altes Tier, das seit einer Vogelewigkeit seinen Horst im Geklüft des Bergriesen hatte. Nun schwebte er über der einsamen Alm, die sich unter den Schneehängen des weisen Freundes hinzog, spähte mit blickscharfen Lichtern in die Tiefe, rüttelte ein paar Blutschläge lang über derselben Stelle und flog dann in weitem Bogen um die Hochwiese.
Dort unten, die Arme auseinandergestrafft, den entblößten Kopf tief in den Nacken geworfen, lag Beatus Klingohr in den Knien, das verklärte, weltentrückte Gesicht dem göttlichen Taggestirn zugewandt, das zuvor, als der Wildadler sich zur Firnzinne des Berges emporschraubte, in gleißender Pracht über die zerklüfteten Morgenberge stieg.
Den Mund halb geöffnet, die Augen in unerforschliche Weiten gerichtet, kniete er regungslos in der würzigstarken Blütenpracht, wie ein Heiliger, der von einer himmlischen Vision erfüllt ist.
Höher stieg die Sonne, stärker wurde ihr Leuchten, wohliger ihre Wärme.
Durch Stängel und Blätter der Almblumen ging ein leises Zerren und Spannen, aus jedem Blütenkelch drang in vermehrter Stärke betörender Duft, so dass sich die emsigen Insekten für einen Augenblick ganz benommen an den lockenden Blütenblättern festhalten mussten, welche die Pflanzen in behutsamer Lautlosigkeit der Göttin des Lebens zudrehten.
In einer Flut von duftender Wärme und morgendlicher Frische lag der Kniende.
Und nun begann sich sein Mund zu öffnen, und mit der Inbrunst eines durch härteste Askese vergeistigten, erdentrückten Klostermönches strömte es ungestüm wie ein junger Gletscherbach von seinen Lippen:
„Sonne, leuchtende, strahlende, goldene Sonne! Hüterin des Himmels, sei mir gegrüßt! Sei mir gepriesen ob deines Lichtes! Siehe das freudige Erwachen aller Kreatur! Sie vermag nur zu leben in deinem Schein. Vermag nur froh zu sein unter dem Gold deiner Scheibe. Siehe, wie die Kronen der Bäume leise im Morgenwind rauschen, wie die Kelche der Blumen aufbrechen und die heiligen Opferdüfte trunken ihren farbigen Lichtschalen entströmen!
Ihr Leben und Sein ruhet in deiner Liebe.
Siehe die Vögel des Himmels! Traumbang kauern sie nachts im Gezweige des Waldes. Doch kündet der Frühschein des Morgens dein nahendes Kommen: Siehe, da steigen sie aufwärts mit tauig glänzendem Gefieder, erfüllen die Himmel mit jauchzender Lust.
Kein Kelch vermöchte zu strömen, kein Lied zu ertönen, wenn du nicht bei uns wärest, Königin!
Mutter des Lebens, o sei gegrüßt! Höre das Donnern der Wildbäche in den Schluchten; sieh die Formenwunder der Wolken in den Zelten der Himmel! Leben in allen Tiefen der Erde, in allen Höhen der Lüfte. O Wunder des Himmels: Leben! Von dir geschaffen, von dir erfüllet. Dir auch ergeben in Ewigkeit!
Leuchte, lohe und sprühe, glühende Göttin, Göttin des Seins! Ströme hernieder Fluten des Lichtes, erfülle uns ganz mit deinem Glanz! Verbrenne das Dunkle, entfache das Lichte zu lodernden Bränden, entfache das Reine!
Dein Strahlen ist Liebe, Liebe dein Kreisen!
Dein Lieben ist Leben, das Leben dein Sein!
Aus jedem Geschöpf grüßt dich der Strahl deiner Liebe! Grüßt du dich selbst. Wie groß bist du, Göttin, in deiner Macht!
Sieh mich auf den Knien, o höre mein Danken, allewige Mutter! Ein Hauch nur bin ich vor deinem Glanz, doch bis zum Versprühen, Verglühen des letzten Funkens in mir sei gepriesen! Sei gesegnet für dein himmlisches Licht, welches das Dunkel der Nächte in die Freuden der Helle wandelt! Gesegnet für die Ströme der Wärme, die den Tod besiegen und das Leben schenken. Sei gesegnet, Königin, dass ich bin und dich lieben kann!“
Beatus hält eine Weile seine Hände der Sonne entgegen, dann wirft er sich zu Boden, presst die Stirne auf den frühlingszarten Teppich des Almgrases und spricht andächtig:
„Heilige Erde, sei mir nicht minder gesegnet! Du trägst mein Leben, duldest mein Wandeln, weist mir in Liebe unendliche, selige Wunder!“
Da werden seine Blicke von einer Enzianblüte angezogen, die ihm ihren Saphirkelch hingebungsvoll entgegenhält. Zärtlich betrachtet er eine Weile das Blütenwunder, dann neigt er sich nieder und umschließt mit behutsamen Fingern die zarte Krone.
„Holdselige Schwester, Rätsel des Lebens, fühl meine Liebe. Nimm sie auf in dein reines Wesen, wärme dich an der Liebe eines Menschenbruders und verwebe sie in die geheimnisvollen Kräfte deines Seins!“
Tief beugt er sich über die Blume und berührt bewegt mit seinen Lippen das azurblaue Mysterium.
Lange verharrt er so, dann hebt er den Kopf, die Blüte noch immer haltend, und murmelt wie im Traum vor sich hin:
„Wärme dich, du Keusche. Und sende meine Liebe deinen Schwestern zu, damit auch sie erleben, wie Menschenliebe ist.“
Und sich vom Boden erhebend und über die Blütenpracht der weiten Almwiese schauend, bewegt er mit feierlicher Ruhe die Arme ringsum und spricht:
„Ich segne euch, Kinder des Lichtes, segne dich, holdseliges Lächeln der heiligen Mutter Erde! Meine ganze Liebe gebe ich euch, o gebt mir von eurer Reinheit, von dem unerschütterlichen Glauben eures Lebens, gebt mir von dem stillen Glück eures Freuens! Lasst mich teilhaben an den heiligen Wundern des Seins, die wir Menschen verloren und die sich in die Schreine eurer zauberhaften Körper zurückgezogen haben!
Heilig seid ihr, die ihr stumm dieses Wissen traget, heilig seid ihr Erwählten!“
Und er preist die wehenden Lüfte, die ziehenden Wolken, die glänzenden Firne, die funkeln, wie wenn sich der ganze Schimmer des Sternenzeltes in sie gesenkt hätte; er segnet die schweigsamen Wälder, die in weitem Bogen die hügelige Alm umsäumen, für den Schutz, den sie dem Getier geben; er segnet das Wasser, dessen kristallklare Flut alles Lebendige labt.
Dann lässt er die Arme sinken und, die Lider schließend, steht er lange Zeit, wie von Erschöpfung überfallen. Fährt mit der Hand langsam über Stirn und Augen und blickt wie benommen über die sonnüberflutete Almwiesenpracht, auf der noch immer die märchenhaften Taugeschmeide der Nachtgeister glitzern, die sie beim Anbruch des Morgens der Sonne als Gruß und Huldigung zurückgelassen haben. Lange betrachtet er dieses menschenentrückte Paradies, das rings von hohen Schneemauern und Eiszacken umschützt ist, deren Alabaster sich unirdisch von der goldgrün leuchtenden Frühlingspracht der Almwiese abhebt. Es scheint, wie wenn die wildzerrissenen Felsgiganten mit ihren weißen Schultern und Häuptern, drohend auf trotzenden Wächtern gleich, geradewegs aus dem bunten Teppich der weiten Wiese wüchsen.
Es ist, als habe der Herrgott sich hier heroben, mitten im ewigen Eis und Schnee, durch die Kraft Seiner Allmacht einen Zaubergarten geschaffen, unzugänglich dem Fuße der Menschen, von keinem Sterblichen geahnt und gewusst.
Dies hatte Beatus Klingohr mit überwältigender Wucht empfunden, als er vor ungefähr einer Woche unerwartet diesen Gottesgarten betreten, und die nie geschaute Schönheit dieses Märchens hatte ihn derart bestrickt, dass er nicht loskonnte und Weiterwandern und Ziel vergaß.
Vom ersten Lichtschimmer bis tief in die sternklaren Nächte hinein wandelte er immerzu kreuz und quer über die Almwiese, lag er bald dort, bald da zwischen den insektenumsummten Blumen, kniete er über jeder Knospe, ihr mit dem warmen Hauch seines Atems helfend, den Wiegenschlaf von ihren geschlossenen Lidern zu lösen, damit ihr Auge früher der himmlischen Glückseligkeit der Sonne teilhaftig würde.
Er wusste, wo die größten Enziane leuchteten, die mehligsten Primeln dufteten, wo die strahlendste Arnika stand.
Viel hockte er auch bei den Bann- und Zauberblumen, von denen man sagt, dass sie unheimliche Kräfte in Wurzeln, Stängeln und Blütenknospen bergen, mit denen man Geister und Kobolde rufen und bannen, sich unsichtbar machen und vor Stich und Schuss feien könnte; die nie erlahmende Stärke zu geben vermochten und Haus und Hof vor fressendem Feuer bewahrten.
Wie vielverratend allein schon ihre Namen klangen! Beschreikraut und Trattelblümel, Geisterwurz, Teufelsbart und Wetterhex! Es war ihm jedes Mal, als zögen sie ihn mit unsichtbaren Netzen in ihren Bann; die unheimlichsten Geschichten wurden in seinem Gehirn lebendig und immer wieder zog es ihn in ihren Machtkreis.
Stundenlang sah er dann wieder dem Flug der Adler und Geier zu, kannte jedes Tier am Klang seines Schreies, seinem Schweben und Flügelklaftern, an der Art seines Aufsteigens und der Richtung des Rückfluges zum heimischen Horst.
Dann wieder lag er regungslos und belauschte in nicht endender Geduld die scheuen Murmeltiere bei ihren possierlichen Spielen.
Dazu stand Tag um Tag die jungstarke Sonne am wolkenlosen Himmel, der schimmerte wie eine riesige Schale von Lapislazuli, die der Ewige behutsam über diesen Himmelsgarten gelegt. Und manchmal verspann sich Beatus in den Gedanken, dies Gestirn oben sei gar nicht die Sonne, sondern das warme, gütige Auge des Schöpfers, der mit unendlicher Liebe auf dieses Wunder herabblicke.
Und es durchrieselte ihn jedes Mal das Glücksgefühl, dass der Herrgott ihn sehr lieb haben müsse.
Die ganze Zeit war kein Menschenlaut an sein Ohr gedrungen und er war dadurch noch mehr in dem Gedanken bestärkt worden, in den Garten Gottes geraten zu sein.
So lebte er wie ein Verzauberter.
Am liebsten aber saß er am Ufer des kleinen Bergsees, dessen smaragdgrüner Kristall so klar und durchsichtig war, dass sein Auge auf dem mannstiefen Grunde jeden Stein, jede Alge und jedes zuckende, flossenschlagende Fischlein betrachten konnte.
Wie seliger Traum war es, wenn in feierlicher Gelassenheit große, weißballige Wolken über den blanken, sonnenlichtfunkelnden Spiegel hauchten oder ein beutesuchender Adler ahnungslos seine stolzen Kreise über ihm zog.
Zu diesem See lenkte Beatus nun seine Schritte, setzte sich auf einen großen Felsblock, ließ seine Blicke ringsum wandern und hatte sich bald wieder in sein tief versunkenes Schauen verloren.
Manchmal höhlte sich seine Hand unbewusst zur Trinkschale, tauchte in den See und führte das kalte Wasser, das noch nach herbem Winterschnee schmeckte, an den Mund.
Denn Beatus aß seit Tagen nur einmal, und zwar, wenn die Sonne sich tief auf die Abendseite neigte und der Wald lange Schatten auf die Almwiese zu werfen begann. Deshalb musste er seinem Magen Wasser zuführen, damit der Hunger nicht gar zu arg wurde.
Als er vor einer Woche nach vielstündigem, schwerem Aufstieg durch den Wald drüben unerwartet in dies verborgene Zauberreich menschenscheuer Berggeister getreten war, über das die eben untergehende Sonne den blauen, goldschimmernden Abendschleier wob, hatte Beatus den Frieden auf der Almwiese so unirdisch empfunden, dass sein Entschluss, hier zu bleiben, vom ersten Augenblick an festgestanden war.
Der suchende Blick hatte sofort einige geduckte, steinbeschwerte Almhütten in einer sanften Mulde entdeckt. Und als die Tür der Sennhütte seinem prüfenden Versuche nachgegeben und ihn eine wirtlich eingerichtete Feuerküche mit offenem Herde begrüßt, hatte er sich so gastlich willkommen gefühlt, dass ein heller Jauchzer durch die winterverschlafene Hütte bis hinauf in die Firstsparren gehüpft war. Beim letzten Dämmerschein war er die alte Holztreppe hinaufgestiegen und in eine urgemütliche Schlafkammer gekommen. Es wäre schwer zu sagen gewesen, wer behaglicher geschmunzelt hatte, das dicke, rotwürfelige Federbett oder der es zärtlich streichelnde Fremdling.
Bis tief in die Nacht war Beatus im Fenster gelegen, hatte in die Sterne und die Mondsichel geschaut, zum silberglänzenden Seespiegel hinüber geträumt und vor Freude keinen Schlaf finden können.
Und als ihn kommenden Tags die Sonne aus der Behaglichkeit seines Bettes geholt und er das Himmelswunder so recht in der starken Frische des prangenden Sonnenmorgens gesehen, war er vollends verzaubert worden.
Erst am Nachmittag, als sein Magen zu knurren begonnen, war er zu sich gekommen und mit besorgter Miene in die Feuerküche getreten, auf deren Ofenbank sein Ränzel lag. Doch so hartnäckig er auch bis auf den Grund gebohrt und gekramt, hatte er darin doch nicht mehr als einen Laib Brot gefunden. Trübselig an der spärlichen Schnitte kauend, die er sich zugemessen, hatte er halb gedankenlos in der Küche herumgestöbert und bald zu seiner freudigen Überraschung einen großen Laib Käse in den Händen gehalten, hart wie Stein zwar, der ihm aber die Möglichkeit bot, längere Zeit in diesem Zaubergarten weilen zu können.
Doch die ständigen Ekstasen, dieses inbrünstigste Sichversprühen und Versenken flammten als lodernde Brände durch seine Lebenskraft und steigerten das Hungergefühl weit über das gewöhnliche Maß.
So war der Vorrat dennoch rasch geschrumpft.
Um nicht aus diesem Paradies durch den Hunger vertrieben zu werden, übte sich Beatus seit Tagen in schwerstem Fasten, das er mit gleicher Standhaftigkeit durchhielt wie ein frommer Waldbruder seine heiligen Ereiferungen.
Die ersten Tage war er dabei halb wirr geworden. Nachts hatte er vor Hunger nicht schlafen können. Aber wer hätte überhaupt bei diesen Sternennächten schlafen können, in denen ein so allgewaltiges Gleißen, Flimmern und Funkeln am samtdunklen Firmamente stand, dass es einem mit überwältigender Wucht durch Kopf und Herz hämmerte: Bruder Mensch, sieh deinen Gott! Sink in die Knie und bete!
So wachte Beatus viele Nächte durch, stand stundenlang regungslos draußen im tauigen Almgras, den Kopf tief im Genick, die Hände erhoben.
Erschöpft vor Hingabe ans Herz der Mutter Natur und von schwerem Fasten fiel er mittags, wenn die Sonne brütend über dem Kessel stand, auf einige Stunden in Schlaf. Aber seine Seele fand auch im Schlafe nicht Ruhe. Es schien ihr, als versäume sie inzwischen etwas Herrliches, Großes, das unwiederbringlich vorübergehe.
So war Beatus in den letzten Tagen durch Inbrunst, Fasten und Nachtwachen, ohne sich dessen bewusst zu sein, in jenen erdentrückten Zustand der Eremiten gekommen, in dem die Seele sich langsam aus dem Leibe entfesselt und dadurch immer mehr jene Fähigkeiten des Schauens, Fühlens und Erlebens erlangt, die der Mensch meist als überirdische Wunder anspricht, während sie in Wirklichkeit nichts anderes sind als ein Rückerlangen göttlicher Fähigkeiten der Seele, die im Alltagsleben niedergebunden bleiben.
Und dann kam die Stunde der Dämmerung, die Beatus über alle Maßen liebte.
Die Hände im Schoß gefaltet, den Kopf an die Hütte gelehnt, saß er bewegungslos auf der Bank neben der Tür und blickte in die Sonne, die unmerklich den Gebirgsgrad hinunterstieg. Auf der Mondseite aber begann es nun zu lodern und zu glühen. Jäh verwandelten sich die milden Glutmauern in wildaufbrennende Feuerlohen, die den Gottesgarten gegen anschleichende Unholde schützen zu wollen schienen.
Kein Vogellaut kam mehr von den Wäldern her. Mit ruhigem Flügelschlag schwebte der uralte Wildadler über den feierlichen Himmel seinem Horste im Geklüft des Dachsteins zu.
Die erhabene Feierlichkeit des Himmels hatte sich auf die Alm herabgesenkt und lag auf ihr als ein Friede, der so unaussprechlich war, dass die Seele vermeinte, jetzt und jetzt müsse Gottvater selber aus dem Wald dort treten und über die Wiesen wandeln.
Und dieser hehre Friede, vereint mit dem Glühen der einsamen Hochgebirgsgrate, löste in seiner Seele täglich dieselbe tiefe, ahnende Andacht aus, dass ihre wahre Heimat nicht hier auf Erden sei, sondern irgendwo oben über den Gluten der Gipfel, wo die Seele frei und leicht, entbunden von den Fesseln und Lasten des Fleisches, einzig nur ihrer wahren Bestimmung lebe: der Anbetung Gottes.
In solcher Stunde gingen seine Gedanken immer in sein stilles Heimatdorf und in das vertraute Haus seiner Eltern. Stumm setzte er sich zu den beiden einsamen Menschen und redete mit ihnen viel über die einstigen seligen Tage seiner Kindheit und Jugendzeit. Und es überfiel ihn jedes Mal eine derart heftige Pein über sein zerbrochenes Leben und die bittere, sorgenbange Verlassenheit der beiden alternden Eltern, dass er sich ungestüm aus der herzpressenden Not dieser schmerzlich-trauten Bilder reißen musste und seine Zuflucht in der Werkstatt des alten, schlohweißen Hahnvaters in Bernau nahm. Und es kam über ihn stets eine leise Wehmut bei diesem Denken an den Alten, der so einsam in den langen Nächten beim Licht der Schusterkugel in der Werkstatt saß und niemanden um sich hatte, der ihm Liebes erwies. Und Beatus holte dann das heilige Vermächtnis des greisen Freundes aus der Tasche und erbaute sich beim Fackelschein der brennenden Berge an einem der tief ins Gemüt greifenden Lieder Paul Gerhards.
Und stärker als in allen Zeiten seiner Wanderjahre, seit ihn das Schicksal so jäh auf die heimatlose Landstraße geschleudert, stieg hier heroben in der erdenlärmentbundenen Stille seiner Einsiedlertage eine erregende, selige Sehnsucht in ihm auf, die ihn tief beunruhigte. So deutlich standen die Bilder vor ihm, das einsame Schloss im Odenwald, die edlen, schönen Züge der hohen Herrin, deren tiefe, traurige Augen immer wieder mit einer vorwurfsvollen Frage auf ihm ruhten, so nah und greifbar, dass quälende Unruhe sein Herz erfüllte. Rief ihn ihre Seele, suchte ihn ihre Liebe so gewaltig über Berge und Länder oder war es die Sehnsucht des eigenen Herzens, die ihm diese schmerzlichsüßen Bilder so lebendig vor das innere Auge stellte?
Er musste dann jedes Mal seine aufgeregten Gedanken in der Gestalt des legendenumwobenen Wunderapostels sammeln, auf dessen Fährte er seit Wochen einhergewandert war und die ihn auch in diese Bergeinsamkeit geführt hatte.
Und wieder, wie schon so oft die letzten Tage, glitt Bild um Bild an ihm vorbei, genoss er noch einmal im Geiste die behagliche Winterrast beim baumlangen Dr. de Christophoro im Kundenspital zu Zams bei Landeck am Inn. Ja, bist uns ein echter Christophorus gewesen, hast uns auf deinen breiten Buckel genommen, mich, den schelmischen Vögeli-Heini, und meinen guten Heinrich Truckenbrodt, und hast uns gar sorgsam hinübergetragen über die Fährnisse des Winters!
Ob wohl schon irgendwo in der Welt deutsche Vagabunden sich so gestreckt und so herzhaft und sorglos ins Schneetreiben gelacht haben wie wir?
Ende Februar, am Tage der heiligen Walpurga, ist Vögeli-Heini davongeflogen. Der goldgekrönte Haselwurm ist wieder Nacht um Nacht in seinen Träumen erschienen und hat ihn hinausgeholt in die Welt.
Bald darauf hat auch Heinrich Truckenbrodt das warme Nest verlassen.
Da hatte auch er keine rechte Freude mehr gehabt. Dazu war von Tag zu Tag die Sorge in ihm größer geworden, er könnte hier den nach Deutschland ziehenden Wunderapostel verpassen. Denn dass der Heißgesuchte über den Winter in Italien gewesen, war nach der Erzählung des weißbärtigen Zigeunerfürsten, der sich ihrer in Frankreich drinnen in ärgster Not angenommen hatte, so gut wie sicher.
Als dann am Maria-Verkündigungs-Tage, nach wilden Föhnstürmen, über Nacht grünes Gras auf allen Hängen leuchtete, hatte es ihn schreckjäh aus seinem geborgenen Nest gescheucht. Wie ein Häufchen Herbstlaub, in das die jungstarken, übermütigen Lenzwinde fuhren, hatte es ihn südwärts geweht, nach Bozen zu und das Etschtal hinunter. Viele Tage lang hatte er sich hier aufgehalten und an jedem Haus den Zinken des Wunderapostels, das Herz mit der Blume, gesucht – doch vergebens!
Deutsche Zugvögel waren etschaufwärts gekommen, bei Tag und Nacht marschierend, doch so viel er auch gespäht, der Wunderapostel war nicht gekommen; so viel er auch gefragt, keiner hatte ihn gesehen. Und als ihrer immer mehr geworden, die instinktgetriebenen Herzens der Heimat zuflogen, hatte ihn eine Angst überfallen, die ihn Tag und Nacht nimmer schlafen ließ. Bis tief unter Rovereto hatte ihn die Unruhe hinabgetrieben, nur von dem einen Gedanken erfüllt, den sehnsüchtig Gesuchten zu finden.
In den italienischen Nestern hatten sie bereits das Fest der Palmkätzchenweihe begangen, die Osterglocken waren mit Jubelgeläute vom Heiligen Vater aus Rom zurückgekehrt und hatten unter großem Gepränge in den warmen, sonnigen Frühlingstag geklungen, dass es im Etschtal sang wie von Tausenden heller Vogelkehlen – und immer noch war die Prophetengestalt des Alten nicht erschienen, so sehr seine suchenden Augen auch südwärts gespäht.
Ganz verzagt und kleinmütig hatte er eines Tages wieder im Straßengraben gesessen, im Schatten zweier mächtiger Edelkastanien, als ein graubärtiger Kunde des Weges gekommen war und sich mit der Frage vor ihm aufgepflanzt hatte, wie man bei solch gottvollem Wetter nur ein so grämliches Gesicht machen könne.
Und er fühlte ordentlich noch die schreckhafte Freude in sich, die ihn dortmals durchfahren, als ihm der fremde Walzbruder auf seine Klage eröffnet hatte, dass er in der Lage sei, seiner Betrübnis Abhilfe zu schaffen.
„Wie du mich hier siehst“, hatte er lachend gesprochen, dabei mit dem Knotenstock an seine Brust klopfend, „habe ich das Glück gehabt, vor noch nicht ganz zwei Wochen in einer Osteria zu Cremona mit dem Wunderapostel und seinem Freund, dem Kundendichter, zusammenzutreffen und mit ihnen einen Abend zu verplaudern. Aus ihrem Gespräch habe ich entnommen, dass der Wunderapostel den Weg den Gardasee aufwärts hat nehmen wollen und der Kundendichter ihn bis Trient begleitet.“ Und laut auflachend: „Ja, Freund, so ist es schon mal in der Welt! Während du da trübselig am Straßenrand gesessen bist, ist der Heißerwartete ein paar Kilometer seitwärts an deiner Nase vorbeigezogen!“
Gegen Mittag des übernächsten Tages waren sie beide in Trient einmarschiert und bald hatten sie das Herz mit der siebenblättrigen Blume entdeckt, deren einzelnes Stängelblatt etschaufwärts wies.
Jedes Mal, wenn er beim Nachsinnen an diese Stelle kam, spürte Beatus die tiefe Ergriffenheit, die ihn beim Anblick des heiligen Zeichens, das er seit Straßburg nimmer gesehen und das er mit so viel Sehnsucht gesucht, erfüllt hatte; und sie erregte ihn so, dass ihm das Herz mächtig im Leibe zu klopfen begann.
Diese Erregung wurde jedes Mal durch den bangen Gedanken gesteigert: Wie würde der Wunderapostel ihn aufnehmen! Wohl hatte er zwei mächtige Nothelfer: den alten Evangelisten, mit dem er innige Freundschaft geschlossen, und den Zigeunerfürsten und dessen Geheimparole, die dieser ihm in Frankreich anvertraut hatte. Aber die Bangnis wich dennoch nicht von ihm. So war er fliegenden Fußes und klopfenden Herzens viele Tage den Weg der Zinken einhergeeilt und dem Gesuchten sehr nahe gekommen. Da hatte er eines Morgens staunend bemerkt, dass der Wunderapostel den beschwerlichen Weg über den Dachstein eingeschlagen hatte.
Beklommenen Herzens hatte er sich an den Aufstieg gemacht, ganz von dem Gedanken erfüllt, nun jeden Augenblick dem geheimnisvollen, mächtigen Manne gegenüberstehen zu können. Und der Gedanke, dass er dem großen Meister nicht willkommen sein und alle Hoffnungen, auf welche die sehnlich-bangen Träume eines gänzlich neuen Lebens gebaut waren, zunichte werden könnten, hatte ihn plötzlich so mächtig überfallen, dass er sich auf die Erde geworfen und sein Gesicht in den würzigstarken Bergboden gepresst hatte.
Wie lange er so in der Not seines Herzens gelegen, das wusste er nimmer; aber als er sich plötzlich auf verfehltem Wege gesehen und ihm schließlich klar geworden war, dass er sich verirrt, hatte ihn neben schmerzlichster Betrübnis doch auch eine wohltätige Erleichterung ergriffen, die so schwerwiegende Entscheidung hinausgeschoben zu sehen.
Als er hernach unerwartet bei den letzten Strahlen der Sonne in dies weltverborgene, von seligem Frieden überwehte Zauberreich geraten war, hatte er es als gute Fügung des Schicksals genommen und sich mit jener Inbrunst in das hohe Mysterium der Gottesnatur und in sich selbst versenkt wie ehedem Verkünder des Wortes der Gottheit, bevor sie die Bahn ihrer öffentlichen Wirksamkeit betraten.
Und er hatte hier jene feste Gleichmütigkeit gewonnen, die ihn voll freudiger Zuversicht dem Zusammentreffen mit dem prophetischen Wunderapostel entgegensehen ließ.
Während Beatus Klingohr dies alles überdachte, waren die lodernden Brände auf den Zinnen der zackigen Gebirge verglüht und langsam erloschen. Tiefblaue Schatten hatten sich auf die Hänge der Berge gelegt, die, gigantischen Unterbauten gleich, das alabasterne Weiß ihrer Opferaltäre gegen den Himmel hielten. Und der Ewige sah es mit Freude, die bei Ihm erhabene Einmut ist, und befahl all Seine Lichtengel an das Firmament Seines Himmels, auf dass sie der Ihm opfernden Natur die Ströme Seiner Liebe zutrügen. Alle Sterngeister schimmerten in sinnverwirrendem Glanz.
Es waren die Nächte, in denen die Zwillinge die Herrschaft im Tierkreis hatten. Mächtig strömten sie starke Lebensfeuer in die ihnen zugeordneten Karneole, und die Beschwörungs- und Zauberkräuter schossen kräftig empor und standen im besten Saft für Salben und Zaubertränke. Merkur hatte ein starkes Wort zu reden und die sagenumwobenen Wurzeln der Mandragora zogen unheimliche magische Bannkräfte in ihre Leiber, die seit Menschengedenken von Wissenden erregten Herzens gegraben wurden. In den Tälern und Wiesen aber stand die Kamille in höchstem Segen. Dazu fand alles, was gelb blühte oder glänzte, Hilfe durch die Hierarchie der Zwillinge.
Beatus ahnte in diesen Tagen noch nichts von den gewaltigen Zusammenhängen alles Seienden, seine Seele aber war von einer seltsamen und unerklärlichen Erregung erfüllt. Abend um Abend versprühte er sein ganzes Ich in die hinreißende Schönheit des Sternenhimmels, seine schwebende Seele stets wieder sammelnd und findend am heimatmilden Lichte der Sichel des zunehmenden Mondes, die unmerklich durch das Lied der Gottesallmacht ihre Bahn dahinzog.
Hirsche schrien wild auf, dass ihr kampfmutiges Röhren unheimlich durch die Nacht klang, und von den Waldrändern her zitterte ununterbrochen das klagende Gewimmer großäugiger Nachtvögel, das sich wie das Stöhnen unerlöster Geister anhörte. Beatus waren sie längst der trauliche Pulsschlag dieses tiefen Nachtfriedens. Seine Brust war von feierlicher Glückseligkeit erfüllt.
Endlich löste Beatus die Blicke aus dem Sternenzelt, stand auf und ging zum See. Ein Bild wie die Offenbarung aus einer überirdischen Welt bot sich hier seinen Augen. Ein riesiger, eirunder Edelstein, der von Hunderttausenden gleißender Goldsplitter übersät und durchädert war, lag vor ihm in kristallener Regungslosigkeit. Aus dem einen ovalen Ende schob sich ein weißlich schimmernder Keil in den flimmernden Spiegel: der Dachstein.
Und weiter schritt Beatus, bis an jene Stelle, wo die unheimlichen Kräuter der Hexen und Zauberer wuchsen. Kniete dort nieder, mitten zwischen sie, streckte seine Hände aus, die Finger weit gespreizt, und murmelte selbstgeformte, dumpfe Worte der Beschwörung, sie heißend, ihm Kraft von ihren Kräften und Macht zu geben, dass sich ihm die Geheimnisse erschlössen, welche die Natur ängstlich verbirgt. Legte seine Finger auf Blätter und Blütenköpfe und bat sie, in ihn ihre Zauberströme, an die er glaube, einfließen zu lassen, auf dass sie ihn verwandelten und er mit wissenden Sinnen an dem Leben der Natur teilhaben dürfe.
Auf dem Rückweg überfiel ihn plötzlich eine derart bleierne Müdigkeit, dass er sich nur mühsam in die Sennhütte schleppen konnte, wo er augenblicklich in schweren, tiefen Schlaf verfiel.
Mit gleichmäßigen Atemzügen schlief Beatus. Schlief die Natur und mit ihr die Zeit, der unberührbar Stunde um Stunde aus den Händen rinnt ...
Als er wieder eines Nachts am See saß und lange in dessen Spiegel starrte und die unirdisch klaren Grate des Dachsteins betrachtete, schreckte ihn plötzlich ein grell aufschimmerndes Licht auf. War ein leuchtender Stern mitten in die Dachsteinmauern gefallen?
Beatus hob den Kopf und blickte auf die gewaltigen Wände. Und er sah mit heftig anwachsendem Staunen ein großes, wunderbares Licht, das rasch zu kreisen schien und allmählich überging in ein ruhig leuchtendes, gleichschenkeliges Kreuz.
Ebenso überrascht wie befremdet starrte Beatus unverwandt auf die Licht-Erscheinung. Doch je länger er hinsah, umso gesammelter schien ihm das Lichtkreuz zu werden, das auch an der Innenwand seines Heimatkirchleins stand und von dem er irgendeinmal gelesen hatte, dass es das älteste über die ganze Erde verbreitete Zeichen der Menschheit sei.
Und das Licht verharrte in der gewaltigen Wand. Beatus fühlte, tief überzeugt, dass es nicht von gewöhnlich Sterblichen herrühre. Es schien ihm, dass das Strahlen und Blinken umso stärker wurde, je mehr er dies dachte und je länger er auf dieses heilige, geheimnisvolle Zeichen starrte. Doch so gewaltig die Erregung in ihm war, noch viel gewaltiger war der Strom, der von dem Lichtzeichen auf ihn zufloss und in ihn einbrach!
Beatus fühlte deutlich, wie ein nahezu Körperhaftes ihn traf, und er empfand es als eine machtvolle Anrührung, eine stark gebietende Anrufung und Aufforderung. Namenlose Unruhe überfiel ihn so übermächtig, dass er plötzlich am ganzen Leibe zitterte. Er spürte sie immer bewusster, ohne sich darüber klar werden zu können, dass dieses heilige Lichtzeichen ihn gebieterisch ansprach, aber es war ihm nicht möglich, es zu verstehen. Alles, was er vermochte, war, dass er regungslos in das Blinken des Kreuzes starrte und seine Seele in Ehrfurcht hingab. Schließlich fühlte er eine unsägliche Wohligkeit im Herzen, wie man sie empfindet, wenn man nach langer Abwesenheit das Dorf seiner Jugend und Heimat betritt oder die Gnadenstunde erlebt, in der man ganz nahe bei Gott ist.
Plötzlich verschwand das unfassbare Licht.
Wie im Traum wankte er heim, warf sich auf sein Lager und fiel sofort in tiefen Schlaf.
Den ganzen anderen Tag konnte er nichts anderes denken als an dieses geheimnisvolle, unfassbare, nicht von Menschen stammende Licht. Und er war geneigt, es für ein Wahnbild zu halten, obwohl seine Seele es ihm anders sagte.
Mit immer größer werdender Spannung erwartete er den Abend, die Nacht. Lange vor der Zeit saß er genau an derselben Stelle am Ufer des Sees und starrte auf die immer dunkler und dunkler werdenden Wände.
Und siehe, zur selben Stunde brach wieder aus den unbesteigbaren, wild niederbrechenden Felsmauern das rätselhafte Licht! Und formte sich wieder zum Kreuz mit den gleichen Balken, dem ältesten Lebenszeichen der Erde, und wieder ging die seltsame, erschreckend körperhaft-spürbare Kraft der Anrührung auf Beatus über, so deutlich, dass kein Zweifel möglich war.
Was war das für ein Licht?
Wer formte und sandte es aus?
Und wer vermochte eine derart fühlbare Macht in das Licht zu legen?
Seine Unruhe und dieser Strom, der auf ihn floss, steigerten sich bis zur Unerträglichkeit. –
Und das Lichtkreuz erschien auch in der dritten Nacht und war leuchtender und eindringender als in den beiden vorigen Nächten.
Nach dieser dritten Nacht erschien es nicht mehr.
Da wusste Beatus mit Schaudern, dass es ein Zeichen gewesen aus einer hohen und verschlossenen Welt, das ihm gegolten. Sollte es auf Erden Wesen geben, Menschen und doch unerreichbar hoch über allen Sterblichen, wie die Kunde ging, und den Erdgebundenen dennoch so unheimlich gegenwartsnah?
Beatus lag die ganze Nacht wach. Seine Seele flatterte und war in Regionen, die sein Tagverstand nicht fasste. In ihm war eine große, geweitete Feierlichkeit, wie sie in kühlen Gotteshäusern ist, wenn deren eherne Portale an heißen Sommertagen weit offenstehen.
Wer waren sie, diese Unerreichbaren?
Was taten sie auf diesem Thron der Götter?
Und was, was wollten sie ihm sagen? Denn dass sie zu ihm geredet, das wusste er.
Erst als die Sterne verblassten, verfiel er in Schlaf.
Doch wieder erwachten die Vogellieder, stieg die Sonne strahlend mit königlichem Glanz über die Firnkämme der Hochgebirge.
Als Beatus am fünften Morgen nach dem letzten Erscheinen des Lichtkreuzes über die Schwelle der Sennhütte in die Pracht des Morgens treten will, werden seine Augen von dem leuchtenden Prangen einer Himmelschlüsselblume gebannt, die dicht an der Schwelle aus der Erde wächst und ihre voll aufgebrochenen Golddolden dem Heraustretenden entgegenhält.
Verzückt starrt Beatus lange Zeit auf das Blütenwunder, das gestern noch nicht da gewesen ist.
Und sich niederbeugend, die würzigen Kelche behutsam in die Hände nehmend, spricht er ergriffen:
„Habt Dank, ihr himmlisch lieblichen Schwestern, für das Zeichen, das ihr mir gebt! Ich nehm euch als Mahnung und goldene Schlüssel, die mir ein neues Leben erschließen! Nun ist die Stunde erfüllt, nun will ich dem Wunderapostel begegnen!“
Wendet sich, packt eilig sein Ränzel, steigt hinauf in die Schlafkammer, blickt sich noch einmal in ihr um, fährt dankbar über das Federbett und steigt hinunter in die Feuerküche. Nimmt Ränzel und Wanderstock, legt seine Hand einen Atemzug lang auf die Ofenbank und tritt über die Schwelle. Beugt sich zum buschigen Primelstock nieder, bricht die zartgoldenen Blüten und befestigt sie an seinem Hut. Sagt dann der gastlichen Hütte ein letztes Lebewohl und schreitet rüstig durch die tauglitzernden Gräser der morgenfrischen Wiese.
Am See taucht er seine Hand eine Weile in das kristallgrüne, eisige Wasser, schaut forschend mit starkem, fragendem Blick auf die Felswand, in der das geheimnisvolle Licht erschienen. Dann geht er mit weit ausholenden Schritten über die einsame Alm, die ihn an das versiegelte Tor der Geheimnisse der Schöpfung geführt hat.
Hoch über ihm aber, in der kaltklaren Bläue des Morgens, kreist mit weitgespannten Schwingen und scharf äugenden Lichtern der König des Dachsteins, der uralte Wildadler.
Zweites Kapitel
Hinter Munderfing zieht sich die Landstraße sanft einen niedrigen Hügelrücken hinauf, um ebenso gemächlich auf der drüberen Seite wieder in eine Talmulde hinabzukriechen. Es ist hier alles so gemächlich und behaglich im Innviertel: die Landschaft, die Dörfer und die Bauern. Da ist nirgends etwas Wildes, Eigensinniges wie im Salzkammergut; hier ist alles ein ewiges hügelauf, hügelab, eine stete Geruhsamkeit. Und hügelauf und hügelbreit, so weit das Auge reicht, ist das Land ein einziger Fruchtboden von goldenem Korn und saftigen Weiden.
Oben, wo die Straße den Hügelrücken erstiegen, steht an ihr ein uraltes steinernes Wegkreuz, von einer riesigen Holderstaude umbuscht, die aus Aberhunderten gelblichweißer Blütenteller betäubend süßen Duft über die Höhe ausgießt und wie eine Wächterin in das Dorf hinabsieht, das mit den festen Fäusten seiner Bauern die Scholle betreut. Weit über hundert Jahre muss der mächtige Busch alt sein, denn der Bauer Peter Suchentrunk, der am Pfingstsonntag hundertzwei Jahre geworden und der Dorfälteste ist, behauptet fest und steif, der Holderbaum wäre schon zu seinen Bubenzeiten so groß gewesen. Und Barbara Maatz, die alte Häuslerin am Ende des Dorfes, die seine Jugendgespielin gewesen, bestätigt dies und erzählt immer wieder, sie hätten als Kinder oft und oft unter den Ästen des Baumes gespielt.
Und es konnte den Kindern ganz unheimlich werden, wenn die Alte von dem heiligen Busch erzählte und mit gekrümmtem Buckel die Verslein zischelte, die sich anhörten wie ein Zauberspruch.
Barbara Maatz hatte den Glauben, der diesen Sträuchern ohnehin schon anhängt, durch ihre Geschichten so lebendig gemacht, dass der Holderbaum von Munderfing weit im Innkreis als heilig galt. Kein Fuhrmann fuhr an dem Wunderbaum vorüber, der nicht den Hut ehrfürchtig vor ihm gezogen hätte, und wenn im Dorfe unten einer starb, dann stieg der Schreinermeister Martin Ansorge feierlichen Schrittes die Chaussee hinauf und schnitt unter schweigender Anrufung eine Stange aus dem Holderbusch, um mit ihr das Maß der Leiche für den bestellten Sarg zu nehmen. Martin Ansorge war der Einzige, der dies durfte. Dies wäre der Frau Holle, die in dem dichten Laub des Strauches hause, angenehm, erklärte Barbara Maatz; wenn einer aber aus Unfug einen Zweig bräche, der beleidige die hohe Frau und ziehe ihren Zorn auf sich.
Von ihr wussten die Leute im Dorfe auch, dass man sich das ganze Jahr über vor Fieber bewahren konnte, wenn man sich zur Zeit, da der Baum die Blüten ansetzte, in den ersten Nächten des abnehmenden Mondes früh vor Tag unter seine Äste legte und sich mit einem niedergezogenen Zweig den Tau ins Gesicht schüttelte.
Wenn aber jemand zu ihr kam und über die staunenswerte Rüstigkeit in ihrem so hohen Alter redete, da wiegte Barbara Maatz den schmalgeschnittenen, klugen Kopf hin und her und hatte ein geheimnisvolles Lächeln um ihren kraftvollen Mund, in dem kein einziger Zahn fehlte. Es waren dann immer die nämlichen Worte, die sie beinahe im Flüsterton sprach: „Ja. die Beeren, die Beeren! Die schwarzen Beeren vom heiligen Hollerbaum!“
Und wenn man sie dann bestürmte und weiter in sie drang, konnte man wohl erfahren, dass diese Beeren die Kraft besaßen, das Leben zu verlängern, wenn sie am richtigen Tag und in der rechten Stunde gepflückt wurden. Ob man aber auch noch so sehr bettelte oder noch so schlau herumredete, Tag und Stunde hat ihr nie einer herauslocken können. Und sie schien an dem Bestreben der Leute, ihr dies Geheimnis zu entreißen, helle Freude zu haben, denn listig funkelten dann ihre rabenschwarzen Augen in den tief eingesunkenen Höhlen. Und während ihr Kopf pendelte, kam es wohl mehrmals beinah in singendem Tone von ihren Lippen: „Ja. der Tag und die Stunde ...“ Sie erzählte ab und zu ganz Vertrauten, dass der Bauer Peter Suchentrunk von ihr Beeren bekäme, und dies deshalb, weil sie in ihrer Jugendzeit ein Liebespaar gewesen und schon von Kind auf oft unter dem heiligen Hollerbaum gesessen hätten.
Und sie kam schließlich in den Ruf, sich unsichtbar machen zu können, denn so viel und so hartnäckig man sie auch belauerte, es hat nie einer die Stunde erspäht, in der sie unter der mächtigen Staude die schwarzen Beeren brach.
Die Kinder aber sahen immer wieder mit großen, neugierigen Augen zu dem alten Busche hinauf, von dem ihnen das Weiblein erzählt, Frau Holle habe sie alle aus seinen Zweigen geschüttelt.
Unter diesem heiligen Holderbaum von Munderfing lag Beatus Klingohr längelang im kühlen Schatten.
Er wusste von dem allem nichts, aber auch er musste sich in seinen Gedanken mit der alten Barbara Maatz beschäftigen, die dort unten am letzten Häuschen des Dorfes auf der Hausbank in der Sonne saß. Was war das für eine seltsame Alte! Deutlich konnte er ihre regungslose, ein wenig vorgeneigte Gestalt sehen. Und er konnte sich nicht genug wundern über ihre frische, beherzte Art, mit der sie ihn angehalten, als er die staubige Dorfstraße heraufmarschiert war: „Ist ein feines Vergnügen, so in der warmen Sonne zu laufen!“ So hatte sie ihm zugerufen. Überrascht war er stehengeblieben und hatte ihr entgegnet: „Ei ja, Mutter, das ist es wohl!“ Hierauf hatte sie ihm schelmisch zugelächelt und gemeint, dass man es sich an solch gottgeliebten Tagen nicht zu eilig machen solle. „Aufs Genießen, ich mein, aufs dankbare Hinnehmen und Würdigen dessen, was der Herrgott in seiner Güte gibt, darauf kommt’s im Leben an, mein Lieber“, fuhr sie fort. „Aber die Menschen bekommen dafür gewöhnlich erst im Alter einen Sinn und dann haben sie nimmer viel davon und müssen auf den Bänken sitzen.“ Und mit lebhafter Beweglichkeit etwas auf die Seite rückend und ihren bauschigen Rock an sich drückend, hatte sie so gemütlich gesagt: „Aber darüber können wir beide geradeso gut sitzend reden“, dass er sich mit frohem Behagen neben der Greisin niedergelassen hatte.
„Die Menschen haben den Kopf viel zu viel auf die Erde gerichtet und sorgen sich zu sehr um die Notdurft des Leibes und den kommenden Tag“, hatte sie nun ernst das Gespräch wieder aufgenommen.
„Und dabei sehen sie nicht, wie die Welt rings um sie lacht und voll Sonne ist, und so entgehen ihnen ungezählte Freuden, welche das Leben erst lebenswert machen.“
Beatus hatte stumm genickt. Die Greisin fuhr fort:
„Es ist bitter traurig, dass so wenige Menschen das wissen! Was bedeuten ihnen die Wunder der Welt neben ihrer Arbeit! Sie sorgen sich nur, dass ihr Auswendiges gut geborgen ist; um ihr Inwendiges kümmern sie sich nicht. Von dem wissen sie nahezu nichts. Nur einen hab ich in unserem Dorfe gekannt, der darin anders war. Er ist ein Großbauer gewesen, und wenn er hinter seinem Pfluge hergegangen ist, dann hat er nicht bloß die braune Ackererde gesehen, sondern hat sich über jede Blume am Weg gefreut und über jeden Vogel, der über ihm geflogen ist, ja über jede Mücke, die vor ihm tanzte. Und wenn der Wind vom Gebirge her geblasen hat, dann ist es für ihn nicht nur ein Wind gewesen, den die andern nicht wahrnehmen, wie sie in ihrem Innersten einen blühenden Baum oder eine schöne Wolke kaum wahrnehmen, weil es ja doch nur ein Baum oder bloß eine Wolke ist, die sie bestenfalls nur mit den Augen streifen, nicht aber mit der Seele erleben. Sondern für ihn ist es ein lustiger Geselle gewesen, der viel Spaßiges und Ernstes zu erzählen gewusst hat, und der einem das Haar zausen konnte, dass es nur so flatterte! Ja, der hat mir oft über derlei Dinge erzählt. Und siehst du, Junge, darauf kommt es im Leben an, man muss das Herz offen haben und muss sich freuen können, und man darf nie gleichgültig sein! Weil die Menschen aber ihren Sorgen viel zu viel Raum geben, darum sehen sie die unzählbaren Schönheiten nimmer, die Gott in Seiner grenzenlosen Liebe über Seine Erde gebreitet hat. Und darum ist ihr Leben und Wirken auch ohne die wahre Freude, und glaub mir, eben darum, weil die Menschen es nimmer verstehen, aus jeder Stunde ihres Lebens Freude zu ziehen, darum werden sie so schnell alt! Du kannst es mir glauben, dass es so ist! Sich freuen können, das ist das Geheimnis des Lebens! Sich freuen können, heißt lange leben, denn Freude haben, heißt die Gesundheit haben! Der Peter Suchentrunk hier im Dorf ist einer von den wenigen, die den Sinn des Lebens verstanden haben. Darum ist er auch hundertzwei Jahre alt, und wenn er sonntags zwischen seinen Kindern und Kindeskindern zur Kirche geht, ist sein Rücken so grad wie der seiner Enkel.“
Nun hatte die Alte eine Weile innegehalten, und er entsinnt sich deutlich, wie jetzt die Worte über seine Lippen gekommen sind, dass es wohl schön und wahr sei, was sie gesagt, und er ihr mit Freuden zustimme. Aber ohne es recht zu wollen, war ihm der Nachsatz entschlüpft, dass das Leben es einem manchmal doch arg schwer mache, froh zu sein.
Wie war die Greisin da lebhaft geworden!
„So lass es hart sein, das Leben!“, hatte sie ihm entgegnet.
„Wer von uns hat denn ein Recht, ohne Leid zu sein! Wer darf verlangen, dass es ihm immer gut gehen soll! Das steht keinem von uns zu und darüber dürfen wir nicht klagen, denn es ist sicher, dass sich dahinter ein tiefer, großer Sinn verbirgt. Vielleicht der tiefste des Lebens.“ Und nach einer kleinen Pause: „Aber das sollen wir wissen, die Welt und das Leben bleiben allezeit schön und voll Wunder, auch wenn die Hand des Schicksals einmal hart auf uns liegt! Wohl, es kann dir ein Leid geschehen, die Welt aber ist darum nicht weniger licht und die Freuden derselben sind darum nicht geringer geworden!
Ob du in diesem oder jenem Augenblick deines Lebens in der Sonne stehst oder im Schatten, darauf kommt es nicht an, sondern darauf kommt es an, dass du nicht lau bist! Das ist das weit schwerere Übel! Jedes Leid vergeht und findet seine Versöhnung in den Schönheiten der Welt. Glaub mir: Nur auf das bewusste Leben kommt es an! Wer das kann, der vermag sich auch im Leid zu freuen, denn die Freuden der Gotteswelt sind ohne Zahl. Darum hab ich zuvor gesagt, das tiefste Geheimnis des Lebens ist: sich freuen können.“
Bei diesen Worten hatte er ihre Hand genommen und zärtlich gestreichelt. Und Barbara Maatz, die wusste, wie sehr er sie verstanden, hat mit der tiefen Liebe einer Mutter auf ihn geblickt. So waren sie eine Weile gesessen, dann hatte er gerührt gesagt:
„Wie schön habt Ihr das ausgedrückt, Mutter! Ich danke Euch und ich glaube, wir müssen als Gleichnis nicht erst zum alten Bauer Peter Suchentrunk greifen!“
Doch die Alte hatte abgewehrt und entgegnet:
„Wir wollen nicht von mir reden; ich bin dazu zu alt geworden! Aber als ich dich da vorhin langsam die Dorfstraße heraufkommen sah, die Augen bald links auf einem Giebel, bald rechts in einem Blumenfenster, und als du dich gar vor den mächtigen Birnbäumen beim Suchentrunkbauern seiner Toreinfahrt aufgepflanzt hast, den Kopf in der Höh, und aus dem Schauen gar nicht herausgekommen bist, siehst du, da hast du mir gefallen und da hab ich meine Freude gehabt an dir! Und da hab ich auch gewusst, wer du bist, und mir vorgenommen, dich anzurufen. Ach, es geht so mancher Wanderer des Weges, doch fast immer haben sie den Kopf zur Erde gesenkt und mit ihrem Schuhwerk auch ihre Augen verstaubt! Wie tut mir das immer bis in mein altes Herz hinein weh, wenn ich so blinde Augen sehe!“
Und nun ihrerseits ihre runzelige Hand auf die seine legend, hatte sie ihm zugelächelt: „Dein Gesicht aber war froh und in deinen Augen hat noch die Freude geglänzt über die großen, schönen Bäume. Gelt, das sind Bäume! Die haben hier im Ort ebenso viel zu reden wie der Bürgermeister und der Pfarrer. Schau, und darum ist mir um dich nicht bang! Schauen können, erleben können, das ist alles! Wer das vermag, in dem seiner Brust kann es nie dunkel bleiben, in dessen Innerem bricht früher oder später die Freude durch und wenn’s vordem stockdunkel in ihr gewesen wär! Aber ich denk, wir wollen miteinander eine Schale Kaffee trinken. Nein, nein, das darfst du mir nicht abschlagen! Es ist grad Jausenzeit und was Warmes im Magen ist zu allen Tageszeiten gut.“
So hatte er denn mit Freuden zugestimmt und in Barbara Maatz’ Küche einen Topf Kaffee getrunken.
Und als er ihr zum Abschied die Hand mit gutem Segenswunsch gedrückt, hatte ihn die Alte noch einmal forschend angesehen und gesagt: „Ich seh, dass du etwas sehnlich suchst. Ja, es ist dir aufs Gesicht geschrieben! So merke: Heute ist ein Glückstag, und wenn du von mir einen guten Rat annehmen willst, so tu Folgendes: Dort oben auf dem Hügel siehst du den großen Hollerbaum, von dem seit alters her die Rede geht, dass er unter dem Schutz ganz besonderer Mächte steht. Geh dort hinauf und leg dich recht andächtig unter seine Krone, das wird dir Glück bringen!“
So lag er nun hier unter dem heiligen Holderbaum von Munderfing und harrte auf das Glück. Und seine Gedanken waren bei der alten, klugen Barbara Maatz mit ihrer tiefen, feinen Seele, die so weltversteckt in diesem kleinen Dörfchen saß und doch eine ganz große, wundervolle Frau war!
Seine Blicke gingen immer wieder ins Dorf hinunter und über die Feldbreiten hinweg, die in vollem Segen standen.
Und immerzu strömte der gewaltige Busch eine derartige Fülle süßesten Duftes aus, dass der ganze Hügelrücken nach der Würze seines Honigs roch. Hähne krähten im Dorf unten, ab und zu kläffte ein Hund, sonst kein Laut, soweit die Augen gingen. Glühendheiß lag die Sonne über dem strotzenden Fruchtland und buk die Körner in den Ähren, die so zahlreich waren wie die Tropfen im Meere. Der Wanderer, der in diesen Tagen durch das Innviertel Oberösterreichs ging, roch das Brot auf den Äckern.
Im Süden zog sich in dunstigen Schleiern die langgestreckte Kette der Alpen hin. Beatus kam unter der Gewalt des Sonnenglastes und Honigseims ins Träumen und erlebte voll dankbarer seliger Freude noch einmal alles von der Almwiese am Dachstein bis zur kleinen Wegkapelle am Eingang des Dorfes Munderfing. Hier hatte ihm der Zinken des Wunderapostels entgegengegrüßt und das Datum ihn belehrt, dass der Zeichenschreiber ebenfalls erst heute an dieser Kapelle vorbeigekommen sei. So war er also dicht hinter ihm und heute vielleicht noch, spätestens morgen, musste er auf ihn stoßen. Wo es sein würde und um welche Zeit? Und wie die Begegnung wohl sein würde? Heut ist ein Glückstag, hat die alte Barbara Maatz gemeint. Der käm mir gerade gelegen! Glück könnt ich gebrauchen! So hilf mir, du schöner, sonnenleuchtender Tag, und auch du, du uralter, geheimnisvoller Holderbaum von Munderfing!
Lange sah er in die mächtige Krone des Busches hinauf, dessen weiße Blütendolden, die fast bis zum Boden niederhingen, wie goldene Teller leuchteten, in denen der würzige Honig unter den Gluten der Sonne zu kochen schien, denn der ganze Strauch war ein siedendes, brodelndes Bienenlied.
Als Beatus wieder ins Dorf hinabblickte, bemerkte er einen Mann, der eben daran war, die Straße heraufzusteigen. Gemächlich, wie einer, der nichts Dringendes vorhat, setzte er Fuß vor Fuß. Ohne besondere Aufmerksamkeit beobachtete Beatus das langsame Heraufkommen des Mannes. Dieser musste eine kraftvolle Gestalt haben, denn es schien ihm, als höbe dieselbe sich machtvoll von dem weißen Bande der Straße ab. Ein Bauer war es nicht, denn Bauern bewegen sich anders, schwerfälliger. Der unten aber hatte etwas in seinem Gang, das auf endloses Wandern deutete. Plötzlich musste sich Beatus ordentlich zurechtsetzen. Er konnte keinen Blick mehr von dem Heraufkommenden wenden, so gefesselt war er von der Art dieses Schreitens. Nie noch in seinem Leben hatte er einen Menschen so schreiten sehen!
Je näher der Fremde kam, umso größer wurde sein Staunen über die Erscheinung, die bei aller Kraft dennoch kaum den Boden als Halt für die Füße nötig zu haben schien, während sie heraufschwebte. Sein Gehen war, wie wir Menschen uns das Schreiten Christi oder Buddhas vorstellen, wenn wir in den heiligen Evangelien darüber etwa Folgendes lesen: ‚Und Jesu schritt aus den Toren der Stadt und wandelte über die Felder und es wollte Abend werden‘, oder wenn uns in den heiligen Palischriften der Inder etwa die Worte begegnen: ‚Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der Sacker, bei Kapilavatthu, und wandelte unter den Feigenbäumen des mächtigen Parkes.‘
Und je näher die Gestalt heraufkam, umso mehr wuchs auch der Eindruck, dass er einen solchen Erhabenen vor sich hätte.
Beatus war wie gebannt. Wer mochte das sein! Welcher Sterbliche vermochte so zu schreiten! Erregung und Entzücken wallten heftig in seinem Herzen gegeneinander. Er hatte das Gefühl, dass in den nächsten Augenblicken Großes, Unvorstellbares sich ereignen müsse, und in seiner Aufregung standen plötzlich die Worte der alten Barbara Maatz vor ihm. Ihm selber unbewusst, verkroch er sich unwillkürlich tiefer unter die niederhängenden Zweige.
Nun wandte sich die Gestalt, blickte ins Dorf hinab und nahm den breitkrempigen Hut ab.
Als der Wanderer hierauf in deutliche Nähe kam, fuhr ein Schlag durch Beatus Klingohr, der ihn beinah umwarf.
Der Wunderapostel! Beim allmächtigen Gott: der Wunderapostel!
Ja, er war es, er war es Zug um Zug! Sein Antlitz kündete es so gewaltig, wie es sein Gang gekündet hatte, den er nicht sogleich als den seinen erkannt. Der Atem wollte ihm stocken, in seinen Augen glomm ein Feuer der Verzückung, wie es in denen jener Glückseligen geglüht haben mag, an denen der Erlöser vorbeigegangen.
Die Mär der Vagabunden hatte nicht zu viel gesagt! Sie hatte viel zu wenig gekündet! Auf diesem Antlitz lag die Hoheit, wie sie das Haupt weiser, sagenumwobener Könige längst verklungener Jahrtausende geziert haben mag, gepaart mit einer derart sonnenhaften Klarheit, die nur Auserwählte kennzeichnet, deren Geist in alle Höhen und Tiefen des Seins gedrungen, und dem sich Geheimnisse der Schöpfung geoffenbart, die sich den andern Sterblichen eifersüchtig verschließen. Der assyrisch gehaltene dunkle Bart, in dem die ersten Silberfäden spielten, unterstrich noch diesen Eindruck. So denken wir Menschen uns das Antlitz eines Erhabenen. Doch so sehr dieses Antlitz auch leuchtete, wurde es dennoch überstrahlt von dem blendenden Glanz zweier Augen, die so mächtig waren wie die Majestät der Sonne vor der Erhabenheit des Himmels.
Beatus war nicht fähig, sich zu bewegen. Wuchtig lag die Ehrfurcht vor der Größe dieses Erhabenen, dem er sich so einfältig hatte nähern wollen, auf ihm und drohte ihn zu erdrücken. Gewaltig, wie eine Sturzflut, brach die Nichtigkeit seines Seins in ihn ein. Als er aber seine Blicke neuerdings auf die zwei milden Sonnen richtete und die unendliche Güte fühlte, die von diesem Gesichte ausging, war doch wieder eine unerklärliche, wohlige Ruhe in ihm und freudige Zuversicht senkte sich in sein Herz.
Die machtvolle Gestalt, die dem Gliederbau des hünenhaften alten Evangelisten nur wenig nachgab, ragte wie eine Säule gegen das Blau des Himmels. Das stark angegraute Haupt von den Strahlen der in seinem Rücken stehenden Sonne wie von einem Heiligenschein umspielt. So sah er lange ins Dorf hinab. Unten, neben dem fließenden Brünnlein vor ihrem Hause, gewahrte Beatus die anheimelnde Gestalt der alten Barbara Maatz. Es war alles so klein dort unten zu den Füßen der Gestalt vor ihm, die aufragte wie der heilige Leib eines Weltüberwinders.
Und die alte Barbara Maatz, die so klein da unten am Brünnlein stand, gab Beatus plötzlich gläubigen Mut, dass er sich leicht und freudig vom Boden erhob. Laut raschelte das Laub des alten Holderbaumes von Munderfing. Ruhig wandte sich der Wunderapostel um, und als er die Gestalt aus den Zweigen treten und über den mit Sternblumen übersäten Hang auf sich zukommen sah, legte sich ein so freudiges, gütiges Lächeln auf das Antlitz des heißgesuchten Meisters, dass es Beatus’ Sinne verwirrte und sein Schritt unsicher wurde. Gleichzeitig aber war es ihm, als flute eine starke, bebende Welle von Liebe in sein Herz.
Ohne einen Laut über seine Lippen bringen zu können, trat Beatus vor den Wunderapostel, die Hände hilflos herabhängend, seine weitgeöffneten Augen mit der ganzen Kraft seines Glaubens auf den Ersehnten gerichtet.
Doch wie vor einer überirdischen Erscheinung taumelte Beatus zurück, als der Wunderapostel die Arme öffnete und ihn mit den Worten an seine Brust zog:
„Sei mir gegrüßt, Beatus, mein Sohn! Ich habe lange auf dich gewartet!“
Drittes Kapitel
Die Turmuhr von Aurolzmünster schlug Mitternacht. Laut und behäbig drangen ihre vollen Töne durch die mondklare Stille, über Dächer und Felder hinweg, bis weit hinaus auf die Wiesen am Waldrand.
Dort standen zwei Gestalten im hohen Gras, die sich immerzu niederbeugten. Aufgerichtet lauschten sie, bis der letzte der zwölf Schläge verhallt war, dann krümmten sie die Rücken wieder zur Wiese hinab. Hell floss das silberne Licht des Mondes über sie.
„Du hast es also nicht verwechselt“, kam es von dem größeren der beiden Suchenden: „Von der Schafgarbe und dem Teufelsabbiss nehmen wir das Kraut –.“
„Und vom Spitzwegerich, der Pfefferminze und dem Thymian die Blüte“, fiel der andere mit eifriger Stimme ein.
„Ja, so ist es recht!“
Schweigend suchten und rissen sie eine Weile nebeneinander, dann stellte der Jüngere der beiden die Frage:
„Hat es eine bestimmte Bedeutung, Vater, dass wir von allen Blumen der Wiese heute gerade diese Kräuter pflücken?“
„Ja, Beatus! Denn jede Pflanze hat eine Zeit, in der ihre einzelnen Teile in stärkster Heilkraft stehen, und in dieser Zeit sollen sie gebrochen werden. Diese aber ist für die Kräuter, die wir heute nehmen, der Juni.“
„Und stehen außer diesen im Juni keine anderen in höchster Heilkraft?“
„Doch! In diesem Monat steht sogar eine ganz große Anzahl von Pflanzen in voller Kraft, nur müssen diese wieder an anderen Tagen geholt werden.“
„So hat also Vögeli-Heini doch recht gehabt, wenn er sagte, jedes Kraut habe seinen Tag und seine Stunde?“
„Freilich! Dies war die volle Wahrheit!“, erwiderte der Wunderapostel.
„Wenn es so ist, dann könnten wir also diese Kräuter an gar keinem anderen Tag der Woche pflücken als dem heutigen?“
„Das stimmt nicht ganz, Beatus; aber insofern hast du recht: Willst du die Kräfte in ihnen in ihrer gesteigertsten Heilwirkung, dann musst du sie an ihrem Tage brechen. Wie ich dir schon gesagt habe, kannst du im Juni eine Unzahl von Pflanzen sammeln; doch musst du dies bei Kamille und Johanniskraut zum Beispiel an einem Sonntag tun und beim Baldrian und der Königskerze an einem Mittwoch. Den heilsamen Salbei müsstest du an einem Donnerstag suchen, den leuchtenden Feldmohn hingegen an einem Montag.“
„Wie ist das seltsam“, sprach Beatus ernst. Und nach einer Pause: „Warum muss es in unserem Falle gerade ein Freitag sein?“
„Weil die Schafgarbe und die anderen Kräuter, die wir heute sammeln, Venuskräuter sind!“
„Venuskräuter? Was heißt das und was hat es mit dem Freitag zu tun?“
„Das soll heißen, dass diese Pflanzen dem Planeten Venus unterstehen und am Freitag die gesteigertste Heilkraft haben, weil dieser Tag unter der besonderen Beherrschung der Venus steht.
Doch damit du dieses ganze Pflücken der Pflanzen in den Nachtstunden tiefer verstehst, will ich weiter ausholen. Komm, setze dich hier nieder und höre!
Gott hat in seiner ganzen Schöpfung alles auf die Zweipoligkeit, also auf den Gegensatz gestellt. Denn erst im Gegensatz werden die Dinge sich bewusst und entsteht jene geheimnisvolle Spannung, durch die sich das Leben erkennt.
Der eine Pol ist immer der strahlende, aktive; der andere Pol der empfangende, passive. Der strahlende, männliche Pol strebt danach, sich voll bewusst zu werden. Diese volle Bewusstseinserlangung aber ist nur möglich durch das Aufstoßen auf den Gegenpol. Erst dadurch, dass der weibliche, passive Gegenpol die Strahlung des männlichen, aktiven Poles auffängt, wird sich dieser durch die Empfindung seines Seins am hemmenden Gegenpol bewusst.
So wird selbst Gott sich seiner erst an Schöpfung voll bewusst; Christus an Luzifer, der Geist am Stoff, das Licht an der Finsternis, das Gute am Bösen, das Gesunde am Kranken, das Große am Kleinen, der Mann am Weibe, das Leben am Tod, das Positive am Negativen.
Auch innerhalb unseres Sonnensystems herrscht zwischen der Sonne und unserer Erde diese Zweipoligkeit.
Die Sonne ist positiv und verkörpert das zeugende, schöpferische Prinzip und ist männlich; die Erde ist negativ und verkörpert das aufnehmende, tragende Prinzip und ist weiblich. Beide zusammen sind die ,himmlische Ehe‘ und schaffen in ihrem sinnvollen Zusammenspiel ebenso wie Mann und Weib das Leben.
Oder, wenn wir es vom Standpunkt eines Wesens aus betrachten, die Sonne ist der Geist dieses Sonnensystemwesens, die Erde der Körper, und der Mond, der um die Erde kreist und aus ihr stammt, ist die zu diesem Leibe gehörende Seele. Du weißt längst, dass die Erde und alle Geschöpfe der Erde nur durch die Sonne leben können. Die Menschen sagen, durch das Licht und die Wärme, die von der Sonne strahlt. So richtig das ist, ist es doch nicht das Urgründige!
Der Urgrund dieses lebenschaffenden Geheimnisses ist nicht das Licht und nicht die Wärme, sondern die Lebenskraft, das Lebensfluidum, das ewig aus der Sonne strömt. Die unsichtbare Lebenskraft, die mit dem sichtbaren Licht- und Wärmestrahl dauernd auf die Erde fließt, ernährt und erhält die Erde und jedes Geschöpf ebenso am Leben, wie im Mutterleib der Embryo am Leben erhalten wird durch das Blut und die Säfte, besonders aber durch die Lebenskraft der Mutter! Das zu wissen ist entscheidend!
Und auch dieser Lebenskraftstrahl der Sonne ist zweipolig und besteht aus einer positiven und einer negativen Seite. Er ist Tag und Nacht derselbe, nur dass die Erde ihn in den Tagesstunden unmittelbar aufnimmt und in den Nachtstunden umweglich über den Mittler oder die Linse des Mondes. Dadurch wird der Lebenskraftstrahl zweipolig.
Der geradewegs auf die Erde fließende Lebenskraftstrahl ist positiv elektrisch, also zeugend oder männlich, und dient der Erde und den Gottesfunken aller Geschöpfe zum aktiven, stofflichen Aufbau des Körpers: der dauernden Nahrungsbereitung, der Bildung der Zellen und der ungeheuren Abwicklung aller Lebensfunktionen. Denke bloß, um nur eine einzige zu nennen, an die ungeheure Leistung des Wasserpumpens von der Wurzel bis zum Wipfel! Und bei Mensch und Tier noch an die vielgestaltige Art ihrer Bewegungen und Tätigkeiten. Dieser große Verbrauch an Lebenskraft ist das Geheimnis, warum Mensch und Tier, und auch die Pflanzen, abends nach getaner Arbeit müde werden.
Der des Nachts hingegen mittelbar über den Mond auf die Erde fließende Lebenskraftstrahl ist negativ magnetisch, also aufnehmend oder weiblich, und dient der Erde und der Seele der Menschen, Tiere und Pflanzen zur passiven Auffüllung der Körper, also zur Aufspeicherung dieser astralen Fluide in den Nervensträngen, dem Blut und den Säften, um das ausgelaugte Geschöpf immer wieder zu erneuern und kraftstark zu machen für die ungeheure Tagesarbeit unter dem unmittelbaren Strahl der Sonne. Denn der Tag dient der Arbeit und verbraucht die Lebenskraft. Die Nacht dient der Ruhe und der Aufladung derselben.
Dass es so ist, siehst du bei Menschen, welche die Nacht durchschwärmen! Sie schauen welk aus, denn die Lebenskraft, welche des Nachts auffüllend in sie fließen sollte, wurde nicht aufgespeichert, sondern verbraucht, und so sind ihre Zellen nicht genügend geladen und somit ohne Spannung. Darum ist es von zwingender Notwendigkeit, dass jeder Mensch wenigstens zwei Stunden vor Mitternacht auf seinem Lager ruht.
Und nun wirst du ohne Weiteres begreifen, warum die Pflanzen des Nachts gebrochen werden müssen, wenn du sie zu Heilzwecken verwenden willst.
Brichst du die Pflanze des Tages, brichst du nur ihr Kraut, denn da die Lebenskräfte der Sonne, also die astralen Heilessenzen der Pflanze, während des Tages verbraucht werden, steht sie in diesen elektrischen Stunden in ihrer Ohnmacht und Schwäche.
Brichst du sie aber in den passiven, aufnehmenden Stunden der Nacht, in denen die Pflanze ruht und voll geladen wird mit dem heiligen Feuer des leuchtenden Lebensgottes, dann brichst du sie in den Stunden ihrer Gnade und Stärke. In diesen Nachtstunden ist die Pflanze und die ganze Natur einem Weibe gleich, das den lebentragenden Samen des Mannes in sich aufnimmt.
Ebenso wie bei jedem Geschöpf nicht der sichtbare, vergängliche Körper das Wahre ist, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist, so ist in den Pflanzen nicht der Saft das Wahre und Heilende, sondern die im Saft wesende und webende Lebenskraft der Sonne!
Diese im Safte webenden, magnetischen, astralen, himmlischen Arkana sind das Wahre, die Quinta Essentia der Pflanze!
Darum hatte euer größter priesterlicher Arzt und Kosmosoph Theophrastus Paracelsus vollkommen recht, wenn er sagte: ,Was dich am Brote nährt, ist nicht so sehr das Stoffliche an ihm, als die im Stoffe wesenden, geistigen Kräfte.‘