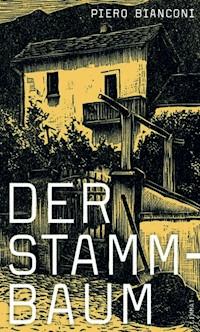
17,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Der Stammbaum": Anhand der eigenen Familie erzählt Bianconi vom Schicksal der Bewohner des kleinen Tessiner Bergdorfs Mergoscia. Als er im März 1966 in das fast verlassene Dorf hochsteigt, findet er zerfallende Mauern und darin eine Truhe mit Dokumenten, Verträgen und vor allem Briefen. Briefe von jungen Tessinern, die seit dem 19. Jahrhundert ausgezogen waren, um anderswo das Glück zu finden, angezogen von den magischen Namen Australien und Kalifornien, von der Hoffnung auf Gold und Wohlstand. Kaum einer fand das Glück, viele kamen zurück. Aber die warnenden und beschwörenden Berichte der Heimgekehrten verhinderten nicht, dass die nächste Generation wieder aus der Armut und Kargheit ihrer Dörfer floh, um das Abenteuer zu suchen. Bianconis Vorfahren waren allesamt brillante Briefeschreiber, ob sie nun Kleinigkeiten über den Ozean austauschten, sich Ratschläge erteilten oder bittere Vorwürfe machten. Es entsteht ein ungemein plastisches und präzises Bild des Lebens der Auswanderer wie des Bergdorfs: ein faszinierender Blick in die Geschichte des Verzascatals.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
«Der Stammbaum»: Anhand der eigenen Familie erzählt Bianconi vom Schicksal der Bewohner des kleinen Tessiner Bergdorfs Mergoscia. Als er im März 1966 in das fast verlassene Dorf hochsteigt, findet er zerfallende Mauern und darin eine Truhe mit Dokumenten, Verträgen und vor allem Briefen. Briefe von jungen Tessinern, die seit dem 19. Jahrhundert ausgezogen waren, um anderswo das Glück zu finden, angezogen von den magischen Namen Australien und Kalifornien, von der Hoffnung auf Gold und Wohlstand.
Kaum einer fand das Glück, viele kamen zurück. Aber die warnenden und beschwörenden Berichte der Heimgekehrten verhinderten nicht, dass die nächste Generation wieder aus der Armut und Kargheit ihrer Dörfer floh, um das Abenteuer zu suchen.
Bianconis Vorfahren waren allesamt brillante Briefeschreiber, ob sie nun Kleinigkeiten über den Ozean austauschten, sich Ratschläge erteilten oder bittere Vorwürfe machten. Es entsteht ein ungemein plastisches und präzises Bild des Lebens der Auswanderer wie des Bergdorfs: ein faszinierender Blick in die Geschichte des Verzascatals.
Foto Alberto Flammer
Piero Bianconi (1899–1984), geboren in Mergoscia, war ein Tessiner Schriftsteller. Bianconi galt als Nestor der Tessiner Autoren. Er bildete sich zum Primarlehrer aus und promovierte später an der Universität in Fribourg in französischer Literatur. Bevor er ins Tessin zurückkehrte, verbrachte er kurze Zeit in Florenz und Rom. Nebst einem reichen Prosawerk verfasste er auch zahlreiche kunstgeschichtliche Texte und arbeitete als Übersetzer. Bianconi starb 1984 an den Folgen eines Autounfalls in Minusio.
Piero Bianconi
Der Stammbaum
Chronik einer Tessiner Familie
Nachwort von Renato Martinoni
Aus dem Italienischen von Hannelise Hinderberger
Limmat Verlag
Zürich
Quel contentement me seroit ce d’ouir ainsi quelqu’un qui me recitast les meurs, le visage, la contenance, les parolles communes et les fortunes de mes ancestres! Combien j’y serois attentif!
Montaigne, Essais, II, 18
… dans toute la durée du temps de grandes lames de fond soulèvent, des profondeurs des âges, les mêmes colères, les mêmes tristesses, les mêmes bravoures, les mêmes manies à travers les générations superposées …
m. proust, Le Temps retrouvé
Maria Angela und Giacomo Rusconi, Barbarossa genannt
Maria Angela, Margherita und Battista Rusconi
Giuseppe, Maria Orsola Campini, Mutter von Barbarossa, Angelica und Gottardo Rusconi
Der Pass von Barbarossa aus dem Jahre 1867
Der erste Brief von Barbarossa, 17. Juli 1867
Anna und Maria Mansueta Rusconi
Gottardo, Giacomo und Anna Rusconi
Brief von Angelica Rusconi, 4. August 1889
Giovanni Battista Rusconi jr. auf der Ranch von James Campini in Placerville, Kalifornien
1
Gestern und morgen
Juni 1965
Ich bin mit meinem Sohn, dem Geologen, in der Junihitze zum untern Verzascatal hinaufgestiegen. Die Talsperre ist fast beendet. Es herrscht intensiver Arbeitseifer und Werklärm. Antennen, Krane, Silos. Zement und zerkleinertes Berggestein bilden die grosse, gewalttätige Mauer, die das Tal absperrt. Auf dem tadellosen doppelten Bogen wimmelt es von Arbeitern wie von Ameisen. Mit dem Rauschen geölter Räder transportieren die Schiebekarren die letzten Betonladungen.
Wir gehen auf der Staumauer. Grauer Zement, aus dem da und dort Eisenstücke hervorragen. Sie bilden das Skelett dieses steinernen Organismus, der nicht tot und starr, sondern – wie mir Filippo erklärt – elastisch, vibrierend, kurz: lebendig ist. Es herrscht Weltuntergangsstimmung: ein rasend schnelles und doch geregeltes, fast ruhiges Hin und Her, das seinen eigenen Zauber hat. Von der mächtigen Mauer gestaut, steigt das Wasser und verschlingt ganz langsam abschüssige Böschungen, Felder und Ställe, überschwemmt eine Welt undenklicher, namenloser Mühsal, um Energie, Wärme und Licht hervorzubringen. Ich betrachte mit verwirrten, fast bestürzten Blicken dieses riesige Unternehmen. Mein Sohn Filippo sitzt auf der Erde und prüft mit erfahrenem Geologenauge die «Karotten», die aus den Eingeweiden des Berges herausgezogenen Bohrkerne. Er prüft ihre Dichtigkeit, die Kohärenz, den möglichen Widerstand, den das Werk dem ungeheuren Druck entgegensetzt. Er gehört dieser Welt an, die auf ihre Art verzaubernd ist, dieser Welt, die ich mit Misstrauen betrachte, einem Misstrauen, das gleichsam von Entsetzen durchzogen ist. Es ist eine Welt, weit entfernt von meinen Interessen, meinem Verständnis. Die Raumforschung und die Eroberung des Mondes berühren mich nicht sehr stark. Dies sind Dinge, denen ich eine vielleicht verblüffte, doch kühle, abstrakte Bewunderung zolle. Mir scheint, ich lese in den Blicken der Techniker und Arbeiter die Antwort auf mein Misstrauen; sie sind kalt, vielleicht ein bisschen ironisch.
Ich betrachte das gleichmütige Wasser, das immer höher steigt, die Wolken, die sich in den schmutzigen Fluten spiegeln, wie die fernen Häuser von Vogorno, jene Häuser, die stehenbleiben, und jene andern, die dazu verurteilt sind, zu verschwinden. Ein leiser Windhauch kräuselt die Oberfläche des Sees ein wenig und zersplittert die weissen Wolken, zerstreut sie wie auf einem impressionistischen Gemälde. Es heisst, es seien Millionen von Kubikmetern, ich weiss nicht, wie viele Millionen. Aber wenn ich mir überlege, dass ein Kubikmeter tausend Liter enthält und dass man mit einem Liter zehn redliche Gläser füllt – dann werden für mich, der ich nach Gläsern rechne, die Dinge verteufelt unverständlich, ich finde mich nicht mehr zurecht, ich fühle, wie mir schwindelt …
Auf der alten Strasse, die morgen unter Wasser liegt, spaziere ich allein nach Vogorno weiter. Es werden dort bald nur noch Forellen schwimmen, vielleicht ein wenig betäubt von all dem Neuen. Ich bleibe jenseits des Wassers vor den einsamen Häusern von Tropino stehen; eine Handvoll Ställe, die von der Zeit und dem Elend schwarz geworden sind. (Einst aber war der Weiler bedeutend und dicht besiedelt. Er wird schon in einem Dokument aus dem Jahre 1411 erwähnt, in dem die Gemeinde Mergoscia einen Guillermuzetum ermächtigte, die Unterwerfung unter den Herzog von Savoyen zu vollziehen. In dem Dokument werden die Bewohner von Mergoscia von denen von Tropino unterschieden.) In einem jener Ställe, die sich im Wasser spiegeln, wurde vor mehr als einem Jahrhundert meine Mutter geboren. Ich weiss nicht, war es in dem jetzt noch unberührten oder in dem schon des Daches beraubten, oder in dem, den eben jetzt die Fluten bespülen. Und sie wurde dort unter Verhältnissen geboren, die man nicht zu schildern wagt, denn niemand würde einem glauben.
Die Häuser, die unter Wasser zu stehen kommen, wurden abgedeckt. Jene dreieckige Öffnung unter dem Dach fehlt nun. Man hat die Holzteile weggenommen, damit nicht grosse und kleine Balken auf dem Wasser herumschwimmen. Alles muss ständig gesäubert werden. Zwei Männer in einem Boot sammeln das schwimmende Holz, bringen es ans Ufer und verbrennen es. Eine hellblaue Rauchsäule steht in dem Licht, das durch die beiden einander gegenüber liegenden Abhänge vom See heraufdringt, vom richtigen See. Es ist nicht das langsame und eigentlich barmherzige Werk der Zeit, das wohl zerstört, aber doch auch geduldig die Wunden verbindet und sie vernarben lässt. Es ist die unbarmherzige Hand des Menschen, die den Dingen Gewalt antut und alles nach ihrem Willen zurechtbiegt, oder doch zurechtzubiegen versucht, und zwar mit ruhiger, gleichmütiger Heftigkeit. Hier erlebt man den Gegensatz zwischen den Leuten von gestern, die der kargen Erde einen elenden Unterhalt abrangen, jenes bisschen, das die Natur gewährt, und den heutigen Menschen, welche die Natur vergewaltigen, sie zu dem zurechtbiegen und zwingen, was die Natur nicht will. (Doch ab und zu lässt einen ein kleines Achselzucken der Natur nachdenklich werden …)
Die wenigen übriggebliebenen Ställe sehen aus wie Tiere, die sich dort am Ufer des Wassers zum Trinken niederkauern. Wie ein erschrockenes Auge sperren sie das einzige weissumrandete Fensterchen im Grau der rauen Mauer auf. Sie sind die Denkmäler dessen, was die Welt meiner Vorfahren gewesen ist, die Trümmer des Stalls, wo vor mehr als einem Jahrhundert meine Mutter zur Welt kam. Ihre Mutter, meine Grossmutter, war allein. Niemand stand ihr in der Qual der Entbindung bei. (Und es war ihre erste Entbindung.) Um sich irgendwie zu ernähren, musste sie hinausgehen und eine Handvoll Gras ausraufen. (Es war Februar, und an jener Stelle ist es lau und mild.) Und sie musste das Gras kochen, um nicht Hungers zu sterben. Es ist, als sei das eine Geschichte unterentwickelter Völker (wie die Leute es denn auch tatsächlich waren), eine Erfindung der finstersten Romantik. Aber es ist nichts als die lauterste Wahrheit jenes Lebens, das ich mit einer Mischung aus Mitleid und der Bitte um Abwendung des Elends betrachte. Es war ein entsetzliches Leben, hätte man nicht die Gewissheit gehabt, in den Himmel zu kommen. Doch auch diejenigen, welche diese Gewissheit nicht hatten, harrten zähe aus …
Es ist ein Leben, von dem ich mich sehr weit entfernt fühle, von dem ich ausgeschlossen bin, wie ich auch ausgeschlossen bin von dem Leben, an dem Filippo heiter teilhat, während er dort auf der Erde sitzt und die «Karotten» prüft. Ich gehöre nicht mehr zur Welt meiner Vorfahren, und noch nicht zu der meines Sohnes. Ich bin vereinsamt zwischen einer jetzt fremd gewordenen Vergangenheit und einer Gegenwart, die für mich Zukunft ist, so dass für die Gegenwart, für meine Gegenwart, kein Platz mehr bleibt. Ich fühle mich allein, vereinzelt, schwebend zwischen zwei Lebensweisen, die zwar in der Zeit nebeneinander bestehen, die aber unendlich weit voneinander entfernt, durch Jahrtausende voneinander getrennt sind. Einerseits der vergebliche, einsame Schweiss auf der elendiglichen Erde und andererseits die Gewalttätigkeit der Energie, die aus dem Beharrungsvermögen des Wassers gewonnen wird. Ich frage mich, zu welcher Welt ich nun eigentlich gehöre, an welcher Welt ich teilhabe, so ohne Verbindung mit der Vergangenheit und ohne Brücken in die Zukunft.
Das Elend des damaligen Lebens! Die immerwährende Knappheit, der tägliche Hunger, der in kargen Jahren an Unterernährung grenzte! Und eine Art Grausamkeit, welche die Leute zwang, auch auf das wenige Mögliche zu verzichten und ohne dies auszukommen, zu sparen, weil man sich eine noch trostlosere Zukunft vorstellte. Einer meiner Verwandten sagte, er habe als Knabe den Geschmack aller möglichen Kräuter gekannt; mit Ausnahme derjenigen, die hart waren wie Fischgräte, habe er sie alle gegessen. Meine Tante Paolina hatte ihren ersten Bissen Weissbrot erst mit zwanzig Jahren gekostet. Und sie erzählte, wie sie Nüsse aufbrachen (um Öl daraus zu gewinnen für ein Lämpchen, bei dessen Schein man an langen Winterabenden ununterbrochen spann), und erkühnte sie sich dabei, ein Stückchen Nusskern in den Mund zu stecken, da hörte sie sagen: «Iss, iss, dann stecken wir dir diesen Winter den Docht ins Gesäss!» Und ich habe schon anderswo erwähnt, wie eine Frau die vor Hunger weinenden Kinder tröstete: «Weint nicht, Kinder, gestern haben wir droben in Fossei Erdäpfel gesteckt: Om a metù i tòten su in Foséi …»
Sie haben den Wald abgeholzt, haben jeden Strauch weggeschnitten, der steile Abhang ist ganz kahl. Auch die Reben haben sie bis zur Höhe, die das Wasser erreichen soll, ausgestockt. Übrig geblieben sind die von Mäuerchen gestützten nackten kleinen Felder, über die unschuldiges Gras wächst. Aber niemand wird dieses Gras mehr mähen, keine Wöchnerin wird mehr auf allen vieren herauskriechen, um jene Handvoll Gras auszuraufen, das sie kochen muss, um nicht Hungers zu sterben.
Über dem Wasserstand werfen die Reblauben noch Schatten. Man sieht die kräftigen blauen Schosse (sie sind schon mit Grünspan gespritzt worden), und sie schaukeln im leichten Wind. Und auch droben auf der steilen Anhöhe, wo der Wald noch Raum lässt, sieht man Rebland. Und zwischen jenen Kastanien steht eine Kapelle (ich sehe sie nicht, aber ich weiss, dass sie dort steht), die den Namen meiner Vorfahren trägt und die naiven Gestalten der Heiligen, die ihnen jenes elende Dasein ertragen halfen.
Zwischen dem Brombeergesträuch flitzt vielleicht eine Smaragdeidechse oder eine Viper, grau auf grauer Erde, und dehnt sich träge an der Sonne auf dem Trockenmäuerchen. Man sieht niemanden, nicht eine Seele zwischen den Ställen, wo der Holunder die weissen Flecken seiner Schirmchen ausbreitet. Alles schweigt. Nur ab und zu hört man ein kreischendes Geräusch (sie fällen die Bäume mit jenen Motorsägen, die so grell tönen), und das rhythmische Schluchzen eines verspäteten Kuckucks. Und wenn man die Ohren spitzt, hört man das ferne Getöse der Arbeit am Staudamm, jener hellen Mauer dort unten. In der Höhe segeln am Junihimmel weisse Wolken schweigend dahin. Und schweigend steigt auch das mitleidlose Wasser. Es überflutet, tilgt und verschlingt alles, das leere Gehäuse der Schnecke, die Schlangenhaut und den Stall, wo, verlassener und einsamer als die Muttergottes, vor mehr als einem Jahrhundert meine Grossmutter meine Mutter zur Welt brachte.
Meine Mutter, die als Kind von dieser armseligen Behausung leichtfüssig in die finstern Schluchten des Flusses hinaufstieg. Sie ging im Dorf zur Schule, und in der Tasche hatte sie eine Handvoll Kastanien. Das war ihr ganzes Mittagessen. Sie konnte in der kurzen Mittagspause nicht hinunter- und wieder hinaufsteigen. Wenn ich an sie denke, kommt mir ein Gedanke, der mir oft und immer wieder im Kopf herumgeht: Es liegt mehr tatsächlicher Abstand zwischen der Kindheit und dem Alter meiner Mutter als zwischen ihr, da sie ein Kind war, und den Höhlenmenschen. Zwischen der Art, mit der sie damals Feuer machte, und der Art, in der sie sich in ihren letzten Jahren den Kaffee wärmte. Wenn der Herd erloschen war, trat meine Mutter unter die Tür der Hütte und spähte hinunter nach der gestuften Reihe der mit Steinplatten gedeckten Dächer, die silbern glänzten oder in reinem Weiss, wenn Schnee lag. Sie spähte hinunter, um ein Dach zu entdecken, das rauchte (Kamine gab es in jenen urtümlichen Häusern nicht, der Rauch zog durchs Dach ab oder durch die Türe). Dann nahm sie einen Ginsterzweig, lief die steilen Stufen der Treppen und Stiegen hinunter zu dem rauchenden Haus, bat um die Erlaubnis, legte ein paar glühende Kohlen auf den Ginsterzweig, lief wieder die steilen Treppen und Stiegen hinauf, legte den Ginster in den Herd, blies darüber hin und weckte die Flamme. So bekam sie Feuer, ohne ein Streichholz zu verbrauchen, ein blitzendes Schwefelhölzchen, wie mein Grossvater selig sagte, denn auch diese musste man sparen. Als alte Frau brauchte meine Mutter nur am elektrischen Schalter zu drehen, damit die Minestra zum Abendessen kochte.
Sie erinnerte sich, dass sie als junges Mädchen eine Ladung Wein von Ascona nach Mergoscia tragen musste (wo ein Don Abbondio von dort unten Pfarrer war), und das für einen halben Franken. Und für das gleiche Geld trug sie ein Zicklein auf dem Arm bis nach Locarno. An solche Sachen erinnert man sich, um sie den Nachfahren wie Reliquien zu hinterlassen, damit diese wissen, wie das Leben damals war und wie hart es zuging. Solche Dinge habe ich nicht mehr erfahren, ich kenne sie nur vom Hörensagen. Aber sie kennzeichnen den rasenden Lauf der Zeit, der immer rascher, immer schwindelerregender wird, und lassen einen die Veränderung spüren, die sich in geometrischer Progression vollzieht. Und gerade deshalb nennt man sie Fortschritt.
Deshalb fühle ich mich desorientiert, verloren zwischen der Erinnerung an eine noch zu nahe, fast noch blutende Vergangenheit und einer gegenwärtigen Wirklichkeit, die schwer anzunehmen ist, weil sie allzu unvorhergesehen und anders ist, einer Gegenwart, in der mein Sohn, meine Söhne, sich äusserst wohl fühlen.
An einem Sonntag im Juli steige ich mit Lorenzo nach Mondacce hinauf. Man hört das rasche rhythmische Sensendengeln, marlà. Ich frage ihn, was für ein Ton das sei. Er weiss es nicht, vielleicht ist es ein Steinmetz, vielleicht einer, der Nägel einschlägt, wer weiss … Er kennt jenen so typisch sommerlichen Ton nicht mehr. Für uns ist es wie das Zirpen der Zikaden in wärmeren Ländern, dieses nachhaltige Klopfen, leicht und rasch und auf seine Art wohlklingend, eindringlich in dem grossen Licht. Wie rasch das Leben seine Zeichen auslöscht, wie es sich erneuert und die Bedingungen verändert! Aber so wie Lorenzo jenen sommerlichen Klang nicht mehr kennt, so kenne ich mich nicht aus in Dingen, die ihm vertraut sind. Das steigert das Gefühl der Einsamkeit, der Vereinzelung in jedem von uns. Die Alten stehen auf der einen Seite, und die Jungen auf der andern. Wände, Abdichtungen, unübersteigbare, trennen sie.
Deshalb bin ich darauf bedacht, Erinnerungen wieder aufzuspüren, alle möglichen Erinnerungen, selbst kleine, selbst winzige, die mir helfen sollen, rückwärtszugehen (wie eine Spur, wie die weissen Steinchen des Däumlings, die ihn nach Hause zurückführten), um die Wurzeln meiner selbst wiederzufinden, um mich endlich zu erkennen und mich in meinem verwirrten Dasein zu begreifen.
Ich muss wieder einmal nach Mergoscia hinaufwandern (von hier aus erkennt man nur die Spitze des Kirchturms, der zwischen den Kastanien hervorlugt und der einst die amerikanische Flagge trug, stripes and stars), um mir die vielen, nach Übersee Ausgewanderten in Erinnerung zu rufen. Um Mergoscia richtig zu sehen, muss man auf seiner Strasse hinaufgehen, auf der Strasse, die nur und ganz ihm gehört und auf dem ländlichen Platz vor der Kirche aufhört. Von der Strasse aus erscheint das Dorf ganz ausgebreitet, in seinen verstreuten Teilen, mit seinen einzeln stehenden Häusern. Es ist ein ganzer Ameisenhaufen von Häusern und Ställen, aufgefächert und ausgelegt wie ein graues, weiss gesprenkeltes Linnen auf den Schultern des Berges. Ein Ameisenhaufen von Häusern, Häuschen, Loggien und Altanen und Fensterchen, die neugierig weissumrandet aus dem rauen Grau der Trockenmauern herausschauen. Es ist ein neugieriges Dorf und sonderbar mit Augen besetzt, man fühlt sich beinah verlegen unter so viel Augen. Und zwischen den einzelnen Teilen die unendliche Geduld der Mäuerchen, die wenige Spannen karger Erde stützen, und die parallelen Reihen der kleinen Sackgassen, wie biegsame emsige Höhenlinien (allerdings setzen jetzt etliche Neubauten Flecken geweisselter Mauern und roter Ziegel ins untadelige Grau von einst. Man bekommt Lust, die Augen zu schliessen, damit das alte Bild nicht gestört wird, das sich dem Gedächtnis auf vertraute Weise eingeprägt hat).
So sieht man Mergoscia, wenn man auf der Strasse steht, rechts vom Mühlbach. Ist man aber erst einmal dort oben angekommen – zwischen dem Gasthaus, dem Gemeindehaus, dem Beinhaus und der Kirche –, dann atmet man einen grossen Frieden. Es ist, als stünde man auf einem sonnigen Balkon. Kaum ist man um die Kirche herumgegangen, die, wie auch das Beinhaus, von Grabsteinen übersät ist, kommen wir zum Kirchhof, wo meine Vorfahren in Frieden schlafen, die Alten, die ich auf der dünnen Spur der Erinnerung wiederzufinden suche.
Monsignore Feliciano Ninguarda, Bischof von Como, bemerkte bei seinem pastoralen Besuch (1591), dass das Dorf hundert Herde zählte, «und sie sind reich, doch bei all dem haben sie keinen Pfarrer und keinen Kaplan». Im Jahre 1790 zählte Mergoscia 752 Einwohner. Jetzt erreicht die Bevölkerung mit Müh und Not 120. Allerdings bevölkert sich das Dorf langsam wieder, besonders im Sommer, aber meist sind es Deutschschweizer, welche die leeren Häuser bewohnen. Sie modernisieren sie, sie kommen herauf, um die Sonne zu geniessen. Sie antworten auf den Ruf der Leere, sie nehmen überhand. Man sagt mir, vor einigen Jahren sei die Erstaugustrede auf der Piazza in deutscher Sprache gehalten worden. Zwei Schritte von den Häusern im «Benitt» entfernt, mahnt eine Tafel in deutscher und französischer Sprache: «Abfälle wegwerfen verboten» («Dépôt de déchets interdit»). Das klingt, optimistisch betrachtet, nach einer Einladung, unsere Landessprachen zu lernen. Wenn es nicht eher eine Beleidigung für die verschwundenen Einheimischen ist …
Es gibt keinen Pfarrer mehr. Und der Lehrer der wenigen Knaben ist ein Süditaliener, aus Caltagirone oder Catanzaro soll er herstammen. Und das ist der, fast möchte man sagen sinnbildliche, Zustand vieler, allzu vieler unter den Dörfern unseres Tals. Wenn das so weitergeht, werden wir uns innert kurzem nicht mehr daheim fühlen, sondern im Exil zwischen Deutschen und Süditalienern. Wie grausam unbeheimatet mussten sich die Bewohner von Mergoscia vorkommen, die einst auf den Strassen der Welt sich zurechtfinden mussten, unwissend in allem, besonders in der fremden Sprache, eingemauert in ihre gedemütigte Einsamkeit.
2
Mergoscia
März 1966
Ich bin nach Mergoscia hinaufgestiegen, denn mich verlangte darnach, etwas aus der Vergangenheit wiederzufinden; nicht nur Erinnerungen an mich als Knaben, der ich ab und zu ein paar Wochen dort oben verbrachte, und der ich oft hinging, um die Grosseltern und die Onkels zu besuchen. Jetzt aber finde ich mich zwischen den Häusern des hochgelegenen Weilers, im «Benitt», wo meine Vorfahren lebten und von wo meine Eltern herkamen, nicht mehr zurecht. Von den Leuten, die ich dort kannte, blieben kaum zehn Personen übrig, und sie bieten keine Gewähr für Nachkommenschaft. Die Feuerstellen in den Häusern sind dazu bestimmt, zu verlöschen. Zwischen den verlassenen Häusern ohne Dächer, die Mauern sind oft gut gebaut, aber sie stürzen trotzdem entmutigt ein, zwischen jenem strengen Grau des Steins und den Schornsteinen, die seit Jahrzehnten nicht mehr rauchen, steht ab und zu ein wieder aufgebautes oder auch ein ganz neues Haus, und zwischen dem abgestuften Silbergrau der Steinplatten sind rote Flecken von Ziegeln zu sehen. Von dieser Handvoll Häuser, sagt man mir, sind gut fünfzehn im Besitz von Deutschschweizern, die hier ihre Ferien verbringen; ja einige wohnen sogar dauernd hier.
Es ist März. In einem dunkeln und feuchten Durchgang zwischen den Häusern blüht Seidelbast, ein schmächtiges Zweiglein mit seinem lieblichen Duft. Draussen in den abschüssigen Wiesen steigen hellblaue Rauchsäulen auf. Man hört niemanden, nur das Aufflattern eines Vogels. An einigen Stellen erkenne ich noch die abgewetzten Steine, geglättet von unendlich vielen Schritten; jenen bläulichen, weiss geäderten, und die Treppenstufe, die unter dem Fuss wackelt wie vor sechzig Jahren. Und das hier sind die Stufen, auf denen die genagelten Schuhe des Grossvaters erklangen, worauf denen im Haus die Worte im Mund erstarben. Ich finde tausend Dinge wieder, aber das Bild von einst finde ich nicht mehr. Das Weiss des Verputzes blendet im sonnigen Hof des Grossvaters Rusconi und verjagt die dünnen Schatten der vielen Toten. Alles ist viel zu sauber. Und auch der Geruch ist derjenige fremder Leute. Es bleibt nur das naive Fresko auf der Mauer, die Mutter Gottes, die den toten Sohn im Schoss hält und die einst einer meiner Vorfahren im 18. Jahrhundert malen liess.
Ich stehe da und suche ein Zeichen aus früheren Zeiten, einen Hinweis, der mir die erschreckende Last der Vererbung erklärte, diesen Wirrwarr aus Müdigkeit und Kraft, aus Kühnheit und Zaghaftigkeit, aus Bosheit und untätiger Güte, die mein Wesen ausmachen. Ich suche etwas, das mir erklärte, weshalb ich auf den Schultern so etwas wie eine unendliche, auf der Spitze stehende Pyramide von Menschen zu tragen meine: Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern, Vorfahren ohne Antlitz, eine ganze anonyme Masse. Und weshalb ich ein erdrückendes Gewicht verspüre, körperliche und geistige Lasten, lang vergangene Falten und Wunden, die ich nicht beseitigen kann. Es ist ein Eindruck, der mit den Jahren immer stärker wird. Die oberflächlichen Anwandlungen, der dünne Firnis der Erziehung und Erfahrung, die weniger wesentlich sind, als man glauben möchte, verschwinden. Etwas Tieferes und Wahreres enthüllt sich. Eine geheime Schichtenbildung, fast so etwas wie eine moralische Geologie, kommt zum Vorschein. Wiederum müssen Schmerzen erlitten werden, die unheilbar bleiben, weil sie alt und anonym sind, und ebenso Demütigungen, Leiden und Mühsale. Wiederum müssen die Knochen alle Müdigkeiten der Ahnen erfahren. Und es gibt keine Ruhe, die sie stillen könnte. Sie sind im Blut, zuinnerst im Fleisch.
In den Häusern der Bianconi, der Grosseltern väterlicherseits, ist nichts mehr vorhanden, weder Papiere noch irgendein anderer Hinweis oder ein Schriftstück. Die Häuser sind veräussert worden. Alles ist zerstört. Die wenigen Papiere wurden von fremden Händen dem Feuer überantwortet.
Als Knaben gingen wir oft unsere Tante Nina besuchen, die dort allein lebte. Sie war klein, ein wenig verkrümmt, wachsgelb und hatte einen einzigen grossen blanken Zahn im Mund. Sie allein war übrig geblieben, um den Herd zu hüten. Über dem Feuer stand andauernd der bronzene Kaffeetopf. Und dort flüsterte sie ihre Requiem eterna und ihre Gebete für die Lebenden und Toten und räusperte sich und spann dabei – arm und gütig wie sie war – ihren Rocken leer. Sie erzählte, als ihre Mutter (die Grossmutter Mariorsola, wir nannten sie MammarÌa, und ein Bildnis von ihr hält meine Erinnerung an sie wach) im Sterben lag, hätte sie sie gebeten, ihr eine Erinnerung zurückzulassen, ein Wort, einen Ratschlag, eine Lebensregel. «Tu allen Leuten Gutes!», sagte die Grossmutter zu ihr. Und nach einer Weile, als sie sie nochmals um dasselbe bat, erhielt sie die gleiche Antwort: «Tu allen Leuten Gutes!» Und das tat sie denn auch immer. Selber arm und elend, fand sie Mittel und Wege, denen, die noch elender waren, mit ihrer stets kräftigen Mildtätigkeit zu helfen: mit einer Schüssel voll Minestra, ein wenig Brot, einem guten Wort. Sie hatte sich, wer weiss unter wie viel Entbehrungen, dreissig Franken gespart, drei halbe Taler, um sich ein Kleid schneidern zu können. Dann aber gab sie sie dem Pfarrer, damit er sie nach Indien sende und den Hunger der Ärmsten dort drüben stille …
Sie trug noch die alte Tracht, den Rock und die Schürze dicht unter der Brust gegürtet, und das kurze Mieder, das sich über dem Weiss des aus Hanf gesponnenen Hemdes öffnete. Sie war Asthmatikerin und verbrachte ganze Sommernächte unter einem grossen Birnbaum neben dem Haus. Immer empfing sie uns voller Freude, immer hatte sie einen Apfel, eine Birne oder eine Handvoll gerösteter Kastanien für uns bereit. Sie wunderte sich nie, wenn sie uns unversehens kommen sah: «Ich wusste, dass jemand kommen würde; heute Morgen hat das Feuer gepustet!» Dort neben dem Feuer kauerte sie und hörte ihm zu und deutete es. Auch sprach sie mit den Toten und den weit entfernt Lebenden, mit den Brüdern, die sich dann und wann ihrer erinnerten. Mein Vater hielt ihr immer ein kleines Fässchen voll Wein bereit. Sie starb im Jahre 1922, als sie 68 Jahre alt war.
Auch vom Grossvater Francesco Bianconi, dem Pà Cecc, gibt es eine vergrösserte Fotografie. Eine andere Erinnerung habe ich nicht an ihn. Er starb im Jahre 1904, als ich fünf Jahre alt war. Er war 84 Jahre alt geworden. Es ist in unserer Familie zur Gewohnheit, ja, fast zur streng eingehaltenen Tradition geworden, sich spät zu verheiraten. Das dehnt und verlängert die Intervalle zwischen den Generationen und schafft erschreckend grosse Abstände … Aus dem Bildnis schaut mich ein schönes, klares, heiteres Gesicht an; der Mund ist ein bisschen ironisch, die Stirn ist hoch, und das Haar fällt lang zu beiden Seiten des Kopfes herab. Auch er hatte versucht, das Glück zu erproben, aber es war ihm nicht gelungen. Er hatte sich nach Australien eingeschifft, doch war er eiligst wieder zurückgekehrt, vielleicht sogar auf demselben Segelschiff, und hatte somit nichts nach Hause gebracht als die Schulden für die Reisespesen, die Musse langer Monate auf dem Meer und die verlorene Zeit.
Er war ein scheuer und sanfter Mensch. Als Scherenschleifer zog er durchs Land, besonders durch die Täler bei Lugano, wo bis vor einigen Jahren die Alten sich seiner noch erinnerten. Mit seinem Schleifrad schlief er in den Heuschobern und sparte sich alles vom Munde ab, um die Familie durchzubringen: jeden Becher Wein, jeden Bissen, der nicht unumgänglich nötig war. Als er dem Haus ein paar kleine Kämmerchen anbauen lassen musste, weil die Kinderzahl wuchs, mass er die Höhe der Türe und des Küchenplafonds an seiner Gestalt. Er war ein sehr kleines Männchen, und so musste man sich, wenn man eintrat, bücken, und auch drinnen konnte man nur zwischen den Deckenbalken aufrecht stehen. Aber der Tante Nina ging es dort gut, denn auch sie war klein und von den Jahren und Krankheiten bucklig geworden. Der Grossvater Bianconi war ein weiser Mann, er beschied sich mit dem wenigen, das er besass, oder war sogar zufrieden mit nichts. Er mass alles an seiner klösterlichen Genügsamkeit. Er passte den Schritt seinen Beinen an oder nahm ihn sogar noch ein bisschen kürzer, als die Beine es waren. (Was sicher nicht die beste Art ist, die Beine länger werden zu lassen.) An dieser niedern Tür kann man ein Lebensprogramm ablesen, ein fast horazisches Lebensbekenntnis, einen Sinn fürs Masshalten, der vielleicht nicht möglich ist ohne ein bisschen Egoismus. (Diese Tugend ist bei den Nachfahren nicht ganz verloren gegangen. Mein Vater hat sie geerbt und sein ganzes Leben lang wert gehalten …)
Aus dieser Tür sind mein Vater und zwei seiner Brüder herausgetreten, um nach Amerika auszuwandern. Nur der jüngste Bruder, Pietro – er soll sehr intelligent gewesen sein –, ist Lehrer geworden und zu Hause geblieben.
Aber nicht einmal von Onkel Pietro ist etwas auf uns gekommen. Nur durch Zufall ist es mir gelungen, ein schmales Heft mit der Reinschrift italienischer Aufsätze aus dem Jahre 1879/80 ausfindig zu machen. Ferner sein Lehrerdiplom vom 24. Juni 1883, das vom Direktor F. Antognini und vom Staatsrat Marino Pedrazzini unterzeichnet ist. Ein schönes Lehrpatent mit lauter Zehnern (ein Vorwort erklärt: «Die Note zehn entspricht den besten Leistungen»), und nur einer Neun (beinah höchste Leistung) in Kalligrafie und im Singen. Fürs Turnen hat er keine Note erhalten. Es heisst, er sei als Knabe von einem bösen Hund erschreckt worden; davon war er ungelenk und ein wenig bucklig geworden. Jener Rektor Antognini hatte die Brüste der Caritas, die sie ihrem Tugendamt gemäss im Refektorium des Franziskanerklosters, das zum Lehrerzimmer geworden war, einem nackten Knäblein reichte, prüde verschleiern lassen. Dieser unbedeutende Vorfall kennzeichnet das Klima der Schule, wie man es in den Aufsätzen Onkel Pietros wiederfindet. Sie sind von einer rhetorischen Unaufrichtigkeit, die einen ärgert und zugleich zum Lächeln reizt; eitle Wortspielereien. Doch bei einem der ersten Aufsätze, mit dem Titel «Stellt euch die Aufgabe, einen eurer Verwandten oder Freunde über die wenigen bisher verbrachten Schultage zu unterrichten, und fügt irgendeinen weiteren Bericht hinzu, den ihr als passend erachtet» muss man bedenken, dass mein Onkel damals fünfzehnjährig und eben erst aus seinem Bergdorf heruntergekommen war; dort liest man nämlich ein paar Sätze, die aufrichtig klingen: «Ich tue hiermit kund, dass ich dieses Jahr hier in Locarno ins kantonale Gymnasium aufgenommen wurde. Ich überlasse es dir, dir vorzustellen, wie sehr ich mich am Anfang schämte, denn keiner kannte mich, und alle schauten mich an, und ich war sehr verwirrt, als ich mich so von all den Schülern umgeben sah und keinen einzigen kannte! Dennoch fasste ich Mut und antwortete, so gut ich es konnte, auf die Fragen des Herrn Professor. Jetzt aber kenne ich meine Gefährten schon … Wir sind etwas mehr als zwanzig Schüler und haben drei Stunden Schule im Tag.»
Daraus spürt man so recht die Empfindung der Scham und der Demütigung des wer weiss wie gekleideten Knaben, der darüber hinaus auch körperlich ungelenk war und mitten unter den kühnen Gefährten stand. Doch drei Jahre später war er der Tüchtigste von allen.
Er war nur ein Jahr lang Lehrer, ich glaube in Cugnasco. Dann starb er zwanzigjährig, im Jahre 1884.
Wenn sich im Haus der Bianconi nichts mehr finden lässt, so ist glücklicherweise im Haus der Grosseltern mütterlicherseits, bei den Rusconi, manches erhalten geblieben. Es waren dies weniger armselig lebende Leute und sie waren der Erde fester verhaftet. In der sonnigen Loggia, wo wir nicht lasen, nein, nur die Bilder in den Zeitungen anschauten, die der Onkel Gottardo aus Kalifornien erhielt, die bunten





























