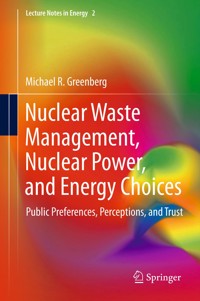8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Reise in die Tiefen der Seele Michael Greenberg ist Schriftsteller und führt ein mehr oder weniger geordnetes Leben in New York. Doch dann wird seine Tochter krank – und alles ändert sich. Ein heißer Tag in Manhattan. Michael Greenberg sieht, dass ein Polizeiauto vor seinem Wohnhaus parkt. Was er erst später erfährt: Oben sind zwei Polizisten damit beschäftigt, seine von Visionen geschüttelte Tochter zu beruhigen. Dies ist der Beginn eines langen Weges, den er zu gehen hat, um sein Kind in die Wirklichkeit zurückzuholen. »Ich habe das Gefühl zu reisen, aber ohne Möglichkeit zur Umkehr«, sagt Sally. Ihr Vater folgt ihr auf dieser »Reise«, die sie unter anderem durch die Psychiatrie führt, hin zu einem halbwegs »normalen« Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Ein heißer Tag in Manhattan. Michael Greenberg sieht ein Polizeiauto vor seinem Wohnhaus parken. Was er erst später erfährt: Oben sind zwei Polizisten damit beschäftigt, seine von Visionen geschüttelte Tochter zu beruhigen. Es ist der Beginn eines langen Weges, den er zu gehen hat, um sein Kind in die Wirklichkeit zurückzuholen. »Ich habe das Gefühl zu reisen, aber ohne Möglichkeit zur Umkehr«, sagt Sally. Ihr Vater folgt ihr auf dieser »Reise«, die sie unter anderem durch die Psychiatrie führt, hin zu einem halbwegs »normalen« Leben.
Ein anrührendes Buch, das einen ganz eigenen Sog ausübt. Es wirkt, so die ›Welt‹, »in seiner Detailfülle und seinen tiefgreifenden Charakterstudien eher wie ein geglückter Roman denn wie eine Reportage«.
Vorwort
Am 5. Juli 1996 wurde meine Tochter verrückt. Sie war fünfzehn, und ihr Zusammenbruch markierte einen Wendepunkt in ihrem und auch in meinem Leben. »Ich habe das Gefühl zu reisen, aber ohne Möglichkeit zur Umkehr«, sagte sie in einer plötzlichen Anwandlung geistiger Klarheit, während sie auf einen Ort zuraste, von dem ich mir nicht hätte träumen lassen und von dem ich keine Vorstellung hatte. Ich wollte sie an mich reißen und sie zurückholen, doch es gab kein Zurück mehr. Auf einmal war jede Verbindung zwischen uns abgebrochen, schien ein Ding der Unmöglichkeit. Von mir hatte sie sprechen gelernt, von mir ihre ersten Geschichten gehört. Unauslöschliche Erfahrungen, hatte ich gedacht. Und doch waren wir von einem Tag auf den anderen fremd füreinander geworden.
Meine erste Regung war, mir selbst die Schuld daran zu geben. Ich versuchte, die Fehler aufzuzählen, die ich begangen, die Dinge, die ich ihr vorenthalten hatte, aber das reichte nicht aus, um zu erklären, was vorgefallen war. Nichts reichte dafür aus. Vorübergehend setzte ich meine Hoffnung in die Ärzte, bevor ich erkannte, dass diese, abgesehen von dem verhältnismäßig eng umgrenzten klinischen Befund ihrer Symptome, auch nicht viel mehr über Sallys Gemütsverfassung wussten als ich. Wie ich erfahren sollte, sind die der Psychose zugrunde liegenden Mechanismen wie eh und je in Geheimnis gehüllt. Wenn mir diese Einsicht auch wenig unmittelbare Hoffnung auf Heilung beließ, so verwies sie doch auf dunklere Rätsel.
Heute gilt es geradezu als Sakrileg, Irrsinn anders denn als eine chemisch verursachte Hirnkrankheit aufzufassen, was auf einer Ebene ja auch zutrifft. Indes gab es bei meiner Tochter Augenblicke, da ich die quälende Empfindung hatte, Zeuge einer seltenen Naturgewalt zu sein, wie ein heftiger Schneesturm oder eine mächtige Flut: verheerend, auf ihre Weise aber auch grandios.
Erster Teil
5. Juli. Ich wache in unserem Apartment in der Bank Street auf, einer Mietwohnung im obersten Stockwerk eines der ansehnlicheren Wohnblocks im West Village. Der Platz neben mir im Bett ist leer. Pat ist früh aus dem Haus gegangen, zu ihrem Tanzstudio in der Fulton Street, um Buch zu führen und ein paar Dinge zu erledigen. Wir sind seit zwei Jahren verheiratet, und unser Zusammenleben muss sich erst noch von dem Gewicht der getrennten Welten befreien, die jeder von uns in die Ehe eingebracht hat.
Was ich einbrachte, das »Greifbarste« von allem, war meine halbwüchsige Tochter Sally, die, wie ich zu meiner Überraschung feststelle, ebenfalls nicht zu Hause ist. Es ist acht Uhr und bereits stickig heiß. Die Sonne brennt durch das Teerdach, das sich nicht einmal einen Meter über ihrem Hochbett befindet. Gegen Mitternacht ist die letzte Reservesicherung unserer Klimaanlage durchgebrannt; Sally wird wohl das Gefühl gehabt haben, sich ins Freie retten zu müssen, um überhaupt atmen zu können.
Auf dem Wohnzimmerboden liegen die Überreste einer ihrer durchwachten Nächte: ein Walkman, der einen Sprung hat und notdürftig mit Klebeband zusammengehalten wird, eine halbvolle Tasse kalter Kaffee und der in Leinen gebundene Band mit Shakespeares Sonetten, über dem sie nun schon seit Wochen mit zunehmendem Eifer brütet. Als ich aufs Geratewohl eine Seite aufschlage, stoße ich auf ein schockierendes Gewirr von Pfeilen, Definitionen und umkringelten Wörtern. Sonett Nr. 13 sieht aus wie eine Seite aus dem Talmud, die Ränder sind mit so vielen Anmerkungen vollgekritzelt, dass der Originaltext kaum mehr als ein Pünktchen in der Mitte ausmacht.
Dann gibt es Blätter mit Sallys eigenen Gedichten, bestehend aus Verszeilen, die ihr – wie sie mir vor wenigen Tagen anvertraute – »zufliegen, wie Vögel zum Fenster hereinfliegen«. Einen dieser gefallenen Vögel hebe ich auf:
Und wenn alles still sein müsste,
versengt dein Feuer einen Fluss aus Schlaf.
Weshalb, Liebster, soll der große
Höllenatem küssen, was du siehst?
Heute Nacht gegen zwei Uhr saß sie auf der Cordcouch und schrieb etwas in ihr Notizheft, während sie in ihrem Walkman immer wieder Bachs Goldberg-Variationen hörte, gespielt von Glenn Gould. Ich war erst spät nach Hause gekommen, ich hatte den Abschluss einer meiner Auftragsarbeiten als freier Schriftsteller gefeiert, eines Textes für ein zweistündiges Video über die Geschichte des Golfspiels, einer Sportart, die ich selbst nie betrieben habe.
»Bist du nicht müde?«, fragte ich.
Heftiges Kopfschütteln, eine Handbewegung, die »Hör auf und lass mich in Ruhe« bedeutete, während die andere Hand, die den Füller hielt, nur noch flinker über die Seite huschte. Kränkende Zurückweisung. Zugleich aber empfand ich heftige Sehnsucht nach einer Periode meines Lebens, in der ich mit den Gedichten von Hart Crane Ähnliches angestellt, all die fremden jazzigen Wörter nachgeschlagen und mich auf die schiere Kraft seiner (mir nahezu unverständlichen) Sprache eingelassen hatte. Ich blieb in der Tür zum Wohnzimmer stehen und sah zu, wie sie mich ignorierte: ihre mandelförmigen galizischen Augen, ihr Haar, das aus ihrem Kopf nicht so sehr wächst als vielmehr in einem ungestümen Ausbruch von Bernsteingelb hervorschießt, ihr Hunger nach Sprache, nach Wörtern.
Ich bin überzeugt, dass diese Nächte der Lernbegier eine Befreiung von den Minderwertigkeitsgefühlen bewirken, die sich seit dem Tag ihrer Einschulung vor nunmehr fast neun Jahren in ihr angestaut haben. Vielleicht denke ich ja nur aus Gründen der Symmetrie von Damals und Heute, dass Sallys Kindheit an jenem Tag zerflossen war, wie das Einzelbild in einem Stummfilm, bei dem das Licht auf die Größe eines Nadelstichs in der Mitte des Bildschirms zusammenschrumpft. Aber so war es mir vorgekommen. Sie tat sich schwer mit dem Lesenlernen, doch ihre Schwierigkeiten reichten noch tiefer. Das Alphabet war für sie ein Kryptogramm: Das w hätte ebenso gut ein Mund voll schiefer Zähne sein können, das h ein Stuhl. Die Fibel war für sie ein Buch mit sieben Siegeln. Die Konvention willkürlich festgesetzter und allseits akzeptierter Bedeutung, auf der so gut wie alle menschliche Kommunikation beruht, entzog sich ihrem Verständnis.
Es schmerzte mich, mitansehen zu müssen, wie dieser erbarmungswürdige Ausdruck in ihr Gesicht trat, als hätte sie die Freude an allem verloren. Und doch meisterte ihre Zunge, befreit von der Bürde schriftlich fixierter Sprachzeichen, dieselben Wörter, die ihre Augen auf einer Buchseite nicht zu entziffern vermochten, mit einer Gewandtheit, die ihr Wortspiele, Gedichtvorträge, Argumente, ja ganze Reden ermöglichte, wenn sie denn beliebte, sie mitzuteilen -all das zeugte von verblüffend scharfer Intelligenz.
Als ich sie einmal von der Schule abholte, war das Schultor von Reportern und Kamerateams umlagert. Ein Mädchen aus Sallys Klasse war von ihrem Vater ermordet worden. Schlagartig wurde mir die Gefährdung meiner sechsjährigen Tochter bewusst, zumal der Mörder, Joel Steinberg, und ich eine gewisse physische Ähnlichkeit aufwiesen. Beide waren wir Aschkenasi-Juden – gleicher Teint, gleiche Körpergröße, gleiche Brille. Aufgrund meiner Herkunft fühlte ich mich an dem Verbrechen beteiligt, schuldig, weil aus demselben Umfeld stammend wie der Täter. Was früher einmal unvorstellbar gewesen war, mochte auf geradezu teuflische Weise Nachahmungstäter heraufbeschwören, und so hatte ich das Gefühl, Sally und ich seien einer neuen Gefahrenquelle ausgesetzt: In Amerika meuchelten die Urenkel des jüdischen Milchmanns Tevje ihre Töchter.
Ich drängte mich durch das Gewühl von Journalisten und fand sie inmitten der Menschenmenge. Sie hielt eine Klassenkameradin an der Hand. Ein Reporter hatte sein Mikrofon auf die beiden Mädchen gerichtet und wollte ihre Reaktion herauskitzeln. Sally blinzelte zu ihm auf. Sie hatte ihren Mantel verkehrt herum angezogen, ihre Schnürsenkel waren lose. Ihre Haarspange baumelte nutzlos herab wie ein Insekt, das sich in ihrem Schopf verfangen hatte. Ich sammelte die Mädchen ein und bahnte mir einen Weg durch die Menge.
Etwa um diese Zeit geschah es, dass Sallys Mutter und ich uns trennten. Wir hatten uns in der Highschool kennengelernt, und unsere Scheidung war wie die allzu lange hinausgezögerte Trennung von Zwillingen: notwendig und herzzerreißend. Nach den Turbulenzen jener Monate kamen Sally und ich uns näher. Ich wurde ihr Fürsprecher, der sie umständlich in Schutz nahm: vor ihren Lehrerinnen, vor anderen Eltern und vor unseren eigenen Familienangehörigen, die bestürzt waren über den Abgrund, der sich zwischen Sallys Weltsicht und der der meisten anderen Menschen auftat. Bezeichnet dieser Abgrund nicht genau den Ort, wo die Einbildungskraft gedeiht?, argumentierte ich. Ist er nicht Ausdruck dessen, dass sie Zutritt zu jener erhabenen Sphäre des Geistes hat, die uns anderen verwehrt bleibt?
»Du bist genauso klug wie alle anderen auch«, versicherte ich ihr. »Deine Intelligenz ist angeboren, sie steckt in dir drin. Sieh zu, dass du diese Jahre hinter dich bringst, und das Leben wird anders werden, du wirst schon sehen.«
Und das Leben wurde anders. Wir suchten ein Lernlabor auf, erschwingliche Spezialisten in einem Gemeindezentrum in Chelsea. Als sie in eine Sonderklasse aufgenommen wurde, lernte sie mit der Zähigkeit eines Gelehrten, der sich bemüht, eine tote Sprache zu verstehen, einfache Wörter und Zahlen. Sie schien um eine innere Leistungsfähigkeit zu ringen, die zum Erliegen käme, wenn es ihr nicht gelang, diesen Code zu knacken. Sie erreichte ihr Ziel, machte sich das Selbstvertrauen zunutze, das sie dabei gewonnen hatte, und durfte wieder in den normalen Unterricht zurückkehren – ein Erfolg des Schulsystems. Zwar musste sie sich abermals abplagen, aber mein Versprechen, dass ihre verborgenen Talente früher oder später ans Licht kommen würden, war glaubhaft geworden.
Und jetzt war es so weit! Bach, Shakespeare, die überschäumenden Hieroglyphen ihrer Tagebücher – wenn sie die ganze Nacht aufbleibt, dann deswegen, weil sie nach den Strapazen jener Jahre jede Minute des Triumphes auskostet.
Ich verlasse das Apartment und begebe mich nach unten, fünf Treppen durch ein farbverschmiertes Treppenhaus, in dem seit Menschengedenken nicht mehr sauber gemacht worden ist. Der 5. Juli. Das Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages. Das Village kommt mir vor wie ein Hotel, aus dem die anspruchsvollsten Gäste abgereist sind. Wir Zurückgebliebenen wissen, wer wir sind: der Sessionmusiker, der Korrektor, die Dame mit dem Strohhut, von dem Plastiktrauben herabhängen (sie rettet die streunenden Hunde der Nachbarschaft) … Nun, da ihre Besitzer im Urlaub sind, wirken die blassen Reihenhäuser, als lägen sie im Koma. Die Bank Street ist einem trägen Glanz anheimgefallen.
Ich gehe zu dem Café in der Greenwich Avenue, wo sich Sally morgens gern herumtreibt, und stoße um ein Haar mit ihr zusammen, als sie eben um unsere Ecke biegt. Sie scheint erhitzt, irritiert, und als ich sie routinemäßig frage, was sie vorhat, wendet sie sich mit einem merkwürdig wilden Blick gegen mich, der mich völlig überrumpelt.
»Wenn du wüsstest, was sich in meinem Kopf abspielt, würdest du diese Frage nicht stellen. Aber du hast ja keine Ahnung. Du weißt überhaupt nichts von mir, Vater, oder?«
Sie hebt den Fuß und tritt mit der Sandale so wuchtig gegen einen Mülleimer, dass der Metalldeckel scheppernd zu Boden fällt. Ein Nachbar von gegenüber hebt die Augenbrauen, als wollte er sagen: Was geht denn hier vor? Sally scheint ihn nicht zu bemerken oder sich nicht um ihn zu scheren. Obwohl sie jetzt, die Fäuste geballt, reglos dasteht und mich anstarrt, hat ihr Auftritt etwas eigentümlich Bewegtes. Ihr herzförmiges Gesicht ist so unruhig, dass mir angst und bange wird. Nicht zum ersten Mal kommt mir der Gedanke, dass ich meiner Tochter eigentlich recht ratlos gegenüberstehe. Aufgewachsen bin ich mit vier Brüdern in einer halbverwilderten Männeratmosphäre. Mein Vater verbrachte den größten Teil seines Lebens als Schrotthändler in einem Lagerhaus im Hafengebiet von Brooklyn. Die weibliche Seite der Welt fehlte bei uns zu Hause beinahe ganz.
Als sie erneut nach der Mülltonne treten will, lege ich ihr die Hand auf die Schulter, um sie daran zu hindern. Gereizt schüttelt sie sie ab.
»Mache ich dir etwa Angst, Vater?«
»Weshalb solltest du mir Angst machen?«
»Du siehst aus, als hättest du Angst.«
Sie beißt sich so fest auf die Lippe, dass das Blut daraus entweicht. Ihre Arme zittern. Warum führt sie sich so auf? Und warum nennt sie mich andauernd »Vater«, in diesem unechten, gepressten Tonfall, als spräche sie einen auswendig gelernten Bühnentext?
Da nähert sich unsere Nachbarin Lou mit ihrem gutmütigen Schäferhund. Ein willkommener Anblick. Lous Zuneigung zu Sally reicht fast zehn Jahre zurück, bis zu dem Tag, als diese ihr instinktives Mitgefühl für die wehrlosen Wesen dieser Welt entdeckte. Je hilfloser ein Mensch war, desto bereitwilliger schüttete Sally ihm ihr Herz aus. Mit den Opfern von Schlaganfällen und Alzheimer saß sie im Village vor dem Pflegeheim; dem Betrunkenen, der in der Seventh Avenue zusammengebrochen war, brachte sie ein Stück Pizza vorbei. Ihr stärkstes Mitgefühl jedoch blieb kleinen Kindern vorbehalten. Ein Baby war für Sally ein Objekt der Verehrung. Es war, als hätte sie begriffen, welch heilloser Zerstörung das Leben eines Kindes in jedem flüchtigen Augenblick seines Daseins ausgesetzt ist, sogar noch vor aller Erinnerung, noch bevor sich auf biochemischer Ebene jener Charakter herausgebildet hat, der das Schicksal eines Menschen bestimmt. Wenn man ihr Gelegenheit dazu gab, behielt sie ein Neugeborenes stundenlang im Arm. Es war eine Wesensverwandtschaft, um die ich mir mitunter Sorgen machte, geradeso als wäre das, was sie tatsächlich in diesen Säuglingen erkannte, der Schlüssel zu einer Art Fluchtdrang in ihr selbst, den sie zu überwinden trachten müsse.
Damals wollte Lou nichts davon wissen. »Weißt du, was nácheß ist? Freudige Erfüllung. Davon hat das Mädchen mehr als genug. Sie ist jemand, der gibt, Michael. In einer Welt von Raffzähnen und Arschlöchern ist sie jemand, der gibt.»
Deshalb wirkt Lous Verhalten jetzt so verstörend. Sie winkt uns von weiter unten in der Straße zu, kommt bis auf drei Meter heran und bleibt unvermittelt stehen. Sie mustert Sally durchdringend, dann streckt sie, wie um einen bösen Geist abzuwehren, die Hände aus, reißt an der Leine ihres Schäferhundes und eilt davon.
Ihr Rückzug macht mich sprachlos. Sally dagegen scheint völlig unberührt. Ihre normalerweise warmen kastanienbraunen Augen sind glasig und dunkel, als wären sie mit Lack überzogen. Vermutlich aus Schlafmangel.
Ich frage sie, ob ihr etwas fehlt.
»Mir geht’s gut.«
Und ich denke: Vermutlich hat Lou geglaubt, dass wir uns streiten, und wollte sich nur nicht einmischen.
»Bist du dir sicher? Du scheinst mir ziemlich angespannt zu sein. Du hast nicht geschlafen und die ganze Woche über kaum etwas gegessen.«
»Mir geht’s gut.«
»Vielleicht solltest du heute Abend etwas langsamer machen, den Shakespeare eine Weile beiseitelegen.«
Sie presst die Lippen zu einem verächtlichen Laut zusammen und nickt widerstrebend.
Am Nachmittag treffe ich mich mit einem Freund, der von außerhalb kommt. Über ein paar Drinks tauschen wir Neuigkeiten aus, und auf dem Weg zum Abendessen kommen wir an unserem Haus in der Bank Street vorbei. Davor parkt in der zweiten Reihe ein Polizeiwagen. Er ist leer, das Blaulicht ausgeschaltet. Die Straße strahlt eine solche Ruhe aus, dass mir gar nicht in den Sinn kommt, irgendetwas könnte nicht stimmen. Eine ereignislose Nacht, die Polizisten werden sich wohl aus dem Staub gemacht haben, oder sie schauen bei dem Typen vorbei, dessen Dobermannpinscher den Nachbarn dauernd Anlass zu Beschwerden geben.
Wir setzen unseren Weg zum Restaurant fort, wo Pat schon auf uns wartet. Die anderen Tische im Raum, jeder mit einer brennenden Kerze versehen, sind leer.
Beim Abendessen finden Pat und unser Freund einen gemeinsamen Gesprächsstoff: Jeder der beiden hat eine schöne, aufsässige Stieftochter. Beide wissen Geschichten zu erzählen – theatralische Selbstmorddrohungen, Verbrühungen mit Kaffee, das Brotmesser, mit dem sie sich die Hand aufgeschlitzt haben.
»Die Tochter meiner Frau ist die Liebe ihres Lebens«, scherzt er. »Ich bin nur die Mätresse.«
Pat pflichtet ihm mutig bei: »Es ist wie in einem schlechten Märchen. Die böse Stiefmutter. Die Letzte, die geliebt, und die Erste, die verteufelt und abgelehnt wird.«
Dabei widerspricht fast alles, was Pats Beziehung zu Sally ausmacht, dem Klischee von der bösen Stiefmutter. Sie quält sich ab mit Sallys Hausaufgaben, liefert sich auf Gedeih und Verderb ihren Launen aus und warnt sie vor den katastrophalen Folgen eines allzu stürmischen Vorpreschens in die Weiblichkeit – Warnungen, nach denen Sally unverkennbar hungert, selbst wenn sie nach außen hin Widerstand leistet. Doch nichts davon hat eines der durchgängigen Dramen in unserem Haushalt entschärfen können: Sallys Weigerung, zu glauben, dass Pats Zuneigung zu ihr aufrichtig ist. Sallys Sichtweise zufolge besteht das Hindernis darin, dass Pat sie niemals so lieben wird wie ein leibliches Kind – weder physisch noch emotional, niemals. Sie sei Pats Körper fremd, insofern also auch ihrem Herzen. Unsere Gegenargumente (dass die Nabelschnur nicht das einzige Bindeglied mütterlicher Anhänglichkeit ist, dass das Band zwischen ihr und Pat umso stärker ist, als es aus ihren tatsächlichen Lebensumständen hervorging, und schließlich, dass sie doch bereits eine leibliche Mutter hat) verstärken Sallys düstere Stimmung nur noch. »Erzählt mir keinen Stuss, ihr braucht euch gar nicht erst zu bemühen«, sagt sie unumwunden. »Es ist ein Naturgesetz.«
Nach dem Abendessen laufen wir die drei Minuten zur Bank Street, wo wir uns von unserem Freund verabschieden und die Treppe hinaufsteigen.
Sally schläft auf ihrem Hochbett, zum ersten Mal seit Tagen sieht sie friedlich aus. Ihre lackierten kleinen Zehen ragen über den Bettrand, und ihr rechter Fuß, mit dem sie heute Morgen nach der Mülltonne getreten hat, ist leicht angeschwollen. Neben ihr liegt ihre Freundin Cass, die heute bei ihr übernachtet. Auch sie schläft. Sie schwitzt leicht.
Ich gehe in die Küche und bemerke, dass die Messer nicht an ihrem angestammten Platz auf der Arbeitsplatte liegen; vielmehr sind sie auf das höchste Regalbrett geräumt worden, hinter ein selten benutztes Service. Jede Klinge sitzt in ihrem Schlitz im Messerblock, die schwarzen Griffe sind zur Wand gedreht.
Ich versuche, mir die Veränderung zu erklären, als Pat sagt: »Da liegt ein Zettel. Du sollst Robin anrufen.«
Robin ist Sallys Mutter. Obwohl eine waschechte New Yorkerin, schwor sie dem Großstadtleben mehrere Jahre nach unserer Trennung ab und übersiedelte mit ihrem neuen Mann in eine abgelegene Gegend in Vermont. Die Kinder teilten wir nach Geschlecht auf: Sally zog zu ihrer Mutter aufs Land, wo sie die unteren Klassen der Highschool besuchte, während ihr älterer Bruder Aaron bei mir in der Großstadt blieb. Sally, so hofften wir, wäre in einer kleinen ländlichen Schule besser aufgehoben als in New York.
Aber es kam anders. In der Schule fühlte sie sich bald wieder als Außenseiterin, und ihr schon immer prekäres Verhältnis zu Robin nahm eine Wendung zum Schlechteren. Je stärker Sally sie herausforderte, desto passiver wurde Robin. Kampflos gewann Sally jede Schlacht (um Taschengeld, Ausgangssperren und so weiter), bis es nichts mehr gab, wofür zu kämpfen sich lohnte, und sie verzweifelt darauf wartete, von ihrer erschreckenden Frühreife erlöst zu werden. Robin wusste nicht ein noch aus, sie befand sich in einem Erschöpfungszustand unaufhörlicher Kapitulation. Und doch – je sinnloser ihre Schlachten wurden, desto verbissener focht Sally sie aus. Sie strafte ihre Mutter dafür, dass diese ihr genau die Freiheit gewährte, nach der sie verlangte, und forderte doch zugleich mehr Freiheit, mehr Macht, mehr … Im Grunde erkämpfte sie sich ihr eigenes Elend. Es konnte nicht ausbleiben, dass sich Sally einer Gruppe Älterer anschloss: verrostete Autos, verschlüsselte Liedtexte über zerfetztes Fleisch und Metall, unbefestigte Straßen ins Nirgendwo. Ihr Bauchnabel verfärbte sich schwarz, als sie, angeblich, um sich zu piercen, mit einer Nähnadel auf ihn einstach. Nach zwei Jahren in Vermont kehrte sie mit dreizehn nach New York zurück, um bei Pat und mir zu wohnen.
Ich wähle Robins Nummer. »Sally ist heute Nacht von der Polizei aufgegriffen worden«, sagt sie.
Und mit einem Mal wird mir klar, dass der Streifenwagen, der vor dem Haus geparkt hatte, Sallys wegen da gewesen war. In demselben Moment, als mein Freund und ich unbekümmert am Haus vorbeischlenderten, waren die Beamten hier in der Wohnung gewesen und hatten die Messer in Sicherheit gebracht.
»Hast du mit ihnen gesprochen?«
»Mit der Polizei? Ja, das habe ich allerdings. Sie haben gesagt, Sally und Cass hätten sich auf der Straße ziemlich verrückt aufgeführt, und da hätten sie entschieden, dass die Mädchen zu Hause besser aufgehoben seien.«
Robins Botschaft ist eindeutig: Immer hast du mich dafür kritisiert, wie ich meine Mutterrolle ausfülle, aber du selbst bist, um den Daddy spielen zu können, auf die New Yorker Polizei angewiesen.
Wir reden noch eine Weile weiter, dann geht uns der Gesprächsstoff aus. Nach einer Pause gibt Robin ein unterdrücktes, eigenartig verführerisches Lachen von sich.
»Michael?«
»Ja?«
Schweigen. Fast kann ich durch die Leitung hindurch die pulsierende Stille ihres Bauernhofs hören. Ich male mir die Szene aus: parfümierte Kerzen, ein gerahmtes Foto ihres Gurus, Bücher über die sittliche Läuterung der Seele. Eine andere Welt.
»Gibt es etwas, das ich wissen sollte?«, frage ich.
»Eigentlich nicht. Höchstens – ich gebe dich frei, Michael. Das habe ich dir schon seit geraumer Zeit sagen wollen, und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment dafür gekommen. Ich gebe dich frei. Und ich segne dich von ganzem Herzen.«
Am nächsten Morgen hat Sally den benommenen Gesichtsausdruck eines Menschen, der soeben aus einem zu Schrott gefahrenen Auto gekrochen ist. Als ich mich nach dem gestrigen Abend erkundige, lässt sie sich auf die Couch fallen und presst die Handballen gegen die Augen.
Ich wende mich an Cass, die sich mit ihren Springerstiefeln abmüht und sich am liebsten verdrücken würde. Sie vermeidet jeden Blickkontakt mit Sally, und auch mich schaut sie nicht an. Meinen Fragen weicht sie mit einem Achselzucken und wiederholten Grunzlauten aus.
Mit viel Geschick vermag Pat sie so weit aufzulockern, dass sie uns mit stockenden Worten berichtet, was vorgefallen ist. Sie und Sally seien spazieren gegangen. Sally habe geredet wie ein Wasserfall und versucht, ihr etwas furchtbar Dringliches mitzuteilen. Wenn Cass sie unterbrochen oder nicht gleich verstanden habe, worauf sie hinauswollte, hätte sie ihr am liebsten den Kopf abgerissen. »Ich werd dir zeigen, was ich meine!«, habe sie aus vollem Hals geschrien und angefangen, in der Hudson Street die Passanten anzuhalten, sie an den Armen zu packen und gehörig durchzuschütteln. Als ein Mann Sally verwünschte und sie von sich stieß, habe Cass gemerkt, dass das Ganze kein Scherz war. Sie habe Sally angefleht, mit dem Unsinn aufzuhören, als diese sich mitten in den Verkehr gestürzt und sich den entgegenkommenden Autos entgegengeworfen habe in der festen Überzeugung, sie in ihrer Fahrt aufhalten zu können. »Ich hab sie auf den Bürgersteig zurückgezerrt. Ein Wunder, dass sie nicht überfahren worden ist. Und als die Bullen kamen, ist sie auch auf die losgegangen. Auf dieselbe Art. Derselbe verrückte Scheiß.«
Ohne sich von Sally zu verabschieden (die ohnehin mit keiner Miene verrät, dass sie sich der Gegenwart ihrer Freundin bewusst ist), humpelt Cass aus der Wohnung.
Ich folge ihr zum Treppenabsatz, eine Flut von Fragen auf den Lippen. Die Antwort stellt sich ganz von selbst ein, mit der Kraft einer ganz einfachen Erklärung: Drogen. Acid, Ecstasy, zumindest irgendein Superhaschisch, das gerade die Runde macht. Ich bestürme Cass, es zuzugeben.
Stattdessen wirft sie mir nur einen flehentlichen Blick zu. »Wir haben keine Drogen genommen. Kann ich jetzt bitte nach Hause gehen?«
In der Wohnung bleibt Sally auf der Couch liegen, träge, entrückt. Ich setze mich neben sie, nehme ihre Hand und konzentriere mich auf diese. Ich sage laut ihren Namen, nicht eigentlich um sie anzusprechen, sondern als wollte ich mich einer dünnen Verbindungslinie zwischen uns vergewissern.
Keine Reaktion.
»Vielleicht hat sie Sally das Leben gerettet«, sagt Pat. Sie meint Cass. Aber wieso musste ihr das Leben gerettet werden?
Plötzlich macht sich Sally von mir los, springt auf und beginnt, in der Wohnung auf und ab zu rennen. Sie fröstelt, aber nicht wie jemand, dem kalt ist, sondern mit einem Zittern und Sichsträuben ihres innersten Wesens. Und sie redet, oder vielmehr: sie stößt Worte zwischen den Lippen hervor, so wie eine Ladenbesitzerin mit einem Kehrbesen den Staub stoßweise zur Ladentür hinausfegt. Leute warten auf sie, sagt sie, Leute, die auf sie angewiesen sind, im Sunshine Café, der heiligen Stätte des Lichtes, sie darf sie nicht enttäuschen, sie muss sofort zu ihnen …
Sie stürzt zur Tür. Ich versuche, ihr den Weg zu verstellen, aber sie schubst mich gegen die Wand. Ihre Kraft ist erschreckend. Sie ist eins zweiundsechzig groß, vielleicht fünfundvierzig Kilo schwer, doch wie ein Sturm jagen ungeheure Energieschübe durch ihren Körper. Sie ringt mich nieder, reißt mir die Brille herab, zerkratzt mir das Gesicht, bis es blutet. Pat stößt einen Schrei aus und kommt hinzugerannt, um mir beizustehen. Von uns beiden überwältigt, erschlafft der gedehnte Draht ihres Körpers. Ohne die Tür aus den Augen zu lassen, löse ich mich aus ihrer Umklammerung, und sie windet sich unter uns hervor und zieht sich auf die andere Seite der Wohnung zurück.
Sie setzt sich unter einem der Fenster auf den Fußboden, und wütend, keuchend starren wir einander an wie Tiere in einem Käfig. Pat hat die Fassung wiedergewonnen und lässt sich neben ihr zu Boden gleiten. Wer wartet auf dich, Sally? Was willst du ihnen sagen?
Sally bedarf keiner weiteren Überredungskünste. Wieder bricht Sprache aus ihr hervor, ein gedrängter Schwall von Worten, diesmal mit gespielter Gelassenheit, als hätte Pat ihr die Pistole auf die Brust gesetzt und ihr befohlen, »normal« zu klingen. Sie habe eine Vision gehabt. Diese habe sie ein paar Tagen zuvor auf dem Kinderspielplatz in der Bleecker Street ereilt, als sie zwei kleinen Mädchen dabei zusah, wie sie auf dem Holzsteg nahe der Rutsche spielten. Da sei die Erkenntnis in ihr aufgeblitzt, dass diese beiden kleinen Mädchen von Geburt an mit grenzenloser Genialität begabt seien, und zugleich habe sie erkannt, dass wir alle Genies sind, dass der Begriff, den das Wort bezeichnet, entstellt worden ist. Genie, das ist nicht etwa, wie man uns einzureden sucht, ein seltener Glücksfall, nein, Genie ist für unser Ichsein ebenso elementar wie unser Gespür für Liebe, für Gott. Genie ist Kindheit. Der Schöpfer schenkt es uns zusammen mit dem Leben, und die Gesellschaft treibt es uns wieder aus, noch bevor wir Gelegenheit haben, den Impulsen unserer von Natur aus kreativen Seele zu folgen. Einstein, Newton, Mozart, Shakespeare – die alle waren ganz normal. Sie fanden lediglich eine Möglichkeit, sich das Geschenk zu bewahren, das jedem von uns wie ein Lotteriegewinn in die Wiege gelegt ist.
Sally vertraute ihre Vision den kleinen Mädchen auf dem Spielplatz an. Offenbar verstanden diese sie vollkommen. Dann ging sie hinaus in die Bleecker Street und stellte fest, dass ihr Leben sich von Grund auf verändert hatte. Die Blumen vor dem koreanischen Delikatessengeschäft in ihren grünen Plastikkübeln, die Titelseiten der Illustrierten im Zeitungskiosk, die Gebäude, die Autos – all das nahm klare Konturen an, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Die Konturen »des Gegenwärtigen«. Ein Kraftstrom durchflutete ihr Innerstes. Sie konnte das verborgene Leben der Dinge erkennen, jede scharf umrissene Einzelheit, den konzentrierten Genius, der sie zu dem macht, was sie sind. Am deutlichsten aber war das Elend in den Gesichtern der Passanten. Sie versuchte, ihnen ihre Vision begreiflich zu machen, doch sie eilten einfach an ihr vorüber. Dann traf es sie wie ein Schlag: Die wissen längst von ihrem Genie, es ist gar kein Geheimnis, sondern etwas viel Schlimmeres: Das Genie in ihnen ist unterdrückt worden, so wie in ihr selbst auch. Und die ungeheure Anstrengung, zu verhindern, dass es an die Oberfläche dringt und wieder seinen herrlichen Einfluss in unserem Leben geltend macht, ist Ursache allen menschlichen Leids. Eines Leids, das zu heilen Sally mit dieser Epiphanie unter allen Menschen auserwählt ist.
Pat und ich sind fassungslos, weniger darüber, was Sally sagt, als wie sie es sagt. Kaum schießt ein Gedanke aus ihrem Mund hervor, überholt ihn auch schon ein anderer, eine Karambolage von Wörtern ohne jede Folgerichtigkeit. Jeder Satz annulliert den vorhergehenden, ehe er überhaupt die Chance hat, ihr über die Lippen zu treten. Mit fliegendem Puls mühen wir uns ab, das gewaltige Ausmaß an Energie in uns aufzunehmen, das aus ihrem kleinen Körper herausdrängt. Sie schlägt die Luft mit den Fäusten, reckt das Kinn vor – es ist das reinste Kasperletheater: der überreizte Despot, der seinen armen Untertanen eine Utopie aufzwingen will. Aber es ist kein Theater; ihr Mitteilungsdrang ist so übermächtig, dass er sie peinigt, jedes einzelne Wort wie ein Gift, das sie aus ihrem Körper ausscheiden muss.
Je länger sie redet, desto wirrer wird sie, und je wirrer sie wird, desto dringender ihr Bedürfnis, sich uns verständlich zu machen. Bei ihrem Anblick fühle ich mich hilflos. Und doch bin ich von ihrer unverfälschten Lebendigkeit wie elektrisiert.
Baruch de Spinoza spricht von der Seelenstärke (fortitudo) als dem reinsten, ja dem einzigen Fundament der Tugend. Das Bestreben, in seinem Sein zu beharren, das ihm Nützliche zu suchen, sei eine unumschränkte, allen Lebewesen gemeinsame Eigenschaft. Doch was geschieht, wenn dieser starke Wille so erdrückend wird, dass Spinozas Tugend sich gegen sich selbst kehrt und man, statt nach den Gesetzen der eigenen Natur das Nützliche zu suchen, dazu getrieben wird, bei lebendigem Leibe sich selbst zu verzehren?
Ich fühle mich in meiner Überzeugung bestärkt und klammere mich an die Gewissheit, des Rätsels Lösung gefunden zu haben: Drogen. Irgendein verheerender Wachmacher ist in Sallys Blutkreislauf eingedrungen und hat einen Anfall ausgelöst, einen Anfall von ungeheuren Ausmaßen zwar, aber – wichtiger noch – einen Anfall, der vorübergehen wird.
So besorgniserregend diese Erklärung auch ist, in ihrem Schutz nimmt Sallys Wahn sich weniger bösartig aus. Meine lernbehinderte Tochter hält sich also für ein Genie. Hält alle Menschen für Genies, sofern es gelingt, das Feuer der Kindheit in uns neu zu entfachen. Beileibe keine abwegige Vorstellung. Die Bewohner von Bali glauben, dass wir während unserer ersten sechs Lebensmonate im wahrsten Sinne des Wortes Götter seien. Danach verliere sich unsere Göttlichkeit, und was zurückbleibt, sei nur mehr ein Mensch. Und für die Gnostiker sind wir Gottheiten, die den Fehler begangen haben, sich in die Natur zu verlieben. Deshalb verbringen wir unser Leben damit, uns nach einem Urzustand zurückzusehnen, an den wir uns nur undeutlich erinnern. Was ist Sallys Vision anderes als ein Ausdruck dieser Sehnsucht? Sie hat zurückgefunden zu jenem idealisierten Zeitpunkt ihrer Existenz vor allen Eignungstests, vor »sonderpädagogischem Förderbedarf«, »Verarbeitungs-defiziten« und »Persönlichkeitsbewertung« – bevor das Wort »Durchschnitt« einen Gipfelpunkt bezeichnete, den sie nicht zu erklimmen vermochte. Sie hat ihre Vergangenheit entleert, hat allen verderblichen Einflüssen abgeschworen, allem den Rücken gekehrt: Scheidung, Verrat, ihrer Mutter, mir – und wer könnte ihr einen Vorwurf daraus machen?
Sally sitzt auf dem Wohnzimmerboden, die Arme um die Knöchel geschlungen, den Kopf auf die Knie geschmiegt. Sie zittert leicht, aber für den Augenblick ist sie ruhig. Ich nutze die Stille und winke Pat ins Schlafzimmer, wo wir miteinander reden können, ohne dass Sally uns hört. Hier lege ich ihr dar, wie ich über alles denke. Sallys Bedürfnis, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, sei völlig verständlich. Die psychiatrische Fachliteratur kenne derartige Fälle zur Genüge. Ein unterentwickeltes Ichgefühl schäume in einem Strudel übersteigerter Selbstachtung nach oben. Wenn man die bewusstseinsverzerrende Wirkung der Drogen, die sie offenkundig genommen habe, einmal außer Acht lasse, deute ihr Enthusiasmus dann nicht auf ein gesundes Verlangen nach emotionalem Gleichgewicht hin?
»Wenn es uns gelingt, sie zu beruhigen, wird die Sache bestimmt vorübergehen. Dann wird sie wieder ganz sie selbst sein.«
»Vielleicht sollten wir uns fragen, wer das wirklich ist: ›sie selbst‹«, meint Pat.
Die helle Ungläubigkeit in ihrer Stimme verschlägt mir die Sprache. »Was willst du damit sagen?«
»Du wirst es nicht gern hören, aber Cass hat auf mich überhaupt nicht so gewirkt, als wäre sie zugedröhnt gewesen. Und ich glaube, Sally ist es auch nicht. Und selbst wenn sie Drogen genommen hätte, dann müsste es mindestens zehn Stunden her sein. Sollte die Wirkung nicht längst nachgelassen haben?«
Durch die offene Badezimmertür sehe ich mein Spiegelbild: Wo Sally mir die Wange zerkratzt hat, hängen zwei Hautfetzen herab.
»Ich muss dir was sagen. Ich habe Arnold angerufen«, verrät Pat. Arnold ist der Psychoanalytiker in der Nachfolge Wilhelm Reichs, der sie behandelt hatte, als sie von einem Auto angefahren worden und ihre Karriere als Tänzerin abrupt beendet war. »Er hat mir einen einzigen Ratschlag erteilt: ›Bringt sie zur nächstgelegenen Notaufnahme.‹«
Arnolds Ratschlag hat Gewicht, zumal in Anbetracht seiner wöchentlichen Radiosendung, in der er unter anderem seiner Skepsis gegenüber psychotropischen Medikamenten und der biomedizinischen Voreingenommenheit der psychiatrischen Zunft Ausdruck verleiht. Ich habe Arnold sagen hören, »Geisteskrankheit« sei ein gesellschaftlicher Mythos, einzig und allein dazu ersonnen, einen potenziell subversiven Teil der Bevölkerung mundtot zu machen.
»Ich dachte, er wäre gegen jede stationäre Behandlung?«
»Nicht in Fällen akuter Psychose.«
Akute Psychose. Der Begriff schockiert mich. Im Vergleich dazu klingt »Geisteskrankheit« geradezu harmlos. Ich spritze mir Wasser ins Gesicht; ein paar blasse Blutstropfen fließen in den Ausguss. Dann plötzlicher Lärm. Die Wohnungstür fliegt auf. Pat stößt einen Schrei aus, und beide stürzen wir die Treppe hinab, Sally nach.
In der Bank Street holen wir sie ein. Sie rast, den Oberkörper weit vorgebeugt, blindlings in Richtung Westen. Sie wolle zum Sunshine Café, erklärt sie auf unsere wiederholten Fragen, die Leute seien bereits versammelt, saugten das Licht auf, warteten darauf, dass sie wie versprochen zurückkehre.
Sie biegt in die schmale, kopfsteingepflasterte Gasse nahe der Charles Street, und wie ich dahintrabe, um mit ihr Schritt zu halten, habe ich das überwältigende Gefühl, aus der Zeit herausgefallen zu sein, in ein gespenstisches Gemälde von Bosch oder Brueghel: Durch die Straßen einer ummauerten mittelalterlichen Stadt jagen zwei Narren dem Wahnsinn nach.
Eine Minute später stehen wir vor dem Sunshine Café, einem schäbigen Speiselokal, das auf einer Seite von einer billigen Absteige flankiert wird, die in ein Hospiz für Aidskranke umgebaut worden ist, auf der anderen von einem Pornobuchladen, in dessen Schaufenster ein Schild den Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe verkündet: »Alles muss raus!« Auf der verfallenen Mole gegenüber der West Street rekelt sich ein halbes Dutzend Menschen halbnackt in der Sonne.
Als wir das Café betreten, verdreht der Typ hinter dem Tresen die Augen zur Decke, als habe er das Missvergnügen, sich mit uns befassen zu müssen, schon einmal gehabt. Dann geht er dazu über, uns geflissentlich zu ignorieren. Sally hält geradewegs auf den einzigen Gast zu, einen milde wirkenden Mann mit Bürstenschnitt und ledernen Minishorts, der sich friedlich durch einen Teller Caesarsalat mit Huhn mümmelt. Sie setzt sich zu ihm und streckt ihm ihr Gesicht entgegen. »Was hat dich heute ins Sunshine Café geführt?«
»Ich hoffe, eine Freundin zu treffen.«
Sie ergreift seinen bloßen, tätowierten Arm. »Du hast bereits eine Freundin gefunden. Ich bin deine Freundin.«
Erschrocken entwindet er sich ihr, dann schaudert er sichtlich zurück.
Sally liest die entgegengesetzte Botschaft heraus: Sie glaubt, er hänge an jedem ihrer Worte. Sie schenkt ihm ein gedehntes, seltsam kühles Lächeln. Doch bevor sie eine Chance hat, auf ihn einzureden, schaltet sich der Mann hinter dem Tresen ein. »Schaffen Sie sie raus. Ich will ihre Visage nicht noch mal sehen.«
Ich verarbeite den Schock, sie mit seinen kalten Augen wahrnehmen zu müssen: ein Paria. Das Herz wird mir schwer. Zuerst unsere Nachbarin Lou, nun der unmissverständliche Rausschmiss aus dem Sunshine Café. Ich erinnere mich an eine Legende um Salomo: Von einem Dämon überlistet, wird er aus Jerusalem vertrieben, und der Dämon nimmt den Thron des Königs ein. Salomo sieht sich genötigt, um Nahrung zu betteln, beteuert jedoch, der wahre König Israels zu sein. Die Leute halten ihn für geistesgestört. Sie verhöhnen ihn und weichen ihm aus. Er schläft in dunklen Ecken, ist allein, seine Kleidung verdreckt und zerlumpt.
Mit Pats Hilfe versuche ich, Sally zur Tür zu lotsen. Sie wirft mir einen tödlichen Blick zu und befiehlt mir, den Mund zu halten. Aber sie wird nicht gewalttätig. Sie lässt zu, dass wir sie aus dem Café bugsieren, und durch die heißen Straßen des Village gehen wir zurück. Wir haben Sally in die Mitte genommen, und sie fuchtelt gebieterisch mit den Händen wie ein gefangener Monarch auf einem Zwangsmarsch.
Schweißglänzend nehmen wir in der Wohnung, durch deren Decke fast sichtbar flirrend die Hitze eindringt, wieder unsere hilflosen Positionen ein. Sally, hast du Hunger? Möchtest du dich hinlegen? Soll ich dir etwas vorlesen? Meine Stimme klingt weit entfernt und befremdlich, als hätte ich kraft einer selbstbesänftigenden Illusion die Uhr auf jene Zeit zurückgestellt, als sie zwei Jahre alt war. Bei jeder Frage warte ich auf eine Antwort, auf den leisesten Anhaltspunkt dafür, dass der Zauberbann, unter dem sie steht, gebrochen ist und sie wieder zu dem Kind wird, das ich kannte. Doch jedes Mal wird ihr Anderssein bekräftigt. Es ist, als wäre die echte Sally entführt worden und an ihrer Stelle ein Dämon, ähnlich dem Salomos, der sich ihren Leib angeeignet hat. Der uralte Aberglaube der Besessenheit! Wie sonst sollte man diese groteske Verwandlung nachvollziehen können?
Eine weitere Stunde vergeht. Der Tag fühlt sich immer unwirklicher an. Ich warte darauf, dass die Symptome spontan nachlassen – gewissermaßen auf das Fingerschnalzen des Hypnotiseurs –, doch die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, schwindet zusehends. Eine hermetische Stille umhüllt uns. Es ist, als wären wir für immer mit Stummheit geschlagen. Doch Stumme verfügen wenigstens über eine Zeichensprache, über ein System allseits akzeptierter Bedeutungen. Sally und ich sind im tiefsten Sinne des Wortes Fremde: Wir verfügen über keine gemeinsame Sprache. Der eiserne Rachen ihrer Fixierung verschlingt alles; außerhalb seiner gibt es keine Realität. Sie ist von uns gegangen wie die Toten und hat lediglich eine trügerische Hülle hinterlassen. Diese spricht mit mir in einem selbsterfundenen Dialekt, den allein sie versteht.
»Die Menschen fallen, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihnen eine Falle stellt. Hast du das Gefühl, man hat dir eine Falle gestellt, Vater?«
Ihre Stimme durchbohrt mich wie ein Pfeil. Sally ist erregt, schön, unergründlich seelenlos.
»Ich bin stolz auf dich, Vater. Es gibt so vieles, worüber man weinen muss. So unendlich viel.«
Erst als ich in den Schrammen auf meiner Wange eine brennende Nässe spüre, begreife ich, was sie meint: Sie glaubt, dass ich Freudentränen über ihre Epiphanie vergieße, dass ich mir ihre Vision zu eigen gemacht habe, dass dank ihr auch ich gerettet bin.
Am späten Nachmittag bleibt uns nichts anderes übrig, als Arnolds Rat zu befolgen und Sally ins Krankenhaus zu bringen. Statt dass sie sich, wie ich erwartet hätte, dem Vorhaben widersetzt, begrüßt sie es mit überschäumendem Optimismus, als wären wir dabei, uns endlich auf ein immer wieder vertagtes Abenteuer einzulassen. Sie wird ihre Entdeckungen mit Menschen »teilen« können, die in derlei Angelegenheiten bewandert sind, mit Fachleuten, die sie verstehen werden. So steigen wir wieder die Treppe hinunter und hasten die Bank Street entlang. Die Augen der ganzen Nachbarschaft ruhen auf Sally, die ihren Zusammenbruch herausposaunt und alle, die uns entgegenkommen, in ein misstönendes und verworrenes Gespräch verwickelt.
Am Spielplatz in der Bleecker Street bleibt sie stehen, umklammert die Stäbe des schmiedeeisernen Zauns und betrachtet die Kinder dahinter mit sonderbar nachdenklichem Ernst. Der Anblick der Kinder, die unter dem Wasser des Rasensprengers hindurchlaufen, im Sandkasten graben, einander in ihren Plastiktretautos umkreisen, scheint sie zu faszinieren. Ihr Atem geht flach und schnell, ihre Augen glänzen, und in diesem Moment wirkt sie ungeheuer traurig. Traurig ohne die Fähigkeit, Trauer zu erkennen (»Glanz im Elend«, nannte es Robert Lowell, als er über seine eigene abgrundtiefe Hochstimmung schrieb). Später werde ich erfahren, dass dies die wirre Geistesverfassung von Menschen ist, die an Manie leiden.