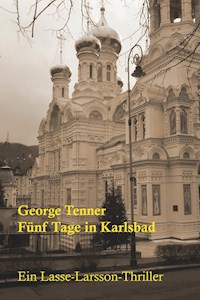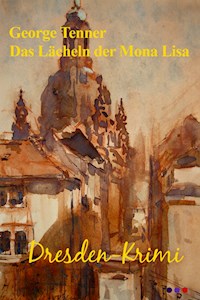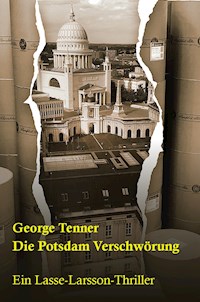Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die afrikanische Kiliwhite Limited hat zum Ziel, in Black Rock-Manier Geld zu verdienen, um jenseits der bekannten Fluchtwege möglichst vielen Menschen den Weg von Afrika nach Europa zu bahnen. Zu diesem Zwecke kauft die Gesellschaft unter anderem eine süddeutsche Metallfabrik, die im Verdacht steht, über Drittländer Teile für das Atomprogramm des Irans geliefert zu haben. Um die Geschäfte voranzutreiben, treffen sich vier der afrikanischen Führungskräfte in der Ostsee – scheinbar mit schwedischen Mittelsmännern. Doch irgendetwas geht schief. Als ihr gecharterter Motorsegler im Anschluss daran spurlos in der Ostsee verschwindet, wird Lasse Larsson mit der Fahndung beauftragt. Zusammen mit seinen Kollegen vom BKA deckt der Kriminalkommissar Zusammenhänge mit der Ermordung Olof Palmes und Uwe Barschels in den 80er Jahren auf. Mit Hilfe der schwedischen Dienste setzen sie schließlich alles daran, herauszufinden, was mit dem Motorsegler passiert ist und welche Motive dahinterstecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Tenner
Der Tod zwischen den Inseln
Die Lasse Larsson Reihe, 7. Band
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Impressum
Copyright 2020 © by George Tenner
Besuchen Sie George Tenner im Internet:
www.georgetenner.de
oder auf Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Tenner
Telefon: +49 (0) 15784495128
E-Mail: [email protected]
Coverfoto: © Henry Böhm
DAS FOTO henry boehm
E-Mail: henry. [email protected]
Tel.: 01795275483
WWW. Facebook. COM/planetusedom
Covergestaltung: VercoDesign, Unna
Herstellung
Neuauflage 2020
George Tenner
Der Tod zwischen den Inseln
Usedom-Krimi
1. Kapitel
25. Juni 2007
Gaston Lloyd fuhr hinter die weiße Ferienanlage, die unmittelbar vor dem Becken des Hafens von Karlshagen auf Usedom lag. Er stieg aus dem silbergrauen BMW, einem Mietwagen von Europcar mit einer Wiesbadener Registriernummer aus, und schlenderte seelenruhig zum Eingang.
Die Haustür war geschlossen.
Lloyd zog einen Schlüsselbund aus der Tasche, öffnete die Türe mit dem durch einen roten Kunststoffring gekennzeichneten Schlüssel. Es begegnete ihm niemand auf der Treppe. Das herrliche Sonnenwetter hatte die Gäste in ihrer Mehrzahl an den Strand gezogen, oder zu Wanderungen ins Usedomer Hinterland verführt. Aus der Wohnung neben seinen Räumen hörte er leise Musik.
Als er die Tür der Ferienwohnung geschlossen hatte, schaute er sich in aller Ruhe um. Die Wohnung bestand aus einer kleinen Pantry, dem Wohnraum mit dem faszinierenden Ausblick auf den Hafen sowie einem Schlafzimmer. Er schaute in die Schränke des Schlafzimmers, des Wohnraumes und des Flurs. Zu seiner Zufriedenheit waren sie leer. Nur in der Pantry fand er komplett vor, was ein vierköpfiger Haushalt brauchte. Außer dem modernen Herd verfügte sie über einen Geschirrspüler, ferner eine Kaffeemaschine. In den Hängeschränken fand er die notwendigen Töpfe nebst Pfannen. Von der Wand ließ sich ein kleiner Tisch abklappen, der zwei Menschen ausreichenden Platz zum Essen bot.
Gaston Lloyd ging zum Fahrzeug zurück. Er entnahm dem Kofferraum des Wagens eine Reisetasche, eine längliche Lederhülle im Durchmesser von etwa sechzig Zentimetern und einer Länge von einem Meter. Sein Blick überflog den Rest der mitgebrachten Habseligkeiten. Er beschloss, sie vorerst zurückzulassen.
Er ging zur Ferienanlage zurück, blieb einen Augenblick stehen, als wolle er die Tasche in die andere Hand nehmen. Seine Blicke suchten den Hafen ab.
Vor ihm an der Pier, offensichtlich kurz vor dem Ablegen, zog eine Frau die Leine vom Poller auf das Vorschiff. Die Maschine arbeitete bereits, was er an dem leisen Motorengeräusch und dem Wasserausstoß bestätigt sah, der in unregelmäßiger Folge eine runde Aussparung an Backbord verließ. Plätschernd ergoss sich das Kühlwasser in den Hafen. Eilig ging die Frau zum Achterdeck, um dort ebenfalls die Vertäuung einzuholen, die das Schiff an Land festhielt. Auf dem erhöhten Steuerstand überwachte ein braun gebrannter Mittvierziger das Manöver. Als er sah, dass das Boot frei schwamm, ließ er es langsam anziehen. Dabei justierte er die ersten Meter mit dem Bugstrahlruder, um nicht die geringste Möglichkeit einer Kollision mit einem der anderen Boote zu gestatten. Majestätisch bot sich der Anblick der weißen Jacht, wie sie auf die Mitte des Hafenbeckens, dann in Richtung Norden Fahrt aufnahm.
Ein Stück begleiteten Lloyds Blicke die Stella Maris aus Hamburg. Abrupt wurde seine Aufmerksamkeit von einem Auto beansprucht, das kurz vor ihm zum Halten gezwungen war. Er machte eine entschuldigende Geste zu dem maulenden Fahrer, gab den Weg frei. Der Wagen rollte an ihm vorbei. Lloyd schaute zurück, zu dem zu dieser Stunde mäßig besuchten Lokal Veermaster. Dort werde ich essen gehen, bevor der Mittagsansturm einsetzt, dachte er.
Im Treppenhaus piepte das Handy. Er stellte das Gepäck kurz ab. Skagerrak Mélisande 25/14/15 Salamander.
Er schob das Handy in seine Tasche. Dann setzte den Weg zur Wohnung fort.
In der Wohnung angekommen, warf er die Tasche auf das Doppelbett im Schlafzimmer. Er packte ein Gestänge aus, steckte es im Wohnzimmer zusammen, sodass es dem Ständer einer Kameraausrüstung glich. Lloyd ging zum Schlafzimmer zurück. Er entnahm der Tasche ein kleines Bündel. Seitlich des Wohnzimmerfensters wickelte er ein Richtmikrofon aus, steckte es auf den Gestängeständer. Er ließ einen Sicherungsbügel über dem Mikrofon einrasten, das ein hochauflösendes Einrohrfernglas tragen würde, sofern er es aufsteckte. Er schaute auf seine Seiko-Astron-GPS-Weltzeituhr, einen 2.400 Euro teuren Solar-Herrenchronografen, den er sich von einem Teil der Entlohnung des letzten Auftrages gekauft hatte. Lloyd glaubte, sich das gönnen zu müssen. Wer weltweit operiert, sollte auch stets auf die weltweite Zeit zurückgreifen können. Schließlich pendelte er ständig zwischen seinem Geburtsort Wellington sowie London, seinem derzeitigen Hauptwohnsitz, hin und her. Da war eine solche Uhr von Nutzen. Eine halbe Stunde würde es ein warmes Essen geben.
Gaston Lloyd freute sich auf eine Mahlzeit mit einem schönen Stück Fisch. Zum Schluss prüfte er, ob der Akku des Aufzeichnungsgerätes für Tonaufnahmen über eine ausreichende Ladung verfügte. Das war der Fall.
Probehalber steckte er das Einrohrfernglas auf; er ließ seinen Blick durch das Glas über den Hafen gleiten, suchte durch Verstellung des Okulars die jeweils beste Auflösung zur erreichen. Wie genau es war, konnte er ermessen, wenn es ihm gelang, den Kassenbon, den die Verkäuferin in der Fischverkaufsstelle, die ein ortsansässiger Fischer mit seiner Familie betrieb, und die linksseitig zum Hafenbecken lag, mühelos zu entziffern. Ein Lächeln huschte ihm übers Gesicht. Ihm entging nichts. Nicht einmal die Fliegen, die sich auf die Fischreste stürzten, die einem Kind aus dem Brötchen gefallen waren. Bei der Wärme gäbe es bald ein Gewimmel von Maden.
Gerade als er das Stativ durch ein Tuch abdecken wollte, fiel ihm ein, das nur wenige Meter neben seinem Domizil befindliche Restaurant in Augenschein zu nehmen. Er sah ein jüngeres Pärchen den Veermaster verlassen. Es lief auf eines der nahe liegenden Segelboote am Pier zu. Zurück blieb die Bedienung des Restaurants. Der Anblick der Brünetten regte seinen Jagdinstinkt an. Es dauert nicht mehr lang, da setzt der Mittagsansturm ein, dachte Lloyd. Es ist besser, ich gehe gleich.
Gewissenhaft schloss er die Türe des Appartements ab, lauschte, ob er noch Musik der Nachbarwohnung hören könnte. Das war nicht der Fall. Beherzt setzte er den Weg fort. Kurze Zeit später stand er vor dem Veermaster. Auf einer der Segeljachten tingelte die Musik einer vergangenen Hitparade und hallte zu ihm herüber. Nicht übermäßig laut, dennoch konnte er ABBAs Hit Dancing Queen erkennen. Schon lange hatte er die Gruppe nicht mehr gehört. Leise summte er die Melodie mit. Eine Familie mit zwei Kindern kam auf ihn zu. Er wandte sich ab. Als sie an ihm vorbei waren, zog er eine Sonnenbrille mit sehr dunklen Gläsern aus der Brusttasche des Hemdes und setzte sie auf. Er ging die sechs Stufen hoch.
Durch vier polygonale Kantsäulen wurde der Anbau an das Haupthaus, einem zweistöckigen rotgrau melierten Ziegelanbau, getragen. Im Parterre lag das Außenrestaurant, das wegen der unmittelbar davor am Pier liegenden Boote ein überaus begehrter Sommerplatz war. In diesem Moment wurde gerade wieder einer der Tische besetzt. Er beschloss, ins Innere des Restaurants abzutauchen. Beherzt betrat er die Speisewirtschaft. Sein Kalkül, dass er in dem dunklen Raum um diese Zeit auf wenige Gäste treffen würde, ging auf.
Das gleißende Sonnenlicht, dem er entkommen war, machte ihn für einen Augenblick fast blind. Einen Augenblick drängte es ihn, seine Brille abzusetzen. Er entschloss sich, das zu unterlassen.
»Suchen Sie etwas?« Es musste die Stimme der jungen Frau mit dem brünetten Haar sein, die er zuvor durch das Glas so bewundert hatte. Er empfand ihre Stimme als äußerst sympathisch.
»Einen Tisch.«
»Es ist nahezu alles frei. Sehen Sie das nicht?«
»Nein.«
»Wie wär es, Sie setzten die Brille ab«, sagte die Frau lachend.
»Das würde ich gern, aber …« Er hörte ihre Schritte, die auf ihn zukamen. Dann sah sie schemenhaft. »Ich hatte eine Augenoperation. Die Brille ist derzeit noch notwendig.«
Von einem der Nebentische kamen leise Stimmen. Eine junge Frau lachte auf.
»Kommen Sie.« Beherzt fasste sie seine Hand, und führt ihn zu einem großen runden Tisch.
»Ist Ihnen der Platz hier recht?«,, fragte sie.
»Wenn Sie in meiner Nähe sind.« Umständlich nahm er Platz. Langsam gewöhnten sich die Augen an die Dunkelheit. Er konnte das Gesicht der jungen Frau deutlich erkennen. Er fand, dass sie ihn hinreißend anlächelte. Was für ein Jammer, dachte er, dass sie eine Art Fata Morgana bleiben wird.
»Können Sie mir etwas zu essen empfehlen«, fragte Lloyd.
»Hirschsteak an sautierten Kräuterseitlingen und Rosmarinkartoffeln. Medaillons vom Schwein mit Kürbis-Chili-Kruste, mit Möhrenstiften in Butter-Macaire …«
»Nein«, beschied er knapp.
»Wie ist es mit Rinderhüftsteak mit Kürbis-Kruste und Kräuterseitlingen an getrüffeltem Kartoffelstampf?«
»Fisch. Ich bin am Meer, da möchte ich Fisch essen.«
Von der Tür kam eine rufende Stimme.
»Ich muss erst einmal draußen nach dem Rechten sehen«, sagte sie. »Hausgebeizter Lachs mit einer Senf-Dill-Soße, frischem Gemüse und Kartoffelrösti.« Sie stand auf.
»Das klingt schon besser.«
»Ich bin gleich zurück.«
Während die junge Frau dem Außenbereich zustrebte, schob er die Brille ein wenig hoch. Er musterte die Umgebung. Zufrieden ließ er sie erst auf die Nase zurückgleiten, als er sie kommen hörte. Durch ein Fenster zur Küche gab sie eine Bestellung auf. Sie kam zum Tisch zurück.
»Keinen Lachs?«
»Haben Sie nichts Besseres, etwas Typisches für den Veermaster?«
Sie war versucht, ihn nach seinem Dialekt zu fragen. Dazu fehlte ihr der Mut.
»Natürlich. Gebratene Ostseescholle Finkenwerder Art mit Gurken-Dill-Schmand an Bratkartoffeln.« Sie spürte seine Unschlüssigkeit. Darum ergänzte sie. »Ostsee-Zanderfilet mit Bordelaiser Kruste, Rieslingsoße und Stampfkartoffeln, oder …«
»Oder?«
»Ostsee-Dorsch im Speckmantel mit geschmorten Römersalatherzen an Rahmlinsen.«
»Das nehme ich. Sagen Sie bitte dem Koch, er möchte eine besonders große Fischportion reichen. Ich zahle das.«
Sie stand auf. Doch bevor sie sich abwenden konnte, fragte er: »Wie heißen sie eigentlich?«
»Conny.«
»Conny?«
»Das kommt von Cornelia.«
»Von Cornelia«, stellte er lapidar fest. »Man könnte ebenso gut Nele sagen, oder?«
Sie nickte. »Darf ich Sie etwas fragen?«
»Nur zu!«
Das Klingelzeichen aus der Küche zeigte, dass die Bestellung für den Außenbereich des Lokals fertig war.
»Dorsch im Speckmantel. Ist das in Ordnung?«
»Okay.«
Die Serviererin entfernte sich.
Sie wird neugierig, dachte er. Gut, soll sie nur.
Als sie zurück an den großen, runden Tisch kam, an dem er saß, sagte sie leise: »Sie haben mich nach meinem Namen gefragt, ich habe ihnen den gesagt.«
Lloyd lächelte. »Gaston, nach meinem französischen Großvater … mütterlicherseits«, sagte er. »Mein Vater wiederum stammt aus Südafrika und hieß Lloyd. Also heiße ich Gaston Lloyd. Zufrieden?«
»Interessant, aber ihr Dialekt.«
»Südafrika«, log er.
»Wow«, entfuhr es der Frau anerkennend. »Sie sind ein faszinierender Mann. Und was arbeitet so ein abwechslungsreich lebender Mann?«
»Ich bin Journalist … Freelancer. Im Augenblick arbeite ich an einer Reportage über Bootsflüchtlinge, die in Italien ankommen.«
»Lampedusa?«
»Die Zahl der afrikanischen Flüchtlinge, die per Boot auf der Insel anlanden, steigt und steigt«, sagte Lloyd bedeutungsvoll. Seine Worte unterstreichend hob er die Augenbrauen. »Allerdings erfüllt sich für die meisten Menschen die große Hoffnung auf ein besseres Leben nicht. Ich schreibe jetzt ein Buch darüber.«
Als der Ton der Küchenglocke anzeigte, dass wieder ein Essen bereitstünde, sagte die Serviererin: »Es sind Ihre Linsen.«
Wenig später war die junge Frau mit anderen Gästen beschäftigt, die nach und nach, zuerst die Plätze draußen mit dem unmittelbaren Hafenblick einnahmen, dann auch ins Lokal kamen.
Lloyd hasste Menschen. Er fühlte sich als Menschenfeind par excellence. Hin und wieder ließ er eine Frau für einige Tage näher an sich heran. Aber es würde ihm nicht einfallen, es mit einer länger auszuhalten als zwei, drei Tage über ein Wochenende. Wenn es hochkam, waren es zwei Wochen am Stück. Doch das hatte bisher nur eine der Frauen geschafft. Als er fertig gegessen hatte, zahlte er.
»Werden Sie wiederkommen?«, fragte sie.
»Vielleicht, wenn sie so schön lächeln wie im Augenblick, Nele … bestimmt sogar.«
Er ging hinaus. An den Liegeplätzen der Steganlagen des größten Hafens im deutschen Teil der Insel lag abends Boot an Boot. Einige Boote waren schon unterwegs, um das Sonnenwetter auf See zu genießen. Zwei der Schiffe machten ihre Eigner gerade fertig, um auszulaufen. Er lief auf der linksseitigen Seite des Hafens entlang. Im Fischladen, bei dem er zuvor mit dem Fernglas den Rechnungsbon gelesen hatte, bewunderte er das Angebot. Tatsächlich aber war er dabei, sämtliche Liegemöglichkeiten für Schiffe in sich aufzunehmen. Jene, die er erwartete, fanden nur an dieser Längsseite des Hafens Platz. Beruhigt ging er nach dieser Feststellung zu der angemieteten Wohnung zurück.
2. Kapitel
Ralswiek, 23. Juni 2007
Die vier Männer landeten am Vortag auf dem kleinsten Flugplatz Deutschlands, in Fehmarn Neujellingsdorf.
Drei wiesen ihre afrikanische Herkunft mittels ihrer Hautfarbe aus. Sie war unverkennbar … schwarz.
Zwei von ihnen wurden erst am 20. Juni mit British Airways via Nairobi in London Heathrow eingeflogen. Der erst zweiundzwanzigjährige Aaron Chandu, Sohn des Gründers der Kiliwhite Ltd., Juma Chandu, jenes sagenumwobenen Multimillionärs aus Nairobi, der auf mysteriöse Weise über ein, für afrikanisch Verhältnisse, unverhältnismäßig hohes Kapital verfügte, und Taabu Zahran, ein großgewachsener, dürrer Massai, die rechte Hand des afrikanischen Moguls, der die Überseegeschicke in der Hand hielt, gleich, auf welchem Kontinent der Welt sie der Kiliwhite Ltd. angeboten wurden. Der dritte Kenianer, Yakubu Uhuru, ein 45-jähriger Internetunternehmer kam aus dem Stamm der Kikuyu. Der Mitbegründer der Kiliwhite Ltd., dessen Tätigkeitsfeld als Stationsleiter des wichtigsten Außenstandortes der Gesellschaft in London lag, unterstützte mit Internet-Ambition die Arbeit. Er kam damit den Interessen aller Beteiligten sehr entgegen.
Nur der vierte Mitreisende, der stellvertretende Stationsleiter der Kiliwhite Ltd. in London, Hector Limas, war der einzige Weiße der Bootsbesatzung. Er verfügte über ein Patent, das ihn zur Führung eines solchen Bootes über die Meere befähigte, und eine Anmietung des Motorseglers erst ermöglichte.
Der zweiundvierzigjährige Limas war bei einer Großwildsafari Juma Chandu begegnet. Er hatte ihn an der Bar des Norfolk Tower getroffen, einer Institution in Nairobi, in der schon der alte Hemingway gewohnt, und an der Bar bis zum Abwinken gesoffen hatte. Bis zum Morgengrauen führten sie ein interessantes Streitgespräch über den Niedergang verschiedener Tierarten Afrikas. Gegen sechs Uhr verabschiedeten sie sich, um wenigstens einige Stunden Schlaf zu bekommen. Sie waren übereingekommen, dass Limas mit seinen Kontakten in der Wirtschaft, die weit über Großbritannien hinausgingen, in die Dienste der Kiliwhite Ltd. eintreten würde.
Am Mittag des Vortages war der seegängige Motorsegler Venus, eine in Deutschland gebaute Stahljacht von der Charterfirma verproviantiert worden. Noch am Nachmittag starteten die Männer die rund 80-Seemeilen-Reise.
Am Abend bereitete Taabu Zahran, Steaks vom Springbock vor, die er eingeschweißt mitgebracht hatte, um einen Hauch ostafrikanischer Heimat zu genießen. Nahezu jeder erkannte die Stammeszugehörigkeit des Mannes an seiner Körperlänge von mehr über zwei Metern. Doch spätestens, wenn er mit den wippenden Armen rennt, oder die Gangway eines Jets benutzt, identifizierte man ihn als Massai.
Nach Mitternacht übernahm Yakubu Uhuru das Ruder. Bis zu diesem Zeitpunkt war Hector Limas, bis auf wenige Minuten allein am Steuer gestanden. Zu gefährlich war der rege Schiffsverkehr innerhalb der Kadetrinne, in der Mecklenburg, zwischen der deutschen Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Insel Falster auf dänischer Seite, die ihren Ruf als eines der schwierigsten und gefährlichsten Gewässer der gesamten Ostsee alle Ehre machte.
Zahlreiche Frachter jeder Größe, zwei gewaltige Tanker sowie die Fähren, die von Deutschland nach Dänemark und Schweden unterwegs waren, begegneten ihnen. Die weißen Fährschiffe mit dem roten Schornstein der Stena Line, die Kiel Göteborg und zurück bedienten, Moltzaus graue Armada, die Travemünde mit Gedser verband, und die Schiffe der TT-Linie.
Gleich, als sie ihre Schiffsreise begannen, waren sie einem Geschwader russischer Kriegsschiffe begegnet, das ihnen aus der östlichen Ostsee entgegenkam und in den Belt einlief, um über Kattegat und Skagerrak die Nordsee zu erreichen. Die Flotte bestand aus einer Reihe kleinerer Begleitschiffe, dem U-Boot-Jagdschiff Cевероморск der Nordflotte, dem Raketenkreuzer Варягs sowie dem großen U-Boot-Abwehrboot Маршал Шапошников. Gemeinsam hatten sie in der Region um die Insel Остров Мощный bis Церковь Святой Троиц an einer Übung teilgenommen. Nun waren sie auf der Reise zu ihren Stützpunkten außerhalb Russlands. Bis die Nacht hereinbrach, war Hector Limas immer nur für wenige Augenblicke zum Schlafen gekommen, denn er hatte jeden der Männer, die für kurze Zeit das Ruder übernehmen durften, eingebläut, ihn ja anzustoßen, wenn eines der Schiffe sie passierte, oder gar auf sie zukam. Sehr gefährlich wäre es gewesen, hätte eines der Riesenschiffe sie überlaufen. Limas wusste nur zu gut, dass sie jämmerlich ersaufen müssten, gäbe es eine solche Kollision.
Nach elf einhalb Stunden, um vier am Morgen, gewahrten sie das zuckende Licht des Leuchtturms vom Darßer Ort. Sechs Stunden später kam Hiddensee in Sicht. Gegen zwei Uhr am Nachmittag, nach rund 22 Stunden Fahrt lag die Insel querab. Sie näherten sich der Einfahrt in den Vitter Bodden, die sie gleich passieren müssten. Noch gut drei Stunden durch den Vitter und den Jasmunder Bodden; nur mit der Motorkraft des 80-PS-Diesels waren sie dabei, ihr Ziel Ralswiek auf Rügen anzusteuern.
Yakubu Uhuru, der Stationsleiter der Kiliwhite Ltd. in London, hatte den Spätdienst in der winzigen Pantry übernommen. Er bereitete ein typisches kenianisches Abendessen vor, einen ostafrikanischen Geflügelsalat. Wie die von Taabu Zahran vorbereiteten Steaks vom Springbock, so brachten sie auch das gekochte eingeschweißte Huhn mit. Wenngleich die in Europa lebenden Männer problemlos die Gerichte westlicher und internationaler Küche genossen, war es Taabu Zahran und der Junge Aaron Chandu, die heimische Gerichte vorzogen.
»Mach, dass du rauskommst, Aaron«, sagte Yakubu Uhuru. »Es ist ohnehin zu eng hier.«
»Aber ich bin hungrig«, widersprach Aaron Chandu.
»Ich habe dich niemals anders gesehen. Also raus.« Uhuru wischte die fettigen Hände an einigen Servietten ab, die er von der Küchenrolle gezogen hatte. Er nahm die geöffnete Dose mit den Ananasstücken, goss die Flüssigkeit in den Ausguss. Dann zerschnitt er die Stücke fingergroß. Er nahm nacheinander eine Dose Keniabohnen und eine Dose mit kleinen Champignons, goss deren Flüssigkeit ebenfalls ab. Er filetierte eine Orange, schnitt zwei Frühlingszwiebeln in dünne Ringe. Er schichtete alles in Lagen in eine große Kunststoffschüssel. Zwei Esslöffel Mayonnaise und zwei Esslöffel Mango Chutney, von einer halben Zitrone den Saft, eine Messerspitze Cayennepfeffer sowie einen Teelöffel Currypulver gab er hinzu. Dann rundete Yakubu Uhuru den Geschmack mit Salz und etwas Pfeffer aus der Mühle ab, bedeckte die Schüssel.
Im Bodden lag die Venus ruhig im Wasser. Dünungsfrei glitt sie leicht dahin. Gut, dachte Limas, dass ich von Fehmarn aus einen Liegeplatz bestellt habe. Jetzt, wo das Störtebekerfest in Ralswiek begonnen hat, sind die Liegeplätze ausgebucht. In das Gewühl des Festes abzutauchen, gehörte zu dem Plan, den Limas seinem Chef unterbreitet hatte. Sein Blick ging nach Steuerbord zum Schloss Ralswiek und der vorgelagerten Seebühne, auf dem die Störtebeker Festspiele stattfanden. Minuten später machten sie am Kopf des mittleren der drei Stege fest. Es war der Liegeplatz, den man Limas zugeteilt, und per Mail bestätigt hatte.
Wie aus dem Nichts tauchte der Hafenmeister auf, um die ungewöhnliche Crew des Schiffes auf die Gepflogenheiten des Hafens aufmerksam zu machen und die Liegegebühr zu kassieren.
Limas erledigte die Formalitäten, während die drei Männer unter Deck munter in Kisuaheli palaverten, was weder der Hafenmeister noch Limas verstand. Zum Schluss gab der Hafenmeister Limas eine Broschüre mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Insel – Störtebeker Festspiele, den Bahn, die Schiffsverbindungen und die Telefonnummer der örtlichen Taxizentrale. Der Mann verschwand ebenso schnell, wie er gekommen war.
Der Himmel zeigte mäßige, graue Schlierenwolken. Limas beobachtete den Hafen. Er sah ein lebhaftes Treiben, was zu dieser Jahreszeit keineswegs etwas Besonderes war. Schließlich war Mitte Juni für viele schon der Urlaubsanfang. Die Störtebeker Festspiele waren ein faszinierender Anziehungspunkt. Exakt heute, dem 23. Juni war der Beginn der diesjährigen Festspiele. Verraten und verkauft war, nach In Henkers Hand 2006, die erste Inszenierung der neuen Episoden. Die Festspielleitung hatte diesen Zyklus für die nächsten sechs Jahre geplant.
»Ich möchte, dass wir immer eine Wache an Bord haben«, begann Limas, der mit Interesse wahrnahm, dass Uhuru den Tisch deckte, während sich die beiden anderen Männer um irgendetwas stritten, was Limas nicht verstand. »Habt ihr es gehört«, setzte Limas nach.
Die beiden Männer verstummten.
»Wir teilen Wachen ein. Nie wird unser Boot aus den Augen gelassen.«
»Gibt’s dafür einen Grund«, maulte der junge Aaron Chandu.
»Es ist eine alte Weisheit, Aaron. Lasse nie dein Schiff aus den Augen, es könnte gestohlen werden«, mischte Taabu Zahran sich ein. »Dein Vater würde dir das ebenfalls sagen.«
»Wir wollen doch zu diesem sherehe gehen«, begehrte Aaron auf.
»Es ist kein gewöhnliches Fest«, stellte Limas richtig. »Es sind Festspiele.«
»Tamasha«, sagte Taabu Zahran in Kisuaheli.
»Umso lieber gehe ich da hin.«
»Einer von euch sollte hierbleiben«, erklärte Limas.
»Warum?«, fragte Aaron.
»Weil Hector mitgehen sollte«, ließ Uhuru sich vernehmen.
»Weshalb sollte Hector mitgehen?«, fragte Aaron.
»Falls es Probleme gibt.«
»Probleme? Was für Probleme?«
»Wir sind in Deutschland«, sagte Limas.
»Und?«
»Da wird ab und zu ein Nigger totgeschlagen«, sagte Taabu Zahran lapidar.
»Du solltest nicht so respektlos von deinem Volk sprechen«, sagte Limas leise.
»Aber es stimmt.«
»Was stimmt?«, fragte Aaron nach.
»Dass es in Deutschland Fremdenhass gibt. Ganz vorn trifft er die schwarze Haut. Die kommt noch vor den Türken, denn die erkennt man erst richtig, wenn sie den Mund aufmachen«, sagte Yakubu Uhuru.
»Ich will da hingehen«, beharrte Aaron.
»Taabu …« Limas meinte das als Aufforderung an den Massai, ein Machtwort zu sprechen. Er wusste, dass Zarahn wohl der Einzige war, auf den Aaron hören würde.«
»Limas hat recht«, sagte Zahran. »Einer bleibt hier. Du wirst, der heute die erste Wache übernimmt, Aaron.«
Aaron schäumte. Doch er wusste, wie der Vater reagierte, würde der Massai über seine Widerspenstigkeit berichten.
Sie setzten sich in der Messe an den Tisch.
»Es sieht gut aus«, sagte Limas, als Yakubu Uhuru das Essen auf den Tisch stellte.
»Und es riecht schon verführerisch«, gab Aaron zu bedenken.
»Dabei könnte es wohl gerade für dich reichen«, sagte Yakubu Uhuru mit einem breiten Grinsen.
»Wir lassen ihm den Hauptanteil«, beschied Taabu Zahran kurz. Er legte sich einen Löffel des auch für ihn köstlichen Geflügelsalates vor. Dann brach er ein großes Stück eines der drei Baguettes ab, die ihre knackige Frische bereits verloren hatten. Doch das störte den Mann nicht.
»Der Hafenmeister hat uns eine Übersicht der Möglichkeiten gebracht, die uns die Insel bietet«, sagte Limas. »Wir werden sie wohl kaum nutzen können. Wir werden hier nur eine Nacht liegen, und müssen morgen am Spätnachmittag verschwunden sein.«
»Ist das ein Problem?«, fragte der Massai.
»Wir fahren, bis es dunkel wird, ankern draußen im Wieker Bodden«, sagte Limas. »Dann haben wir noch immer eine rund 10-Stunden-Reise bis zum Treffpunkt.«
Einen Augenblick schwiegen sie kauend.
»Wenn wir allen Unbilden aus dem Wege gehen wollen«, sagte Taabu Zahran nachdenklich, »bleiben wir gemeinsam an Bord bis morgen.«
»Glaubst du, dass es Ärger geben kann?«, brauste Aaron auf.
»Ich will es gar nicht darauf ankommen lassen. Was meinst du, Hector?«
Limas zucke mit der Schulter. »Jeder von uns brauchte zwar ein wenig Landgang. Doch müssen wir vermeiden, was die Operation gefährdet.«
»Dann bleiben wir heute alle an Bord«, beschied Taabu Zahran.
Aaron brauste auf. »Ich werde mit meinem Vater telefonieren.«
»Tu das«, sagte der Massai ruhig. »Aber er wird nicht sonderlich begeistert reagieren. Hat er doch ausdrücklich angeordnet, nur im äußersten Notfall Kontakt mit ihm aufzunehmen. Einen Notfall kann ich nicht erkennen.«
Aaron erkannte die aussichtslose Lage.
»Du kannst dich nützlich machen. Hilf Yakubu beim Abräumen, Aaron.« Taabu Zahran stand auf. Lass uns hochgehen«, sagte er zu Limas.
Die beiden Männer gingen ins Ruderhaus.
Der Massai schaute hinaus zum Horizont. Die Sonne ging glutrot unter. Es ist fast wie zu Hause, dachte er. Nur das Brüllen der Löwen fehlt, und der schnelle Wechsel vom Tag zur Nacht.
Limas steckte sich eine Zigarette an. Zweimal glühte sie auf, bevor er sagte: »Wir haben den Termin morgen elf Uhr. Die Frage ist, wer geht hin?«
»Ich denke, dass wir beide das machen werden«, sagte der Massai.
»Wie erklärst du das Yakubu? Er ist der Europachef.«
»Ich werde ihm sagen, dass er zusammen mit Aaron hier sein muss, weil wir gezwungen sind, nachzutanken.«
»Ich bin der Einzige mit einem Patent.«
»Wer weiß das außer uns? Yakubu ist schon mit seinem Vater auf dem Victoriasee zwischen Muhuru und Kisumu hin und her geschippert. Wusstest du das nicht? Der Alter war dort Kapitän. Yakubu kann das.«
Später, als der Massai über das Wasser des Jasmunder Boddens schaute, sah er in der Abenddämmerung ein großes Motorboot näherkommen. »Wir kriegen Besuch.«
Limas justierte das Fernglas. »Es ist ein umgebauter Fischkutter«, sagte er ruhig. »Solche Schiffe gibt es ebenfalls bei uns in Großbritannien, seegängig, zuverlässig. Sie bieten viel Raum.«
»Ein Fischkutter?«
Limas antwortete nicht. Er beobachtete, wie der Kutter am Kopf des linken Stegs festmachte.
»Es ist eine Frau an Bord«, sagte er nach einer Weile. Beruhigt legte er das Glas weg.
Yakubu Uhuru und Aaron spielten Scrabble. Aaron war ganz scharf darauf. Yakubu hingegen ließ es über sich ergehen. Sie mussten so die Zeit totschlagen, um den Jungen daran zu hindern, Unruhe wegen seines Wunsches zu verbreiten, die Störtebekerfestspiele nicht ansehen zu dürfen.
Kurz nach zehn ging Yakubu Uhuru, der eine der beiden Kojen im Vorschiff benutzte, und legte sich hin. Limas ging kurz nach ihm. Er war geschlaucht von den überlangen Wachen, die er während der Fahrt am Ruder gestanden, oder zumindest wach daneben aufgepasst hatte, dass keiner von den anderen ihr Schiff versenkte.
Aaron Chandu räumte das Spiel zusammen. Legst du dich gar nicht hin?«, fragte er.
Taabu Zahran schaute auf. Er schob das kleine Buch beiseite, in denen er stichartig Tagesereignisse notierte. Später würde er sich Erinnerungsanstöße holen, wenn er die Berichte für Juma Chandu, seinen Boss schreiben würde.
»Ich brauche wenig Schlaf«, sagte er. »Da ich keine Ruhe finde, solange du nicht im Bett bist, bleibe ich, bis auch du müde sein wirst.«
Aaron schluckte einen Fluch herunter. Dann ging wortlos ins Achterschiff, wo er sich die Kabine mit dem Massai teilte.
Taabu Zahran ging noch einmal hoch zum Steuerstand des Bootes. Er setzte sich und beobachtete in die Dunkelheit hinein, ob er im fahlen Licht der Laternen Bewegungen auszumachen konnte. Auch der umgebaute Fischkutter, der wenige Stunden zuvor ankam, lag im Dunklen. Er konnte keine Bewegung an Bord des Schiffes feststellen. Als er überprüft hatte, dass die Außentüren des Motorseglers verschlossen waren, ging auch er hinunter zu seiner Koje in der Heckkabine. Er bewegte sich wie ein Gepard beim Anschleichen an eine Beute. Bevor er die Schiebetür öffnete, lauschte er hinein. Was er vernahm, befriedigte ihn. Aaron stieß ein gedämpftes Röcheln aus, das der Massai schon aus anderen Nächten kannte. Sehr leise legte er sich auf die Koje. Er hatte sich nicht ausgezogen, um jederzeit sprungbereit zu sein, falls Aaron ihn erfolgreich getäuscht hatte. Seine Vorsicht war unbegründet.
Aarons gleichmäßiges Atmen zeigte ihm, dass der Sohn des Chefs der KW schlief. Doch wenn er versuchte, ihn zu täuschen, um von Bord zu schleichen. Er würde nicht einmal bis zur Messe kommen, denn der Massai war es aus vielen Nachtjagden und Wachen bei den Zelten während der Safaris in der ostafrikanischen Savanne gewöhnt, selbst die spärlichste Regung wahrzunehmen. Der kleinste Laut, den ein Löwe von sich geben würde, oder das Knacken eines Astes, wenn ein Springbock in der Nähe äste, wären ihm nicht entgangen. Hier lagen die Situationen anders. Doch die zarte Welle, die von einem Paddelboot übertragen, sich an der stählernen Wand des Schiffes leicht plätschernd brach, das leiseste Geräusch eines eintauchenden Paddels, – keiner der Mitreisenden könnte sie bemerken. Der Jagdinstinkt eines Massai aber schläft nie.
Kurz nach vier brach die Morgendämmerung herein. Für Taabu Zahran das Zeichen, aufzustehen. Nichts würde er anders machen als Zuhause in seiner Enkaji in der kenianischen Savanne. Es war eine typisch kenianische Rundhütte, gebaut mit getrocknetem Kuhdung, in denen auch Ziegen über Nacht blieben, damit sie nicht einem Raubtier zum Opfer fielen. Dementsprechend herb kam der Geruch an empfindlichen Nasen an, den seine beiden Frauen als durchaus normal ansahen.
Für Taabu Zahran hatte sich das Leben geändert, als ihn Juma Chandu an sich band. Der junge Massai erledigte zuerst wie eine Art Butler Arbeiten für den Boss. Mit dem Einkommen ermöglichte er seinen beiden Frauen und den drei Kindern ein sicheres Leben. Doch der Millionär Juma Chandu hatte das ungewöhnliche schnelle Auffassungsvermögen und die Sprachbegabung des jungen Massais erkannt, der neben seiner nilotischen Stammessprache auch Suaheli und fließend Englisch sprach. Es verging kein Jahr, da schickte er ihn auf die School of Business der UNIVERSITY OF NAIROBI. Was dann geschah, hatte selbst den geschäftstüchtigen Millionär verblüfft. Taabu Zahran schaffte den Masterabschluss innerhalb zweier Semestern. Fortan arbeitete er als rechte Hand seines Chefs und war in alle Überseegeschäfte eingeweiht.
Mit Gründung der Kiliwhite Ltd. gehörte Taabu Zahran zu den unangefochtenen Führungskräften. Immer seltener erlaubte es ihm seine Zeit, hinauszufahren, um die Familie zu sehen. Manchmal überkam ihn der Wunsch, dies zu ändern. Doch wusste er zu genau, dass ihm eine solche Chance eines pekuniären Aufschwungs nur einmal geboten wurde. Er entschied sehr bewusst, die Stellung bei Juma Chandu so lange zu behalten, bis dieser ihn eines Tages vor die Tür setzte.
Kurz nach fünf kam Limas in die Messe. »Morning Taabu«, sagte er lässig, und gähnte.
Der Massai war gerade dabei, sein kleines Buch mit den Eintragungen zu versorgen, die er am Tage zuvor nicht mehr geschafft hatte. Er klappte es zu.
Limas war nicht überrascht, den Massai zu so früher Stunde anzutreffen. »Du schläfst wohl nie?«
»Schlafen können wir noch lange genug«, sagte Zahran doppeldeutig.
Limas lachte auf. »Wenn wir tot sein werden, ich weiß. Das ist deine Philosophie.«
Limas stellte den Topf mit dem Wasser für den Kaffee auf den Gaskocher und zündete die Flamme an.
»Kaffee?«
»Wir Briten trinken eigentlich lieber einen guten Tee. Doch du, Taabu, möchtest Kaffee. Also koche ich Kaffee für alle, die zu so früher Stunde da sind.«
Zahran lächelt breit. »Wir schauen uns das Bauwerk heute nur an, Hector«, sagte er der Massai warnend. »Alles, was ich darüber lese, haben wir es ausschließlich mit einer großen historischen Ruine zu tun, die man wiederbeleben will, koste es, was es wolle.«
»Dafür wird sie preiswert sein«, widersprach Limas.
»Vielleicht. Aber es gelten drei Regeln für eine jegliche Immobilieninvestition – Lage, Lage, Lage.«
Limas lachte auf. »Eine bessere Lage findest du nicht, um ein Project anständig mit Gewinn vermarkten zu können.«
»Wir wollen kein Projekt vermarkten Hector. Der Boss hat gesagt, nur dann, wenn es so außergewöhnlich ist, dass man es machen muss.«
»Und?«
»Wir können, aber wir werden nicht, wenn wir zu viel Geld über zu lange Zeit binden müssen.«
»Aber die Lage … Genau hinter der Düne. Derartiges bekommst du heute gar nicht mehr so genehmigt.«
»Ich erinnere mich gern an unsere gemütlichen Enkajis. Wenn ich nur daran denke, ich müsste in einem solchen Monstrum leben, würde ich sehr still werden und eingehen«, sagte der Massai nachdenklich.
Doch mit Ziegen in einer so kleinen Rundhütte wohnen …«
»… Ist für mich nicht mehr à jour, aber allemal vorzuziehen«, konterte Zahran Hector Limas.
»Immer, wenn ich nach Haus komme, um meine beiden Frauen Zainabu und die junge Mwanaisha und die Kinder zu sehen, weiß ich, dass sie glücklich sind, so wie sie leben, in Freiheit und mit einem Mann, der sie ernähren kann! Löwenjagd, Hector, ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Wir jagen jetzt eine andere Art Löwen.«
Limas goss das kochende Wasser auf das Kaffeepulver in der Kanne. Unmittelbar zog der herrliche Geruch durch die Messe. Er stellte zwei große Tassen und die Kanne auf den Tisch.
Irgendwie ist es schon beachtlich, was dieser hagere Kerl aus seinem Nomadenleben macht, dachte er. Wer kann schon von sich behaupten, aus der Savanne zu kommen, und innerhalb von kurzer Zeit zur rechten Hand eines der reichsten Männer Nairobis aufzusteigen. Das nenne ich Glück.
*
Für zehn Uhr hatte Limas durch den Hafenmeister das Taxi bestellen lassen. Pünktlichkeit ist eine deutsche Eigenschaft, stellte er fest, als der gelbe Wagen am Kai entlangfuhr, und vor dem Steg stehen blieb.
Das ungleiche Paar, der etwas untersetzte Limas, und der lange, nahezu dürre Massai gingen den Steg entlang zum Pier. Neugierige Blicke anderer Bootseigner und deren Gäste folgten ihnen.
Limas nannte dem Fahrer die Adresse. Der Wagen setzte sich unvermittelt in Bewegung. Sie unterhielten sich noch eine Weile in englischer Sprache. Der Massai bemerkte, dass der Fahrer dauernd in den Spiegel schaute. Scheinbar hörte er ihnen zu. Deshalb schwiegen die Männer.
Das Erste, was er von dem langen Bauwerk sah, empfand Taabu Zahran als einen Schlag ins Gesicht.
»We are there, Mister. That’s prora. One of the major buildings of the Nazis. House one …«, sagte der Fahrer und hielt vor dem lang gezogenen, grauen Bau.
»Can you see the road slowly continue until the end of the building?«, fragte Taabu Zahran.
Das Taxi fuhr langsam an dem viereinhalb Kilometer langen Bau entlang.
»Are you familiar with the parts of the building?”, fragte Limas.
»Yes, indeed.«
»House four ... they hold in front of.«
Zarahn machte er eine Bewegung, der Fahrer solle weiterfahren. Das Taxi weiter an dem grauen Bau vorbei. An manchen Stellen glich es eher einem Fragment, bestehend aus Betonpfeilern, die mit roten Backsteinen aus gemauert waren. Das Ganze machte einen überaus fragilen Eindruck.
Vor dem Eingang stand ein grauer Mercedes der mittleren Baureihe. Der Fahrer hielt das Taxi an, und grüßte nickend zu dem Wagen hinüber. Offensichtlich kannte er die beiden Personen, die dem Wagen entstiegen waren.
Limas zahlte. Die Männer stiegen aus. Das Taxi wendete, und fuhr davon.
»Wir könnten noch eine Weile gebrauchen«, sagte Limas mit dem Blick zur Armbanduhr. »Doch die Deutschen sind pünktlich.«
»Es ist kein Weltwunder«, stellte der Massai fest. »Und es ist maroder als eine Enkaji nach einem heftigen Sturm während der Regenzeit, und erheblich hässlicher.«
»Aber es beeindruckt«, widersprach Limas. »Wer konnte schon 1935 so verrückt sein, ein viereinhalb Kilometer langes Bauwerk zu errichten.«
Taabu Zahran sagte nichts. Sie gingen auf die Menschen zu, die wie aufgebaut neben dem Mercedes standen. Der Mann mochte die Vierzig gerade überschritten haben, während die Frau noch jung war.
Der Blondine fällt fast die Kinnlade herunter, dachte Limas, als er sah, dass die Frau nur zögerlich Taabus Hand ergriff und stammelte: »Meier … Ines Meier.« Limas wusste sofort, was der Massai dachte. In dieser Welt der Weißen bin ich nur ein lausiger Nigger vom schwarzen Kontinent.
»Hector Limas«, sagte Limas, als er dem Mann die Hand gab.
»Dann haben wir miteinander telefoniert. Wolfgang Schröder.« Er reichte Limas seine Visitenkarte. Sie wies ihn als Dr. Wolfgang Schröder aus, was Limas eher belustigt registrierte.
Limas lächelte. »Ich habe sie gleich an der Stimme erkannt«, sagte er. »Das ist also der Prachtbau, den sie offerieren.«
»Wir sind jetzt am Haus eins. Für dieses Haus gibt es einen Investor aus Berlin, der sich brennend dafür interessiert. Aber es ist möglich, eines der anschließenden Häuser, Haus zwei oder drei zu erwerben, wenn Sie eine geeignete Nutzung einreichen.«
»Eine geeignete Nutzung?«, fragte Zahran.
»Das Land möchte natürlich erfahren, wie der jeweilige Investor das Haus zu nutzen gedenkt. Damit sollen erfolgreiche Modelle gefördert werden.«
»Es sieht eher aus wie eine Riesenruine«, stellte Limas fest. »Wer ist der Eigentümer der Immobilie?«
»Der Bund.« Er sah, dass die Auskunft bei den beiden Männern auf Unverständnis stieß. Deshalb fuhr er fort: »Die Bundesrepublik Deutschland, und das Land Mecklenburg-Vorpommern.«
»Warum wollen die es nicht selbst so herrichten, dass es ordentlich verwendbar ist?«, fragte Taabu Zahran, der bisher geschwiegen hatte.
»Das ist eine Investitionsfrage. In diesem Falle ist man an privaten Investoren interessiert.«
Limas wechselte mit Zahran vielsagende Blicke.
»An welche Summe hat der Staat gedacht, für eines dieser Häuser zu erzielen?«, fragte Limas.
»Fünf Millionen Euro«, sagte Schröder.
Zahran atmete hörbar aus. »Gehen wir ein Stück«, sagte er.
Die kleine Kavalkade setzte sich langsam in Richtung Haus zwei in Bewegung. Schröder erläuterte bildreich, welch ein interessanter Bau das doch sei, und was für Möglichkeiten er böte, in dieser exponierten Lage. Das reiche vom Hotelbau bis zu, an dieser herausgehoben Strandlage, sehr begehrten Eigentumswohnungen.
Als sie am Haus zwei ankamen, fragte Limas: »Haben wir die Möglichkeit, die Räumlichkeiten innen zu besehen?«
»Selbstverständlich«, sagte Schröder. »Die Schlüssel« er sah seine Sekretärin herausfordernd an.
Die Frau stellte die Tasche auf ihren angewinkelten Oberschenkel, öffnete sie, und nahm ein Bund heraus, an dem verschiedene Schlüssel hingen. Sie schloss die provisorische Absicherung des Hauses auf. Die Männer gingen hinein. Überall fehlten Teile des Putzes. Auch die Fenster, die teilweise eingeschlagen worden waren, hatte man nicht ersetzt, manche jedoch einfach mit Brettern vernagelt.
»Fünf Millionen Euro«, sagte Limas langsam. »Glauben Sie wirklich, eine solche Summe erzielen zu können?«
»Bedenken Sie, welch große Grundfläche Sie dafür bekommen«, sagte Schröder.
Limas schaute zu Taabu Zahran. Niemand, außer ihm, würde erkennen können, was der Massai jetzt dachte. »Für den Fall, dass sich Kiliwhite Ltd. auch nur im Ansatz damit beschäftigen soll, müssten sie schon ihr Angebot deutlich nach unten verhandelbar präzisieren.« Er drehte sich um, und ging, im Gefolge der Kavalkade, zum Eingang zurück.
»Im Augenblick kann ich Ihnen kein günstigeres Angebot machen, bin jedoch sicher, dass sich nach Rücksprache mit dem Auftraggeber noch ein wenig Spielraum erreichen kann.«
Während des Rückweges machte Hector Limas den Immobilienmakler auf weitere Probleme am Haus aufmerksam.
»Wären Sie so freundlich, uns ein Taxi zu rufen?«, fragte er. Der Makler schloss das Haus wieder ab.
Der Makler telefonierte kurz.
An den Fahrzeugen angekommen, tauschten sie noch einige allgemeine Floskeln über Binz, Rügen im Allgemeinen und die Entwicklung nach der politischen Wende in Deutschland aus. Als das Taxi kam, verabschiedeten sie sich.
Auf der Fahrt durch Binz ließ Limas das Taxi vor einem Supermarkt halten. Er bat den Fahrer zu warten, während er und Taabu Zahran in den Markt gingen, um für die nächsten 24 Stunden Verpflegung einzukaufen. Überall wo der lange Massai auftauchte, begleiteten ihn neugierige, manchmal feindselige Blicke. Er schien es nicht zu bemerken. Das aber war ein Irrtum. Taabu Zahran spürte sehr wohl die feindselige Haltung, die ihm entgegenschlug.
Gegen 14:00 Uhr hatten sie den Proviant an Bord der Venus verstaut. Die Venus nahm Kurs auf die östliche Ostsee.
3. Kapitel
Ein Jagdlager in der Nähe Massai Mara, im August 2004
Die Gruppe bestand aus vier Männern und einer Frau, die vor wenigen Stunden mit dem Flugzeug aus Mombasa ankamen. Dort hatten sie auf Einladung Juma Chandus im Dolphin, ganz in der Nähe Mombasas genächtigt, sich am Pool des Hotels erholt. Das wichtigste Ereignis aber war für die Fünf das Hochseeangeln, das Juma Chandu organisierte. In den zwei Tagen hatten sie einen Blue Marlin, zwei Yellow Fin Tuna – Gelbflossen Thunfische, diverse Barsche, einen Karambezi und letztlich einen Delfin gefangen. Während sie die Großfische allesamt wieder in die Freiheit entließen, boten die Zackenbarsche und der Karambezi, das ist der Name für den Giant Trevally in der Bantusprache Swahili, wundervolle Mahlzeiten, die das Personal zum Teil schon an Bord hervorragend zubereitete.
Juma Chandu verstand sein Geschäft. Schließlich gehörte ihm die Kenia-Safari & Fishing Ltd. Diese Firma rangierte bei den europäischen sowie den nordamerikanischen Reiseanbietern an einer der ersten Stellen.
Menschen, die er zu instrumentalisieren anstrebte, erhielten stets seine individuelle Betreuung. Von diesen fünf Personen stand zumindest eine ganz oben auf der Liste Chandus. Er plante, in London eine Holding zu gründen, eine europäische, die selbst diffizile Unternehmungen koordinieren und überwachen können müsste, weitab vom Geruch eines armen Afrika. Genau dafür suchte er seit einiger Zeit schon einen geeigneten Repräsentanten. Einer der Gäste, Hector Limas, verfügte über eine ausgezeichnete Referenz eines britischen Geschäftsfreundes Chandus. Deshalb hatte der sein ausgeprägtes Interesse geweckt. Um ihn bemühte er sich während der einwöchigen Reise besonders und lud ihn ein, nach Beendigung der Safari für zwei Tage im Norfok-Tower in Nairobi, mit ihm über eine Zusammenarbeit zu sprechen.
Die beiden Geländewagen, ein Land Rover Defender und der Toyota Land Cruiser erreichten das Zeltlager. Es war nur wenige Hundert Meter von einem Massai-Dorf entfernt aufgeschlagen, und für die Nacht, in der Wildtiere bis dicht an das Lager herankommen konnten, mit automatischen Bewegungsmeldern gesichert worden.
»Wir nehmen jetzt einen Tee«, begann Juma Chandu seine kleine Ansprache, als alle an dem Klapptisch platzgenommen hatten. »Und dann biete ich ihnen ein besonderes Erlebnis, das sie sicher lange nicht vergessen können. Wir werden heute hier abseits der Mara Simba Lodge nächtigen, damit sie das Feeling vergangener Jagdzeiten erleben können.«
»Was meinen Sie damit, Mister Chandu?«, fragte die einzige Frau der Gruppe, eine herbe Mittfünfzigerin, die ihre besten Jahre wohl als Kriegsreporterin, zuletzt im Jahr 2003 auf der vergeblichen Suche nach Saddam Husseins nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen in Irak unterwegs gewesen war. Der amerikanische Außenminister Colin Powell präsentiert Beweise für die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Iraks vor dem UN-Sicherheitsrat. Er zeigte auch eine Kaufvereinbarung der irakischen Regierung mit der Regierung des Niger über waffenfähiges Plutonium. Beides erwies sich als Fälschung.
Aus Protest gegen diesen durch ein Lügengestrüpp verursachten Krieges war Rhonda Irene Morken, wie sie selbst mehrfach von sich gegeben hatte, von ihrer Mission zurückgetreten und nach Brentwood, 35 Kilometer von London entfernt, zurückgekehrt. Kurz vor ihrer Abreise aus der Nähe von Mosul hatte sie ein Querschläger am Bein erwischt. Mit einem gewissen Stolz genoss sie diesen Hinweis auf ihre Tätigkeit, indem sie das rechte Bein leicht nachzog.
»Ich meine, Mrs. Morken, das Feeling, das der englische Großwildjäger Denys Finch Hatton in der damaligen Kronkolonie Britisch-Ostafrika in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts, als Liebhaber der dänischen Autorin und Farmerin Karen Blixen, jener Frau vermitteln konnte.«
»Ich hatte keine Farm in Afrika. Leider. Mein Afrika waren die Kriege dieser Welt«, insistierte die Frau. »Und die Liebhaber …«
Doch Juma Chandu ging nicht mehr darauf ein. Er machte den beiden schwarzen Dienern ein Zeichen.
»Wer möchte, kann jetzt einen Tee trinken, denn danach werde ich sie entführen. Es ist unser vorletzter gemeinsamer Abend.« Juma Chandu machte eine Pause, während die beiden weiß behandschuhten jungen Schwarzen, die kleine Gruppe der Weißen mit Tee versorgten.
»Der Massai Mara ist der schönste Nationalpark. Diese Region weist eine der am dichtesten bewohnten und größten Tierbestände in Afrika auf. Wir in Kenia sind stolz darauf, das unseren Gästen anbieten zu können«, fuhr Juma Chandu fort, als alle mit Tee und Biskuites versorgt waren. »Wie wir heute Morgen losfuhren, haben sie die Löwinnen beobachten können, die kurz nach Sonnenaufgang ein Gnukalb erlegt, und es förmlich auseinanderrissen haben. Sie erinnern sich an die große Zahl der imposanten Geier. In gebührendem Abstand im Kreis um die Löwen herum saßen die großen Aasfresser, ebenfalls in den umliegenden Bäumen, von denen sie sich noch einen genaueren Überblick verschafften Sie ließen die Löwinnen und die Reste des Kalbes nicht aus den Augen. Sie haben die Tüpfelhyänen gesehen, die in ihrem typischen Passgang angelaufen kamen, dann aber in angemessenem Abstand sitzen blieben, sich noch nicht näher an die geschlagene Beute heranwagten. Auch sie hatten Hunger. Nach einer Zeit waren die Löwinnen satt und konnten den Knochen des Gnukalbes nichts mehr abgewinnen. Warum? Es bestand fast nur noch aus Haut und Knochen. Die beiden Löwinnen zogen sich langsam zu einer Buschgruppe zurück. Doch kaum sind die Raubkatzen weg gewesen, schon stürzten sich die Geier alle wie auf einen Schlag auf die Beute. Vom Gnukalb war nichts mehr zu sehen,