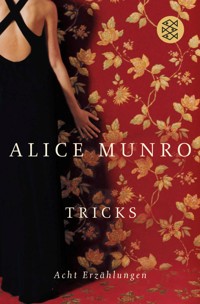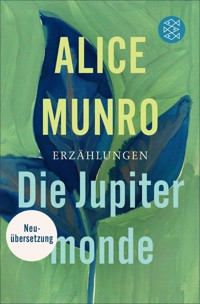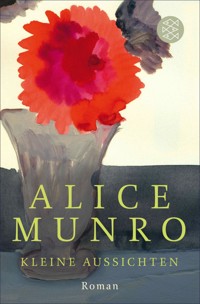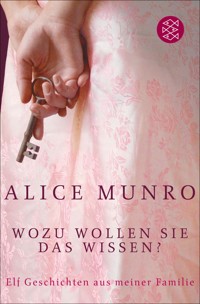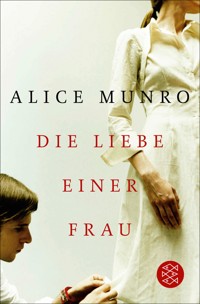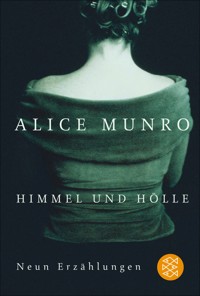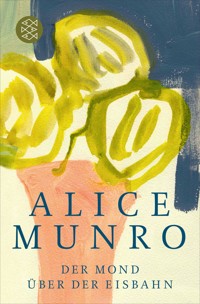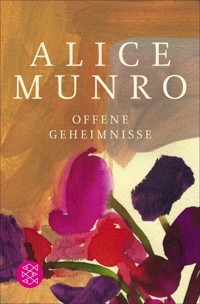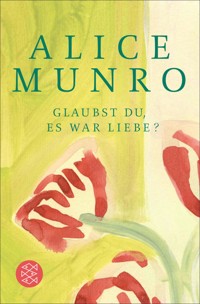8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nobelpreis für Literatur 2013 Alice Munro ist die Meisterin der Ambivalenz. Komik und Tragik, scheinbar Alltägliches und Schicksalhaftes oszilliert in ihren Geschichten in immer neuer Intensität, die den Leser nie unberührt lässt. Ein ›literarisches Wunder‹ nannte die New York Times die Erzählungen der kanadischen Autorin - Geschichten, so komplex wie Romane, Kammerspiele des Gefühls, Geschichten, die wie Idyllen beginnen und sich auf den Abgrund zu bewegen. »Bei Alice Munro gelangt man lesend wie Hand in Hand mit ihr zu der Erkenntnis eines Augenblicks; das ist eine merkwürdige und eher seltene Form von Gemeinsamkeit mit einem Autor. Ich lese - das bedeutet, ich lebe mich in das Leben eines anderen Menschen ein.« Judith Hermann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alice Munro
Der Traum meiner Mutter
Erzählungen
Über dieses Buch
Nobelpreis für Literatur 2013
Alice Munro ist die Meisterin der Ambivalenz: Komik und Tragik, scheinbar Alltägliches und Schicksalhaftes oszilliert in ihren Geschichten in immer neuer Intensität. Wie alle Geschichten der Autorin haben auch die vier Erzählungen dieses Bandes eine unheimliche Unterströmung; sie spielen mit der Irritation von Zeitverschiebung und Perspektivenwechsel und locken den Leser mit Andeutung und Aussparung in das Reich dunkler Ahnungen. »Immer sind es emotionale Verstrickungen, aus dem Lot geratene Gefühle, die die kanadische Autorin auf wunderbare Weise vor ihren Lesern entwirrt.« (Manuela Reichart) In der Titelgeschichte Der Traum meiner Mutter inszeniert Alice Munro mit feinem Gespür für Spannungen den erbitterten Machtkampf zwischen Säugling und Mutter, der um ein Haar in eine häusliche Katastrophe führt.
»Literarische Wunder« hat die New York Times Munros Erzählungen genannt – Geschichten, so komplex wie Romane, Kammerspiele des Gefühls, Geschichten, die wie Idyllen beginnen und sich auf den Abgrund zubewegen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alice Munro, geboren 1931 in Wingham, Ontario, ist eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie erhielt 2013 die höchste Auszeichnung für Literatur – den Nobelpreis. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde zuvor bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Giller Prize, dem Book Critics Circle Award sowie dem Man Booker International Prize. Alice Munro lebt in Ontario, Kanada.
Im Fischer Taschenbuch Verlag liegen vor: ›Himmel und Hölle‹ (Bd. 15707), ›Die Liebe einer Frau‹ (Bd. 15708), ›Der Traum meiner Mutter‹ (Bd. 16163), ›Tricks‹ (Bd. 16818), ›Wozu wollen Sie das wissen?‹ (Bd. 16969), ›Zu viel Glück‹ (Bd. 18686), ›Tanz der seligen Geister‹ (Bd. 18875).
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: +malsy, Bremen
Coverabbildung: Syko / Photonica
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die hier vorliegenden Erzählungen erschienen im Original 1998 zusammen mit vier weiteren Erzählungen der Autorin (›Die Liebe einer Frau‹, ›Jakarta‹, ›Cortes Island‹, ›Einzig der Schnitter‹) in dem Band ›The Love of a Good Woman‹ bei Alfred A. Knopf, New York. Eine deutsche Übersetzung der zuletzt genannten Erzählung hat der Fischer Taschenbuch Verlag unter dem Titel ›Die Liebe einer Frau‹ bereits veröffentlicht.
© Alice Munro, 1998
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2002
Alle Rechte vorbehalten
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402686-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Der Traum meiner Mutter
Die Kinder bleiben hier
Stinkreich
Vor dem Wandel
Nachwort
Für Ann Close, meine Lektorin und Freundin
Der Traum meiner Mutter
In der Nacht – oder in der Zeit, in der sie geschlafen hatte – war eine dicke Schicht Schnee gefallen.
Meine Mutter stand an einem großen Bogenfenster, wie man es in einem Herrenhaus oder einem altmodischen öffentlichen Gebäude findet, und sah hinaus. Sie blickte auf Wiesen und Sträucher, auf Hecken, Blumengärten und Bäume, alle mit Schnee bedeckt, der in Polstern und Kissen lag, nicht vom Wind verweht oder geebnet. Sein Weiß tat den Augen nicht weh, wie im Sonnenlicht. Es war das Weiß von Schnee unter einem klaren Himmel kurz vor Tagesanbruch. Alles war still, so still wie in der Heiligen Nacht.
Doch etwas stimmte nicht. Die Szene hatte einen Fehler. Alle Bäume, alle Sträucher und Stauden standen in vollem Sommerlaub. Das Gras unter ihnen, an vor dem Schnee geschützten Stellen, war frisch und grün. Schnee hatte sich über Nacht auf die Fülle des Sommers gesenkt. Ein Wechsel der Jahreszeit, unerklärlich, unerwartet. Auch waren alle fortgegangen – obwohl unklar blieb, wer »alle« waren, und meine Mutter war ganz allein in dem hohen, geräumigen Haus inmitten seiner Garten- und Parkanlagen.
Sie dachte, was auch geschehen war, man würde es ihr sicher bald mitteilen. Doch niemand kam. Das Telefon klingelte nicht; die Gartenpforte wurde nicht geöffnet. Sie konnte keinen Verkehrslärm hören, sie wusste nicht einmal, in welcher Richtung die Straße lag – oder der Weg, falls sie draußen auf dem Lande war. Sie musste aus dem Haus hinaus, in dem die Luft schwer und stickig war.
Als sie herauskam, fiel es ihr wieder ein. Sie erinnerte sich, dass sie das Baby irgendwo draußen gelassen hatte, bevor der Schnee gefallen war. Lange, bevor der Schnee gefallen war. Diese Erinnerung, diese Gewissheit überkam sie mit Entsetzen. Es war, als erwachte sie aus einem Traum. Innerhalb ihres Traums erwachte sie aus einem Traum, zu einem Wissen von ihrer Verantwortung und ihrem Fehler. Sie hatte ihr Baby über Nacht draußen gelassen, sie hatte es vergessen. Es irgendwo liegen lassen, wie eine Puppe, die ihr langweilig geworden war. Und vielleicht hatte sie das nicht am vorigen Abend, sondern vor einer Woche oder vor einem Monat getan. Eine ganze Jahreszeit oder mehrere Jahreszeiten lang hatte sie ihr Baby draußen gelassen. Sie war mit anderem beschäftigt gewesen. Es konnte sogar sein, dass sie von hier weggefahren und gerade erst zurückgekommen war, ohne zu wissen, zu was sie zurückkehrte.
Sie ging umher und suchte unter Hecken und breitblättrigen Stauden. Sie hatte vor Augen, wie stark das Baby eingeschrumpft sein musste. Tot, braun und verschrumpelt, sein Kopf wie eine Nuss, auf seinem winzigen, verschlossenen Gesicht ein Ausdruck nicht der Qual, sondern von schmerzlichem Verlust, von lange und geduldig ertragenem Leid. Keinerlei Anklage gegen sie, seine Mutter – nur diese Miene der Geduld und der Hilflosigkeit, mit der es auf seine Rettung oder sein Schicksal gewartet hatte.
Kummer ergriff meine Mutter, Mitgefühl mit dem Baby, wie es gewartet und nicht gewusst hatte, dass es auf sie wartete, seine einzige Hoffnung, während sie es völlig vergessen hatte. Ein Baby, noch so klein, dass es dem Schnee hilflos ausgeliefert war. Vor Kummer konnte sie kaum atmen. In ihr würde nie wieder Raum für irgendetwas anderes sein. Nur noch Raum für die Erkenntnis, was sie getan hatte.
Welch eine Erlösung für sie, ihr Baby in seiner Wiege zu finden. Auf dem Bauch liegend, den Kopf zur Seite gewandt, seine Haut hell und zart wie Schneeglöckchen, der Flaum auf seinem Kopf rötlich wie die Morgendämmerung. Rotes Haar wie ihr eigenes, also unverkennbar ihr Baby, und gesund und munter. Die Freude, Vergebung zu finden.
Der Schnee und die belaubten Gärten und das fremde Haus waren verschwunden. Das einzig Weiße war die Decke in der Wiege. Eine Babydecke aus dünner, weißer Wolle, vom nackten Rücken des Babys heruntergerutscht. In der Hitze, der wirklichen Sommerhitze, hatte das Baby nur eine Windel und darüber ein Plastikhöschen an, damit das Laken trocken blieb. Das Plastikhöschen war mit Schmetterlingen gemustert.
Meine Mutter, die zweifellos noch an den Schnee dachte und an die Kälte, die den Schnee für gewöhnlich begleitet, zog die Decke hoch über den bloßen Rücken, die Schultern, den mit rotem Flaum bedeckten Hinterkopf.
Es ist früher Morgen, als dies in der wirklichen Welt geschieht. Der Welt im Juli 1945. Zu einer Tageszeit, zu der es sonst an jedem anderen Morgen seine erste Mahlzeit fordert, schläft das Baby weiter. Meine Mutter ist zwar auf den Beinen und hat die Augen offen, ist aber viel zu schlaftrunken, um sich darüber zu wundern. Baby und Mutter sind erschöpft von einem langen Zweikampf, und die Mutter hat sogar das für den Augenblick vergessen. Einige Schaltkreise sind lahm gelegt; undurchdringliche Stille hat sich auf ihr Hirn und das ihres Babys gesenkt. Die Mutter – meine Mutter – merkt nichts von dem Tageslicht, das immer heller wird. Sie begreift nicht, dass die Sonne aufgeht, während sie dort steht. Keinerlei Erinnerungen an den Tag zuvor oder an das, was um Mitternacht geschah, rüttelten sie wach. Sie zieht die Decke über den Kopf ihres Babys, über sein sanftes, zufrieden schlafendes Profil. Sie tappt in ihr Zimmer zurück und fällt aufs Bett und ist sofort wieder bewusstlos.
Das Haus, in dem dies geschieht, ist völlig anders als das Haus im Traum. Ein anderthalbgeschossiges weißes Holzhaus, beengt, aber solide, mit einer Veranda, die fast bis an den Bürgersteig reicht, und einem Erkerfenster im Wohnzimmer, das auf ein von Hecken umgebenes Gärtchen blickt. Es steht in einer Seitenstraße einer Kleinstadt, die sich – für einen Ortsfremden – in nichts von vielen anderen Kleinstädten unterscheidet, denen man im Abstand von fünfzehn bis fünfundzwanzig Kilometern im einst dicht bevölkerten Ackerland am Lake Huron begegnet. Mein Vater und seine Schwestern wuchsen in diesem Haus auf, und die Schwestern mit Mutter lebten immer noch dort, als meine Mutter zu ihnen zog – und ich ebenfalls, groß und lebhaft in ihrem Bauch, nachdem mein Vater in den letzten Kriegswochen in Europa gefallen war.
Meine Mutter – Jill – steht am hellen, späten Nachmittag neben dem Wohnzimmertisch. Das Haus ist voller Leute, die hierher eingeladen worden sind, nach dem Trauergottesdienst in der Kirche. Sie trinken Tee und Kaffee und bringen es fertig, die Schnittchen in der Hand zu halten, die Scheiben Bananenbrot, Nuss- und Früchtekuchen. Die Eiercreme- und Rosinentörtchen mit ihrem krümeligen Teig sollen mit einer Kuchengabel von einem der Porzellantellerchen gegessen werden, die Jills Schwiegermutter in ihrer Brautzeit mit Veilchen bemalt hat. Jill nimmt sich alles mit den Fingern. Kuchenkrümel, auch eine Rosine sind auf ihr Kleid gefallen und an dessen grünem Samt kleben geblieben. Das Kleid ist für den Tag viel zu warm, und es ist gar kein Umstandskleid, sondern ein weites, wallendes Gewand, das für ihre Konzerte angefertigt worden ist, wenn sie öffentlich auftritt und Geige spielt. Der Saum ist vorn ein ganzes Stück kürzer, durch mich. Aber sie besitzt sonst nichts, was groß genug und gut genug ist, um beim Trauergottesdienst für ihren Mann getragen zu werden.
Was isst sie denn so viel? Es fällt den Leuten auf. »Isst für zwei«, sagt Ailsa zu einer Gruppe ihrer Gäste, damit die sie nicht mit Bemerkungen über ihre Schwägerin übertrumpfen können.
Jill ist den ganzen Tag lang übel gewesen, bis sie in der Kirche, als ihr durch den Kopf ging, wie schlecht die Orgel war, auf einmal merkte, dass sie urplötzlich einen Bärenhunger hatte. Während des gesamten Chorals »O tapfere Herzen« dachte sie an einen fetten Hamburger, der von Fleischsaft und geschmolzener Mayonnaise troff, und jetzt versucht sie herauszufinden, welches Gemengsel aus Walnüssen, Rosinen und braunem Zucker, welche zahnwehsüße Kokosglasur oder welcher besänftigende Mund voll Bananenbrot oder Eiercreme als Ersatz dienen kann. Natürlich alles nicht, aber sie versucht es weiter. Als ihr echter Hunger gestillt ist, quält sie weiterhin ihr eingebildeter Hunger und stärker noch eine an Panik grenzende Gereiztheit, die sie zwingt, sich den Mund voll zu stopfen, obwohl sie kaum noch etwas schmeckt. Sie ist außerstande, diese Gereiztheit zu beschreiben, kann höchstens sagen, dass sie etwas mit Pelzigkeit und Eingeengtheit zu tun hat. Die Berberitzenhecke draußen vor dem Fenster, dicht und stachelig im Sonnenlicht, das Samtkleid, das an ihren feuchten Achselhöhlen klebt, die wie zu Sträußchen aufgesteckten Löckchen – von derselben Farbe wie die Rosinen in den Törtchen – auf dem Kopf ihrer Schwägerin Ailsa, sogar die aufgemalten Veilchen, die wie Schorf aussehen, den man von den Tellern abkratzen kann, alle diese Dinge kommen ihr besonders abscheulich und bedrückend vor, obwohl sie weiß, dass sie völlig alltäglich sind. Sie scheinen eine Botschaft über ihr neues und unerwartetes Leben zu enthalten.
Warum unerwartet? Sie weiß seit einiger Zeit von mir, und sie hat auch gewusst, dass George Kirkham fallen konnte. Schließlich war er bei der Luftwaffe. (Um sie herum im Haus der Kirkhams sagen die Leute an diesem Nachmittag – obwohl nicht zu ihr, der Witwe, oder zu den Schwestern –, dass er einer von den Jungen war, von denen man wusste, sie würden fallen. Sie meinen damit, dass er ein strahlender junger Mann und der Stolz seiner Familie war, einer, auf dem alle Hoffnungen ruhten.) Sie wusste das, aber sie lebte genauso weiter wie vorher, stieg an dunklen Wintermorgen mit ihrem Geigenkasten in die Straßenbahn und fuhr zum Konservatorium, wo sie stundenlang übte, in Hörweite anderer, aber allein in einem kargen Raum, nur begleitet vom Gluckern der Heizkörper, die Haut ihrer Hände anfangs rotfleckig vor Kälte, dann spröde von der trockenen Zentralheizungsluft. Sie wohnte weiter in einem möblierten Zimmer mit schlecht schließendem Fenster, das im Sommer Fliegen hereinließ und im Winter eine dünne Schneeschicht auf dem Fensterbrett, und träumte – wenn sie sich nicht gerade übergeben musste – weiter von Würstchen und Fleischpasteten und großen, dunklen Schokoladenstücken. Am Konservatorium behandelten alle ihre Schwangerschaft taktvoll, als handelte es sich um einen Tumor. Sie war ohnehin lange Zeit nicht zu sehen, wie häufig erste Schwangerschaften bei großen Frauen mit breitem Becken. Sogar, als ich in ihrem Bauch schon Purzelbäume schlug, trat sie noch öffentlich auf. Majestätisch gerundet, das lange rote Haar wie einen Busch um die Schultern, auf dem erhitzten Gesicht ein Ausdruck strenger Konzentration, so gab sie ihr bis dahin wichtigstes Konzert. Das Violinkonzert von Mendelssohn.
Was in der Welt geschah, ging nicht völlig an ihr vorbei – sie wusste, dass der Krieg zu Ende ging. Sie dachte, dass George bald nach meiner Geburt zurück sein würde. Sie wusste, dass sie dann nicht weiter in ihrem möblierten Zimmer bleiben konnte – sie würde irgendwo mit ihm zusammen wohnen müssen. Und sie wusste, dass ich da sein würde, aber in ihrer Vorstellung beendete meine Geburt eher etwas, als dass damit etwas Neues anfing. Sie würde die Tritte beenden, mit denen ich die ständig wunde Stelle auf einer Seite ihres Bauchs malträtierte, die Schmerzen in den Genitalien, wenn sie aufstand und das Blut hereinströmte (als würde ihr dort ein kochend heißer Breiumschlag aufgelegt). Ihre Brustwarzen würden nicht mehr groß und dunkel und knotig sein, und sie würde ihre Beine mit den geschwollenen Venen nicht mehr jeden Morgen vor dem Aufstehen bandagieren müssen. Sie würde nicht mehr alle halbe Stunde Wasser lassen müssen, und ihre Füße würden wieder in die normalen Schuhe passen.
Nachdem sie wusste, dass George nicht zurückkommen würde, dachte sie daran, mit mir noch eine Weile in dem möblierten Zimmer zu bleiben. Sie besorgte sich ein Buch über Säuglinge. Sie kaufte, was ich unbedingt brauchen würde. Im Haus wohnte eine alte Frau, die nach mir schauen konnte, während sie übte. Sie würde eine Kriegerwitwenrente erhalten und in sechs Monaten die Abschlussprüfung am Konservatorium ablegen.
Dann kam Ailsa mit der Eisenbahn und holte sie. Ailsa sagte: »Wir können dich doch nicht so ganz allein hier hocken lassen. Alle fragen schon, warum du nicht zu uns gezogen bist, als George nach Übersee ging. Jetzt wird es Zeit, dass du kommst.«
»Meine Familie hat einen Haschmich«, hatte George zu Jill gesagt. »Iona ist ein Nervenbündel, und Ailsa hätte Feldwebel werden sollen. Und meine Mutter ist senil.«
Er sagte auch: »Ailsa hat den Grips abbekommen, aber sie musste von der Schule runter und bei der Post anfangen, als mein Vater starb. Ich hab die Schönheit abbekommen, und für die arme Iona ist nichts übrig geblieben als die schlechte Haut und die schlechten Nerven.«
Jill begegnete seinen Schwestern zum ersten Mal, als sie nach Toronto kamen, um George zu verabschieden. Sie waren nicht zur Hochzeit erschienen, die zwei Wochen zuvor stattgefunden hatte. Niemand war da, nur George und Jill und der Geistliche und die Frau des Geistlichen und eine Nachbarin, die als zweite Trauzeugin hinzugeholt wurde. Ich war ebenfalls da, in Jills Bauch, aber ich war nicht der Grund für die Heirat, und zu dem Zeitpunkt wusste niemand von meiner Existenz. Hinterher bestand George auf Hochzeitsfotos, also ließen beide sich mit steinernen Gesichtern in einer dieser Fotomaton-Kabinen ablichten. Sein Überschwang kannte kein Erbarmen. »Das wird’s ihnen zeigen«, sagte er, als er die Fotos betrachtete. Jill fragte sich, wem er es zeigen wollte. Ailsa? Oder den hübschen Mädchen, den verliebten Backfischen, die ihm nachgelaufen waren, ihm sentimentale Briefe geschrieben und Socken mit Rautenmuster gestrickt hatten? Er trug die Socken, er steckte die Geschenke ein, und er las die Briefe in der Kneipe vor, zum allgemeinen Gaudi.
Jill hatte vor der Hochzeit nicht gefrühstückt und dachte die ganze Zeit an Pfannkuchen und gebratenen Schinkenspeck.
Die beiden Schwestern sahen normaler aus, als sie erwartet hatte. Obwohl es stimmte, dass George die Schönheit abbekommen hatte. Seidig gewelltes dunkelblondes Haar, lustig blitzende Augen und beneidenswert klare Gesichtszüge. Sein einziger Nachteil: Er war nicht sehr groß. Gerade groß genug, um Jill in die Augen zu schauen. Und um Luftwaffenpilot zu werden.
»Schlakse kommen als Piloten nicht infrage«, sagte er. »Da habe ich sie ausgestochen. Die langen Lulatsche. Viele Filmschauspieler sind klein. Für die Küsserei stehen die auf Kisten.«
(Im Kino konnte George laut werden. Er buhte bei der Küsserei. Er hielt auch im wirklichen Leben nicht viel davon. Lass uns loslegen, sagte er.)
Die Schwestern waren ebenfalls klein. Sie hießen nach Orten in Schottland, die ihre Eltern auf der Hochzeitsreise besucht hatten, bevor die Familie ihr Vermögen verlor. Ailsa war zwölf Jahre älter als George, und Iona war neun Jahre älter. In der Menschenmenge an der Union Station wirkten sie plump und unbeholfen. Beide trugen neue Hüte und Kostüme, als wären sie es, die gerade geheiratet hatten. Und beide waren wie aufgescheuchte Hühner, weil Iona ihre guten Handschuhe im Zug vergessen hatte. Es stimmte, dass Iona schlechte Haut hatte, obwohl gerade keine Pickel blühten und ihre Aknezeiten vielleicht vorüber waren. Ihre Haut war schrundig von alten Narben und grau unter dem rosa Puder. Ihr Haar rutschte in schlaffen Ranken unter ihrem Hut hervor, und in ihren Augen standen Tränen, entweder, weil Ailsa mit ihr geschimpft hatte, oder weil ihr Bruder in den Krieg zog. Ailsas Haar war zu Bündeln von festen, dauergewellten Locken geordnet, auf denen ihr Hut saß. Sie hatte gescheite, blasse Augen hinter glitzernd gerahmten Brillengläsern, runde, rosa Wangen und ein Grübchenkinn. Beide Schwestern hatten eine schmucke Figur – hoher Busen und schlanke Taille und ausladende Hüften, aber an Iona sah diese Figur wie etwas aus, an das sie aus Versehen geraten war und das sie mit krummen Schultern und verschränkten Armen zu verbergen trachtete. Ailsa ging mit ihren Kurven selbstbewusst, aber nicht provokant um, als wäre sie aus solider Keramik gemacht. Und beide hatten die dunkelblonde Haarfarbe von George, aber ohne seinen Glanz. Und seinen Sinn für Humor schienen sie auch nicht zu teilen.
»Also ich muss dann los«, sagte George. »Um als Held auf den Schlachtfeldern von Passchendaele zu fallen.« Und Iona sagte: »Sag so was nicht. Rede nicht so.« Ailsa kniff ihren Himbeermund zusammen.
»Ich kann von hier aus das Fundsachen-Schild sehen«, sagte sie. »Aber ich weiß nicht, ob das nur für Dinge ist, die man auf dem Bahnhof verloren hat, oder auch für Dinge, die in den Zügen gefunden wurden. Passchendaele war im Ersten Weltkrieg.«
»Ist wahr? Bist du sicher? Ich komme zu spät?«, sagte George und schlug sich mit der Hand an die Brust.
Und wenige Monate später verbrannte er auf einem Übungsflug über der Irischen See.
Ailsa lächelt die ganze Zeit. Sie sagt: »Natürlich bin ich stolz. Das bin ich. Aber ich bin nicht die Einzige, die jemanden verloren hat. Er hat getan, was er tun musste.« Manche finden ihre Munterkeit ein wenig schockierend. Aber andere sagen: »Die arme Ailsa.« All diese Konzentration auf George und die Sparsamkeit, damit er einmal Jura studieren konnte, und dann schlug er das alles aus – meldete sich als Freiwilliger; ging auf und davon und in seinen Tod. Er konnte nicht warten.
Seine Schwestern opferten ihre eigene Ausbildung. Sie ließen sich nicht einmal die Zähne richten – sie opferten auch das. Iona besuchte zwar eine Schwesternschule, aber wie sich herausstellte, hätte es ihr mehr genutzt, sich die Zähne richten zu lassen. Jetzt stehen Iona und Ailsa mit einem Helden da. Jeder gibt das zu – ein Held. Die jüngeren Leute, die da sind, denken, es ist schon etwas, einen Helden in der Familie zu haben. Sie denken, die Bedeutung dieses Augenblicks wird von Dauer sein, er wird Ailsa und Iona für immer bleiben. »O tapfere Herzen« wird für immer um sie erschallen. Ältere Leute, die sich an den vorigen Krieg erinnern, wissen, dass die Schwestern mit nichts dastehen als mit einem Namen auf dem Ehrenmal. Denn die Witwe, die junge Frau, die sich den Bauch vollschlägt, wird die Rente bekommen.
Ailsa ist in hektischer Stimmung, denn sie ist zwei Nächte hintereinander aufgeblieben und hat sauber gemacht. Nicht, dass das Haus vorher nicht ordentlich und sauber gewesen wäre. Trotzdem spürte sie den Drang, sämtliches Geschirr, alle Töpfe und allen Zierrat abzuwaschen, das Glas vor jedem Bild zu putzen, den Kühlschrank vorzurücken und dahinter aufzuwischen, die Kellertreppe zu schrubben und Chlorkalk in die Mülltonne zu schütten. Sogar die Lampe über dem Esszimmertisch musste auseinandergenommen werden, alle Teile wurden in Seifenwasser getaucht, abgespült, abgetrocknet und wieder zusammengesetzt. Und wegen ihrer Arbeit beim Postamt konnte Ailsa damit erst nach dem Abendessen anfangen. Sie ist jetzt die Vorsteherin des Postamts, sie hätte ohne weiteres einen Tag frei nehmen können, aber so etwas würde Ailsa nie tun.
Jetzt ist ihr heiß unter ihrem Rouge, es juckt sie unter ihrem dunkelblauen Kreppkleid mit dem Spitzenkragen. Sie kann nicht stillsitzen. Sie füllt die Servierplatten wieder auf und reicht sie herum, bedauert, dass der Tee lauwarm geworden ist, eilt, um frischen aufzubrühen. Besorgt um das Wohlbefinden ihrer Gäste, erkundigt sie sich nach deren Rheumatismus oder deren sonstigen Beschwerden, lächelt im Angesicht ihrer Tragödie, wiederholt ein ums andere Mal, dass ihr Verlust kein Einzelfall ist, dass sie sich nicht beklagen darf, wenn so viele andere im selben Boot sitzen, dass George nicht wollen würde, dass seine Freunde trauern, sondern sie sollten dankbar sein, dass alle zusammen den Krieg beendet hätten. Alles mit der hohen, nachdrücklichen Stimme freundlicher Ermahnung, die die Leute vom Postamt her kennen. Sodass sie das unangenehme Gefühl bekommen, etwas Falsches gesagt zu haben, genau wie ihnen auf dem Postamt zu verstehen gegeben werden soll, dass ihre Handschrift eine Zumutung ist oder ihre Pakete schlampig verschnürt sind.
Ailsa ist sich bewusst, dass ihre Stimme zu hoch ist und dass sie zu viel lächelt und dass sie Leuten Tee eingeschenkt hat, die keinen mehr wollten. In der Küche sagt sie, während sie die Teekanne vorwärmt: »Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin völlig überdreht.«
Sie sagt das zu Dr. Shantz, ihrem Nachbar auf der Rückseite des Hauses.
»Bald ist es vorbei«, sagt er. »Möchten Sie ein Schlafmittel?«
Seine Stimme verändert sich, sobald die Tür vom Esszimmer aufgeht. Das Wort »Schlafmittel« kommt ihm streng ärztlich über die Lippen.
Ailsas Stimme verändert sich auch, aus der Verlorenheit wird Tapferkeit. Sie sagt: »Oh, nein, vielen Dank. Ich werde schon allein zurechtkommen.«
Ionas Aufgabe ist es, auf die Mutter aufzupassen, darauf zu achten, dass sie ihren Tee nicht verschüttet – was ihr nicht aus Ungeschicklichkeit, sondern aus Vergesslichkeit passieren kann – und dass sie weggebracht wird, sobald sie zu jammern und zu weinen anfängt. Aber Mrs. Kirkham benimmt sich die meiste Zeit über tadellos, und es gelingt ihr weit besser als Ailsa, den Gästen die Befangenheit zu nehmen. Für die Dauer einer Viertelstunde versteht sie die Situation – oder erweckt zumindest den Anschein –, redet tapfer und vernünftig davon, dass sie ihren Sohn immer vermissen wird, aber dankbar dafür ist, noch zwei Töchter zu haben: Ailsa, so tüchtig und zuverlässig, ein wahres Wunder von Anfang an, und Iona, die Liebe selbst. Sie vergisst nicht einmal, von ihrer neuen Schwiegertochter zu sprechen, lässt sich aber ein wenig anmerken, dass nicht mehr alles stimmt, als sie ausspricht, was die meisten Frauen ihres Alters in Gesellschaft, zumal wenn Männer zuhören, nicht aussprechen würden. Mit Blick auf Jill und mich sagt sie: »Und uns allen steht ein Trost ins Haus.«
Dann, auf dem Weg von Zimmer zu Zimmer, von Gast zu Gast, vergisst sie alles, sie schaut sich in ihrem eigenen Haus um und sagt: »Warum sind wir hier? So viele Leute – was feiern wir?« Und da sie mitbekommt, dass alles etwas mit George zu tun hat, fragt sie: »Ist es Georges Hochzeit?« Zusammen mit dem aktuellen Wissen hat sie etwas von ihrem Taktgefühl verloren. »Es ist doch nicht etwa deine Hochzeit?«, sagt sie zu Iona. »Nein. Konnte ich mir auch nicht denken. Du hattest ja nie einen Freund, wie?« Ein Unterton von »Man muss den Tatsachen ins Auge blicken«, von »Den Letzten beißen die Hunde« hat sich in ihre Stimme geschlichen. Als sie Jill entdeckt, lacht sie.
»Das ist doch nicht etwa die Braut? Oh, oh. Jetzt verstehen wir.«
Aber die Wahrheit kommt ihr so plötzlich wieder, wie sie verschwand.
»Gibt es etwas Neues?«, fragt sie. »Etwas Neues von George?« Und dann fängt das Weinen an, vor dem Ailsa Angst hatte.
»Schaff sie fort, wenn sie anfängt, sich daneben zu benehmen«, hat Ailsa gesagt.
Iona ist nicht fähig, ihre Mutter fortzuschaffen – sie ist in ihrem ganzen Leben noch nie fähig gewesen, sich gegenüber einem anderen Menschen durchzusetzen –, aber die Frau von Dr. Shantz nimmt die alte Dame beim Arm.
»George ist tot?«, fragt Mrs. Kirkham furchtsam, und Mrs. Shantz sagt: »Ja. Aber wissen Sie, seine Frau bekommt ein Kind.«
Mrs. Kirkham lehnt sich bei ihr an; sie sinkt in sich zusammen und sagt leise: »Kann ich meinen Tee bekommen?«
Wohin meine Mutter sich in diesem Haus auch wendet, überall sieht sie ein Foto von meinem Vater. Das letzte und offizielle von ihm in seiner Uniform steht auf einem bestickten Zierdeckchen auf der geschlossenen Nähmaschine im Erker des Esszimmerfensters. Iona legte Blumen darum, aber Ailsa nahm sie weg. Sie sagte, damit sah er zu sehr aus wie ein katholischer Heiliger. Im Treppenhaus hängt eins von ihm mit sechs Jahren, er spielt draußen auf dem Bürgersteig mit seinem Bollerwagen, und in dem Zimmer, in dem Jill schläft, ist eins von ihm, da steht er neben seinem Fahrrad mit seinem Free-Press-Zeitungsbeutel. Mrs. Kirkhams Zimmer hat das Foto von ihm, auf dem er für die Operettenaufführung der achten Klasse kostümiert ist, mit einer goldenen Pappkrone auf dem Kopf. Da er unmusikalisch war, kam er für eine Hauptrolle nicht infrage, aber natürlich erhielt er die beste Nebenrolle, die des Königs.
Das handkolorierte Studiofoto über dem Büfett zeigt ihn im Alter von drei Jahren, ein unscharfer blonder Knirps, der eine Stoffpuppe an einem Bein hinter sich herzieht. Ailsa dachte daran, es herunterzunehmen, weil es auf die Tränendrüsen drücken könnte, aber dann ließ sie es hängen, damit kein heller Fleck auf der Tapete zu sehen war. Und niemand sagte etwas zu dem Bild, nur Mrs. Shantz blieb stehen und sagte, was sie schon einmal gesagt hatte, und auch nicht mit Tränen in der Stimme, sondern mit leicht amüsierter Bewunderung.
»Ah – Christopher Robin.«
Die Leute waren es gewohnt, dem, was Mrs. Shantz sagte, nicht viel Beachtung zu schenken.
Auf allen seinen Fotos strahlt George wie ein Goldstück. Ihm hängt immer eine sonnige Locke in die Stirn, außer wenn er seine Offiziersmütze oder seine Krone trägt. Und schon, als er fast noch ein Säugling war, sah er aus, als wüsste er, was für ein übermütiger, gerissener, charmanter Bursche er war. Einer von der Sorte, der andere nie in Ruhe ließ, der sie zu Gelächter aufpeitschte. Gelegentlich auf eigene Kosten, doch meistens auf Kosten anderer. Wenn Jill ihn ansieht, erinnert sie sich daran, wie er trank, aber nie betrunken zu werden schien, und wie er es darauf anlegte, Betrunkenen Geständnisse zu entlocken, über ihre Ängste, ihre Schwindeleien, ihre Jungfräulichkeit oder ihre Untreue, aus denen er dann Witze oder demütigende Spitznamen machte, die seine Opfer mit gespieltem Lachen hinnahmen. Denn er hatte zahlreiche Anhänger und Freunde, die sich ihm vielleicht aus Angst anschlossen – oder vielleicht auch nur, weil er, wie immer von ihm behauptet wurde, für Stimmung sorgte. Wo er auch war, stand er im Mittelpunkt, und die Luft um ihn knisterte vor Wagnis und Ausgelassenheit.
Was sollte Jill mit solch einem Liebhaber anfangen? Sie war neunzehn, als sie ihn kennenlernte, und noch niemand hatte sie haben wollen. Sie verstand nicht, was ihn anzog, und sie merkte, dass auch alle anderen es nicht verstanden. Sie war den meisten ihres Alters ein Rätsel, aber ein langweiliges Rätsel. Ein Mädchen, das ihr ganzes Leben dem Studium der Geige weihte und keine anderen Interessen hatte.
Das stimmte nicht ganz. Sie kuschelte sich schon einmal unter ihre schäbige Steppdecke und malte sich einen Liebhaber aus. Aber niemals einen strahlenden Angeber wie George. Sie dachte an einen warmen, bärigen Burschen oder an einen Musiker, zehn Jahre älter als sie und schon berühmt, mit feuriger Potenz. Ihre Vorstellungen von Liebe waren opernhaft, obwohl das nicht die Musik war, die sie am meisten bewunderte. George hingegen machte Witze im Bett; er stolzierte im Zimmer umher, wenn er fertig war; er machte unanständige und kindische Geräusche. Sein forsches Vorgehen brachte ihr wenig von dem Genuss, den sie von Selbstversuchen kannte, aber sie war auch nicht völlig enttäuscht.
Eher benommen von der rasenden Geschwindigkeit. Und voller Erwartung, glücklich zu sein – dankbar und glücklich, wenn ihr Kopf sich erst einmal an die körperliche und gesellschaftliche Wirklichkeit gewöhnt hatte. Das Zusammensein mit George und ihre Heirat – es war wie ein glitzernder Anbau in ihrem Leben. Hell erleuchtete Räume voll verwirrender Pracht. Dann kam die Bombe oder der Wirbelsturm, der nicht unwahrscheinliche Schicksalsschlag, und der ganze Anbau war fort. In die Luft geflogen und verschwunden, und sie stand mit denselben Räumen und Möglichkeiten da wie zuvor. Sie hatte etwas verloren, gewiss. Aber nichts, was sie sich wirklich zu eigen gemacht hatte oder was für sie mehr war als ein hypothetischer Entwurf ihrer Zukunft.
Jetzt hat sie genug gegessen. Ihre Beine tun weh vom langen Stehen. Mrs. Shantz ist bei ihr und sagt: »Hatten Sie Gelegenheit, Georges Freunde hier kennenzulernen?«
Sie meint die jungen Leute, die in der Diele für sich bleiben. Zwei nett aussehende Mädchen, ein junger Mann immer noch in Marine-Uniform und andere. Jill betrachtet sie und denkt, dass niemand wirklich traurig ist. Ailsa vielleicht, aber Ailsa hat ihre eigenen Gründe. Niemand ist wirklich traurig darüber, dass George tot ist. Nicht einmal das Mädchen, das in der Kirche geweint hat und so aussieht, als ob es noch weitere Tränen vergießen wird. Diese junge Frau wird sich daran erinnern können, dass sie in George verliebt war, und glauben, dass er – trotz allem – auch in sie verliebt war, und niemals Angst haben, er könnte etwas sagen oder tun, was das Gegenteil beweist. Und keiner von ihnen wird, wenn eine um George gescharte Gruppe losprustet, sich fragen müssen, wen sie auslachen oder was George ihnen erzählt. Niemand wird sich mehr anstrengen müssen, um mit ihm Schritt zu halten, oder sich den Kopf zerbrechen müssen, wie er sich seine Gunst erhalten kann.
Ihr kommt nicht in den Sinn, dass George, wenn er überlebt hätte, vielleicht ein anderer Mensch geworden wäre, denn sie denkt nicht daran, selbst ein anderer Mensch zu werden.
Sie sagt: »Nein«, so lustlos, dass Mrs. Shantz darauf erwidert: »Ich weiß. Es ist schwer, neue Leute kennenzulernen. Besonders – ich an Ihrer Stelle würde lieber gehen und mich hinlegen.«