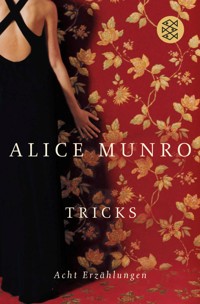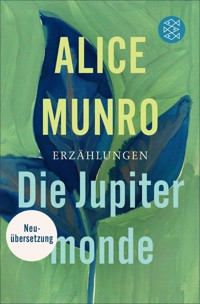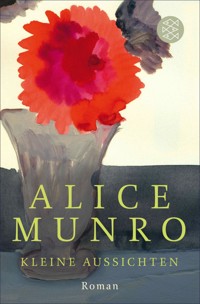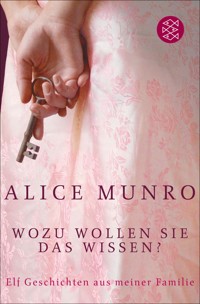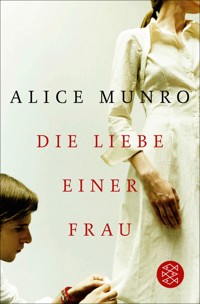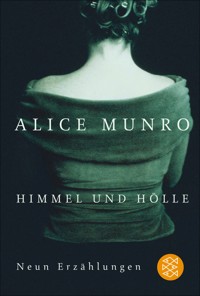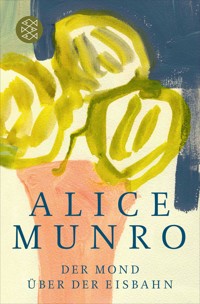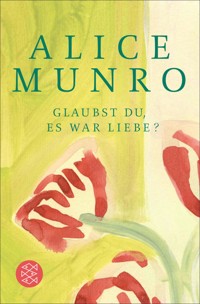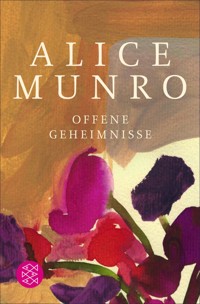
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nobelpreis für Literatur 2013 Endlich wieder lieferbar! In einer der Geschichten aus ›Offene Geheimnisse‹ lernt Dorrie den Australier Wilkie kennen. Sie schreiben sich Briefe, und dann zieht Dorrie nach Australien, wo sie keine kanadischen Walnüsse mehr sammelt, sondern Krokodile jagt und Ananas pflanzt. Ein Band mit Geschichten über das Ausbrechen und Ankommen, wie sie nur die große Nobelpreisträgerin Alice Munro schreiben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alice Munro
Offene Geheimnisse
Über dieses Buch
Nobelpreis für Literatur 2013
In einer der Geschichten aus ›Offene Geheimnisse‹ lernt Dorrie in der kanadischen Provinz den Australier Wilkie kennen. Sie schreiben sich Briefe, und dann zieht Dorrie nach Australien, wo sie keine kanadischen Walnüsse mehr sammelt, sondern Krokodile jagt und Ananas pflanzt. Ein Band mit Geschichten über das Ausbrechen und Ankommen, wie sie nur die große Nobelpreisträgerin Alice Munro schreiben kann. » Lebensklug, nuanciert, virtuos«, befand die ›New York Times‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alice Munro, geboren 1931 in Wingham, Ontario, ist eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie erhielt 2013 die höchste Auszeichnung für Literatur – den Nobelpreis. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde zuvor bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Giller Prize, dem Book Critics Circle Award sowie dem Man Booker International Prize. Alice Munro lebt in Ontario, Kanada.
Im Fischer Taschenbuch Verlag liegen vor: ›Himmel und Hölle‹ (Bd. 15707), ›Die Liebe einer Frau‹ (Bd. 15708), ›Der Traum meiner Mutter‹ (Bd. 16163), ›Tricks‹ (Bd. 16818), ›Wozu wollen Sie das wissen?‹ (Bd. 16969), ›Zu viel Glück‹ (Bd. 18686), ›Tanz der seligen Geister‹ (Bd. 18875), ›Was ich dir schon immer sagen wollte‹ (18876) und ›Glaubst du, es war Liebe?‹ (03097)
Bei S. Fischer erschien zuletzt der Band ›Liebes Leben‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Leanne Shapton
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel ›Open Secrets‹
bei Alfred A. Knopf, New York
© 1994 Alice Munro
Der Band wurde 1996 zum ersten Mal
im Klett-Cotta Verlag auf Deutsch veröffentlicht.
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403079-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Entrückt
Die spanische Grippe
Unfälle
Die Märtyrer von Tolpuddle
Ein echtes Leben
Die albanische Jungfrau
Offene Geheimnisse
Das Jack Randa Hotel
Ein Vorposten in der Wildnis
I
II
III
IV
Raumschiffe sind gelandet
Vandalen
I
II
III
IV
Dieses Buch ist für ewigtreue Freundinnen –
Daphne und Deirdre, Audre, Sally, Julie, Mildred,
Ann und Ginger und Mary
Entrückt
Louisa öffnete den Brief, der an diesem Tag aus Übersee eingetroffen war, im Speisesaal des Commercial Hotel. Sie aß Steak mit Kartoffeln, wie üblich, und trank ein Glas Wein. Mit im Raum saßen ein paar Handlungsreisende und der Zahnarzt, der jeden Abend dort aß, weil er Witwer war. Er hatte anfangs Interesse an ihr gezeigt, aber ihr gesagt, er habe noch nie eine Frau gesehen, die Wein oder Spirituosen anrührte.
»Ich mache es für meine Gesundheit«, sagte Louisa ernst.
Die weißen Tischtücher wurden wöchentlich gewechselt und in der Zwischenzeit mit Wachstuchsets geschont. Im Winter roch der Speisesaal nach diesen mit Küchenlappen gewischten Sets und den Kohlengasen aus dem Ofen, nach Rindersoße und angetrockneten Kartoffeln und Zwiebeln – ein Geruch, der niemandem, der hungrig aus der Kälte hereinkam, zuwider war. Auf jedem Tisch stand eine kleine Menage mit dem Fläschchen brauner Soße, dem Fläschchen Tomatensoße und dem Töpfchen Meerrettich.
Der Brief trug die Anschrift »An die Bibliothekarin, Carstairs Public Library, Carstairs, Ontario«. Er war sechs Wochen zuvor datiert – 4. Januar 1917.
Sie werden vielleicht überrascht sein, von einem Menschen zu hören, den Sie nicht kennen und der sich Ihres Namens nicht erinnert. Ich hoffe, Sie sind noch dieselbe Bibliothekarin, auch wenn es nach so langer Zeit gut möglich wäre, dass Sie fortgegangen sind.
Was mich hier ins Lazarett gebracht hat, ist nichts sehr Ernstes. Ich sehe überall um mich herum Schlimmeres und lenke mich davon ab, indem ich mir allerlei vorstelle und mich zum Beispiel frage, ob Sie noch dort in der Bücherei sind. Wenn Sie diejenige sind, die ich meine, sind Sie etwa mittelgroß oder vielleicht etwas kleiner, mit hellem bräunlichem Haar. Sie haben ein paar Monate vor meiner Einberufung die Nachfolge von Miss Tamblyn angetreten, die schon dort war, als ich mit neun oder zehn begann, in die Bücherei zu gehen. Zu ihrer Zeit standen die Bücher kunterbunt durcheinander, und es war eine echte Mutprobe, sie auch nur um die geringste Hilfe zu bitten, weil sie ein rechter Drache war. Als Sie dann kamen – was für eine Veränderung – wurde alles nach Romanen und Sachbüchern und Geschichte und Reise sortiert, und Sie ordneten die Zeitschriften der Reihenfolge nach und legten sie gleich nach ihrem Eintreffen aus, anstatt sie vermodern zu lassen, bis alles, was drinstand, veraltet war. Ich war dankbar, ohne zu wissen, wie ich es sagen sollte. Und ich fragte mich, was Sie dorthin verschlagen hatte, Sie waren eine gebildete Frau.
Ich heiße Jack Agnew, und meine Karte steckt in der Schublade. Das letzte Buch, das ich ausgeliehen habe, war sehr gut – H.G. Wells, Mankind in the Making. Ich bin bis zur zweiten Highschool-Klasse auf die Schule gegangen und habe dann wie so viele bei Douds angefangen. Ich habe mich nicht gleich gemeldet, als ich achtzehn wurde, deshalb werden Sie mich nicht für einen mutigen Mann halten. Ich bin ein Mensch, der stets zu eigenen Vorstellungen neigt. Mein einziger Angehöriger in Carstairs oder sonst irgendwo ist mein Vater Patrick Agnew. Er arbeitet bei Douds, nicht in der Fabrik, sondern als Gärtner bei ihnen zu Hause. Er ist noch mehr ein Einzelgänger als ich und geht bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bietet, raus aufs Land zum Angeln. Ich schreibe ihm von Zeit zu Zeit einen Brief, aber ich bezweifle, dass er ihn liest.
Nach dem Abendessen ging Louisa nach oben ins Damenzimmer und setzte sich an den Schreibtisch, um ihre Antwort zu verfassen.
Ich freue mich sehr zu hören, dass Sie die Ordnung zu schätzen wussten, die ich in der Bücherei hergestellt habe, auch wenn es nur die normale war und nichts Außergewöhnliches.
Bestimmt würden Sie gern Neuigkeiten aus der Heimat hören, aber für diese Aufgabe tauge ich schlecht, da ich hier im Ort eine Außenseiterin bin. Wobei ich in der Bücherei und im Hotel doch mit Leuten rede. Die Handlungsreisenden im Hotel reden vor allem darüber, wie die Geschäfte gehen (sie gehen gut, wenn man die Waren beschaffen kann), und ein wenig über ihre Zipperlein und viel über den Krieg. Es gibt Gerüchte über Gerüchte und Meinungen wie Sand am Meer, über die Sie bestimmt lachen müssten, wenn Sie sich nicht darüber ärgerten. Ich werde sie gar nicht erst niederschreiben, weil dies bestimmt von einem Zensor gelesen wird, der meinen Brief sonst in Fetzen reißen würde. Sie fragen, wie es mich hierher verschlagen hat. Das ist keine interessante Geschichte. Meine Eltern sind beide tot. Mein Vater arbeitete in Toronto bei Eaton in der Möbelabteilung, und nach seinem Tod arbeitete meine Mutter ebenfalls dort in der Wäscheabteilung, und auch ich arbeitete dort eine Zeitlang als Buchhändlerin. Vielleicht könnte man sagen, Eaton sei unser Douds gewesen. Meinen Abschluss habe ich am Jarvis Collegiate gemacht. Ich hatte eine Krankheit und lag deswegen lange in einer Klinik, aber jetzt bin ich wieder ganz gesund. Ich hatte viel Zeit zum Lesen, und meine Lieblingsschriftsteller sind Thomas Hardy, der vielen zu düster ist, den ich aber als sehr lebensnah empfinde, und Willa Cather. Ich war gerade zufällig in dieser Stadt, als ich hörte, dass die Bibliothekarin gestorben war, und dachte, vielleicht ist das der Beruf für mich.
Wie gut, dass mich Ihr Brief heute erreicht hat, denn ich soll bald aus dem Lazarett entlassen werden, und ich weiß nicht, ob man ihn mir nachgesandt hätte. Ich bin froh, dass mein Brief Ihnen nicht zu dumm war.
Wenn Sie meinen Vater oder andere treffen, brauchen Sie nichts davon zu sagen, dass wir uns schreiben. Es geht niemanden etwas an, und ich weiß, dass es jede Menge Leute gibt, die mich dafür auslachen würden, dass ich der Bibliothekarin schreibe, so wie sie bereits gelacht haben, als ich nur in die Bücherei ging. Wozu ihnen die Genugtuung geben?
Ich bin froh, dass ich hier rauskomme. So viel glücklicher dran als manche, die ich hier sehe und die nie wieder laufen können oder ihr Augenlicht wiederhaben werden und die sich vor der Welt werden verstecken müssen.
Sie fragen, wo ich in Carstairs gewohnt habe. Nun, es ist kein Haus, auf das man stolz sein könnte. Wenn Sie die Vinegar Hill Road kennen und von dort in die Flowers Road einbiegen, ist es das letzte Haus rechts, mit einem uralten gelben Anstrich. Mein Vater baut Kartoffeln an oder hat es jedenfalls früher getan. Ich habe sie früher in der Stadt auf meinem Karren feilgeboten und durfte für jede verkaufte Ladung fünf Cents behalten.
Sie schreiben von Lieblingsschriftstellern. Früher mochte ich mal Zane Grey, aber ich bin von Romanen abgekommen und lese seitdem lieber Geschichtsbücher oder Reiseberichte. Manchmal lese ich Bücher, von denen ich weiß, dass sie mir viel zu hoch sind, aber ich bekomme trotzdem einiges mit. Dazu gehören der besagte H.G. Wells und Robert Ingersoll, der über Religion schreibt. Sie haben mir viel zum Nachdenken gegeben. Wenn Sie sehr religiös sind, dann habe ich Sie jetzt hoffentlich nicht beleidigt.
Einmal, als ich in die Bücherei kam, war es Samstagnachmittag, und Sie hatten gerade erst die Tür aufgeschlossen und machten Licht, weil es draußen dunkel war und regnete. Sie waren ohne Hut oder Schirm von einem Schauer erwischt worden, und Ihr Haar war nass. Sie zogen die Nadeln heraus und ließen es herunter. Ist es zu persönlich, wenn ich Sie frage, ob Sie es noch lang tragen oder ob Sie es abgeschnitten haben? Sie gingen an die Heizung und schüttelten Ihr Haar drüber aus, und das Wasser zischte wie Fett in der Bratpfanne. Ich saß da und las in den Illustrated London News vom Krieg. Wir lächelten uns zu. (Ich wollte mit dem Geschriebenen nicht sagen, dass Ihr Haar fettig war!)
Ich habe mir die Haare nicht abgeschnitten, obwohl ich häufig darüber nachdenke. Ich weiß nicht, ob es Eitelkeit oder Trägheit ist, die mich davon abhält.
Ich bin nicht sehr religiös.
Ich bin die Vinegar Hill Road hinaufgegangen und habe Ihr Haus gefunden. Die Kartoffeln stehen gut. Ein Polizeihund hat sich mit mir angelegt, gehört der Ihnen?
Es wird schon recht warm. Wir haben das Flusshochwasser hinter uns, das, wie ich höre, jedes Jahr im Frühling kommt. Das Wasser ist in den Hotelkeller gelaufen und hat irgendwie unser Trinkwasser verseucht, so dass wir gratis Bier oder Ginger Ale bekamen. Aber nur wenn wir im Hotel wohnten oder übernachteten. Sie können sich vorstellen, dass darüber reichlich Witze gemacht wurden.
Ich sollte fragen, ob es etwas gibt, das ich Ihnen schicken kann.
Ich brauche eigentlich nichts Spezielles. Ich bekomme den Tabak und andere Kleinigkeiten, die die Damen in Carstairs für uns einpacken. Ich würde gern ein paar Bücher von den Schriftstellern lesen, die Sie erwähnt haben, aber ich glaube nicht, dass ich hier Gelegenheit dazu haben werde.
Neulich ist hier ein Mann am Herzschlag gestorben. Das war hier das Größte überhaupt. Hast du von dem Mann gehört, der am Herzschlag gestorben ist? Tag und Nacht kriegte man nichts anderes zu hören. Und dann lachten alle, was wahrscheinlich hartherzig klingt, aber es war einfach zu seltsam. Es war nicht einmal viel los, deshalb konnte keiner sagen, er sei vielleicht vor Angst gestorben. (Übrigens saß er gerade an einem Brief, als es passierte, also sollte ich lieber aufpassen.) Vor und nach ihm sind andere erschossen oder von Granaten getroffen worden, aber er ist der, den alle kennen, weil er am Herzschlag gestorben ist. Alle lassen sich darüber aus, dass er so weit reisen musste und die Army so viel Geld gekostet hat, bloß dafür.
Der Sommer war so trocken, dass der Wasserwagen jeden Tag durch die Straßen fuhr, damit der Staub sich legte, und die Kinder tanzten hinterdrein. Außerdem gab es etwas Neues in der Stadt – einen Karren mit einer kleinen Glocke, der in den Straßen Eis verkaufte, und auch darauf waren die Kinder ziemlich erpicht. Er wurde von dem Mann geschoben, der in der Fabrik einen Arbeitsunfall gehabt hatte – Sie wissen bestimmt, wen ich meine, auch wenn ich seinen Namen nicht erinnere. Er hat seinen Unterarm verloren. Mein Zimmer im Hotel liegt im zweiten Stock und war wie ein Backofen, deswegen bin ich oft bis nach Mitternacht spazieren gegangen. Viele andere Leute auch, manchmal im Schlafanzug. Es war wie ein Traum. Der Fluss führte immer noch ein wenig Wasser, gerade genug, um Ruderboot zu fahren, und das tat der methodistische Pastor eines Sonntags im August. Er wollte in einem öffentlichen Gottesdienst um Regen beten. Aber das Boot hatte ein kleines Leck, und das Wasser drang ein und machte ihm die Füße nass, und schließlich sank das Boot, und er stand im Wasser, das ihm nicht einmal bis an den Bauch reichte. War es Pech oder ein böser Streich? Alle redeten darüber, dass seine Gebete erhört worden seien, bloß aus der falschen Richtung.
Auf meinen Spaziergängen komme ich oft am Haus der Douds vorbei. Ihr Vater hält die Rasenflächen und die Hecken sehr hübsch in Ordnung. Ich finde das Haus schön, so originell und luftig. Aber es kann sein, dass es nicht einmal dort kühl war, weil ich abends spät die Stimmen der Mutter und der kleinen Tochter gehört habe, als wären sie draußen auf dem Rasen.
Ich habe zwar gesagt, dass ich nichts brauche, aber eins hätte ich doch gern. Das wäre ein Bild von Ihnen. Ich hoffe, Sie finden meine Bitte nicht ungehörig. Vielleicht sind Sie verlobt oder haben einen Liebsten hier drüben, dem Sie auch schreiben, so wie mir. Sie sind eine besondere Frau, und es würde mich nicht überraschen, wenn ein Offizier um Sie angehalten hätte. Aber jetzt wo ich gefragt habe, kann ich es nicht mehr zurücknehmen und werde es einfach Ihnen überlassen, von mir zu denken, was Sie möchten.
Louisa war fünfundzwanzig Jahre alt und einmal verliebt gewesen, in einen Arzt, den sie im Sanatorium kennengelernt hatte. Ihre Liebe wurde nach gewisser Zeit erwidert, und sie kostete den Arzt die Stelle. Louisa wurde von heftigen Zweifeln geplagt, ob er aus dem Sanatorium entlassen worden oder aus eigenem Entschluss gegangen war, der Liebschaft überdrüssig. Er war verheiratet und hatte Kinder. Auch damals hatten Briefe eine Rolle gespielt. Sie hatten sich nach seinem Weggang weiter geschrieben. Und auch noch ein-, zweimal nach ihrer Entlassung. Dann bat sie ihn, ihr nicht mehr zu schreiben, und er hielt sich daran. Doch die Tatsache, dass nichts mehr von ihm kam, vertrieb sie aus Toronto und veranlasste sie, die Stelle als Handlungsreisende anzunehmen. Auf die Weise musste sie nur eine Enttäuschung pro Woche ertragen, wenn sie am Freitag- oder Samstagabend heimkam. Ihr letzter Brief war hart und gefasst gewesen, und während sie auf ihren Reisen durch das Land ihre Warenkoffer in kleinen Hotels treppauf und treppab schleppte und über Pariser Mode redete und ihre Hutmodelle als betörend anpries und ihr einsames Glas Wein trank, war sie von dem Bewusstsein begleitet, die Heldin einer Liebestragödie zu sein. Wenn sie jemanden gehabt hätte, dem sie davon hätte erzählen können, hätte sie allerdings genau diesen Gedanken verlacht. Sie hätte gesagt, die Liebe sei nichts als Hokuspokus, eine Illusion, und das glaubte sie auch. Doch bei der Vorstellung verspürte sie trotzdem ein Stillwerden, ein Nervenflattern, eine Beugung der Vernunft, eine ungeheuerliche Ergebenheit.
Sie ließ ein Foto machen. Sie wusste, wie sie es haben wollte. Gern hätte sie eine schlichte weiße Bluse angezogen, eine gesmokte Bauernbluse mit offenem Bändchen am Hals. Sie besaß keine solche Bluse und hatte sie tatsächlich bisher nur auf Bildern gesehen. Und sie hätte ihr Haar gern offen getragen. Oder wenn sie es schon aufgesteckt lassen musste, dann hätte sie es gern sehr locker hochgekämmt und mit Perlenschnüren gebunden.
Stattdessen trug sie ihr blauseidenes Hemdblusenkleid und steckte sich das Haar auf wie üblich. Sie fand, das Bild machte sie ziemlich blass und hohläugig. Ihre Miene war ernster und verzagter, als sie beabsichtigt hatte. Sie schickte es trotzdem.
Ich bin nicht verlobt und habe keinen Liebsten. Ich habe einmal einen Mann geliebt, aber das musste beendet werden. Das hat mich damals sehr mitgenommen, aber ich wusste, dass ich es ertragen musste, und inzwischen glaube ich, dass es so am besten war.
Natürlich hatte sie sich alle Mühe gegeben, sich seiner zu erinnern. Sie hatte keine Erinnerung daran, ihr Haar ausgeschüttelt zu haben, wie er geschrieben hatte, oder einem jungen Mann zugelächelt zu haben, als die Regentropfen auf die Heizung fielen. Das alles konnte er auch gut geträumt haben, und vielleicht war das der Fall.
Sie hatte begonnen, den Krieg genauer zu verfolgen als vorher. Sie hörte auf, ihn ignorieren zu wollen. Sie ging mit dem Gefühl durch die Straßen, dass in ihrem Kopf die gleichen aufregenden und beunruhigenden Nachrichten herumgeisterten wie bei allen anderen. Saint-Quentin, Arras, Montdidier, Amiens, und außerdem wurde gerade eine Schlacht an der Somme geschlagen, wo doch bestimmt schon mal eine stattgefunden hatte? Sie legte die Karten der Kriegsschauplätze, die als Doppelseite in den Zeitschriften veröffentlicht wurden, auf ihren Schreibtisch. Sie sah die farbigen Linien des deutschen Vormarschs an die Marne, des ersten Vorstoßes der Amerikaner bei Château-Thierry. Sie betrachtete die braunen Zeichnungen eines Künstlers von einem Pferd, das sich bei einem Luftangriff aufbäumte, von einer Gruppe Soldaten in Ostafrika, die aus Kokosnüssen tranken, und von deutschen Kriegsgefangenen, die mit verbundenen Köpfen oder Gliedmaßen und leeren, grimmigen Mienen Schlange standen. Jetzt fühlte sie, was alle anderen fühlten – ständige Angst und böse Ahnungen und gleichzeitig diese Sucht erzeugende Aufregung. Man konnte von seinem momentanen Leben aufschauen und die Welt hinter den Mauern knistern hören.
Ich freue mich zu hören, dass Sie keinen Schatz haben, auch wenn ich weiß, dass es selbstsüchtig von mir ist. Ich glaube nicht, dass Sie und ich uns je wiedersehen werden. Das sage ich nicht, weil mir geträumt hätte, was geschehen wird, oder weil ich ein Schwarzseher bin, der stets mit dem Schlimmsten rechnet. Es erscheint mir nur als das Wahrscheinlichste, auch wenn ich nicht ständig darüber nachdenke, sondern von Tag zu Tag lebe und mir alle Mühe gebe, am Leben zu bleiben. Ich will Sie nicht mit Sorge plagen oder um Ihr Mitgefühl buhlen, sondern nur erklären, dass die Vorstellung, ich könnte Carstairs nie wiedersehen, mich auf die Idee bringt, alles sagen zu können, was ich will. Vermutlich so ähnlich wie bei einer Fieberkrankheit. Deshalb will ich sagen, dass ich Sie liebe. Ich denke an Sie, wie Sie auf einem Hocker in der Bücherei stehen und sich recken, um ein Buch einzustellen, und ich komme dazu und lege Ihnen die Hände an die Taille und hebe Sie herunter, und Sie drehen sich in meinen Armen um, als wären wir uns in allem einig.
Dienstagnachmittags trafen sich die Frauen und Mädchen vom Roten Kreuz immer im Ratssaal, der auf demselben Flur lag wie die Bücherei. Als die Bücherei einmal ein paar Minuten leer war, ging Louisa über den Flur in den Saal mit den Frauen. Sie hatte beschlossen, einen Schal zu stricken. Im Sanatorium hatte sie gelernt, einfache rechte und linke Maschen zu stricken, aber sie hatte nie gelernt oder wieder vergessen, wie man Maschen aufnahm oder abkettete.
Die älteren Frauen waren alle damit beschäftigt, Kisten zu packen oder aus schweren, über die Tische gebreiteten Baumwollbahnen Verbände zu schneiden. Aber eine Gruppe junger Mädchen saß Brötchen essend und Tee trinkend an der Tür. Eines hielt zwischen den Armen einen Strang Wolle, und ein anderes wickelte sie auf.
Louisa trug ihren Wunsch vor.
»Ja, was wollen Sie denn stricken?«, fragte ein Mädchen mit dem Mund noch voll Brötchen.
Louisa sagte, einen Schal. Für einen Soldaten.
»Oh, dann brauchen Sie die vorgeschriebene Wolle«, sagte eine andere in höflicherem Ton und sprang vom Tisch auf. Sie kam mit einigen braunen Wollknäueln wieder, angelte ein Paar Stricknadeln aus ihrem Beutel und sagte Louisa, das könne sie haben.
»Ich mache Ihnen nur eben den Anfang«, sagte sie. »Die Breite ist auch vorgeschrieben.«
Andere Mädchen kamen hinzu und neckten dieses Mädchen, das den Namen Corrie trug. Sie sagten ihr, sie mache alles falsch.
»Ach, ja wirklich?«, sagte Corrie. »Möchtest du eine Stricknadel ins Auge haben? Ist er für einen Freund?«, fragte sie Louisa eifrig. »Einen Freund in Übersee?«
»Ja«, sagte Louisa. Natürlich war sie in den Augen der Mädchen eine alte Jungfer, die sie je nach dem, wie ihre Stimmung es diktierte, freundlich bemitleideten oder frech auslachten.
»Dann stricken Sie mal schön fest«, sagte diejenige, die ihr Brötchen aufgegessen hatte. »Stricken Sie schön fest, damit er ihn gut warm hält!«
Eines der Mädchen in dieser Gruppe war Grace Horne. Sie sagte nichts. Sie war ein schüchternes, aber resolut wirkendes Mädchen von neunzehn Jahren, mit einem breiten Gesicht, dünnen, oft zusammengepressten Lippen, braunem Haar mit einem gerade geschnittenen Pony und einer hübsch gereiften Figur. Sie hatte sich mit Jack Agnew verlobt, bevor er nach Übersee ging, aber sie waren übereingekommen, nichts davon zu sagen.
Die spanische Grippe
Louisa hatte sich mit einigen der Handlungsreisenden angefreundet, die regelmäßig in dem Hotel übernachteten. Einer von ihnen, Jim Frarey, vertrieb Schreibmaschinen und Bürogeräte und Bücher und Papierwaren aller Art. Er war ein blonder, ziemlich rundschultriger, aber kräftig gebauter Mann von Mitte vierzig. Seinem Aussehen nach hätte man meinen können, er verkaufe etwas Schwereres und in der Männerwelt Wichtigeres, vielleicht landwirtschaftliche Maschinen.
Jim Frarey unterbrach seine Reise während der Grippeepidemie nicht, obwohl man nie wissen konnte, welche Läden geöffnet oder geschlossen sein würden. Gelegentlich waren auch Hotels geschlossen, wie auch die Schulen und die Kinos und sogar – das fand Jim Frarey skandalös – die Kirchen.
»Die sollten sich was schämen, diese Feiglinge«, sagte er zu Louisa. »Was haben die Leute davon, zu Hause herumzulungern und darauf zu warten, dass die Grippe zuschlägt? Sie haben die Bücherei doch nie zugemacht, oder?«
Louisa sagte nein, nur als sie selbst krank geworden sei. Eine leichte Attacke, die nur knapp eine Woche gedauert habe, aber natürlich habe sie ins Krankenhaus gehen müssen. Im Hotel habe sie nicht bleiben dürfen.
»Feiglinge«, sagte er. »Wenn es einen erwischen soll, erwischt es einen. Meinen Sie nicht auch?«
Sie sprachen über das Gedränge in den Krankenhäusern, die Todesfälle unter den Ärzten und Schwestern, den unablässigen traurigen Anblick von Beerdigungen. Jim Frarey lebte in Toronto in der gleichen Straße wie ein Bestattungsunternehmer. Er erzählte, dass sie immer noch jedes Mal die schwarzen Pferde, die schwarze Kutsche, das ganze Drum und Dran auffuhren, wenn Leute zu beerdigen waren, für die sich solches Aufheben lohnte.
»Tag und Nacht ging das«, sagte er. »Tag und Nacht.« Er hob sein Glas und sagte: »Auf die Gesundheit also. Sie scheinen wohlauf zu sein.«
Er fand wirklich, dass Louisa besser aussah als früher. Vielleicht hatte sie angefangen, Rouge aufzulegen. Sie hatte eine blassbräunliche Haut, und er hatte den Eindruck, ihre Wangen hätten früher keine Farbe gehabt. Sie zog sich auch schicker an und bemühte sich mehr um Freundlichkeit. Früher war sie mal so und mal so gewesen, ganz nach Laune. Sie trank jetzt auch Whisky, obschon sie sich weigerte, auch nur daran zu nippen, bevor sie ihn nicht in Wasser ertränkt hatte. Früher hatte sie immer nur ein Glas Wein bestellt. Er fragte sich, ob diese Veränderung auf einen Freund zurückzuführen war. Aber ein Freund hätte sie hübscher machen können, ohne ihr Interesse für alles Mögliche zu wecken, was jedoch seiner Ansicht nach offenbar geschehen war. Wahrscheinlich war die Ursache eher darin zu suchen, dass ihr die Zeit davonlief und die Heiratsaussichten durch den Krieg so entsetzlich gering waren. So etwas konnte eine Frau in Bewegung bringen. Sie war eine klügere und angenehmere Gesprächspartnerin und sah auch hübscher aus als die meisten verheirateten Frauen. Wie kam eine solche Frau zu ihrem Schicksal? Manchmal schlicht durch Pech. Manchmal durch eine Fehleinschätzung zu einer Zeit, in der es darauf ankam. War sie früher ein bisschen zu spitz und selbstsicher gewesen, so dass die Männer unsicher wurden?
»Das Leben kann man trotzdem nicht anhalten«, sagte er. »Es war richtig von Ihnen, die Bücherei geöffnet zu lassen.«
Das war im Frühwinter des Jahres 1919, als die Grippe erneut ausgebrochen war, nachdem die Gefahr angeblich bereits ausgestanden war. Sie schienen ganz allein in dem Hotel zu sein. Es war erst gegen neun, aber der Wirt war schon ins Bett gegangen. Seine Frau lag mit Grippe im Krankenhaus. Jim Frarey hatte die Whiskyflasche aus der Bar geholt, die wegen Ansteckungsgefahr geschlossen war, und sie saßen an einem Tisch am Fenster, im Speisesaal. Draußen war ein Winternebel aufgezogen und drückte gegen die Fenster. Man konnte kaum die Straßenlaternen oder die wenigen Autos sehen, die vorsichtig über die Brücke rumpelten.
»Ach, dass ich die Bücherei offen gelassen habe, war keine Frage des Prinzips«, sagte Louisa. »Der Grund dafür war persönlicher, als Sie denken.«
Dann lachte sie und versprach ihm eine sonderbare Geschichte. »Oh, der Whisky muss mir die Zunge gelockert haben«, sagte sie.
»Ich bin verschwiegen«, sagte Jim Frarey.
Sie sah ihn mit lachenden Augen streng an und sagte, wenn jemand verkünde, er sei verschwiegen, dann sei fast immer das Gegenteil der Fall. Ebenso wie wenn jemand verspreche, etwas keiner Menschenseele zu verraten.
»Sie können diese Geschichte erzählen, wo und wann Sie wollen, solange Sie die echten Namen weglassen und sie nicht hier in dieser Gegend zum Besten geben«, sagte sie. »Darauf kann ich mich hoffentlich verlassen. Obwohl ich im Augenblick nicht das Gefühl habe, ich würde etwas drauf geben. Wahrscheinlich werde ich mich, wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt, anders besinnen. Diese Geschichte ist eine Lektion. Sie ist eine Lektion darin, wie Frauen sich zum Narren machen können. Na und, werden Sie sagen, was ist daran neu, das erlebt man doch jeden Tag!«
Sie begann, ihm von einem Soldaten in Übersee zu erzählen, der ihr eines Tages zu schreiben angefangen hatte. Der Soldat erinnerte sich an sie aus der Zeit, als er regelmäßig in die Bücherei gekommen war. Aber sie hatte keinerlei Erinnerung an ihn. Trotzdem beantwortete sie seinen ersten Brief freundlich, und zwischen ihnen entstand ein Briefwechsel. Er erzählte ihr, wo er in der Stadt gewohnt hatte, und sie spazierte an dem Haus vorbei, damit sie ihm erzählen konnte, wie es dort aussah. Er erzählte ihr, was für Bücher er gelesen hatte, und sie teilte ähnliche Dinge von sich mit. Kurzum, sie offenbarten beide etwas von sich, und auf beiden Seiten entstanden warme Gefühle. Zuerst auf seiner Seite, jedenfalls was Erklärungen betraf. Sie neigte nicht dazu, wie eine Närrin vorzupreschen. Zuerst glaubte sie, sie schreibe nur aus Freundlichkeit. Auch später wollte sie ihn nicht zurückweisen oder kränken. Er bat sie um ein Bild. Sie ließ eins machen, es gefiel ihr nicht, aber sie schickte es ihm trotzdem. Er fragte, ob sie einen Liebsten habe, und sie antwortete wahrheitsgemäß nein, sie habe keinen. Er schickte ihr kein Bild von sich, und sie bat auch nicht darum, obwohl sie natürlich neugierig war, wie er aussah. Es wäre für ihn nicht einfach gewesen, sich mitten im Krieg fotografieren zu lassen. Außerdem wollte sie nicht wie eine Frau erscheinen, die ihre Gunst entzog, wenn das Aussehen nicht den Erwartungen entsprach.
Er schrieb ihr, dass er nicht damit rechnete, je wieder nach Hause zu kommen. Er sagte, er habe weniger Angst vorm Tod als davor, wie einige der Männer zu enden, die er gesehen hatte, als er verwundet im Lazarett lag. Er führte das nicht näher aus, aber sie nahm an, er meinte die Fälle, von denen sie erst jetzt erfuhren – die verstümmelten Männer, die Erblindeten, die von Brandwunden Entstellten. Er habe nicht über sein Schicksal gejammert, den Eindruck wolle sie nicht vermitteln. Nein, er habe nur damit gerechnet, sterben zu müssen, und habe lieber sterben wollen, als so zu enden wie manche anderen, und er habe an sie gedacht und geschrieben, wie Männer in einer solchen Situation an eine Liebste schreiben.
Als der Krieg endete, hatte sie schon eine Weile nichts von ihm gehört. Sie wartete weiter täglich auf einen Brief, aber es kam nichts. Nichts. Sie befürchtete, er habe womöglich zu jenen unglückseligsten Soldaten des Krieges gehört – zu jenen, die noch in der letzten Woche oder am letzten Tag oder gar in der allerletzten Stunde gefallen waren. Sie studierte jede Woche die Zeitung, wo bis ins neue Jahr hinein die Namen neuer Todesfälle abgedruckt wurden, aber seiner war nicht dabei. Danach begann die Zeitung außerdem die Namen der Heimkehrer aufzulisten, oft indem sie ein Foto zum Namen abdruckte und einen kleinen Jubelbericht. Als die Soldaten in großer Zahl heimgekehrt waren, hatte der Platz für solche Beigaben nicht gereicht. Und dann sah sie seinen Namen, ein Name unter vielen auf der Liste. Er war nicht gefallen, er war nicht verwundet worden – er kehrte heim nach Carstairs, vielleicht war er schon da.
An diesem Punkt hatte sie beschlossen, die Bücherei geöffnet zu lassen, obwohl die Grippe tobte. Jeden Tag war sie sich sicher, dass er kommen würde, jeden Tag war sie auf ihn gefasst. Die Sonntage waren eine Qual. Immer wenn sie das Rathaus betrat, hatte sie das Gefühl, er könnte schon da sein und an eine Wand gelehnt auf ihr Eintreffen warten. Manchmal war das Gefühl so stark, dass sie einen Schatten sah und ihn irrtümlich für einen Mann hielt. Sie verstand jetzt, wieso Leute glaubten, Gespenster gesehen zu haben. Jedes Mal wenn die Tür aufging, rechnete sie damit, beim Aufblicken in sein Gesicht zu sehen. Manchmal schloss sie mit sich selbst einen Pakt, erst wieder aufzublicken, wenn sie bis zehn gezählt hatte. Wegen der Grippe kamen wenige Leute. Sie nahm sich Umräumungsaufgaben vor, um nicht verrückt zu werden. Sie schloss die Bücherei immer erst ab, wenn die Öffnungszeit um fünf bis zehn Minuten überschritten war. Und dann stellte sie sich vor, dass er sie vielleicht von der anderen Straßenseite auf den Stufen vor der Post beobachtete, zu schüchtern, um den ersten Schritt zu tun. Sie plagte sich mit dem Gedanken, dass er krank war, und nutzte jedes Gespräch, um etwas von den neuesten Fällen zu erfahren. Nie nannte jemand seinen Namen.
Das war der Zeitpunkt, an dem sie ganz und gar zu lesen aufhörte. Buchdeckel sahen für sie aus wie Särge, schäbige oder prunkvolle, und was drinnen war, war nichts als Staub.
Man müsse ihr verzeihen, nicht wahr, man müsse ihr doch verzeihen, dass sie nach diesen Briefen gedacht habe, das eine, was nicht passieren könne, sei, dass er sie nicht aufsuchen, dass er überhaupt keinen Kontakt zu ihr aufnehmen würde? Dass er nach solchen Bekenntnissen nicht ein einziges Mal über ihre Schwelle kommen würde? Leichenzüge zogen unter ihrem Fenster vorüber, und sie schenkte ihnen keine Beachtung, da sie nicht seinem Leichnam galten. Selbst als sie krank in der Klinik lag, war ihr einziger Gedanke, dass sie wieder hinmusste, dass sie aus dem Bett musste, dass ihm die Tür nicht verschlossen sein durfte. Sie rappelte sich mühselig auf und schleppte sich wieder zur Arbeit. Eines heißen Nachmittags ordnete sie neu erschienene Zeitungen in die Regale ein, als ihr sein Name entgegensprang wie etwas aus ihren Fieberphantasien.
Sie las eine kurze Notiz über seine Hochzeit mit einer Miss Grace Horne. Kein ihr bekanntes Mädchen. Keine Büchereinutzerin.
Die Braut trug ein beigefarbenes Seidenkreppkleid mit braunen und cremeweißen Paspeln und einen hellen Strohhut mit braunen Samtbändern.
Ein Bild war nicht dabei. Braune und cremeweiße Paspeln. Das war das Ende, unausweichlich das Ende ihrer Liebesgeschichte.
Doch dann entdeckte sie auf ihrem Schreibtisch in der Bücherei, erst vor wenigen Wochen, eines Samstagabends, als alle Besucher gegangen waren und sie die Tür abgeschlossen hatte und das Licht ausmachte, einen kleinen Zettel. Darauf standen ein paar Worte. Ich war schon verlobt, bevor ich nach Übersee ging. Kein Name, weder ihrer noch seiner. Und daneben lag ihr Foto, ein Stück unter die Schreibtischunterlage geschoben.
Er war an diesem Abend in der Bücherei gewesen. Es hatte viel Betrieb geherrscht, sie hatte ihren Schreibtisch oft verlassen, um für jemanden ein Buch zu suchen oder die Zeitungen zu ordnen oder ein paar Bücher in die Regale zu stellen. Er war im selben Raum mit ihr gewesen, hatte sie beobachtet und seine Chance ergriffen. Aber sich nicht zu erkennen gegeben.
Ich war schon verlobt, bevor ich nach Übersee ging.
»Glauben Sie, dass er sich nur einen Spaß mit mir erlaubt hat?«, fragte Louisa. »Glauben Sie, ein Mann könnte so diabolisch sein?«
»Meiner Erfahrung nach neigen Frauen weitaus häufiger zu solchen Spielchen. Nein, nein. Das dürfen Sie nicht glauben. Viel wahrscheinlicher ist, dass er es ernst meinte. Er hat sich ein wenig mitreißen lassen. Es ist alles so, wie es auf der Oberfläche aussieht. Er war verlobt, bevor er einberufen wurde, er hat nicht damit gerechnet, heil heimzukehren, und dann geschah es doch. Und als er heimkam, wartete seine Verlobte auf ihn – was sollte er tun?«
»Ja, was?«, sagte Louisa.
»Er hat den Mund zu voll genommen.«
»Ah, so wird es gewesen sein!«, sagte Louisa. »Und was war es in meinem Fall anderes als Eitelkeit, die es verdient, bestraft zu werden!« Ihre Augen glänzten und ihre Miene war spitzbübisch. »Sie glauben nicht, dass er mich irgendwann in aller Ruhe in Augenschein genommen und beschlossen hat, dass das Original noch schlimmer war als das armselige Foto, und dass er daraufhin den Rückzug angetreten hat?«
»Nein, auf keinen Fall!«, sagte Jim Frarey. »Machen Sie sich nicht so schlecht.«
»Ich möchte nicht, dass Sie mich für dumm halten«, sagte sie. »Ich bin nicht so dumm und unerfahren, wie mich die Geschichte klingen lässt.«
»Ich halte Sie überhaupt nicht für dumm.«
»Aber vielleicht für unerfahren?«
Da war es, dachte er – das Übliche. Frauen können, wenn sie eine Geschichte von sich erzählt haben, nicht wieder aufhören. Alkohol bringt sie völlig aus der Fassung, alle Umsicht ist vergessen.
Sie hatte ihm früher schon einmal anvertraut, dass sie als Patientin in einem Sanatorium gewesen war. Jetzt erzählte sie von einer Liebe zu einem Arzt dort. Das Sanatorium lag auf einem wunderschönen Gelände oben am Hamilton Mountain, und dort hatten sie sich immer auf den von Hecken gesäumten Wegen getroffen. Die Stufen waren aus großen Kalksteinplatten, und an geschützten Stellen wuchsen Pflanzen, die man in Ontario normalerweise nicht zu sehen bekommt – Azaleen, Rhododendren, Magnolien. Der Arzt kannte sich in Botanik aus, und er erzählte ihr, es sei die Flora der Carolinas. Ganz anders als hier, üppiger, mit kleinen Waldstücken und wundervollen Bäumen und Trampelpfaden unter den Bäumen. Tulpenbäumen.
»Tulpen!«, sagte Jim Frarey. »Tulpen an den Bäumen!«
»Nein, nein, wegen der Form ihrer Blätter!«
Sie lachte ihn herausfordernd an und biss sich dann auf die Lippe. Er hielt es für angebracht, den Dialog fortzuführen, und sagte: »Tulpen an den Bäumen!« Und sie wiederholte: »Nein, es sind die Blätter, die wie Tulpen geformt sind, nein, das habe ich nicht gesagt, hören Sie auf!« So gerieten sie in ein Stadium vorsichtiger Abwägungen – ein Stadium, das ihm wohlvertraut war und von dem er nur hoffen konnte, dass sie sich ebenfalls damit auskannte –, voll von hübschen kleinen Überraschungen, halb boshaften Signalen, dem Aufwallen schamloser Hoffnungen und folgenreicher Liebenswürdigkeit.
»Vollkommen unter uns«, sagte Jim Frarey. »Das hat es noch nie gegeben, oder? Und wird es vielleicht auch nie wieder geben.«
Sie ließ zu, dass er ihre Hände nahm und sie halb von ihrem Stuhl hob. Er löschte das Licht, als sie den Speisesaal verließen. Sie gingen die Treppe hinauf, die sie so oft getrennt hinaufgestiegen waren. Vorbei an dem Bild des Hundes auf dem Grab seines Herrn und an der auf dem Feld singenden Highland Mary und dem alten König mit den vorstehenden Augen und dem verwöhnten, satten Blick.
»Die Nacht im Nebel ist verschwommen, und mein Herz ist tief beklommen«, summte Jim Frarey auf der Treppe mehr, als dass er sang. Er ließ eine sichere Hand an Louisas Rücken ruhen. »Alles gut, alles gut«, sagte er, als er sie um die Biegung in der Treppe führte. Und als sie die schmalen Stufen in den zweiten Stock emporstiegen, sagte er: »War in diesem Hotel dem Himmel noch nie so nah!«
Doch später in der Nacht gab Jim Frarey ein abschließendes Stöhnen von sich und raffte sich zu einem schläfrigen Vorwurf auf. »Louisa, Louisa, warum hast du mir nicht gesagt, dass es so stand?«
»Ich habe dir alles gesagt«, sagte Louisa mit schwacher, entrückter Stimme.
»Dann habe ich einen falschen Eindruck bekommen«, sagte er. »Ich wollte nicht, dass dies irgendwie zählt.«
Sie sagte, das sei nicht der Fall. Nun, da er sie nicht mehr auf die Matratze drückte und festhielt, hatte sie das Gefühl, sich ohne Halt im Kreis zu drehen, so als hätte sich die Matratze in einen Kinderkreisel verwandelt und wirbelte mit ihr davon. Sie bemühte sich zu erklären, dass die Blutspuren auf den Laken von ihrer Periode herrührten, aber ihre Worte kamen zusammenhanglos und mit genüsslicher Nonchalance heraus.
Unfälle
Als Arthur kurz vor Mittag aus der Fabrik nach Hause kam, rief er: »Bleibt mir aus dem Weg, bis ich mich gewaschen habe! Drüben in der Fabrik hat es einen Unfall gegeben!« Er bekam keine Antwort. Mrs Feare, die Haushälterin, redete am Küchentelefon so laut, dass sie ihn nicht hören konnte, und seine Tochter war natürlich in der Schule. Er wusch sich und stopfte alles, was er angehabt hatte, in den Wäschepuff und schrubbte anschließend das Badezimmer wie ein Mörder. Sauber, sogar das Haar zurückgekämmt und glattgestrichen, machte er sich mit dem Auto auf zum Haus des Opfers. Er hatte sich erkundigen müssen, wo es war. Er dachte, es sei oben am Vinegar Hill, aber sie sagten nein, das sei der Vater – der junge Mann und seine Frau wohnten am anderen Ende der Stadt, ein Stück weiter als da, wo früher, vor dem Krieg, die Mosterei gewesen war.
Er fand die beiden nebeneinanderliegenden Ziegelhäuschen und begab sich, wie man ihm gesagt hatte, zum linken. Es wäre ohnehin nicht schwer gewesen, das richtige Haus zu erkennen. Die Nachricht war vor ihm eingetroffen. Die Tür zum Haus stand offen, und Kinder, die zu klein waren, um zur Schule zu müssen, liefen im Garten herum. Ein kleines Mädchen saß in einem Tretauto, ohne sich von der Stelle zu rühren, und versperrte ihm den Weg. Er ging um sie herum. Im gleichen Moment sprach ihn ein größeres Mädchen in förmlicherem Ton an – eine Warnung.
»Ihr Vater ist tot. Ihrer!«
Eine Frau kam mit einem Armvoll Gardinen aus der Wohnstube und überreichte sie einer anderen Frau, die in der Diele stand. Die Frau, die die Gardinen entgegennahm, hatte graue Haare und ein flehendes Gesicht. Sie hatte keine Schneidezähne. Wahrscheinlich nahm sie ihr Gebiss zu Hause aus Bequemlichkeit heraus. Die Frau, die ihr die Gardinen reichte, war untersetzt, aber jung, mit frischer Haut.
»Sagen Sie ihr, sie soll nicht auf die Trittleiter steigen«, sagte die grauhaarige Frau zu Arthur. »Sie wird sich beim Gardinenabnehmen den Hals brechen. Sie denkt, wir müssen alles gewaschen kriegen. Sind Sie der Beerdigungsunternehmer? Oh, nein, entschuldigen Sie! Sie sind Mr Doud. Grace, komm her! Grace! Mr Doud ist hier!«
»Lassen Sie sie.«
»Sie denkt, sie kriegt alle Gardinen abgenommen und gewaschen und bis morgen wieder aufgehängt, weil er in die Wohnstube muss. Sie ist meine Tochter. Von mir lässt sie sich nichts sagen.«
»Sie wird sich gleich beruhigen«, sagte ein ernster und zugleich Behaglichkeit ausstrahlender Mann mit dem Kragen eines Geistlichen, der aus einem hinteren Zimmer in die Diele trat. Ihr Pastor. Allerdings nicht aus einer der Arthur bekannten Kirchen. Von der Baptistengemeinde? Den Pfingstlern? Den Plymouth Brethren? Er hatte eine Tasse Tee in der Hand.
Eine andere Frau kam und holte flink die Gardinen ab.
»Wir haben die Maschine voll und in Gang gebracht«, sagte sie. »An einem Tag wie heute trocknen die wie nichts. Lasst bloß die Kinder nicht ins Haus.«
Der Pastor musste zur Seite treten und die Tasse hochhalten, um sie und ihr Bündel vorbeizulassen. Er sagte: »Will denn keine der Damen Mr Doud eine Tasse Tee anbieten?«
Arthur sagte: »Nein, lassen Sie nur. – Die Bestattungskosten«, sagte er an die grauhaarige Frau gewandt. »Wenn Sie ihr bitte sagen könnten –«
»Lillian hat in die Hose gemacht!«, sagte ein triumphierendes Kind an der Tür. »Mrs Agnew! Lillian hat in die Hose gepinkelt!«
»Ja. Ja«, sagte der Pastor. »Das werden sie sehr zu danken wissen.«
»Die Grabstelle und den Stein, alles«, sagte Arthur. »Sorgen Sie bitte dafür, dass ihnen das klar ist. Eine Inschrift ihrer Wahl für den Stein.«
Die grauhaarige Frau war in den Garten hinausgegangen. Sie kam mit einem schreienden Kind unter dem Arm zurück. »Armer Hase«, sagte sie. »Die anderen haben ihr gesagt, sie darf nicht ins Haus, wo sollte sie also hin? Da konnte doch nur ein Unglück geschehen.«
Die junge Frau kam aus der Wohnstube und schleppte einen Teppich hinter sich her.
»Ich möchte, dass der auf die Leine kommt und geklopft wird.«
»Grace, Mr Doud ist gekommen, um sein Beileid auszusprechen«, sagte der Pastor.
»Und um zu fragen, ob ich etwas tun kann«, sagte Arthur.
Die grauhaarige Frau stieg mit dem nassen Kind auf dem Arm die Treppe hinauf, und ein paar andere Kinder schlichen hinterdrein.
Grace erspähte sie.
»Oh, nein, das kommt nicht in Frage! Macht, dass ihr rauskommt!«
»Meine Mama ist hier drinnen.«
»Ja, und deine Mama hat alle Hände voll zu tun, sie kann dich jetzt nicht brauchen. Sie ist hier, um mir zu helfen. Weißt du nicht, dass Lillians Vater gestorben ist?«
»Gibt es irgendetwas, was ich für Sie tun kann?«, sagte Arthur, der möglichst bald wieder flüchten wollte.
Grace starrte ihn mit offenem Mund an. Die Geräusche der Waschmaschine dröhnten durch das Haus.
»Ja, das gibt es«, sagte sie. »Warten Sie hier.«
»Sie steht neben sich«, sagte der Pastor. »Sie will nicht unhöflich sein.«
Grace kam mit einem Stapel Bücher wieder.
»Diese hier«, sagte sie. »Die hatte er aus der Bücherei. Ich will keine Säumnisgebühren zahlen müssen. Er ging jeden Samstagabend hin, deshalb nehme ich an, sie sind morgen fällig. Ich will damit keinen Ärger haben.«
»Ich kümmere mich drum«, sagte Arthur. »Das tu ich gern.«
»Ich will bloß keinen Ärger damit haben.«
»Mr Doud hat gesagt, er übernimmt die Beerdigung«, teilte ihr der Pastor in sanft mahnendem Ton mit. »Alles, einschließlich des Steins. Mit einer Inschrift Ihrer Wahl.«
»Ach, ich will nichts Besonderes«, sagte Grace.
Letzten Freitag kam es im Sägewerk der Douds-Fabrik zu einem außergewöhnlich grausigen, tragischen Unfall. Mr Jack Agnew verfing sich, als er unter die Hauptwelle greifen wollte, unglücklich mit dem Ärmel an einem Gewindestift in einem nahen Flandsch, so dass sein Arm und seine Schulter unter die Welle gezogen wurden. Er geriet mit dem Kopf an das Sägeblatt mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern. In Sekundenschnelle war der Kopf des unglücklichen jungen Mannes vom Körper abgetrennt, in einem schrägen Winkel, der vom unteren Rand des linken Ohres quer durch den Hals führte. Es wird davon ausgegangen, dass er sofort tot war. Er hat weder etwas gesagt noch geschrien, weshalb seine Kollegen nicht durch Geräusche auf das schreckliche Geschehen aufmerksam wurden, sondern durch das emporschießende, spritzende Blut.
Dieser Bericht wurde eine Woche nach dem Vorfall ein zweites Mal in der Zeitung abgedruckt, für alle, denen er womöglich entgangen war oder die ihn an Freunde oder Verwandte von außerhalb zu schicken wünschten (vor allem an Leute, die früher in Carstairs gewohnt hatten und fortgezogen waren). Die Falschschreibung von »Flansch« war berichtigt. Man entschuldigte sich in einer kleinen Notiz für den Fehler. In einem weiteren Beitrag wurde eine sehr große Beerdigung beschrieben, zu der sogar Leute aus benachbarten Städten gekommen waren, bis hin nach Walley. Sie kamen mit dem Auto und mit der Eisenbahn und einige mit Pferd und Wagen. Sie hatten Jack Agnew zu Lebzeiten nicht gekannt, wollten aber, so berichtete die Zeitung, der sensationellen und tragischen Art, wie er zu Tode gekommen war, ihren Tribut zollen. In Carstairs schlossen an diesem Nachmittag sämtliche Geschäfte für zwei Stunden. Das Hotel schloss seine Türen nicht, allerdings nur, weil die vielen Besucher irgendwo etwas zu essen und zu trinken bekommen mussten.
Die Hinterbliebenen waren eine Ehefrau Grace und eine vierjährige Tochter Lillian. Das Opfer hatte im Großen Krieg tapfer gekämpft und war nur einmal, nicht schwer, verwundet worden. Über diese Ironie hatten sich viele ausgelassen.
Die fehlende Erwähnung eines noch lebenden Vaters war keine Absicht. Der Herausgeber der Zeitung stammte nicht aus Carstairs, und keiner dachte daran, ihm von dem Vater zu erzählen, bis es zu spät war.
Der Vater selbst beschwerte sich nicht über das Versäumnis. Am Tag der Beerdigung, an dem sehr schönes Wetter war, lenkte er seine Schritte genauso aus der Stadt hinaus wie auch sonst an jedem Tag, den er nicht bei den Douds zu verbringen beschloss. Er trug einen Filzhut und einen langen Mantel, der ihm als Unterlage dienen konnte, wenn er ein Nickerchen machen wollte. Seine Überschuhe waren fein säuberlich mit Einweckgummis an den Füßen befestigt. Er hatte vor, ein paar Saugkarpfen zu fangen. Die Saison war noch nicht eröffnet, aber er sah regelmäßig zu, dass er ein wenig früher dran war. Er angelte den Frühling und Frühsommer hindurch und kochte und verzehrte, was er fing. Er hatte eine Bratpfanne und einen Topf am Flussufer versteckt. Der Topf war für den Mais, den er später im Jahr vom Feld klaute, zu der Zeit, wenn er auch die Früchte von wilden Apfelbäumen und Weinreben aß. Er war absolut normal, aber hasste Gespräche. In den Wochen nach dem Tod seines Sohnes waren sie nicht zu vermeiden, aber er hatte eine Art, sie möglichst kurz zu halten.
»Hätte besser achtgeben müssen.«
An jenem Tag traf er bei seinem Gang übers Land noch jemanden, der nicht auf der Beerdigung war. Eine Frau. Sie versuchte nicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, und schien, wie sie mit langen, forschen Schritten die Luft an sich vorbeipeitschte, ebenso grimmig auf ihre Einsamkeit bedacht zu sein wie er.
Die Klavierfabrik, die in ihren Anfängen Zimmerorgeln gebaut hatte, erstreckte sich am westlichen Ende der Stadt wie eine mittelalterliche Stadtmauer. Sie bestand aus zwei langen Hallen, inneren und äußeren Festungsmauern gleich, die durch eine geschlossene Brücke, in der die Verwaltungsbüros lagen, verbunden waren. Und in die Stadt und die Straßen der Arbeitersiedlung hinein ragten die Brennöfen und das Sägewerk, der Holzplatz und die Lagerschuppen. Morgens um sechs ertönte die Pfeife der Fabrik und diktierte vielen Menschen die Zeit zum Aufstehen. Sie ertönte erneut zum Beginn der Arbeitszeit um sieben, um zwölf zur Mittagspause, um eins zum Ende der Pause und dann um halb sechs, wenn die Männer ihre Werkzeuge aus der Hand legten und nach Hause gingen.
Neben der Zeituhr waren Regeln ausgehängt, unter Glas. Die ersten beiden Regeln lauteten:
EINE MINUTE VERSPÄTUNG KOSTET EINE VIERTELSTUNDE LOHN. SEI PÜNKTLICH.
SICHERHEIT ENTSTEHT NICHT VON SELBST. GIB STETS ACHT: AUF DICH UND DEINEN NEBENMANN.
In der Fabrik war es auch früher schon zu Unfällen gekommen, einmal war sogar ein Mann gestorben, als er unter einer Ladung Holz begraben wurde. Das war vor Arthurs Zeit gewesen. Und einmal, während des Krieges, hatte ein Mann einen Arm verloren, oder ein Stück von seinem Arm. An dem Tag, als das passierte, war Arthur in Toronto gewesen. Er hatte demzufolge noch nie einen Unfall miterlebt – jedenfalls keinen ernsten. Aber jetzt ging ihm häufig durch den Kopf, dass etwas passieren konnte.
Vielleicht fühlte er sich nicht mehr so vor Kummer und Sorge gefeit wie vor dem Tod seiner Frau. Sie war 1919 gestorben, in der letzten Phase der Grippeepidemie, als alle schon ihre Angst davor verloren hatten. Nicht einmal sie hatte Angst gehabt. Fast fünf Jahre war das her, und trotzdem erschien es Arthur noch immer als das Ende einer sorglosen Zeit in seinem Leben. Anderen hingegen war er schon immer sehr verantwortungsbewusst und ernst erschienen – niemand hatte ihm eine größere Veränderung angemerkt.
In seinen Träumen von einem Unfall herrschte eine sich ausbreitende Stille, alles wurde abgeschaltet. Alle Maschinen in der Fabrik stellten ihre üblichen Geräusche ein, und die Stimmen aller Männer verstummten, und wenn Arthur aus dem Fenster schaute, ging ihm auf, dass der Untergang gekommen war. Er konnte sich nie erinnern, etwas Bestimmtes gesehen zu haben, das ihm dies klarmachte. Da war nichts als die offene Fläche, der Staub im Fabrikhof, und alles sagte jetzt.
Die Bücher blieben eine Woche oder mehr auf dem Boden seines Wagens liegen. Seine Tochter Bea fragte: »Was machen diese Bücher hier?«, und da fiel es ihm wieder ein.
Bea las die Titel und die Namen der Verfasser vor. Sir John Franklin und die Romantik der Nordwestpassage von G.B. Smith. Was ist los mit der Welt? von G.K. Chesterton. Die Eroberung Quebecs von Archibald Hendry. Die Praxis und Theorie des Bolschewismus von Lord Bertrand Russell.
»Bol-sche-wismus«, las Bea, und Arthur sprach ihr die richtige Betonung vor. Sie fragte, was es heiße, und er sagte: »Das ist etwas, was man in Russland hat, von dem ich auch wenig verstehe. Aber nach allem, was ich höre, ist es schrecklich.«
Bea war damals dreizehn. Mit Russland verband sie das Ballett und Derwische. Sie glaubte für die nächsten paar Jahre, der Bolschewismus sei ein diabolischer und womöglich frivoler Tanz. Das jedenfalls war die Geschichte, die sie als Erwachsene erzählte.
Sie erwähnte dabei nicht, dass die Bücher mit dem Mann zu tun hatten, der den Unfall erlitten hatte. Das hätte die Geschichte weniger amüsant gemacht. Vielleicht hatte sie es wirklich vergessen.
Die Bibliothekarin war verstört. In den Büchern steckten noch die Kärtchen, was hieß, dass er sie nicht offiziell entliehen, sondern nur aus dem Regal genommen und mitgehen lassen hatte.
»Das von Lord Russell ist schon lange verschwunden.«
Arthur war derlei Vorwürfe nicht gewöhnt, aber er sagte freundlich: »Ich bringe sie für jemand anders zurück. Für den Mann, der umgekommen ist. Beim Unfall in der Fabrik.«
Die Bibliothekarin hatte das Buch über Franklin aufgeschlagen. Sie war in das Bild vom Schiff vertieft, das im Eis feststeckt.
»Seine Frau hat mich darum gebeten«, sagte Arthur.
Sie nahm jedes Buch einzeln in die Hand und schüttelte es, als erwartete sie, dass etwas herausfallen würde. Sie fuhr mit den Fingern zwischen die Seiten. Die untere Hälfte ihres Gesichts vollführte hässliche Bewegungen, als kaute sie innen auf ihren Wangen.
»Ich nehme an, er hat sie einfach mitgenommen, wie er lustig war«, sagte Arthur.
»Pardon?«, sagte sie nach einer Minute. »Was haben Sie gesagt? Verzeihung.«
Es ist der Unfall, dachte er. Die Vorstellung, dass der Mann, der auf solche Weise umgekommen ist, als Letzter die Bücher aufgeschlagen, diese Seiten umgeblättert hat. Der Gedanke, dass er womöglich ein Stückchen seines Lebens darin gelassen haben könnte, einen Zettel oder einen Pfeifenreiniger als Lesezeichen oder auch nur ein paar Tabakkrumen. Das bringt sie aus der Fassung.
»Nichts Wichtiges«, sagte er. »Ich bin nur gekommen, um sie abzugeben.«
Er wandte sich vom Schreibtisch ab, aber verließ die Bücherei nicht sogleich. Er war seit Jahren nicht mehr dort gewesen. Zwischen den beiden Fenstern zur Straße hing das Porträt seines Vaters, da wo es immer hängen würde.
A. V. Doud, Gründer der Orgelfabrik Doud und Stifter dieser Bücherei. Ein Mann, der an Fortschritt, Kultur und Bildung glaubte. Ein treuer Freund der Stadt Carstairs und des werktätigen Mannes.
Der Schreibtisch der Bibliothekarin stand im Bogengang zwischen dem vorderen und dem hinteren Saal. Die Bücher standen in Regalen, die im hinteren Saal lange Reihen bildeten. Zwischen ihnen hingen Lampen mit grünen Schirmen und langen Zugschnüren von der Decke. Arthur erinnerte sich, dass man vor Jahren bei einer Ratsversammlung darüber verhandelt hatte, ob man Sechzig-Watt-Birnen kaufen könne, statt vierziger. Den Antrag hatte damals diese Bibliothekarin gestellt, und sie hatten ihm stattgegeben.
Im vorderen Raum gab es Holzständer mit Zeitungen und ein paar schwere runde Tische mit Stühlen, an denen Leute sitzen und lesen konnten, und viele Reihen dicker dunkler Bücher hinter Glas. Lexika wahrscheinlich und Atlanten und Enzyklopädien. Zwei hübsche hohe Fenster gingen auf die Hauptstraße hinaus, und zwischen ihnen hing Arthurs Vater. Die weiteren Bilder im Raum hingen zu hoch und waren zu schlecht beleuchtet und zu stark bevölkert, als dass jemand von unten leicht hätte erkennen können, was darauf zu sehen war. (Später, als Arthur viele Stunden in der Bücherei zugebracht und mit der Bibliothekarin über die Bilder gesprochen hatte, wusste er, dass eines davon die Schlacht von Flodden Field darstellte, wo der König von Schottland bergab in eine Rauchwolke galoppierte, eines die Bestattung des jungen Königs von Rom und eines den Streit zwischen Oberon und Titania aus dem Sommernachtstraum.)
Er setzte sich an einen der Lesetische, von denen er aus dem Fenster schauen konnte. Er nahm eine alte Ausgabe des National Geographic, die dort lag. Er wandte der Bibliothekarin den Rücken zu. Das empfand er als taktvoll, da sie ein wenig aufgelöst wirkte. Andere Leute kamen, und er hörte sie mit ihnen reden. Ihre Stimme klang wieder recht normal. Immer wieder dachte er, dass er gleich gehen wolle, aber er tat es nicht.
Ihm gefiel das hohe, gardinenlose Fenster im vollen Licht des Frühlingsabends, und ihm gefielen die Würde und die Ordnung dieser Räume. Die Vorstellung, dass erwachsene Menschen hier ein und aus gingen und in einem fort Bücher lasen, erschien ihm auf angenehme Weise wundersam. Woche für Woche, ein Buch nach dem anderen, ein ganzes Leben lang. Er selbst las in großen Abständen mal ein Buch, meist auf eine Empfehlung hin, und genoss es für gewöhnlich, und ansonsten las er Zeitschriften, um sich auf dem Laufenden zu halten, und kam nie auf die Idee, ein Buch zu lesen, bis ihm wieder eins gleichsam zufällig in die Hände fiel.
Dann und wann gab es kurze Phasen, in denen niemand außer ihm und der Bibliothekarin in der Bücherei waren.
In einer davon kam sie in seine Nähe, um einige Zeitungen in den Ständer zu räumen. Als sie damit fertig war, sprach sie ihn an, mit kontrolliertem Nachdruck.
»Der Bericht über den Unfall, der in der Zeitung stand – ich nehme an, er war mehr oder weniger genau?«
Arthur entgegnete, er sei möglicherweise zu genau gewesen.
»Warum? Warum sagen Sie das?«
Er nannte die unendliche Gier der Öffentlichkeit nach Einzelheiten. Sollte die Zeitung die bedienen?
»Ach, ich finde das normal«, sagte die Bibliothekarin. »Ich finde es normal, das Schlimmste wissen zu wollen. Die Leute wollen es bildlich vor Augen haben. Das geht mir genauso. Ich habe keine Ahnung von Maschinen. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, was passiert ist. Selbst mit Hilfe der Zeitung. Hat die Maschine sich unerwartet verhalten?«
»Nein«, sagte Arthur. »Es war nicht so, dass die Maschine ihn gepackt und in sich hineingefressen hat wie ein Tier. Er hat eine falsche Bewegung gemacht oder zumindest eine leichtsinnige Bewegung. Und da war er geliefert.«
Sie sagte nichts, entfernte sich aber auch nicht wieder.
»Man muss immer auf der Hut sein«, sagte Arthur. »Keinen Augenblick träumen. Eine Maschine ist ein Knecht, und zwar ein ausgezeichneter Knecht, aber sie ist ein idiotischer Herr.«
Er fragte sich, ob er das irgendwo gelesen oder es sich selbst ausgedacht hatte.
»Und ich nehme an, man kann die Leute nicht davor schützen?«, sagte die Bibliothekarin. »Aber das wissen Sie bestimmt alles.«
Doch an diesem Punkt verließ sie ihn. Es war jemand gekommen.
Auf den Unfall folgte plötzlich warmes Wetter. Die Länge der Abende und die Wärme der lauen Tage wirkten unvermittelt und überraschend, so als verabschiedete sich der Winter in diesem Teil des Landes nicht fast ausnahmslos auf diese Weise. Die Wasserpfützen auf den Feldern schrumpften wie von Zauberhand und zogen sich in die Sümpfe zurück, die Blätter schossen aus den geröteten Zweigen hervor, und bäuerliche Gerüche trieben in die Stadt und vermischten sich mit dem Duft von Flieder.
Arthur stellte fest, dass er an solchen Abenden, statt sich nach frischer Luft zu sehnen, an die Bücherei dachte, und dort landete er dann oft, auf demselben Platz, den er bei seinem ersten Besuch gewählt hatte. Dort blieb er eine halbe oder eine ganze Stunde sitzen. Er blätterte in den Illustrated London News oder im National Geographic oder im Saturday Night oder Collier’s. Diese Zeitschriften kamen alle zu ihm ins Haus, und er hätte dort sitzen können, in seinem Arbeitszimmer, und auf seinen von Hecken gesäumten Rasen hinausblicken können, den der alte Agnew leidlich gepflegt hielt, und auf die Blumenbeete, die jetzt voller Tulpen in allen erdenklichen Farben und Kombinationen standen. Offenbar zog er den Anblick der Hauptstraße vor, auf der dann und wann ein flotter neuer Ford vorbeifuhr oder ein stotterndes älteres Modell mit einem staubigen Tuchverdeck. Und das Postamt, dessen Uhrturm in den vier verschiedenen Himmelsrichtungen vier verschiedene Zeiten anzeigte – allesamt, wie die Leute gerne sagten, verkehrt. Und das Treiben und Herumstehen auf dem Bürgersteig. Die Leute, die versuchten, dem Trinkbrunnen Wasser zu entlocken, obwohl er erst Anfang Juli in Betrieb genommen wurde.
Es war nicht, dass er ein Bedürfnis nach Geselligkeit verspürte. Er kam nicht, um zu plaudern, obwohl er Leute begrüßte, wenn er sie mit Namen kannte, und tatsächlich kannte er die meisten. Und er wechselte wohl auch ein paar Worte mit der Bibliothekarin, auch wenn es oft nicht mehr war als »Guten Abend«, wenn er kam, und »Gute Nacht«, wenn er wieder ging. Er fiel niemandem zur Last. Er empfand sein Dortsein als belebend, beruhigend und vor allem natürlich. Hier zu sitzen, zu lesen und nachzudenken – hier anstatt zu Hause – erschien wie eine Form der Fürsorge. Die Leute konnten auf ihn zählen.
Es gab einen Ausdruck, der ihm gefiel. Diener des Volkes.