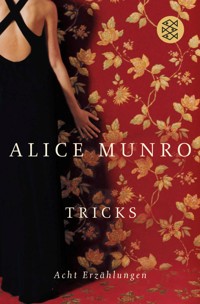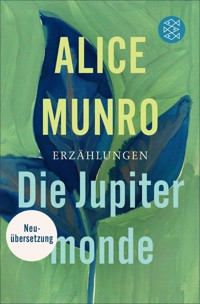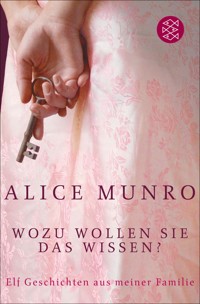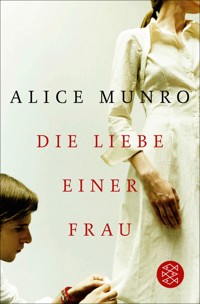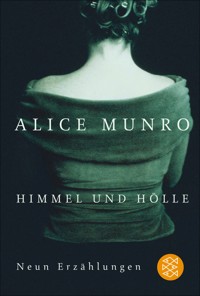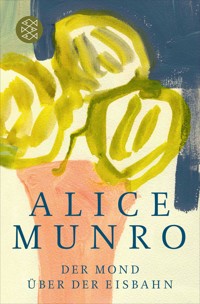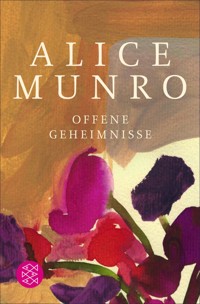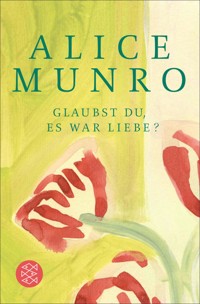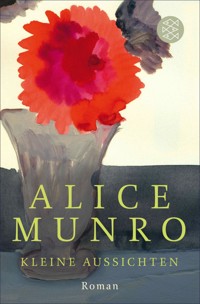
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der einzige Roman der Nobelpreisträgerin Alice Munro – ein frühes Meisterwerk! »In der Anlage autobiographisch, nicht aber in den Details«, so hat Alice Munro ihren Roman ›Kleine Aussichten‹ beschrieben: Die junge Del Jordan wächst auf der Fuchsfarm ihres Vaters in dem verschlafenen Provinznest Jubilee auf. Ihre Freundinnen interessieren sich fürs Heiraten, die Tanten sind mit Bodenschrubben, Backen, Bügeln und der Suche nach Gott beschäftigt. Als die Mutter ein Haus in der Stadt mietet, lernt Del eine neue Welt kennen: Die der Bücher, der ersten Liebe, der Suche nach einem eigenen Platz in der Welt. Das virtuose Porträt einer jungen Frau – und einmal mehr Weltliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alice Munro
Kleine Aussichten
Roman
Über dieses Buch
Der einzige Roman der Nobelpreisträgerin Alice Munro – ein frühes Meisterwerk.
»In der Anlage autobiographisch, nicht aber in den Details«, so hat Alice Munro ihren Roman ›Kleine Aussichten‹ beschrieben: Die junge Del Jordan wächst auf der Fuchsfarm ihres Vaters in dem verschlafenen Provinznest Jubilee auf. Ihre Freundinnen interessieren sich fürs Heiraten, die Tanten sind mit Bodenschrubben, Backen, Bügeln und der Suche nach Gott beschäftigt. Als die Mutter ein Haus in der Stadt mietet, lernt Del eine neue Welt kennen: die der Bücher, der ersten Liebe, der Suche nach einem eigenen Platz in der Welt. Das virtuose Porträt einer jungen Frau – und einmal mehr Weltliteratur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alice Munro, geboren 1931 in Wingham, Ontario, ist eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie erhielt 2013 die höchste Auszeichnung für Literatur – den Nobelpreis. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde zuvor bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Giller Prize, dem Book Critics Circle Award sowie dem Man Booker International Prize. Alice Munro lebt in Ontario, Kanada.
Im Fischer Taschenbuch Verlag liegen vor: ›Himmel und Hölle‹ (Bd. 15707), ›Die Liebe einer Frau‹ (Bd. 15708), ›Der Traum meiner Mutter‹ (Bd. 16163), ›Tricks‹ (Bd. 16818), ›Wozu wollen Sie das wissen?‹ (Bd. 16969), ›Zu viel Glück‹ (Bd. 18686), ›Liebes Leben‹ (Bd. 18691), ›Tanz der seligen Geister‹ (Bd. 18875), ›Was ich dir schon immer sagen wollte‹ (Bd. 18876), ›Offene Geheimnisse‹ (Bd. 03096) und ›Glaubst du, es war Liebe‹ (Bd. 03097).
Weitere Informationen finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1971 unter dem Titel
›Lives of Girls and Women‹ bei McGraw-Hill Ryerson Ltd., New York
© Alice Munro, 1971
Der Band wurde 1983 zum ersten Mal
im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, auf Deutsch veröffentlicht.
Die Übersetzung wurde für die vorliegende Ausgabe neu durchgesehen.
Für diese Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Leanne Shapton
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403361-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Jim
Dieser Roman ist der [...]
Flats Road
Die Erben des lebenden Körpers
Prinzessin Ida
Zeit der Gläubigkeit
Veränderungen und Zeremonien
Aus dem Leben von Mädchen und Frauen
Taufe
Epilog. Der Fotograf
Für Jim
Dieser Roman ist der Anlage nach autobiographisch, nicht aber in den Details. Weder meine Familie noch meine Nachbarn oder Freunde dienten als Vorlage. A.M.
Flats Road
Wir verbrachten ganze Tage am Wawanash River und halfen Onkel Benny beim Fischen. Wir fingen für ihn die Frösche. Wir jagten sie, beschlichen sie, krochen ihnen nach unter den Weiden am schlammigen Flussufer und in den sumpfigen Löchern voller Wolfsdisteln und Riedgras, das haarfeine, zunächst unsichtbare Schnitte in unseren nackten Beinen hinterließ. Alte Frösche waren schlau genug, sich vor uns zu verstecken, aber sie wollten wir auch nicht; wir waren hinter den schmächtigen jungen, grünen her, den prächtigen halbwüchsigen, die kühl und schleimig waren; wir ließen sie lustvoll durch unsere Hände glitschen, dann in einen Honigeimer plumpsen und setzten den Deckel darauf. Dort blieben sie, bis Onkel Benny so weit war, sie an den Haken zu stecken.
Er war kein Onkel. Nicht unser und überhaupt.
Er stand ein Stück weit draußen in dem seichten braunen Wasser, da, wo der schlammige Grund in Kiesel und Sand übergeht. Jeden Tag, sein Leben lang, wo man ihn auch sah, trug er die gleichen Sachen – Gummistiefel, Overall, kein Hemd, einen verschossenen schwarzen Sakko, der zugeknöpft war und ein V von rauer roter Haut mit einem feinen weißen Rand sehen ließ. Dem Filzhut auf seinem Kopf waren ein schmales Band und zwei kleine Federn geblieben, die vom Schweiß ganz dunkel geworden waren.
Obwohl er sich nie umdrehte, merkte er es stets, wenn wir einen Fuß ins Wasser setzten.
»Ihr Gören wollt im Schlamm rumplanschen und mir die Fische verscheuchen, verschwindet und macht das woanders, haut ab von meinem Ufer.«
Es gehörte ihm nicht. Genau hier, wo er gewöhnlich fischte, gehörte das Ufer uns. Aber auf den Gedanken kamen wir nicht. In seiner Vorstellung gehörten der Fluss und das wilde Buschland und der Grenochsumpf mehr oder weniger ihm, weil er dies alles besser kannte als jeder andere. Er behauptete, er sei der Einzige, der den Sumpf vollständig durchquert und nicht bloß kleine Vorstöße an den Rändern unternommen habe. Er sagte, dort drinnen gebe es ein Treibsandloch, in dem ein Zweitonner verschwinden würde wie ein Bissen zum Frühstück. (Er sagte »quicksand«, und in meiner Phantasie sah ich es glänzen und nasstrocken kullern, weil ich es mit Quecksilber verwechselte.) Er sagte, es gebe im Wawanash Stellen, die auch mitten im Sommer zwanzig Fuß tief seien. Er sagte, er könnte uns dorthin mitnehmen, aber er tat es nie.
Er war immer bereit, beim leisesten Schimmer von Zweifel beleidigt zu sein.
»Ihr werdet noch in so eins reinfallen, dann glaubt ihr mir.«
Er hatte einen mächtigen schwarzen Schnurrbart, wilde Augen, ein schlaues Räubergesicht. Er war nicht so alt, wie man nach seinen Kleidern, seinem Schnurrbart, seinem Verhalten meinen mochte; er gehörte zu der Sorte Mann, die schon zu unerschütterlichen Exzentrikern werden, bevor sie zwanzig sind. In allen seinen Äußerungen, Vorhersagen, Urteilen lag eine geballte Leidenschaft. Auf unserem Hof schaute er einmal zu einem Regenbogen hinauf und rief: »Wisst ihr, was das ist? Das ist das Versprechen Gottes, dass es nie wieder eine Sintflut geben wird!« Seine Stimme bebte angesichts der Tragweite dieses Versprechens, als wäre es eben erst gemacht worden und er selbst wäre der Überbringer.
Wenn er die Fische gefangen hatte, die er haben wollte (er warf Schwarzbarsche zurück, behielt aber Döbel und Rotflosser und sagte, der Rotflosser sei ein schmackhafter Fisch, obwohl er so voller Gräten sei wie ein Nadelkissen voller Nadeln), kletterten wir aus der schattigen Flussmulde heraus und liefen über die Felder zu seinem Haus. Owen und ich gingen auch barfuß mühelos über Stoppeln. Manchmal folgte uns unser ungeselliger Hund Major in einigem Abstand. Drüben am Rand des Dickichts – des Dickichts, das eine Meile weiter in den Sumpf überging – stand Onkel Bennys Haus, groß und silbergrau, aus alten ungestrichenen Brettern, die im Sommer trocken gebleicht wurden, und dunkelgrünen zerschlissenen und zerfetzten Jalousien, die an allen Fenstern heruntergelassen waren. Das Gestrüpp dahinter war schwarz, heiß, dornenverfilzt und erfüllt von Insekten, die in Myriaden herumschwirrten.
Zwischen dem Haus und dem Buschland standen mehrere Gehege, in denen er immer ein paar gefangene Tiere hielt – ein halbzahmes goldfarbenes Frettchen, ein Paar Wildnerze, eine Rotfüchsin, die sich in einer Falle das Bein verletzt hatte. Sie hinkte und heulte bei Nacht und hieß Duchess. Für die Waschbären brauchte er kein Gehege. Sie lebten rund um den Hof und in den Bäumen, zahmer als Katzen, und kamen an die Tür, um sich füttern zu lassen. Sie mochten Kaugummi. Auch Eichhörnchen kamen und saßen keck auf den Fenstersimsen und stöberten in den Zeitungshaufen auf der Veranda.
In der Erde neben der Hauswand gab es außerdem noch eine Art flaches Gehege oder Loch, das auf den drei freien Seiten fast zwei Fuß hoch von festgenagelten Brettern umgeben war. Dort hatte Onkel Benny die Schildkröten gehalten. In einem Sommer hatte er alles andere aufgegeben, um Schildkröten zu fangen. Er sagte, er werde sie einem Amerikaner aus Detroit verkaufen, der ihm fünfunddreißig Cents das Pfund bezahlen wolle.
»Macht man Suppe draus«, sagte Onkel Benny, während er sich über das Gehege für die Schildkröten beugte. Sosehr ihn das Zähmen und Füttern der Tiere freute, sosehr freute ihn auch ihr unerfreuliches Schicksal.
»Schildkrötensuppe!«
»Für Amerikaner«, sagte Onkel Benny, als ob das alles erklärte. »Ich selber würde sie nicht anrühren.«
Entweder erschien der Amerikaner nicht, oder er wollte nicht bezahlen, was Onkel Benny verlangte, oder er war ohnehin nur ein Gerücht gewesen – aus dem Plan wurde nichts. Ein paar Wochen später machte Onkel Benny, wenn man Schildkröten erwähnte, ein ausdrucksloses Gesicht und sagte in einem Ton, als bedauerte er, dass man so weit hinter der Zeit zurück war: »Ach, darüber werde ich mir doch nicht mehr den Kopf zerbrechen.«
Wenn er auf seinem Lieblingsstuhl gleich neben unserer Küchentür saß – er saß stets dort, als habe er kaum Zeit sich zu setzen, wolle niemanden stören, werde in einer Minute wieder fort sein –, war Onkel Benny immer voller Neuigkeiten über irgendeine Geschäftsidee, immer etwas Außergewöhnliches, mit dem Leute gar nicht weit weg von uns, unten im Süden des County oder noch näher im Ortsgebiet von Grantly, unglaubliche Summen verdienten. Sie züchteten Chinchillas. Sie züchteten Wellensittiche. Sie verdienten zehntausend Dollar im Jahr und brauchten kaum dafür zu arbeiten. Wahrscheinlich war der Grund, warum er immer weiter bei meinem Vater arbeitete, obwohl er nie länger in einem anderen Job gearbeitet hatte, dass mein Vater Silberfüchse züchtete und dass ein solcher Beruf etwas Unsicheres und Ungewöhnliches an sich hatte, eine zauberhafte und ungreifbare, nie verwirklichte Hoffnung auf Reichtum.
Er nahm die Fische auf seiner Veranda aus, und wenn ihm nach Essen war, briet er schnell ein paar in einer Pfanne, in der noch das alte verbrannte Fett war. Er aß aus der Pfanne. Ganz gleich, wie heiß und hell es draußen war, hatte er immer ein Licht brennen, eine nackte Birne, die an der Decke hing. Die vielen, vielen Schichten von Gerümpel und der Schmutz im Haus verschluckten Licht.
Wenn Owen und ich heimgingen, versuchten wir manchmal, die Dinge aufzuzählen, die er in seinem Haus oder bloß in seiner Küche hatte.
»Zwei Toaster, einen mit Klappen und einen, wo man das Brot drauflegt.«
»Einen Autositz.«
»Eine aufgerollte Matratze. Ein Akkordeon.«
Aber wir schafften nicht einmal die Hälfte, das wussten wir. Die Dinge, an die wir uns erinnerten, hätte man aus dem Haus fortnehmen können, und sie wären nie vermisst worden; sie waren nur einige erkennbare und identifizierbare Dinge zuoberst auf einem riesigen Haufen, einem üppigen, dunklen, verrottenden Durcheinander aus Teppichen, Linoleum, Möbelteilen, Maschinenteilen, Nägeln, Draht, Werkzeugen, Geräten. Es war das Haus, in dem Onkel Bennys Eltern ihr ganzes Eheleben lang gewohnt hatten. (Ich konnte mich noch vage an sie erinnern, wie sie alt und dick und halbblind, in viele dunkle Schichten zerschlissener Kleider gehüllt, auf der Veranda in der Sonne saßen.) Ein Teil der angehäuften Dinge ging also auf fünfzig oder mehr Jahre Familienleben zurück. Aber es waren auch weggeworfene Sachen anderer Leute dabei, die sich Onkel Benny erbat und heimbrachte oder die er gar vom Müllplatz in Jubilee holte. Angeblich hoffte er, die Sachen zusammenzuflicken und wieder brauchbar zu machen und sie dann zu verkaufen. Wenn er in einer Stadt gewohnt hätte, hätte er einen riesigen Trödelladen gehabt; er hätte sein Leben zwischen fleckigen Möbeln und Bergen ausgedienter Geräte, angeschlagener Schüsseln und verstaubter Bilder von Verwandten anderer Leute verbracht. Er schätzte Abfall um seiner selbst willen und gab nur vor, sowohl sich selbst als auch anderen gegenüber, dass er vorhabe, irgendeinen praktischen Nutzen daraus zu ziehen.
Aber das Liebste an seinem Haus waren mir die Zeitungen auf der Veranda; ihrer wurde ich niemals müde. Er bekam weder den ›Herald-Advance‹ aus Jubilee, noch die Stadtzeitung, die mit einem Tag Verspätung in unserem Briefkasten landete. Er hatte kein Abonnement des ›Family Herald‹ oder der ›Saturday Evening Post‹. Seine Zeitung kam einmal in der Woche und war schlecht und auf billiges Papier gedruckt, mit drei Zoll hohen Schlagzeilen. Sie war seine einzige Informationsquelle über die Außenwelt, da er selten ein funktionierendes Radio besaß. Es war eine ganz andere Welt als die, über die meine Eltern in der Zeitung lasen oder in den täglichen Nachrichten hörten. Die Schlagzeilen hatten nichts mit dem Krieg zu tun, der um diese Zeit begann, oder mit Wahlen oder Hitzewellen oder Unfällen, sondern lauteten folgendermaßen:
VATER VERFÜTTERT ZWILLINGSTÖCHTER AN SCHWEINE
FRAU BRINGT MENSCHLICHEN AFFEN ZUR WELT
JUNGFRAU AM KREUZ VON DURCHGEDREHTEN MÖNCHEN VERGEWALTIGT
RUMPF DES EHEMANNS MIT DER POST VERSCHICKT
Ich saß oft am Rand der abschüssigen Veranda und las, während meine Füße die Federnelken streiften, die Onkel Bennys Mutter gepflanzt haben musste. Schließlich sagte Onkel Benny: »Du kannst die Zeitungen mitnehmen, wenn du willst. Ich hab sie ausgelesen.«
Ich war klug genug, dies nicht zu tun. Ich las schneller und schneller, was ich nur aufnehmen konnte, und wirbelte dann hinaus in die Sonne, auf den Weg, der quer über die Felder zu unserem Haus führte. Mir war schummrig, und ich war übervoll von Enthüllungen des Bösen, seiner Vielseitigkeit und großartigen Erfindungskraft und seinem erschreckenden Übermut. Aber je mehr ich mich unserem Haus näherte, umso mehr verblasste diese Vision. Wie kam es, dass die nüchterne Rückwand des Elternhauses, die blassen bröckelnden Backsteine, die betonierte Fläche vor der Küchentür, die an Nägeln aufgehängten Waschzuber, die Pumpe, der Fliederbusch mit den braunfleckigen Blättern es zweifelhaft erscheinen ließen, dass eine Frau tatsächlich den Rumpf ihres Mannes, in Weihnachtspapier gewickelt, mit der Post an seine Freundin in Süd-Carolina schicken würde?
Unser Haus stand am Ende der Flats Road, die von Buckles Laden nach Westen verlief, am Rand der Stadt. Dieser schäbige Holzladen, der von vorn so schmal war, dass er wie ein aufgestellter Pappkarton wirkte, aufs Geratewohl bepflastert mit bemalten Metallschildern, die Mehl, Tee, Haferflocken, Erfrischungsgetränke, Zigaretten anpriesen, war für mich immer das Zeichen, dass die Stadt zu Ende war. Gehsteige, Straßenlampen, schattenspendende Baumreihen, Milch- und Eiskarren, Vogelbäder, Blumenrabatten, Veranden mit Korbstühlen, von denen Frauen die Straße beobachteten – all diese zivilisierten, begehrenswerten Dinge lagen hinter uns, und wir (Owen und ich nach der Schule, meine Mutter und ich, wenn wir Samstagnachmittag vom Einkaufen kamen) gingen auf der breiten, gewundenen Flats Road, von Buckles Laden bis zu unserem Haus ohne Schatten, zwischen verunkrauteten Feldern, die je nach Jahreszeit gelb von Löwenzahn, wildem Senf oder Goldruten waren. Die Häuser hier lagen weiter auseinander und sahen überhaupt vernachlässigter, ärmlicher und bizarrer aus, als es bei Stadthäusern jemals möglich wäre; eine halbe Wand wurde angestrichen und dann vergessen, mitsamt der Leiter; die Spuren einer abgerissenen Veranda blieben sichtbar, eine Vordertür ohne Stufen drei Fuß über dem Boden; manche Fenster waren mit vergilbten Zeitungen statt mit Jalousien abgedeckt.
Die Flats Road gehörte nicht zur Stadt, aber sie gehörte auch nicht zum Land. Die Flussbiegung und der Grenochsumpf schnitten sie von der Ortschaft ab, zu der sie nominell gehörte. Es gab dort keine richtigen Farmen. Es gab die Anwesen von Onkel Benny und den Potters, fünfzehn und zwanzig Morgen, wobei Onkel Bennys Land verwilderte. Die Pottersöhne züchteten Schafe. Wir hatten neun Morgen und züchteten Füchse. Die meisten Leute hatten ein oder zwei Morgen und ein wenig Vieh, gewöhnlich eine Kuh und Hühner und manchmal etwas Ausgefalleneres, was man nicht auf einer normalen Farm fand. Die Potters besaßen eine Ziegenfamilie, die sie frei laufen ließen, damit sie längs der Straße grasen konnte. Sandy Stevenson, ein Junggeselle, hielt einen kleinen grauen Esel, der wie eine Illustration zu einer biblischen Geschichte in der steinigen Ecke eines Feldes weidete. Der Betrieb meines Vaters war hier nichts Ungewöhnliches.
Mitch Plim und die Potters waren die Schwarzbrenner in der Flats Road. Ihr Verhalten war unterschiedlich. Die beiden Potters waren fröhlich, aber auch gewalttätig, wenn sie betrunken waren. Sie nahmen Owen und mich in ihrem Pick-up von der Schule mit nach Hause; wir saßen hinten und wurden von einer Seite auf die andere geschleudert, weil sie so schnell und durch so viele Schlaglöcher fuhren; meine Mutter schnappte nach Luft, als sie davon hörte. Mitch Plim wohnte in dem Haus mit den Zeitungen vor den Fenstern; er trank selbst nicht, war durch Rheumatismus verkrüppelt und sprach mit niemandem; seine Frau kam zu jeder Tageszeit in einem zerlumpten, mit Volants besetzten Morgenrock und mit nackten Füßen zum Briefkasten. Ihr ganzes Haus schien so viel Böses und Geheimnisvolles zu verkörpern, dass ich es nie direkt ansehen mochte, mit streng geradeaus gerichtetem Gesicht daran vorbeiging, und mir alle Mühe gab, nicht zu rennen.
Außerdem wohnten zwei Schwachsinnige in der Straße. Der eine war Frankie Hall; er wohnte bei seinem Bruder Louie Hall, der in einem ungestrichenen, mit einer falschen Fassade verkleideten Lagerschuppen neben Buckles Laden eine Uhrenreparatur betrieb. Er war dick und bleich wie etwas, das aus Seife geschnitzt ist. Er saß draußen in der Sonne neben dem schmutzigen Ladenfenster, in dem Katzen schliefen. Die andere war Irene Pollox, und sie war weder so freundlich noch so schwachsinnig wie Frank; sie jagte den Kindern auf der Straße nach oder hängte sich über ihr Gartentor und krähte und schlug mit den Armen wie ein betrunkener Hahn. Also war es auch gefährlich, ihr Haus zu passieren, und man musste einen Vers hersagen, den jedermann kannte:
»Verschwinde, Irene, verschwinde
Oder ich häng dich an den Titten in die Linde!«
Ich sagte ihn her, wenn ich mit meiner Mutter vorbeiging, aber war schlau genug, aus den Titten Füße zu machen. Woher kam dieser Vers? Sogar Onkel Benny sagte ihn. Irene war weißhaarig, nicht wegen ihres Alters, sondern weil sie so geboren war, und auch ihre Haut war so weiß wie Gänsefedern.
In der Flats Road zu leben war für meine Mutter das Letzte. Sobald sie den städtischen Gehweg betrat und den Kopf hob, dankbar für den Schatten in der Stadt nach der Sonne auf der Flats Road, strömte sie ein Gefühl der Erleichterung, ein neues Gefühl von Würde aus. Sie schickte mich zu Buckles Laden, wenn ihr etwas ausgegangen war, aber ihre richtigen Einkäufe machte sie in der Stadt. Charlie Buckle schnitt manchmal Fleisch im hinteren Raum, wenn wir vorbeigingen; dann konnten wir ihn durch das dunkle Fliegengitter sehen, leicht verzerrt wie eine Figur in einem Mosaik, und senkten die Köpfe und gingen schnell und hofften, dass er uns nicht bemerkte.
Meine Mutter berichtigte mich, wenn ich sagte, wir würden in der Flats Road wohnen; sie sagte, wir wohnten am Ende der Flats Road, als ob das etwas ganz anderes wäre. Zu späterer Zeit stellte sie fest, dass sie auch nach Jubilee nicht gehörte, aber in diesem Moment nahm sie es voll Hoffnung und mit Freuden an und sorgte dafür, dass es sie ebenfalls zur Kenntnis nahm, indem sie Frauen, die sich mit überraschten, aber doch freundlichen Gesichtern zu ihr umdrehten, laut grüßte oder sich in der dunklen Gemischtwarenhandlung auf einen der hohen Hocker setzte und darum bat, dass ihr jemand ein Glas Wasser brächte nach dem heißen, staubigen Weg. Damals folgte ich ihr noch ohne Verlegenheit und freute mich über das Aufsehen.
Meine Mutter war in der Flats Road nicht beliebt. Sie sprach mit den Leuten hier nicht so freundlich wie in der Stadt, sondern betont höflich und irgendwie auffallend korrekt. Mit Mitch Plims Frau – die früher, obwohl ich es damals nicht wusste, in Mrs McQuades Bordell gearbeitet hatte – sprach sie überhaupt nicht. Sie stand auf der Seite der Armen in aller Welt, der Schwarzen und der Juden und der Chinesen und der Frauen, aber Trunkenheit konnte sie nicht ertragen, nein, und auch keine sexuelle Zügellosigkeit, keine ordinäre Sprache, kein ungeregeltes Leben, keine selbstgefällige Dummheit; und so musste sie die Leute von der Flats Road aus der Reihe der Unterdrückten und Besitzlosen, der wirklich Armen, die sie immer noch liebte, ausnehmen.
Mein Vater war anders. Jeder mochte ihn. Er mochte die Flats Road, obwohl er selbst kaum trank, sich Frauen gegenüber nicht gehenließ und nicht ordinär redete, und obwohl er an Arbeit glaubte und ständig hart arbeitete. Er fühlte sich hier wohl, während er sich mit Männern aus der Stadt, überhaupt mit allen Männern, die bei der Arbeit Hemd und Krawatte trugen, unwillkürlich verunsichert fühlte, ein wenig stolz und empfindlich gegen Kränkungen – mit jener feinen, besonderen Bereitschaft, Anmaßung zu wittern, für die manche Leute vom Land eine besondere Begabung haben. Er war (wie meine Mutter, aber sie hatte all das hinter sich gelassen) auf einer Farm mitten auf dem Land aufgewachsen; aber er fühlte sich auch dort nicht zu Hause in den starren Traditionen, der stolzen Armut und der Monotonie des Farmlebens. Die Flats Road war ihm gut genug; Onkel Benny genügte ihm als Freund.
An Onkel Benny war meine Mutter gewöhnt. Er aß jeden Mittag an unserem Tisch, außer sonntags. Er klebte seinen Kaugummi auf das Ende der Gabel, und nach der Mahlzeit nahm er ihn ab und zeigte uns das Muster, das so hübsch in den zinnfarbigen Gummi eingegraben war, dass es ein Jammer war, ihn wieder zu kauen. Er goss den Tee in seine Untertasse und blies darauf. Mit einem auf eine Gabel gespießten Stück Brot wischte er seinen Teller so sauber wie den einer Katze. Er brachte einen Geruch mit in die Küche, der mir nicht missfiel, nach Fisch, Pelztieren, Sumpf. Er erinnerte sich seiner ländlichen Manieren und bediente sich nie selbst und nahm kein zweites Mal nach, ehe man ihn dreimal aufgefordert hatte.
Er erzählte Geschichten, in denen fast immer etwas geschah, was nach der festen Überzeugung meiner Mutter nicht geschehen sein konnte, wie in der Geschichte von Sandy Stevensons Hochzeit.
Sandy Stevenson hatte eine dicke Frau weit aus dem Osten, bereits außerhalb des County, geheiratet; sie hatte zweitausend Dollar auf der Bank, und sie besaß einen Pontiac. Sie war Witwe. Kaum war sie vor zwölf, fünfzehn Jahren hergekommen, um mit Sandy in der Flats Road zu wohnen, begann sich allerlei zu ereignen. Geschirr zerbrach nachts von selbst auf dem Fußboden. Ein Ragout flog von selbst vom Herd und bespritzte die Küchenwände. Sandy wachte in der Nacht auf und spürte, dass ihn etwas wie eine Ziege durch die Matratze anstieß, aber als er nachsah, war nichts unter dem Bett. Das beste Nachthemd seiner Frau wurde von oben bis unten aufgeschlitzt und mit der Schnur der Jalousie verknotet. Am Abend, wenn sie friedlich dasitzen und sich ein bisschen unterhalten wollten, klopfte es an die Wand, so laut, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Schließlich sagte die Frau zu Sandy, sie wisse, wer das tue. Es sei ihr toter Mann, der wütend auf sie sei, weil sie wieder geheiratet habe. Sie erkenne ihn an seinem Klopfen, das seien eindeutig seine Knöchel. Sie versuchten, ihn nicht zu beachten, aber es nützte nichts. Sie beschlossen, mit dem Wagen eine kleine Reise zu machen, um zu sehen, ob ihn das nicht davon abbringen würde. Aber er kam mit. Er saß oben auf dem Dach. Er trommelte mit den Fäusten auf das Dach des Wagens und stieß und schlug und schüttelte ihn so, dass Sandy ihn kaum auf der Straße halten konnte. Sandys Nerven gaben schließlich nach. Er fuhr an den Rand und sagte der Frau, sie solle das Steuer übernehmen, er werde aussteigen und zu Fuß nach Hause gehen oder sich von jemand mitnehmen lassen. Er riet ihr, in ihre Stadt zurückzufahren und zu versuchen, ihn zu vergessen. Sie brach in Tränen aus, stimmte aber zu, dass es das Einzige sei, was man tun könne.
»Aber Sie glauben das doch nicht, oder?«, sagte meine Mutter mit heiterem Nachdruck. Sie fing an zu erklären, warum das alles Zufall, Einbildung, Autosuggestion gewesen sei.
Onkel Benny warf ihr einen scharfen, mitleidigen Blick zu.
»Gehen Sie Sandy Stevenson fragen. Ich hab die Flecken gesehen, ich hab sie selber gesehen.«
»Was für Flecken?«
»Na, wo es ihn unter der Matratze gestoßen hat.«
»Zweitausend Dollar auf der Bank«, überlegte mein Vater, um zu verhindern, dass dieser Streit weiterging. »Das ist mir eine Frau. Du solltest dich nach so einer Frau umsehen, Benny.«
»Genau das werd ich tun«, sagte Onkel Benny im gleichen spaßig-ernsthaften Ton. »Demnächst, wenn ich mal dazu komme.«
»So eine Frau zu haben müsste eine feine Sache sein.«
»Das sag ich mir auch immer.«
»Die Frage ist nur: eine dicke oder eine dünne? Dicke sind meist gute Köchinnen, aber sie essen vielleicht viel. Aber das tun auch manche magere, schwer zu sagen. Manchmal erwischt man eine dicke, die mehr oder weniger von ihrem eigenen Fett lebt, die wäre wirklich sparsam für die Brieftasche. Pass auf, dass sie gute Zähne hat, entweder das oder gar keine und eine gute Garnitur falsche. Am besten, sie hat auch den Blinddarm und die Galle raus.«
»Du redest, als wolltest du eine Kuh kaufen«, sagte meine Mutter. Aber es machte ihr nicht wirklich etwas aus; sie hatte diese unvorhersehbaren Momente der Nachsicht, die sich später verloren, in denen sogar die Konturen ihres Körpers weicher zu werden schienen und die gleichgültigen Bewegungen, mit denen sie die Teller wegnahm, eine natürliche Überlegenheit bekamen. Sie war eine vollere, hübschere Frau, als sie es später war.
»Aber sie könnte dich zum Narren halten«, fuhr mein Vater ernst fort. »Dir sagen, ihre Gallenblase und ihr Blinddarm sind raus, aber sie sind doch noch drin. Lass dir besser die Narben zeigen.«
Onkel Benny bekam einen Schluckauf, wurde rot, lachte fast unhörbar und beugte sich tief über seinen Teller.
»Kannst du schreiben?«, fragte mich Onkel Benny in seinem Haus, als ich auf der Veranda las und er Teeblätter aus einer blechernen Teekanne schüttete; sie trieften über das Geländer.
»Wie lang gehst du schon zur Schule? In welcher Klasse bist du?«
»In der vierten, wenn sie wieder anfängt.«
»Komm hier rein.«
Er führte mich zum Küchentisch, räumte ein Bügeleisen, das er reparierte, und einen Kochtopf mit löchrigem Boden weg, brachte einen neuen Schreibblock, Tintenfass, Füllfederhalter. »Jetzt übst du hier mal ein bisschen schreiben.«
»Was soll ich denn schreiben?«
»Das ist mir gleich. Ich will nur sehen, wie du es machst.«
Ich schrieb seinen vollen Namen und seine Adresse: Mr Benjamin Thomas Poole, Flats Road, Jubilee, Wawanash, Provinz Ontario, Kanada, Nordamerika, Westliche Hemisphäre, Erde, Sonnensystem, Universum. Er schaute mir über die Schulter und sagte scharf: »Wo ist das im Verhältnis zum Himmel? Du bist nicht weit genug rausgegangen. Ist der Himmel nicht außerhalb vom Universum?«
»Universum bedeutet alles. Es ist alles, was es gibt.«
»Na gut, du meinst, du weißt so viel, aber was ist da, wenn du ans Ende davon kommst? Da muss irgendwas sein, sonst gäbe es kein Ende, es muss etwas anderes da sein, damit es ein Ende gibt, oder nicht?«
»Da ist nichts«, sagte ich unschlüssig.
»O doch, da ist etwas. Da ist der Himmel.«
»Na, und was ist da, wenn du ans Ende vom Himmel kommst?«
»Du kommst nie ans Ende vom Himmel, denn da ist Gott!«, sagte Onkel Benny triumphierend und betrachtete meine Schrift eingehend, die rund, zittrig und unsicher war. »Na, das kann jeder ohne Schwierigkeiten lesen. Ich möchte, dass du dich hier hinsetzt und einen Brief für mich schreibst.« Er konnte sehr gut lesen, aber er konnte nicht schreiben. Er sagte, die Lehrerin in der Schule habe ihn geschlagen und geschlagen, um das Schreiben in ihn hineinzuprügeln, und er habe sie deshalb geachtet, aber es habe zu nichts geführt. Wenn er einen Brief geschrieben haben wollte, bat er gewöhnlich meinen Vater oder meine Mutter darum.
Er beugte sich über mich, um zu sehen, was ich oben hinschrieb: Flats Road, Jubilee, 22. August 1942. »Das ist richtig, so macht man’s! Jetzt fang an. Werte Dame.«
»Man fängt mit Liebe an, und dann kommt der Name der Person«, sagte ich, »außer wenn es ein Geschäftsbrief ist, und dann muss man mit Sehr geehrter Herr anfangen oder mit Sehr geehrte Frau, wenn es eine Dame ist. Ist es ein Geschäftsbrief?«
»Es ist einer und doch keiner. Schreib hin Sehr geehrte Dame.«
»Wie heißt sie?«, sagte ich widerspenstig. »Ich könnte ebenso gut ihren Namen hinsetzen.«
»Ich weiß ihren Namen nicht.« Ungeduldig brachte mir Onkel Benny die Zeitung, seine Zeitung, blätterte sie von hinten auf, bei den Chiffreanzeigen, zu denen ich nie vordrang, und hielt sie mir unter die Nase:
»Frau mit Kind sucht Stellung im Haushalt bei Mann in ruhigem Haus auf dem Land. Liebt Landleben. Gegebenenfalls Heirat.«
»Das ist die Dame, der ich schreibe, also was kann ich anderes tun, als sie mit Dame anreden?«
Ich gab nach und schrieb es hin, malte ein großes, sorgfältiges Komma und wartete darauf, den Brief unter dem h von Sehr anzufangen, wie man es uns beigebracht hatte.
»Sehr geehrte Dame«, sagte Onkel Benny ungerührt, »ich schreibe diesen Brief –
Ich schreibe diesen Brief als Antwort auf das, was Sie in die Zeitung gesetzt haben, die ich mit der Post bekomme. Ich bin ein Mann von siebenunddreißig Jahren, lebe allein auf meinem eigenen Anwesen, das fünfzehn Morgen groß ist, draußen am Ende der Flats Road. Es steht ein gutes Haus darauf mit Steinfundament. Es ist dicht am Buschland, so dass wir im Winter nie Mangel an Brennholz haben. Es ist ein guter Brunnen da, der sechzig Fuß tief gebohrt ist, und eine Zisterne. Im Busch gibt es mehr Beeren, als man essen kann, und guten Fisch im Fluss, und man könnte einen schönen Gemüsegarten haben, wenn man die Kaninchen fernhalten könnte. Ich habe einen zahmen Fuchs in einem Gehege am Haus, auch ein Frettchen und zwei Nerze, und es gibt immer Waschbären und Eichhörnchen und Erdhörnchen in der Gegend. Ihr Kind wird willkommen sein. Sie sagen nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Wenn es ein Junge ist, könnte ich ihm beibringen, ein guter Trapper und Jäger zu werden. Ich habe einen Job bei einem Mann auf dem nächsten Anwesen, der Silberfüchse züchtet. Seine Frau ist gebildet, falls Sie Lust haben, Besuche zu machen. Ich hoffe, ich werde bald einen Brief von Ihnen bekommen. Mit den besten Grüßen
Benjamin Thomas Poole.«
Innerhalb einer Woche hatte Onkel Benny eine Antwort:
»Sehr geehrter Mr Benjamin Poole!
Ich schreibe im Namen meiner Schwester Miss Madeleine Howey, um Ihnen zu sagen, dass sie sich freuen wird, Ihr Angebot anzunehmen, und bereit ist, jederzeit nach dem 1. September zu kommen. Wie sind die Bus- oder Bahnverbindungen nach Jubilee? Oder vielleicht wäre es besser, wenn Sie hierherkämen, ich schreibe unsere volle Adresse ans Ende des Briefes. Unser Haus ist nicht schwer zu finden. Das Kind meiner Schwester ist kein Junge, es ist ein Mädchen von 18 Monaten und heißt Diane. In Erwartung, von Ihnen zu hören, verbleibe ich
Ihr sehr ergebener
Mason Howey
Chalmers Street 121
Kitchener, Ont.«
»Na, das ist riskant«, sagte mein Vater, als Onkel Benny uns den Brief am Tisch beim Essen zeigte. »Wieso meinst du, dass das diejenige ist, die du haben willst?«
»Es kann nichts schaden, sie mal anzusehen.«
»Mir klingt es, als wäre der Bruder ganz schön darauf aus, sie loszuwerden.«
»Gehen Sie mit ihr zu einem Arzt, lassen Sie sie ärztlich untersuchen«, sagte meine Mutter mit Nachdruck.
Onkel Benny sagte, das werde er bestimmt tun. Von da an gingen die Vorbereitungen rasch voran. Er kaufte sich neue Kleider. Er fragte, ob er den Wagen leihen könne, um nach Kitchener zu fahren. Er fuhr früh am Morgen in einem hellgrünen Anzug, weißem Hemd, einer grün, rot und orangefarbenen Krawatte, einem dunkelgrünen Filzhut und braunweißen Schuhen. Er hatte sich die Haare schneiden lassen und seinen Schnurrbart gestutzt, und er hatte sich gewaschen. Er sah fremd aus, blass und opfermütig.
»Nur Mut, Benny«, sagte mein Vater. »Du gehst nicht zu deiner eigenen Hinrichtung. Wenn dir die Sache dort nicht gefällt, kehr um und komm nach Hause.«
Meine Mutter und ich gingen mit Mopp, Besen, Kehrschaufel, Seife und Scheuerpulver, Old Dutch Cleanser, über die Felder. Aber meine Mutter war noch nie in dieser Küche gewesen, nie richtig drin, und es warf sie um. Sie fing an, Sachen auf die Veranda zu werfen, aber nach einer Weile sah sie, dass es hoffnungslos war. »Man müsste eine Grube graben und alles hineinwerfen«, sagte sie, setzte sich auf die Stufen, stützte das Kinn auf den Besenstiel wie eine Hexe in einer Geschichte und lachte. »Wenn ich nicht lachen würde, müsste ich weinen. Stell dir vor, sie kommt hierher. Sie wird keine Woche bleiben. Sie wird nach Kitchener zurückgehen, und wenn sie zu Fuß gehen muss. Entweder das, oder sie stürzt sich in den Fluss.«
Wir scheuerten den Tisch und zwei Stühle und den mittleren Teil des Fußbodens und rieben den Ofen mit Brotpapier ab und holten die Spinnweben über der Lampe herunter. Ich pflückte einen Strauß Goldruten und stellte sie mitten auf den Tisch. »Wozu das Fenster putzen«, sagte meine Mutter, »und noch mehr von dem Desaster hier drin beleuchten?«
Zu Hause sagte sie: »Also, ich denke, jetzt gehört meine Sympathie der Frau.«
Als es bereits dunkel geworden war, legte Onkel Benny die Schlüssel auf den Tisch. Er sah uns mit dem Blick eines Menschen an, der von einer langen Reise heimkommt, deren Abenteuer niemals richtig zu vermitteln sein werden, auch wenn er weiß, dass er es wird versuchen müssen.
»Ist alles gutgegangen?«, fragte mein Vater ermunternd. »Hat der Wagen irgendwelche Schwierigkeiten gemacht?«
»Nee, nee. Ist prima gelaufen. Einmal bin ich von der Strecke abgekommen, aber es hat nicht lang gedauert, bis ich gemerkt habe, was los war.«
»Hast du auf die Karte gesehen, die ich dir gegeben habe?«
»Nein, ich hab einen Mann auf einem Traktor gesehen und ihn gefragt, und er hat gesagt, ich soll umkehren.«
»Also bist du richtig hingekommen?«
»Ja, ja, ich bin richtig hingekommen.«
Meine Mutter schaltete sich ein. »Ich dachte, Sie würden Miss Howey auf eine Tasse Tee mitbringen.«
»Na, sie ist wohl müde von der Fahrt und allem und will das Kind ins Bett bringen.«
»Das Kind!«, sagte meine Mutter bedauernd. »Ich habe das Kind vergessen! Wo wird das Kind denn schlafen?«
»Wir werden irgendwas zurechtmachen. Ich glaube, ich habe ein Kinderbett irgendwo drüben, wenn ich da ein paar neue Leisten reinmache.« Er nahm seinen Hut ab, so dass ein roter Streifen über der schweißnassen Stirn sichtbar wurde: »Was ich sagen wollte, sie ist nicht mehr Miss Howey, sie ist Mrs Poole.«
»Na, Benny, Glückwunsch. Wünsch dir alles Gute. Hast dich in dem Augenblick entschlossen, als du sie gesehen hast, war es so?«
Onkel Benny kicherte nervös.
»Also, sie waren alle da. Sie hatten alles für die Hochzeit vorbereitet. Schon bevor ich hinkam. Sie hatten den Prediger da und den Ring gekauft und irgendeinen Burschen organisiert, der in aller Eile die Genehmigung beschaffte. Ich konnte sehen, dass sie an alles gedacht hatten. Alles, was man für eine Hochzeit braucht. Jawoll. Sie haben nichts ausgelassen.«
»Dann bist du jetzt ein verheirateter Mann, Benny.«
»Jaja, ein verheirateter Mann, das stimmt.«
»Sie müssen Ihre Braut herbringen«, sagte meine Mutter energisch. Dass sie das Wort Braut benutzte, war überraschend, dachte man dabei doch an lange weiße Schleier, Blumen, Feierlichkeiten, an die hier kein Gedanke war. Onkel Benny versprach es. Er sagte, ja, das werde er ganz bestimmt tun. Sobald sie sich von der Reise erholt hätte, ja, ganz bestimmt.
Aber er tat es nicht. Madeleine wurde nicht gesehen. Meine Mutter dachte, dass er jetzt mittags zum Essen heimgehen würde, aber er kam wie gewöhnlich in die Küche. Meine Mutter sagte: »Wie geht es Ihrer Frau? Wie kommt sie zurecht? Kennt sie sich mit diesem Ofen aus?«, und er antwortete auf alles mit unklarer Zustimmung, kicherte und schüttelte den Kopf.
Am späten Nachmittag, als er mit der Arbeit fertig war, sagte er zu mir: »Wollt ihr was sehen?«
»Was?«
»Kommt nur mit, dann werdet ihr schon sehen.«
Owen und ich folgten ihm über die Felder. Am Rand zu seinem Garten drehte er sich um und bedeutete uns anzuhalten.
»Owen möchte das Frettchen sehen«, sagte ich.
»Er wird auf ein anderes Mal warten müssen. Kommt nicht näher als bis hierher.«
Nach einiger Zeit kam er mit einem kleinen Kind aus dem Haus. Ich war enttäuscht; das war es also. Er stellte es auf den Boden. Es beugte sich unsicher vor und hob eine Krähenfeder auf.
»Sag, wie du heißt«, sagte Onkel Benny schmeichelnd. »Wie heißt du? Heißt du Di-ane? Sag den Kindern, wie du heißt.«
Sie wollte es nicht sagen.
»Sie kann gut sprechen, wenn sie will. Sie kann Mama und Benny und Di-ane sagen und Wassa tinken. Na? Wassa tinken?«
Ein Mädchen in einer roten Jacke kam auf die Veranda.
»Komm jetzt rein!«
Rief sie Diane oder Onkel Benny? Ihre Stimme war drohend. Onkel Benny hob das kleine Mädchen hoch und sagte leise zu uns: »Ihr lauft jetzt besser nach Hause. Ihr könnt ein anderes Mal kommen und das Frettchen sehen«, dann wandte er sich zum Haus.
Wir sahen sie von weitem, in derselben roten Jacke, als sie die Straße hinunter zu Buckles Laden ging. Ihre Hände steckten in den Jackentaschen, ihr Kopf war gebeugt, ihre langen Beine bewegten sich scherenartig. Meine Mutter traf sie schließlich im Laden. Sie legte es ausdrücklich darauf an. Sie sah Onkel Benny vor der Tür, mit Diane auf dem Arm, und fragte ihn, was er dort mache, und er sagte: »Wir warten nur auf ihre Mama.«
Also ging meine Mutter hinein und trat an die Ladentheke, wo das Mädchen wartete, während Charlie Buckle ihre Rechnung schrieb.
»Sie müssen Mrs Poole sein.« Sie stellte sich vor.
Das Mädchen sagte nichts. Sie schaute meine Mutter an, sie hörte, was sie sagte, aber sagte selbst nichts. Charlie Buckle warf meiner Mutter einen Blick zu.
»Ich nehme an, Sie haben viel zu tun gehabt, um sich einzurichten. Sie müssen herüberkommen und mich besuchen, wann immer Sie Lust haben.«
»Ich gehe nirgendwohin über Schotterstraßen, wenn ich nicht muss.«
»Sie könnten über das Feld kommen«, sagte meine Mutter, bloß weil sie nicht gehen und dem Mädchen das letzte Wort lassen wollte.
»Sie ist ein Kind«, sagte sie zu meinem Vater. »Sie ist nicht älter als siebzehn, keinesfalls. Sie trägt eine Brille. Sie ist sehr dünn. Sie ist nicht schwachsinnig, deshalb haben sie sie nicht loswerden wollen, aber sie ist vielleicht seelisch gestört oder instabil. Na, der arme Benny. Immerhin ist sie an den richtigen Ort gekommen. Sie passt gut in die Flats Road!«
Dort begann man, sie bereits kennenzulernen. Sie hatte Irene Pollox zurück in ihren eigenen Garten und die Stufen hinaufgejagt, sie auf die Knie gezwungen und ihr mit beiden Händen ins babyhaft weiße Haar gepackt. Das erzählten sich die Leute. Meine Mutter sagte: »Geht nicht rüber, lasst das Frettchen, ich möchte nicht, dass jemand zum Krüppel geschlagen wird.«
Ich ging trotzdem. Ich nahm Owen nicht mit, weil er es verraten würde. Ich dachte mir, ich würde an die Tür klopfen und sehr höflich fragen, ob es recht wäre, wenn ich die Zeitungen auf der Veranda läse. Aber noch ehe ich bis zu den Stufen kam, ging die Tür auf, und Madeleine kam mit einem Schürhaken in der Hand heraus. Vielleicht hatte sie gerade einen Ofenring hochgehoben, als sie mich hörte, sie hatte ihn vielleicht nicht absichtlich in die Hand genommen, aber ich konnte ihn nur als Waffe verstehen.
Einen Augenblick lang sah sie mich an. Ihr Gesicht war wie das von Diane, schmal, weiß, auf den ersten Blick undefinierbar. Ihr Zorn kam nicht sofort. Sie brauchte Zeit, sich seiner zu erinnern, Kräfte zu sammeln. Nicht, dass es, vom Augenblick an, wo sie mich erblickte, eine andere Möglichkeit gegeben hätte als Zorn. Zorn oder Schweigen schienen das Einzige zu sein, was sie zur Wahl hatte.
»Was kommst du hier herumspionieren? Warum spionierst du um mein Haus herum? Verschwinde mal lieber von hier.« Sie kam die Stufen herunter. Fasziniert trat ich den Rückzug nur so schnell an, wie es nötig war. »Du bist ein dreckiges kleines Luder. Eine dreckige kleine Schnüfflerin. Ein dreckiges kleines Schnüffel-Luder, nicht wahr?« Ihr kurzes Haar war ungekämmt, sie trug ein zerrissenes bedrucktes Kleid auf ihrem flachen jungen Körper. Ihre Heftigkeit wirkte gewollt, theatralisch; man wollte am liebsten stehen bleiben und zuschauen, als wäre es ein Schauspiel, und doch gab es keinen Zweifel, dass sie den Schürhaken, wenn sie ihn über den Kopf hob, auf meinen Schädel niedersausen lassen würde, wenn ihr danach zumute war – beziehungsweise wenn sie glaubte, dass die Szene es erforderte. Sie beobachtet sich dabei, dachte ich, und sie kann jeden Moment aufhören, auf gleichgültig schalten oder prahlen wie ein Kind: »Siehst du, wie ich dich erschreckt habe? Du hast nicht gewusst, dass ich nur Spaß mache, oder?«
Ich wünschte, ich könnte diese Szene mitnehmen und zu Hause davon erzählen. Geschichten über Madeleine wurden in der Flats Road hin- und hergereicht. Im Laden hatte sie sich über irgendwas aufgeregt und hatte eine Packung mit Damenbinden nach Charlie Buckle geworfen. (Zum Glück hatte sie nicht gerade eine Dose Sirup in der Hand!) Onkel Benny lebte in einem Hagelsturm von Schimpfereien, man konnte es von der Straße hören. »Da hast du dir einen Hitzkopf hergeholt, nicht, Benny?«, sagten die Leute, und dann kicherte er und nickte beschämt, als nähme er Glückwünsche entgegen. Nach einer Weile fing er an, selbst Geschichten zu erzählen. Sie hatte den Kessel durchs Fenster geworfen, weil kein Wasser darin war. Sie hatte die Schere genommen und seinen grünen Anzug zerschnitten, den er nur einmal bei seiner Hochzeit getragen hatte; er wusste nicht, was sie dagegen hatte. Sie hatte gedroht, das Haus anzuzünden, weil er ihr die falsche Zigarettenmarke gebracht hatte.
»Glaubst du, sie trinkt, Benny?«
»Nein, das tut sie nicht. Ich habe nie eine Flasche nach Hause gebracht, und wie soll sie sich selbst was besorgen, und außerdem würde ich es an ihr riechen.«
»Kommst du ihr denn je nahe genug, um es zu riechen, Benny?«
Onkel Benny senkte den Kopf und kicherte.
»Kommst du ihr jemals so nahe, Benny? Ich wette, sie kämpft wie ein Rudel Wildkatzen. Du musst sie mal anbinden, wenn sie schläft.«
Wenn Onkel Benny zum Abziehen der Felle zu uns kam, brachte er Diane mit. Er und mein Vater arbeiteten in unserem Keller, häuteten die Füchse ab, drehten die Innenseite der Bälge nach außen und spannten sie zum Trocknen auf lange Bretter. Diane krabbelte die Kellertreppe hinauf und hinunter oder saß auf der obersten Stufe und schaute zu. Sie wollte mit niemandem außer Onkel Benny sprechen. Sie misstraute Spielsachen, Plätzchen, Milch, allem, was wir ihr anboten, aber sie weinte oder schrie nie. Wenn man sie anfasste oder umarmte, ließ sie es sich zwar gefallen, aber zitterte vor Angst, und ihr Herz schlug heftig wie das eines Vogels, den man in der Hand gefangen hält. Bei Onkel Benny jedoch legte sie sich auf den Schoß oder schlief an seiner Schulter ein, schlaff wie gekochte Spaghetti. Seine Hand verdeckte die blauen Flecken an ihren Beinen.
»Drüben bei mir rennt sie ständig in irgendwas rein. Ich hab so viel Zeug herumstehen, dass sie einfach immer in irgendwas reinrennt und irgendwo raufklettert und fällt.«
Zu Beginn des Frühlings, noch ehe der Schnee ganz weg war, kam er eines Tages, um zu sagen, dass Madeleine weg sei. Als er am Tag zuvor abends heimgekommen sei, sei sie weg gewesen. Er habe gedacht, sie sei vielleicht in Jubilee, und habe auf ihre Rückkehr gewartet. Dann hatte er bemerkt, dass auch ein paar Sachen weg waren – eine Tischlampe, die er hatte richten wollen, ein hübscher kleiner Teppich, ein paar Schüsseln und eine blaue Teekanne, die seiner Mutter gehört hatte, und zwei noch tadellose Klappstühle. Diane hatte sie natürlich auch mitgenommen.
»Sie muss mit einem Laster weggefahren sein, das konnte sie doch gar nicht alles in einem Auto unterbringen.«
Da erinnerte sich meine Mutter, dass sie einen Kastenwagen gesehen hatte, er sei grau gewesen, meinte sie, und am Tag zuvor gegen drei Uhr nachmittags in Richtung Stadt gefahren. Aber sie hatte sich nicht dafür interessiert und auch nicht darauf geachtet, wer drinnen saß.
»Ein grauer Kastenwagen! Ich wette, das war sie! Sie könnte die Sachen hinten reingeladen haben. War eine Plane darüber, haben Sie das gesehen?«
Meine Mutter hatte nicht darauf geachtet.
»Ich muss ihr nach«, sagte Onkel Benny aufgeregt. »Sie kann nicht einfach so verschwinden mit Sachen, die ihr nicht gehören. Immer sagt sie mir, schaff diesen Müll hier raus, räum den Müll hier raus! Na, es sieht wohl nicht nach Müll aus, wenn sie selbst was davon haben will. Nur, wie kann ich wissen, wo sie hin ist? Ich sollte mich an diesen Bruder wenden.«
Nach sieben Uhr, als der Billigtarif begann, arrangierte mein Vater – auf unserem Telefon, Onkel Benny hatte keins – das Ferngespräch mit Madeleines Bruder. Dann gab er Onkel Benny den Hörer.
»Ist sie zu Ihnen runtergekommen?«, schrie Onkel Benny augenblicklich. »Sie ist mit einem Laster weggefahren. Mit einem grauen Kastenwagen. Ist sie dort bei euch aufgetaucht?« Am anderen Ende der Leitung schien Verwirrung zu herrschen; vielleicht schrie Onkel Benny zu laut, als dass ihn jemand verstehen konnte. Mein Vater musste rangehen und geduldig erklären, was geschehen war. Es stellte sich heraus, dass Madeleine nicht nach Kitchener gefahren war. Ihr Bruder zeigte kein großes Interesse dafür, wohin sie gegangen war. Er legte ohne Abschied auf.
Mein Vater versuchte, Onkel Benny davon zu überzeugen, dass es am Ende gar nicht so schlecht war, Madeleine los zu sein. Er wies darauf hin, dass sie keine besonders gute Hausfrau gewesen war und dass sie Onkel Benny das Leben nicht gerade angenehm und heiter gemacht hatte. Er machte das ganz diplomatisch und vergaß nicht, dass er über die Frau eines anderen sprach. Er sagte nichts von ihrer mangelnden Schönheit oder ihren schlampigen Kleidern. Was die Sachen anging, die sie mitgenommen hatte – gestohlen, sagte Onkel Benny –, nun, das war schon schlimm und eine Schande (mein Vater war klug genug, nicht anzudeuten, dass die Sachen von geringem Wert waren), aber vielleicht war das der Preis dafür, dass er sie loswurde, und auf die Dauer gesehen würde Onkel Benny vielleicht finden, dass er Glück gehabt hatte.
»Das ist es nicht«, sagte meine Mutter plötzlich. »Es ist das kleine Mädchen. Diane.«
Onkel Benny lachte traurig.
»Ihre Mutter schlägt sie, nicht wahr?«, rief meine Mutter mit einer Stimme, der anzuhören war, dass ihr das plötzlich aufging und sie erschreckte. »Das ist es. Daher die blauen Flecken an ihren Beinen –«
Onkel Benny hatte angefangen leise zu lachen, er konnte nicht aufhören, es war wie ein Schluckauf.
»Ja. Ja, sie –«
»Warum haben Sie uns das nicht gesagt, als sie hier war? Warum haben Sie es uns nicht schon letzten Winter gesagt? Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte sie angezeigt –«
Onkel Benny schaute bestürzt auf.
»Bei der Polizei! Wir hätten eine Strafanzeige erstatten können. Wir hätten erreichen können, dass ihr das Kind weggenommen wird. Und jetzt müssen wir die Polizei auf ihre Spur setzen. Die werden sie finden. Keine Angst.«
Onkel Benny wirkte auf diese Beteuerung hin nicht glücklich oder erleichtert. Er fragte vorsichtig: »Woher sollen sie wissen, wo sie suchen müssen?«
»Die Polizei wird es wissen. Die kann in der ganzen Provinz arbeiten. Im ganzen Land, wenn nötig. Die wird sie finden.«
»Moment mal«, sagte mein Vater. »Wieso meinst du, die Polizei wäre bereit, das zu tun? So werden nur Verbrecher verfolgt.«
»Und was ist eine Frau, die ein Kind schlägt, anderes als eine Verbrecherin?«
»Du musst einen Grund haben. Du musst Zeugen haben. Wenn du so etwas behauptest, musst du Beweise haben.«
»Benny ist Zeuge. Er kann es ihnen sagen. Er könnte gegen sie aussagen.« Sie wandte sich Onkel Benny zu, der wieder seinen Schluckauf bekam und ahnungslos sagte: »Was müsste ich denn dann tun?«
»Für den Augenblick ist genug darüber geredet worden«, sagte mein Vater. »Wir werden erst mal abwarten.«
Meine Mutter stand auf, gekränkt und verwirrt. Sie musste noch etwas sagen, und so sprach sie aus, was alle wussten.
»Ich weiß nicht, was das Zögern soll. Mir ist es glasklar.«
Aber was für meine Mutter glasklar war, war für Onkel Benny offensichtlich verschwommen und erschreckend. Ob er Angst vor der Polizei hatte oder nur Angst vor dem öffentlichen und amtlichen Anschein eines solchen Vorgehens, den Worten, die darum gemacht wurden, den fremden Orten, an die es ihn bringen würde, ließ sich unmöglich sagen. Er brach schlicht zusammen und wollte nicht mehr über Madeleine und Diane sprechen.
Was war zu tun? Meine Mutter brütete über dem Gedanken, selbst die Initiative zu ergreifen, aber mein Vater sagte zu ihr: »Du bist von Anfang an im Unrecht, wenn du dich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischst.«
»Trotzdem weiß ich, dass ich recht habe.«
»Du magst recht haben, aber das heißt noch lange nicht, dass du was tun kannst.«
Zu dieser Zeit des Jahres bekamen die Füchse ihre Jungen. Wenn ein Flugzeug vom Luftwaffenausbildungslager am See uns zu niedrig überflog, wenn ein Fremder in der Nähe der Gehege auftauchte, wenn irgendetwas Überraschendes oder Störendes geschah, konnte es passieren, dass sie sie einfach töteten. Niemand wusste, ob sie es aus blinder Panik taten oder aus erwachtem mütterlichen Angstgefühl – hatten sie den Wunsch, ihre Jungen, die noch nicht einmal die Augen geöffnet hatten, aus der gefährlichen Lage zu befreien, in die sie sie für ihr Gefühl gebracht hatten, hier in diesen Gehegen? Sie waren nicht wie zahme Tiere. Sie hatten erst sehr wenige Generationen in Gefangenschaft gelebt.
Um meine Mutter noch weiter zu überzeugen, sagte mein Vater, Madeleine sei vielleicht in die Staaten gegangen, wo niemand sie finden würde. Viele schlechte und verrückte und auch ruhelose und ehrgeizige Menschen würden irgendwann dorthin gehen.
Aber Madeleine nicht. Später im Frühjahr kam ein Brief. Sie hatte die Stirn zu schreiben, sagte Onkel Benny und brachte den Brief und zeigte ihn vor. Ohne Anrede schrieb sie: Ich habe meinen gelben Pullover und einen grünen Regenschirm und Dianes Decke in deinem Haus gelassen, schick sie mir. Ridlet St. 1249, Toronto, Ont.
Onkel Benny hatte sich bereits entschlossen hinzufahren. Er fragte, ob er den Wagen leihen könne. Er war noch nie in Toronto gewesen. Auf dem Küchentisch breitete mein Vater die Straßenkarte aus und zeigte ihm den Weg, obwohl er sagte, dass er sich frage, ob das tatsächlich eine gute Idee sei. Onkel Benny sagte, er habe vor, Diane an sich zu nehmen und herzuholen. Mein Vater und meine Mutter wiesen beide darauf hin, dass das gesetzwidrig sei, und rieten ihm ab. Aber Onkel Benny, der vor jeglichen rechtlichen Amtshandlungen zurückgeschreckt war, machte sich keinerlei Sorgen darüber, etwas zu unternehmen, was sich als Kindesraub erweisen konnte. Er erzählte jetzt auch Geschichten davon, was Madeleine getan hatte. Sie hatte Dianes Beine mit Lederriemen an die Gitterstäbe des Bettchens gebunden. Sie hatte sie mit einer Schindel verprügelt. Sie hatte womöglich noch Schlimmeres getan, wenn er nicht da war. Auf dem Rücken des Kindes waren, glaubte er, Spuren vom Schürhaken gewesen. Während er all das erzählte, überkam ihn sein entschuldigendes Lachen; er musste den Kopf schütteln und es hinunterschlucken.
Er war zwei Tage fort. Mein Vater schaltete die Zehn-Uhr-Nachrichten ein und sagte: »Wir werden schauen müssen, ob der alte Benny aufgegriffen worden ist!« Am Abend des zweiten Tages fuhr er den Wagen in unseren Hof und blieb einen Augenblick sitzen, ohne uns anzusehen. Dann stieg er langsam aus und kam würdig und müde auf das Haus zu. Er hatte Diane nicht dabei. Hatten wir je erwartet, dass er sie bekommen würde?
Wir saßen auf der Betonfläche vor der Küchentür, meine Mutter in ihrem bequemen Segeltuchstuhl, der sie an städtischen Rasen und städtische Muße erinnern sollte, und mein Vater auf einem harten Küchenstuhl. So früh im Jahr gab es nur wenige Insekten. Wir betrachteten den Sonnenuntergang. Manchmal versammelte meine Mutter alle, damit sie den Sonnenuntergang betrachteten, gerade so, als wäre er etwas, das sie eigens in Szene gesetzt hätte, und das ruinierte die Sache ein wenig – etwas später weigerte ich mich, überhaupt hinzuschauen –, aber trotzdem gab es auf der Welt keinen besseren Platz zur Betrachtung des Sonnenuntergangs als das Ende der Flats Road. Das sagte meine Mutter auch selbst.
Mein Vater hatte an diesem Tag die Fliegentür angebracht. Owen schaukelte ungehorsam darauf, um das alte, vertraute Geräusch der sich dehnenden und dann zurückschnappenden Feder zu hören. Man würde ihm sagen, er solle es seinlassen; er würde aufhören und sehr vorsichtig hinter dem Rücken meiner Eltern von neuem damit anfangen.
Auf Onkel Benny lastete eine solche Schwermut, dass nicht einmal meine Mutter ihn direkt befragen mochte. Mein Vater sagte leise zu mir, ich solle einen Stuhl aus der Küche holen.
»Benny, setz dich. Bist du müde von der Fahrt? Wie ist der Wagen gelaufen?«
»Er ist prima gelaufen.«
Benny setzte sich. Er nahm den Hut nicht ab. Er saß steif da, als wäre er an einem ungewohnten Platz, wo er ein Willkommen nicht erwarten oder gar wünschen durfte. Schließlich sprach meine Mutter mit ihm, in einem Ton angestrengter Beiläufigkeit und Fröhlichkeit.
»Nun. Ist es ein Haus oder eine Wohnung, wo sie leben?«
»Ich weiß nicht«, sagte Onkel Benny abweisend. Nach einiger Zeit fügte er hinzu: »Ich hab es gar nicht gefunden.«
»Sie haben das Haus, wo sie wohnen, gar nicht gefunden?«
Er schüttelte den Kopf.
»Also haben Sie sie gar nicht gesehen?«
»Nein.«
»Haben Sie die Adresse verloren?«
»Nein. Ich hab sie auf diesen Zettel geschrieben. Ich hab es hier.« Er zog seine Brieftasche heraus und holte einen Zettel raus und zeigte ihn uns, dann las er: »Ridlet Street 1249.« Er faltete ihn zusammen und steckte ihn wieder ein. Alle seine Bewegungen wirkten verlangsamt, förmlich und kummervoll.
»Ich konnte es nicht finden. Ich konnte das Haus nicht finden.«
»Aber haben Sie sich einen Stadtplan besorgt? Wissen Sie noch, wir haben gesagt, Sie sollen zu einer Tankstelle fahren und nach einem Plan von Toronto fragen.«
»Das hab ich getan«, sagte Onkel Benny mit einer Art finsterem Triumph. »Genau so. Ich bin zu einer Tankstelle gegangen und hab gefragt, und sie haben gesagt, sie hätten keine Stadtpläne. Sie hatten Karten, aber nur von der Provinz.«
»Sie hatten ja schon eine Karte von der Provinz.«
»Das hab ich ihnen auch gesagt. Ich hab gesagt, ich wollte einen Stadtplan von Toronto. Sie haben gesagt, sie hätten keinen.«
»Haben Sie es bei einer anderen Tankstelle versucht?«
»Wenn es an der einen keinen gab, hab ich angenommen, es gäbe nirgends welche.«
»Sie hätten einen in einem Geschäft kaufen können.«
»Ich wusste nicht, in was für einem Geschäft.«
»Im Papierwarengeschäft! Im Kaufhaus! Sie hätten an der Tankstelle fragen können, wo man einen kaufen kann.«
»Ich dachte, statt überall in der Stadt rumzurennen und zu versuchen, einen Stadtplan zu finden, wäre ich besser dran, wenn ich einfach Leute nach dem Weg fragte, wo ich doch die Adresse schon hatte.«
»Es ist sehr riskant, Leute zu fragen.«
»Wem sagen Sie das«, sagte Onkel Benny.
Als er sich besonnen hatte, begann er mit seiner Geschichte.