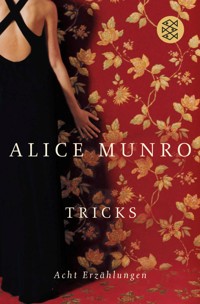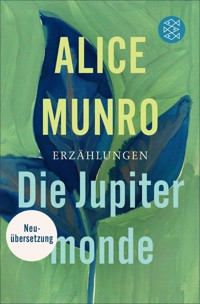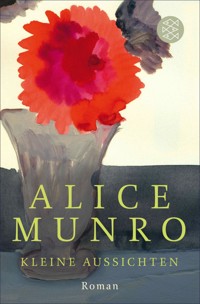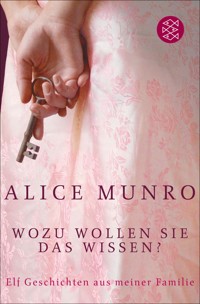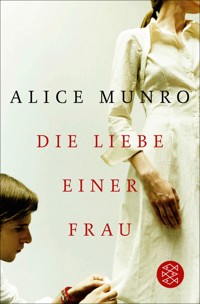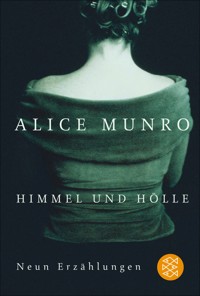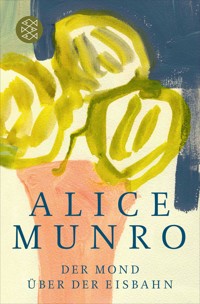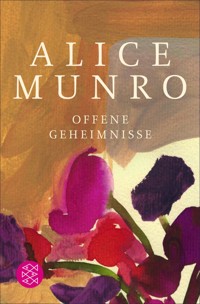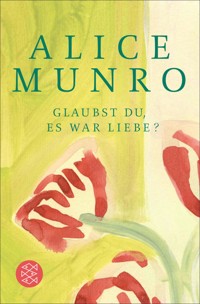9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die in »Ferne Verabredungen« versammelten schönsten Erzählungen der kanadischen Nobelpreisträgerin Alice Munro, darunter auch, erstmals auf Deutsch, ihre frühe Erzählung »Die Dimensionen eines Schattens«, spiegeln das ganze Panorama ihrer Kunst. Da ist die junge Pauline in der berühmten Erzählung »Die Kinder bleiben hier«, die Hals über Kopf ihre Familie verlässt, oder Fiona und Grant in »Der Bär kletterte über den Berg«, deren langjährige Ehe sich durch Fionas Demenz fundamental verändert. Es sind Geschichten von verborgenen Sehnsüchten, die sich allmählich ihren Raum erobern, scheinbar belanglosen Ereignissen, die doch ein ganzes Dasein infrage stellen, Geschichten vom Unterwegssein, von kühnen Momenten des Ausbrechens – mal eindringlich, mal beunruhigend, doch immer voller Sympathie für das Leben und seine Helden. Mit einem Nachwort von Manuela Reichart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alice Munro
Ferne Verabredungen
Die schönsten Erzählungen
Über dieses Buch
Die in ›Ferne Verabredungen‹ versammelten schönsten Erzählungen der kanadischen Nobelpreisträgerin spiegeln das ganze Panorama ihrer Kunst. Da ist die junge Frau in »Tricks«, die erst durch eine zerstörte Hoffnung zu einem selbstbestimmten Leben findet, oder das ältere Paar in »Äpfel und Birnen«, das sich fragen muss, ob der Sommer seiner gemeinsamen Jahre vorüber ist. Es sind Geschichten von verborgenen Sehnsüchten, die sich allmählich ihren Raum erobern, scheinbar belanglosen Ereignissen, die doch ein ganzes Dasein in Frage stellen, Geschichten von kühnen Momenten des Ausbrechens, vom Unterwegssein – mal eindringlich, mal beunruhigend, doch immer voller Sympathie für das Leben und seine Helden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alice Munro, geboren 1931 in Wingham, Ontario, ist eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie erhielt 2013 die höchste Auszeichnung für Literatur – den Nobelpreis. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde bereits zuvor mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Giller Prize, dem Book Critics Circle Award und dem Man Booker International Prize. Alice Munro lebt in Ontario, Kanada.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Copyright © 2014 by Alice Munro
All rights reserved
Siehe auch Einzelnachweise am Ende des Bandes
© 2016 Nachwort von Manuela Reichart
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Richard Dunkley/plainpicture
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403671-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Jakarta
II
III
IV
Die Kinder bleiben hier
Hasst er mich, mag er mich, liebt er mich, Hochzeit
Der Bär kletterte über den Berg
Bald
Zu viel Glück
I
II
III
IV
V
Zug
Die Dimensionen eines Schattens
Aus jedem ihrer Sätze kann man lernen
Bibliographische Notiz
Einzelnachweise
Jakarta
Kath und Sonje haben einen eigenen Platz am Strand, hinter großen Baumstämmen. Den haben sie sich ausgesucht, weil er ihnen Schutz bietet, nicht nur vor dem gelegentlich stark auffrischenden Wind – sie haben Kaths Baby dabei –, sondern auch vor den Blicken einer Gruppe von Frauen, die jeden Tag den Strand bevölkern. Sie nennen diese Frauen die Monicas.
Die Monicas haben zwei oder drei oder vier Kinder pro Nase. Angeführt werden sie von der richtigen Monica, die über den Strand gelaufen kam und sich vorstellte, sobald sie Kath und Sonje und das Baby entdeckt hatte. Sie lud sie ein, sich dem Rudel anzuschließen.
Sie folgten ihr und schleppten die Babytragetasche mit. Was blieb ihnen anderes übrig? Aber seitdem verschanzen sie sich hinter den Baumstämmen.
Das Feldlager der Monicas besteht aus Sonnenschirmen, Badelaken, Windeltaschen, Picknickkörben, aufblasbaren Flößen und Walfischen, Spielsachen, Sonnenschutzmitteln, Kleidungsstücken, Sonnenhüten, Thermosflaschen mit Kaffee, Plastikbechern und -tellern und Kühlboxen, die hausgemachte Eislutscher aus Fruchtsaft enthalten.
Die Monicas sind entweder unverhohlen schwanger oder sehen so aus, als könnten sie schwanger sein, denn sie haben ihre Figur verloren. Sie watscheln ans Wasser und brüllen die Namen ihrer Kinder, die auf Baumstämmen oder den aufblasbaren Walfischen reiten oder gerade davon herunterfallen.
»Wo ist deine Mütze? Wo ist dein Ball? Du bist jetzt lange genug auf dem Ding gewesen, lass Sandy mal ran.«
Sogar wenn sie sich miteinander unterhalten, müssen sie trompeten, um den Lärm und das Geschrei ihrer Kinder zu übertönen.
»Wenn du zu Woodward’s gehst, da sind die Frikadellen so billig wie Hamburger.«
»Ich hab’s mit Zinksalbe versucht, aber die Wirkung war null.«
»Jetzt hat er einen Abszess in der Leiste.«
»Du darfst kein Backpulver nehmen, du musst Soda nehmen.«
Diese Frauen sind gar nicht viel älter als Kath und Sonje. Aber sie haben ein Lebensstadium erreicht, vor dem ihnen graut. Sie verwandeln den ganzen Strand in eine Plattform. Ihre Probleme, ihr zappeliger Nachwuchs, ihre mütterlichen Pfunde und ihre Lebenstüchtigkeit können alles zunichtemachen, das glitzernde Wasser, die traumhafte kleine Bucht mit den rotstämmigen Erdbeerbäumen und den Zedern, die krumm aus den hohen Felsen ringsum wachsen. Kath fühlt sich besonders von ihnen bedroht, denn sie ist jetzt selbst Mutter. Wenn sie ihr Baby stillt, liest sie oft ein Buch und raucht manchmal sogar eine Zigarette, um nicht im Schlamm des Animalischen zu versinken. Und sie stillt, damit ihre Gebärmutter schrumpft und ihr Bauch wieder flach wird, nicht nur, um das Baby – Noelle – mit den wertvollen mütterlichen Abwehrstoffen zu versorgen.
Kath und Sonje haben ihre eigenen Thermosflaschen mit Kaffee und ihre Badelaken, die sie schützend um Noelle drapiert haben. Sie haben ihre Zigaretten und ihre Bücher. Sonje hat ein Buch von Howard Fast. Ihr Mann hat ihr gesagt, wenn sie schon Romane lesen muss, dann wenigstens die von dem. Kath liest die Kurzgeschichten von Katherine Mansfield und die Kurzgeschichten von D.H. Lawrence. Sonje hat sich angewöhnt, ihr eigenes Buch hinzulegen und zu demjenigen zu greifen, das Kath gerade nicht liest. Sie beschränkt sich auf eine Kurzgeschichte und kehrt dann zu Howard Fast zurück.
Wenn sie Hunger bekommen, macht eine von ihnen sich auf den Weg und steigt die lange Holztreppe empor. Häuser umringen die Bucht, oben auf den Felsen zwischen den Kiefern und Zedern. Es sind ehemalige Ferienhäuser, aus der Zeit vor dem Bau der Lions Gate Bridge, als Leute aus Vancouver auf dem Wasserweg herkamen, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Einige Häuschen – wie die von Kath und Sonje – sind immer noch ziemlich primitiv und billig zu mieten. Andere wie das der richtigen Monica sind ausgebaut worden. Aber niemand hat vor, hier lange zu bleiben; alle planen, in ein richtiges Haus zu ziehen. Bis auf Sonje und ihren Mann, dessen Pläne undurchsichtiger sind als die aller anderen.
Eine ungepflasterte Ringstraße verbindet die Häuser und mündet an beiden Enden in den Marine Drive. Sie umschließt eine Waldung, um deren hohe Bäume Farn und Brombeersträucher wuchern und die von zahlreichen Pfaden durchschnitten wird, auf denen man den Weg zum Supermarkt am Marine Drive abkürzen kann. Im Supermarkt holen Kath und Sonje sich immer Pommes zum Mitnehmen. Häufiger ist es Kath, die sich auf diese Expedition begibt, denn sie genießt es, unter den Bäumen zu laufen – etwas, was sie mit dem Kinderwagen nicht mehr kann.
Als Kath herzog, war Noelle noch nicht geboren, und sie benutzte fast täglich die Abkürzung durch den Wald, ohne über ihre Freiheit nachzudenken. Eines Tages lernte sie Sonje kennen. Beide hatten bis vor kurzem in der Stadtbücherei von Vancouver gearbeitet, allerdings nicht in derselben Abteilung, so dass sie nie miteinander ins Gespräch gekommen waren. Kath hatte im sechsten Monat der Schwangerschaft aufgehört, wie es von ihr verlangt wurde, damit ihr Anblick die Benutzer nicht verstörte, und Sonje hatte wegen eines Skandals aufgehört.
Oder zumindest wegen einer Geschichte, die in die Zeitungen gelangt war. Cottar, ihr Mann, ein Journalist bei einer Zeitschrift, von der Kath noch nie gehört hatte, war nach Rotchina gereist. Er wurde in den Zeitungen als linkslastig bezeichnet. Sonjes Foto erschien neben seinem, zusammen mit der Information, dass sie in der Stadtbücherei beschäftigt war. Man befürchtete, sie könnte dort kommunistische Bücher empfehlen und Schulkinder beeinflussen, die anschließend womöglich Kommunisten wurden. Niemand sagte, dass sie das getan hatte – nur, dass die Gefahr bestand. Auch verstieß es nicht gegen die Gesetze, wenn Kanadier China besuchten. Aber wie sich herausstellte, waren Cottar und Sonje US-Amerikaner, also ihr Verhalten unter Umständen sorgfältig geplant und umso bedenklicher.
»Ich kenne die Frau«, hatte Kath zu Kent, ihrem Mann, gesagt, als sie das Foto sah. »Wenigstens vom Sehen. Sie hat auf mich immer ziemlich schüchtern gewirkt. Das wird ihr peinlich sein.«
»Ach, kein Stück«, sagte Kent. »Die Sorte, die lieben das Gefühl, verfolgt zu werden, dafür leben die.«
Die Leiterin der Stadtbücherei hatte angeblich gesagt, Sonje hätte gar keine Gelegenheit gehabt, Bücher auszusuchen oder junge Menschen zu beeinflussen, sondern den größten Teil ihrer Zeit damit verbracht, Listen zu tippen.
»Was komisch war«, sagte Sonje zu Kath, nachdem sie sich erkannt und angesprochen und auf dem Waldweg eine halbe Stunde lang miteinander unterhalten hatten. Das Komische war, dass sie überhaupt nicht tippen konnte.
Sie war nicht entlassen worden, aber von sich aus gegangen. Sie fand es angebracht, da auf sie und Cottar in der Zukunft ohnehin Veränderungen zukamen.
Kath fragte sich, ob eine der Veränderungen ein Kind sein konnte. Für ihr Gefühl ging das Leben nach dem Schulabschluss als eine Reihe fortgesetzter Prüfungen weiter, die bestanden werden mussten. Die Erste war, zu heiraten. Wenn eine Frau das nicht mit spätestens fünfundzwanzig getan hatte, dann war diese Prüfung im Grunde nicht bestanden worden. (Sie unterschrieb stets mit »Mrs Kent Mayberry«, wobei sie Erleichterung und ein leises Hochgefühl verspürte.) Dann musste sie daran denken, das erste Kind zu bekommen. Ein Jahr zu warten, bevor sie schwanger wurde, war eine gute Idee. Zwei Jahre zu warten war ein bisschen vorsichtiger als nötig. Und drei Jahre brachten die Leute auf komische Gedanken. Dann ging es irgendwann weiter mit dem zweiten Kind. Danach lag der Weg zunehmend im Dunkeln, und es ließ sich schwer sagen, wo das Ziel lag und wann es erreicht war.
Sonje war keine von den Freundinnen, die erzählten, wie sehr sie versuchten, ein Kind zu kriegen, und wie lange sie es schon versuchten und welche Techniken sie benutzten. Sonje redete nie in dieser Weise über Sex oder über ihre Regel oder ihren Körper – obwohl sie Kath bald Dinge erzählte, die für die meisten Leute wesentlich schockierender gewesen wären. Sie besaß eine würdevolle Grazie – eigentlich hatte sie Balletttänzerin werden wollen, doch dann war sie dafür zu groß geworden, was sie immer bedauerte, bis sie Cottar kennenlernte, der sagte: »Ach, noch so eine höhere Tochter, die hofft, aus ihr wird mal ein sterbender Schwan.« Ihr Gesicht war breit, still, rosig – sie trug nie Make-up, Cottar war gegen Make-up –, und ihr kräftiges blondes Haar war zu einem buschigen Knoten gebunden. Kath fand, sie sah wundervoll aus – engelhaft und dabei intelligent.
Kath und Sonje essen am Strand ihre Pommes und sprechen über Personen in den Erzählungen, die sie gelesen haben. Wie kommt es, dass keine Frau Stanley Burnell lieben kann? Was hat Stanley an sich? Ein großes Kind ist er, mit seiner bedrängenden Liebe, seiner Gier bei Tisch, seiner Selbstzufriedenheit. Wohingegen Jonathan Trout – ach, Stanleys Frau Linda hätte Jonathan Trout heiraten sollen, Jonathan, der durchs Wasser glitt, während Stanley planschte und prustete. »Sei mir gegrüßt, meine himmlische Pfirsichblüte«, sagt Jonathan mit seiner samtigen Bassstimme. Er verfügt über Ironie, er ist feinsinnig und elegisch. »Die Kürze des Lebens, die Kürze des Lebens«, sagt er. Und Stanleys dreiste, laute Welt fällt entlarvt in sich zusammen.
Etwas macht Kath zu schaffen. Sie kann nicht darüber reden oder darüber nachdenken. Ist Kent so ähnlich wie Stanley?
Eines Tages geraten sie in Streit. Kath und Sonje geraten unerwartet in einen erbitterten Streit über eine Erzählung von D.H. Lawrence. Die Erzählung hat den Titel »Der Fuchs«.
Am Ende dieser Erzählung sitzen die Liebenden – ein Soldat und eine Frau namens March – auf den Klippen an der Atlantikküste und schauen nach Westen, hin zu ihrem zukünftigen Heim in Kanada. Sie werden England verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Sie haben sich gebunden, aber sie sind nicht wahrhaft glücklich. Noch nicht.
Der Soldat weiß, dass beide erst dann wahrhaft glücklich sein werden, wenn die Frau ihm ihr Leben hingibt, in einer Weise, wie sie es bisher noch nicht getan hat. March kämpft immer noch gegen ihn an, um sich von ihm abzugrenzen, macht alle beide mit ihrem Bemühen, an ihrer Frauenseele, ihrem Frauenbewusstsein festzuhalten, insgeheim unglücklich. Sie muss damit aufhören – sie muss aufhören zu denken und aufhören zu wollen und ihren Geist untergehen lassen, bis er völlig in seinen eingetaucht ist. Wie das Seegras, das unter der Wasseroberfläche hin und her wogt. Schau hinunter, schau hinunter – schau, wie das Seegras im Wasser wogt, es lebt, doch es durchbricht nie die Oberfläche. Und so muss ihr weibliches Wesen in seinem männlichen Wesen leben. Dann wird sie glücklich sein und er stark und zufrieden. Dann wird ihnen die wahre Ehe gelungen sein.
Kath sagt, sie findet das blöde.
Sie macht sich an die Begründung. »Er redet doch von Sex, ja?«
»Nicht nur«, sagt Sonje. »Von ihrem ganzen Leben.«
»Ja, aber Sex. Sex führt zu Schwangerschaft. Ich meine, normalerweise. Also bekommt March ein Kind. Wahrscheinlich noch weitere. Und um die muss sie sich kümmern. Wie kann sie das, wenn ihr Geist unter der Meeresoberfläche hin und her wogt?«
»Das ist allzu wörtlich genommen«, sagt Sonje in leicht überlegenem Tonfall.
»Entweder kannst du dir Gedanken machen und Entscheidungen treffen, oder du kannst es nicht«, sagt Kath. »Zum Beispiel, das Baby greift nach einer Rasierklinge. Was machst du? Sagst du bloß: Ach, ich werde einfach hier schweben, bis mein Mann nach Hause kommt, und dann kann er sich den Kopf zerbrechen, das heißt, unseren Kopf, ob das eine gute Idee ist?«
Sonje sagt: »Das ist jetzt aber auf die Spitze getrieben.«
Ihrer beider Stimmen sind scharf geworden. Kath ist forsch und spöttisch, Sonje ernst und eigensinnig.
»Lawrence wollte keine Kinder«, sagt Kath. »Er war eifersüchtig auf Friedas Kinder aus erster Ehe.«
Sonje schaut zwischen ihren Knien zu Boden und lässt Sand durch ihre Finger rieseln.
»Ich glaube einfach, es wäre schön«, sagt sie. »Ich glaube, es wäre schön, wenn eine Frau das könnte.«
Kath weiß, dass etwas schiefgegangen ist. Etwas stimmt nicht an ihrem Argument. Warum ist sie so wütend und aufgebracht? Und warum hat sie das Thema gewechselt und über Kinder geredet? Weil sie ein Kind hat und Sonje nicht? Hat sie das über Lawrence und Frieda gesagt, weil sie den Verdacht hegt, dass es teilweise auch bei Cottar und Sonje so ist?
Wenn eine Frau auf der Grundlage von Kindern argumentiert, um die sie sich kümmern muss, ist sie aus allem raus. Unangreifbar. Aber wenn Kath das tut, will sie etwas vertuschen. Sie kann den Teil über das Seegras und das Wasser nicht ertragen, sie hat das Gefühl, an unklarem Protest zu ersticken. Also denkt sie dabei an sich selbst und nicht an Kinder. Sie selbst ist genau die Frau, über die Lawrence herzieht. Und sie kann das nicht geradeheraus zugeben, denn es könnte Sonje auf den Verdacht bringen – und nicht nur Sonje, sondern auch Kath selbst –, dass Kaths Leben an einer Verarmung leidet.
Sonje, die in einem anderen ärgerlichen Gespräch gesagt hat: »Mein Glück steht und fällt mit Cottar.«
Mein Glück steht und fällt mit Cottar.
Diese Feststellung hat Kath erschüttert. Sie hätte das nie von Kent gesagt. Sie wollte nicht, dass es auch auf sie zutraf.
Andererseits sollte Sonje nicht denken, sie sei eine Frau, die es in der Liebe nicht geschafft hatte. Die sie nicht angestrebt hatte, der sie nicht angeboten worden war, die Unterwerfung in der Liebe.
II
Kent erinnerte sich an den Namen der kleinen Stadt in Oregon, in die Cottar und Sonje gezogen waren. Oder in die Sonje gezogen war, am Ende jenes Sommers. Sie war dorthin gegangen, um Cottars Mutter zu versorgen, während Cottar sich auf eine weitere seiner als journalistische Dienstreisen getarnten Vergnügungsfahrten in den Fernen Osten begeben hatte. Nach seiner Chinareise war ein reales oder eingebildetes Problem mit seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten aufgetaucht. Er hatte geplant, sich nach seiner Rückkehr mit Sonje in Kanada zu treffen und vielleicht auch seine Mutter dorthin zu holen.
Es bestand nicht viel Aussicht, dass Sonje immer noch in der Stadt lebte. Höchstens vielleicht die Mutter. Kent sagte, dass es sich nicht lohnte, dafür anzuhalten, aber Deborah sagte: Warum nicht, wäre doch interessant, das herauszufinden? Und eine Nachfrage auf dem Postamt erbrachte eine Wegbeschreibung.
Kent und Deborah fuhren aus der Stadt heraus und durch die Sanddünen – Deborah saß am Steuer wie meistens auf dieser langen, gemächlichen Reise. Sie hatten Kents Tochter Noelle besucht, die in Toronto lebte, und seine beiden Söhne von Pat, seiner zweiten Frau – den einen in Montreal und den anderen in Maryland. Sie waren ein paar Tage bei alten Freunden von Kent und Pat geblieben, die jetzt in einer bewachten Wohnanlage in Arizona lebten, und bei Deborahs Eltern – die ungefähr in Kents Alter waren – in Santa Barbara. Jetzt fuhren sie die Westküste hoch, heim nach Vancouver, ließen sich aber jeden Tag Zeit, um Kent nicht übermäßig zu ermüden.
Die Dünen waren mit Gras bewachsen. Sie sahen wie ganz normale Hügel aus, bis auf entblößte sandige Schultern, die der Landschaft etwas Verspieltes gaben. Das Werk eines Kindes, aufgequollen ins Gigantische.
Die Straße endete bei dem Haus, das ihnen beschrieben worden war. Gar nicht zu verfehlen. Da war das Schild – pazifik-tanzschule. Und Sonjes Name, und darunter ein Schild: zu verkaufen. Eine alte Frau machte sich mit einer Heckenschere an einem der Sträucher im Garten zu schaffen.
Also lebte Cottars Mutter immer noch. Aber dann fiel Kent ein, dass Cottars Mutter blind war. Deshalb musste ja damals jemand zu ihr ziehen, als Cottars Vater starb.
Was trieb sie also mit der Heckenschere, wenn sie blind war?
Er hatte den üblichen Fehler begangen, sich nicht klarzumachen, wie viele Jahre – Jahrzehnte – vergangen waren. Und wie steinalt die Mutter inzwischen sein musste. Wie alt Sonje sein musste, wie alt er selbst war. Denn es war Sonje, und anfangs erkannte sie ihn auch nicht. Sie bückte sich, um die Heckenschere in den Boden zu spießen, sie wischte sich die Hände an ihren Jeans ab. Er spürte die Steifheit ihrer Bewegungen in den eigenen Gelenken. Ihr Haar war weiß und spärlich, es wehte in der leichten Meeresbrise, die zwischen den Dünen ihren Weg hierherfand. Die feste Fleischhülle um ihre Knochen war verschwunden. Sie war immer flachbrüstig gewesen, aber in der Taille nicht so dünn. Breiter Rücken, breites Gesicht, ein Mädchen nordischen Typs. Obwohl ihr Vorname nicht daher stammte – er erinnerte sich an eine Geschichte, dass sie den Namen Sonja erhalten hatte, weil ihre Mutter die Filme mit Sonja Henie liebte. Sie änderte von sich aus die Schreibweise und verachtete die Oberflächlichkeit ihrer Mutter. Alle verachteten sie damals ihre Eltern für irgendetwas.
Er konnte in der grellen Sonne ihr Gesicht nicht genau erkennen. Aber er sah mehrere glänzende, silberweiße Flecke, wo wahrscheinlich Hautkrebs entfernt worden war.
»Also Kent«, sagte sie. »So was Komisches. Ich dachte, du wärst jemand, der mein Haus kaufen will. Und das ist Noelle?«
Nun hatte auch sie ihren Fehler begangen.
Deborah war sogar noch ein Jahr jünger als Noelle. Aber sie hatte nichts von einem Püppchen an sich. Kent hatte sie nach seiner ersten Operation kennengelernt. Da war er Witwer und sie eine unverheiratete Physiotherapeutin. Eine abgeklärte, ruhige Frau, die der Mode und der Ironie misstraute – sie trug ihr Haar zu einem langen Zopf geflochten. Sie hatte ihm Yoga beigebracht, wie auch die vorgeschriebenen Übungen, und jetzt sorgte sie dafür, dass er Vitamine nahm und Ginseng. Sie war taktvoll und frei von Neugier bis hin zur Gleichgültigkeit. Vielleicht war es für eine Frau ihrer Generation selbstverständlich, dass jeder eine reichbevölkerte und unübertragbare Vergangenheit besaß.
Sonje bat ihre Besucher ins Haus. Deborah sagte, sie werde die beiden ihren Erinnerungen überlassen – sie wolle zu einem Naturkostladen (Sonje sagte ihr, wo einer war) und einen Strandspaziergang machen.
Als Erstes fiel Kent an dem Haus auf, wie kalt es darin war. An einem strahlenden Sommertag. Aber Häuser an der Nordwestküste sind selten so warm, wie sie aussehen – man braucht nur aus der Sonne zu gehen, und sofort spürt man einen klammen Hauch. Nebelschwaden und regnerische Winterkälte mussten seit langer Zeit fast ohne Gegenwehr in dieses Haus eingedrungen sein. Es war ein großer, aus Holz erbauter Bungalow, stark reparaturbedürftig, aber nicht schmucklos mit seiner Veranda und seinen Dachgauben. In West Vancouver, wo Kent immer noch lebte, hatte es früher viele solche Häuser gegeben. Aber die meisten waren mit Abrissgenehmigung verkauft worden.
Die beiden großen, ineinander übergehenden Wohnzimmer standen bis auf ein Klavier leer. Der Fußboden war in der Mitte grau abgetreten und in den Ecken schwarzbraun gebohnert. An einer Wand war eine Ballettstange angebracht und gegenüber ein staubiger Spiegel, in dem er zwei hagere, weißhaarige Gestalten vorbeigehen sah. Sonje sagte, dass sie versuchte, das Haus zu verkaufen – das sah man ja an dem Schild –, und da dieser Teil als Tanzstudio eingerichtet worden war, fand sie, sie konnte es ruhig so lassen.
»Man kann immer noch was Gutes draus machen«, sagte sie. Sie erzählte, sie hätten die Schule um 1960 eingerichtet, bald nachdem sie gehört hatten, dass Cottar tot sei. Cottars Mutter Delia spielte Klavier. Sie spielte, bis sie fast neunzig Jahre alt war und einen Dachschaden bekam. (»Entschuldige«, sagte Sonje, »aber irgendwann wird man mit so was salopp.«) Sonje musste sie in ein Pflegeheim geben und ging jeden Tag hin, um sie zu füttern, obwohl Delia sie nicht mehr erkannte. Und sie holte sich neue Leute fürs Klavier, aber das klappte nicht recht. Außerdem konnte sie selber allmählich den Schülerinnen nichts mehr zeigen, sondern nur noch was sagen. Also sah sie ein, dass es Zeit war aufzugeben.
Was war sie früher für eine stattliche junge Frau gewesen, allerdings nicht sehr mitteilsam. Nicht besonders entgegenkommend, war wenigstens sein Eindruck gewesen. Und jetzt huschte und schwatzte sie nach Art von Menschen, die zu viel allein waren.
»Es lief gut, als wir anfingen, kleine Mädchen begeisterten sich damals fürs Ballett, aber dann kam das alles aus der Mode, weißt du, es war zu förmlich. Aber nie völlig, und dann in den achtziger Jahren zogen viele junge Familien her, die offenbar eine Menge Geld hatten, woher hatten die so viel Geld? Und es hätte wieder toll laufen können, aber ich hab’s irgendwie nicht gepackt.«
Sie sagte, dass vielleicht die Luft heraus war oder der Antrieb weg war, als ihre Schwiegermutter starb.
»Wir waren die allerbesten Freundinnen«, sagte sie. »Immer.«
Die Küche war ein weiterer großer Raum, den die Schränke und Haushaltsgeräte nicht richtig füllten. Der Fußboden bestand aus grauen und schwarzen Fliesen – oder vielleicht aus schwarzen und weißen Fliesen, deren Weiß von schmutzigem Aufwischwasser grau war. Sie gingen durch einen von Regalen gesäumten Flur, Regalen, die bis zur Decke reichten und mit Büchern und zerfledderten Illustrierten vollgestopft waren, vielleicht sogar mit Zeitungen. Ein Geruch nach mürbem, altem Papier. Hier war der Boden mit Sisalläufern ausgelegt, die bis auf eine Seitenveranda reichten, wo Kent endlich die Möglichkeit bekam, sich hinzusetzen. Rattansitzbank und -sessel, und zwar echte, die einiges wert sein könnten, wenn sie nicht unmittelbar vor dem Zerfall stünden. Bambusjalousien, auch nicht im besten Zustand, aufgerollt oder halb heruntergelassen, und draußen verwilderte Sträucher, die an die Fenster drückten. Kent kannte nicht viele Pflanzennamen, aber er erkannte diese Sträucher als eine Sorte, die auf sandigem Boden wuchs. Ihre Blätter waren hart und glänzend – als wären sie in Öl getaucht.
Als sie durch die Küche gingen, hatte Sonje den Kessel für Tee aufgesetzt. Jetzt sank sie in einen der Sessel, als wäre auch sie froh zu sitzen. Sie hielt ihre schmutzigen, grobknochigen Hände hoch.
»Ich geh gleich mich waschen«, sagte sie. »Ich hab dich gar nicht gefragt, ob du Tee willst. Ich kann auch Kaffee kochen. Oder wenn du magst, lass ich beides weg und mach uns gleich einen Gin Tonic. Warum eigentlich nicht? Hört sich doch gut an.«
Das Telefon klingelte. Ein aufstörendes, lautes, altmodisches Klingeln. Es klang, als käme es aus der Diele gleich nebenan, aber Sonje eilte in die Küche.
Sie redete eine Weile, unterbrach nur kurz, um den Kessel vom Herd zu nehmen, als er pfiff. Er hörte sie »gerade Besuch« sagen und hoffte, sie wimmelte nicht jemanden ab, der sich das Haus ansehen wollte. Ihr genervter Tonfall erweckte bei ihm den Eindruck, dass der Anruf nicht nur ein freundschaftlicher Plausch war und vielleicht etwas mit Geld zu tun hatte. Er gab sich Mühe, nichts mehr davon aufzuschnappen.
Die im Flur gestapelten Bücher und Zeitschriften hatten ihn an Sonjes und Cottars Haus über der Bucht erinnert. Es war das Unwohnliche, Verwahrloste, was ihn daran erinnerte. Das große Zimmer im Erdgeschoss war von einem Kamin beheizt worden, und obwohl – bei seinem einzigen Besuch – ein Feuer darin brannte, quoll er über von alter Asche, verkohlten Apfelsinenschalen und Abfallresten. Überall lagen Bücher und Broschüren. Statt einer Couch stand eine Liege da – man musste entweder mit den Füßen auf dem Boden und nichts im Rücken dasitzen oder raufkrabbeln, sich an die Wand lehnen und die Beine anziehen. So saßen Kath und Sonje. Sie hielten sich aus dem Gespräch fast ganz heraus. Kent saß in einem Sessel, den er von einem Buch befreit hatte, einem Band mit abgegriffenem Umschlag und dem Titel Der Bürgerkrieg in Frankreich. So nennen sie also jetzt die Französische Revolution, dachte er. Dann sah er den Namen des Autors, Karl Marx. Aber schon davor fühlte er die Feindseligkeit, die Verurteilung im Raum. So, wie man sich in einem Raum voller frommer Traktate und Jesusbilder, Jesus auf einem Esel, Jesus auf dem See Genezareth, fühlen würde, vor Gericht gestellt und verurteilt. Nicht nur von den Büchern und Druckschriften – es steckte auch in der Kaminschweinerei und dem stark abgetretenen Teppich und den Rupfenvorhängen. Kents Hemd mit Krawatte war falsch. Er hatte das schon an den Blicken geahnt, die Kath darauf geworfen hatte, aber er hatte es nun einmal angezogen und behielt es an. Sie trug eins seiner alten Hemden über Jeans, die von etlichen Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden. Er hatte das anlässlich einer Einladung zum Abendessen für einen reichlich schlampigen Aufzug gehalten, war aber zu dem Schluss gekommen, dass sie vielleicht in nichts anderes mehr hineinpasste.
Das war unmittelbar, bevor Noelle geboren wurde.
Cottar bereitete das Essen zu. Es war ein Curry und, wie sich herausstellte, sehr gut. Sie tranken Bier. Cottar war über dreißig, älter als Sonje und Kath und Kent. Hochgewachsen, schmalschultrig, hohe, kahle Stirn und spärlicher Backenbart. Hastige, leise, heimlichtuerische Sprechweise.
Ein älteres Ehepaar war auch da, eine Frau mit Hängebusen und ergrauendem, im Nacken zusammengerolltem Haar und ein kleiner, sich kerzengerade haltender Mann in schmuddeliger Kleidung, der aber etwas Adrettes an sich hatte durch seine scharf artikulierende, gereizte Stimme und seine Angewohnheit, mit den Händen säuberliche Quadrate zu formen. Und dann war noch ein junger Mann da, ein Rotschopf mit hervorquellenden, wässrigen Augen und pickeliger Haut. Er machte ein Abendstudium und verdiente sein Geld damit, in einem Lastwagen die für die Botenjungen bestimmten Zeitungsbündel auszufahren. Offenbar hatte er gerade erst damit angefangen, und der ältere Mann, der ihn kannte, hänselte ihn mit der Schande, solch eine Zeitung auszuliefern. Werkzeug der kapitalistischen Klassen, Sprachrohr der Elite.
Obwohl das mit scherzhaftem Unterton gesagt wurde, konnte Kent es nicht durchgehen lassen. Besser gleich hineinspringen, dachte er, und nicht erst später. Er sagte, er finde an der Zeitung nicht viel auszusetzen.
Auf so etwas hatten sie nur gewartet. Der ältere Mann hatte schon herausbekommen, dass Kent Pharmazeut war und bei einer der Drugstore-Ketten arbeitete. Und der junge Mann hatte schon gefragt: »Laufen Sie auf der Management-Schiene?«, und zwar so, dass die anderen das als Witz verstanden, nur Kent verstand es nicht so. Kent hatte geantwortet, das hoffe er.
Das Curry wurde aufgetragen, und sie aßen und tranken weiter Bier, und das Feuer erhielt frisches Holz, und der Frühlingshimmel wurde dunkel, und die Lichter von Point Grey erschienen auf der anderen Seite des Burrard Inlet, und Kent nahm es auf sich, den Kapitalismus zu verteidigen, den Koreakrieg, die Kernwaffen, John Foster Dulles, die Hinrichtung der Rosenbergs – alles, was sie ihm an den Kopf warfen. Er hatte nur Hohn für den Gedanken, dass amerikanische Konzerne afrikanische Mütter dahin brachten, Trockenmilch zu kaufen, anstatt ihre Babys zu stillen, und dass die Königlich-Kanadische Berittene Polizei Indianer brutal misshandelte, und vor allem für die Vorstellung, Cottars Telefon könnte abgehört werden. Er zitierte aus dem Nachrichtenmagazin Time und kündigte diese Zitate an.
Der jüngere Mann klatschte sich auf die Knie und schüttelte den Kopf und brach in ungläubiges Gelächter aus.
»Das ist doch nicht zu fassen! Könnt ihr das fassen? Ich nicht.«
Cottar ließ ein Argument nach dem anderen aufmarschieren und versuchte, seine Verärgerung in Zaum zu halten, denn er hielt sich für einen vernünftigen Menschen. Der ältere Mann erging sich in professoralen Abschweifungen, und die Frau mit dem Hängebusen warf in einem Ton giftgetränkter Höflichkeit Bemerkungen ein.
»Warum ist Ihnen so viel daran gelegen, die Obrigkeit zu verteidigen, wo immer sie ihr entzückendes Haupt erhebt?«
Kent wusste nicht, was ihn anstachelte. Er nahm diese Leute nicht einmal ernst. Die drückten sich an den Rändern des wirklichen Lebens herum, hielten flammende Reden und nahmen sich ungeheuer wichtig, wie es Fanatiker jeglicher Couleur taten. Ihnen ging alles Solide ab, im Vergleich zu den Männern, mit denen Kent zu tun hatte. An Kents Arbeitsplatz hatte jeder Fehler Folgen, stand jeder Mitarbeiter ständig in der Verantwortung, man hatte einfach keine Zeit, mit solchen Gedanken herumzuspielen, ob nun Drugstore-Ketten etwas Schlechtes waren oder ob Pharmakonzerne an verbrecherischen Machenschaften beteiligt waren. Das war die wirkliche Welt, und jeden Tag ging er mit der Last seiner und Kaths Zukunft auf den Schultern in diese Welt hinaus. Er bejahte das, er war sogar stolz darauf, und er dachte gar nicht daran, sich bei einer Handvoll Quenglern zu entschuldigen.
»Das Leben wird besser trotz allem, was Sie vorbringen«, hatte er ihnen gesagt. »Sie brauchen sich nur umzuschauen.«
Er distanzierte sich jetzt durchaus nicht von seinem jüngeren Ich. Er fand, er war vielleicht ein bisschen nassforsch gewesen, aber nicht im Unrecht. Doch er machte sich Gedanken über den Zorn in jenem Zimmer, all diese verletzende Energie, was wohl daraus geworden war.
Sonje telefonierte nicht mehr. Sie rief ihm aus der Küche zu: »Den Tee lass ich endgültig weg, es gibt Gin Tonic.«
Als sie die Getränke brachte, fragte er sie, wie lange Cottar schon tot war, und sie antwortete ihm, über dreißig Jahre. Er seufzte und schüttelte den Kopf. So lange schon?
»Er starb sehr schnell an irgendeinem tropischen Virus«, sagte Sonje. »Das passierte in Jakarta. Er war schon unter der Erde, bevor ich überhaupt erfuhr, dass er krank war. Jakarta hieß früher Batavia, hast du das gewusst?«
Kent sagte: »So in etwa.«
»Ich erinnere mich noch an euer Haus«, sagte sie. »Das Wohnzimmer war eigentlich eine Veranda, ging übers ganze Haus, wie unseres. Mit Rollos aus Markisenstoff, grüne und braune Streifen. Kath mochte das Licht, das hindurchfiel, sie nannte es das Urwaldidyll. Du nanntest es die Bruchbude. Jedes Mal, wenn du von dem Haus gesprochen hast. Die Bruchbude.«
»Es stand auf einzementierten Pfählen«, sagte Kent. »Die faulten schon durch. Ein Wunder, dass es nicht eingestürzt ist.«
»Du und Kath, ihr gingt euch immer Häuser ansehen«, sagte Sonje. »An deinem freien Tag seid ihr mit Noelle im Kinderwagen durch irgendwelche Neubausiedlungen gepilgert. Und habt euch alle neuen Häuser angesehen. Du weißt ja, wie diese Neubausiedlungen damals aussahen. Keine Bürgersteige, weil angeblich niemand mehr zu Fuß ging, und alle Bäume abgeholzt, und die Häuser, eins ans andere geklatscht, starrten sich aus ihren Panoramafenstern an.«
Kent sagte: »Was konnte man sich denn damals anderes leisten?«
»Ich weiß, ich weiß. Aber du hast immer gefragt: ›Welches gefällt dir?‹, und Kath hat dir nie geantwortet. Bis du schließlich ausgerastet bist und gefragt hast, ›gibt es überhaupt ein Haus, das dir gefällt‹, und sie gesagt hat: ›Ja, die Bruchbude.‹«
Kent konnte sich nicht daran erinnern. Aber er nahm an, dass es stimmte. Jedenfalls hatte Kath es Sonje so erzählt.
III
Cottar und Sonje gaben eine Abschiedsparty, bevor Cottar auf die Philippinen oder nach Indonesien oder sonst wohin flog und Sonje nach Oregon fuhr, um für seine Mutter zu sorgen. Alle, die an der Bucht wohnten, waren eingeladen – da die Party draußen im Freien stattfinden sollte, war das die einzig vernünftige Lösung. Außerdem einige Leute, mit denen Sonje und Cottar in einer Kommune gewohnt hatten, bevor sie an die Küste zogen, dann noch Journalisten, die Cottar kannte, und Leute, mit denen Sonje in der Stadtbücherei zusammengearbeitet hatte.
»Einfach alle«, sagte Kath, und Kent fragte fröhlich: »Lauter Linke?« Sie sagte, das wisse sie nicht, eben einfach alle.
Die richtige Monica hatte ihre Babysitterin bestellt, und alle Kinder wurden in ihrem Haus abgeliefert, wobei die Eltern sich an den Kosten beteiligten. Kath brachte Noelle in ihrer Babytragetasche hin, als es anfing, dunkel zu werden. Sie sagte der Frau, dass sie vor Mitternacht zurück sein würde, wenn Noelle wahrscheinlich Hunger bekam und aufwachte. Sie hätte das Fläschchen, das sie vorbereitet hatte, mitnehmen können, aber sie ließ es zu Hause. Sie war unsicher wegen der Party und dachte, vielleicht würde sie froh sein über eine Gelegenheit wegzukommen.
Sie hatte nie mit Sonje über das Abendessen in Sonjes Haus geredet, als Kent sich mit allen angelegt hatte. Es war Sonjes erste Begegnung mit Kent gewesen, und hinterher sagte sie nur, dass er wirklich fabelhaft aussah. Kath hatte das Empfinden, Kents Aussehen war in Sonjes Augen nur ein läppischer Trostpreis.
Sie hatte an jenem Abend mit dem Rücken an der Wand gesessen und ein Kissen umklammert. Sie hatte sich angewöhnt, ein Kissen an die Stelle zu halten, wo das Baby strampelte. Das Kissen war ausgeblichen und staubig, wie alles in Sonjes Haus (sie und Cottar hatten es möbliert gemietet). Sein Muster blauer Blüten und Blätter sah inzwischen silbrig aus. Kath heftete den Blick darauf, während Kent von den anderen in die Enge getrieben wurde und es nicht einmal merkte. Der junge Mann redete auf ihn mit der melodramatischen Wut eines Sohnes gegenüber seinem Vater ein, und Cottar sprach mit der strapazierten Geduld eines Lehrers gegenüber einem seiner Schüler. Der ältere Mann amüsierte sich verbittert, und die Frau war voll moralischen Abscheus, als wäre Kent persönlich verantwortlich für Hiroshima und asiatische Mädchen, die in zugesperrten Fabriken verbrannten, für jede üble Lüge und hohltönende Heuchelei. Und Kent forderte das meiste davon heraus, war Kaths Eindruck. Sie hatte etwas Ähnliches befürchtet, als sie sein Hemd mit Krawatte sah, und beschlossen, Jeans anzuziehen, und nicht den schicklichen Umstandsrock. Und als sie dann dort war, musste sie es aussitzen, das Kissen hierhin und dorthin verdrehen, um das silbrige Glitzern einzufangen.
Alle im Raum waren sich in allem so sicher. Kurze Atempausen legten sie nur ein, um aus einem nie versiegenden Quell reiner Tugend, reiner Gewissheit zu schöpfen.
Außer vielleicht Sonje. Sonje sagte nichts. Aber Sonjes Quell war Cottar; er war ihre Gewissheit. Sie stand auf, um noch von dem Curry anzubieten, sie sprach in eine der kurzen, wuterfüllten Schweigepausen.
»Offenbar wollte niemand Kokosnuss.«
»Ach, Sonje, spielst du die taktvolle Gastgeberin?«, fragte die ältere Frau. »Wie jemand bei Virginia Woolf?«
Wie es schien, stand Virginia Woolf also auch in Misskredit. Da war so vieles, was Kath nicht verstand. Aber zumindest wusste sie, dass es da war; sie erklärte es nicht kurzerhand für Unsinn.
Trotzdem wünschte sie, ihre Fruchtblase würde platzen. Ihr war alles recht, Hauptsache, es brachte Erlösung. Wenn sie aufsprang und eine Pfütze unter sich machte, mussten sie aufhören.
Hinterher schien Kent vom Verlauf des Abends überhaupt nicht verunsichert zu sein. Zumal er meinte, gewonnen zu haben. »Das sind alles Linke, die müssen so reden«, sagte er. »Das ist das Einzige, was sie machen können.«
Kath wollte auf keinen Fall weiter über Politik reden, deshalb wechselte sie das Thema und erzählte ihm, dass das ältere Paar mit Sonje und Cottar in einer Kommune zusammengelebt hatte. Mit noch einem weiteren Paar, das inzwischen weggezogen war. Und es hatte regelmäßiger Partnertausch stattgefunden. Der ältere Mann hatte zudem noch eine Geliebte, die nicht in der Kommune wohnte, aber zeitweilig am Partnertausch teilnahm.
Kent fragte: »Du willst sagen, junge Männer sind mit der Alten ins Bett gestiegen? Die muss doch fünfzig sein.«
Kath sagte: »Cottar ist achtunddreißig.«
»Trotzdem«, sagte Kent. »Ist ja ekelhaft.«
Aber Kath fand die Vorstellung von solchem vertraglich festgesetzten und obligatorischen Beischlaf mindestens so erotisierend wie ekelhaft. Sich gehorsam und schuldfrei jedwedem hinzugeben, der laut Liste an der Reihe war – das war wie Tempelprostitution. Lust im Gewande der Pflicht. Daran zu denken versetzte sie in tiefe, obszöne Erregung.
Sonje hatte es nicht in Erregung versetzt. Sie hatte keinerlei sexuelle Befreiung erlebt. Cottar fragte sie immer danach, wenn sie zu ihm zurückkam, und sie musste mit Nein antworten. Er war enttäuscht, und sie war um seinetwillen enttäuscht. Er erklärte ihr, dass sie zu sehr auf eine Person fixiert und zu sehr in der Vorstellung von sexuellem Eigentum befangen war, und sie sah ein, dass er recht hatte.
»Ich weiß, er denkt, wenn ich ihn mehr liebte, könnte ich es besser«, sagte sie. »Dabei liebe ich ihn bis zum Wahnsinn.«
Trotz der verführerischen Gedanken, die ihr in den Kopf kamen, war Kath überzeugt, dass sie einzig mit Kent schlafen konnte. Sex war wie etwas, das sie miteinander erfunden hatten. Es mit jemand anderem zu versuchen hieße, auf einen anderen Stromkreis umzuschalten – ihr ganzes Leben würde ihr um die Ohren fliegen. Und doch konnte sie nicht von sich sagen: Ich liebe Kent bis zum Wahnsinn.
Als sie am Strand entlang von Monicas Haus zu Sonjes Haus ging, sah sie Leute auf die Party warten. Sie standen in kleinen Grüppchen herum oder saßen auf Baumstämmen und sahen sich den Rest des Sonnenuntergangs an. Sie tranken Bier. Cottar und ein anderer Mann wuschen einen Abfalleimer aus, um darin den Punsch zu machen. Miss Campo, die Leiterin der Stadtbücherei, saß allein auf einem Baumstamm. Kath winkte ihr fröhlich zu, ging aber nicht hin, um sich ihr anzuschließen. Wenn man sich in diesem Stadium jemandem anschloss, saß man fest. Dann blieb man zu zweit. Das Beste war, sich einer Gruppe von drei oder vier Leuten anzuschließen, selbst wenn man das Gespräch – das aus der Ferne so lebhaft gewirkt hatte – dann fürchterlich mühsam fand. Aber das konnte sie schlecht tun, nachdem sie Miss Campo zugewinkt hatte. Sie musste den Anschein erwecken, ein Ziel zu haben. Also ging sie weiter, an Kent vorbei, der sich mit Monicas Mann darüber unterhielt, wie lange es wohl dauern würde, einen der Baumstämme am Strand zu zersägen, die Treppe zu Sonjes Haus hinauf und in die Küche.
Sonje rührte in einem großen Topf mit Chili, und die ältere Frau aus der Kommune legte Roggenbrotschnitten mit Salami und Käse auf einen großen Teller. Sie hatte dasselbe an wie bei dem Curry-Abendessen, einen pluderigen Rock und einen missfarbenen, aber dafür enganliegenden Pullover, in dem die Brüste, die er so eng umschloss, bis zur Taille hingen. Das hatte offenbar etwas mit Marxismus zu tun, dachte Kath – Cottar wollte nicht, dass Sonje einen Büstenhalter trug oder Nylonstrümpfe oder Lippenstift. Außerdem hatte es mit ungehemmtem, eifersuchtslosem Sex zu tun, mit dem ursprünglichen, unverdorbenen Verlangen, das auch vor einer Fünfzigjährigen nicht zurückschreckte.
Eine junge Frau aus der Stadtbücherei war auch da, sie schnitt grüne Paprikaschoten und Tomaten klein. Und eine Frau, die Kath nicht kannte, saß auf dem Küchenhocker und rauchte eine Zigarette.
»Also mit Ihnen haben wir ja ein Hühnchen zu rupfen«, sagte die junge Frau aus der Stadtbücherei zu Kath. »Wir alle in der Bibliothek. Wir hören, Sie haben das süßeste Baby der Welt, aber wir kriegen es nicht zu sehen. Wo ist es denn jetzt?«
Kath sagte: »Schläft hoffentlich.«
Die junge Frau hieß Lorraine, aber Sonje und Kath hatten sie in ihren Gesprächen über die Zeit bei der Bücherei Debbie Reynolds getauft. Sie stand immer unter Dampf.
»Och«, sagte sie.
Die Hängebusenfrau warf ihr und auch Kath einen Blick nachdenklichen Abscheus zu.
Kath machte eine Flasche Bier auf und gab sie Sonje, die sagte: »Oh, danke. Ich war so mit dem Chili beschäftigt, dass ich ganz vergessen habe, mir was zu trinken zu nehmen.« Sie war unsicher, weil sie nicht so gut kochen konnte wie Cottar.
»Bloß gut, dass Sie das nicht selber trinken wollten«, sagte die junge Frau aus der Stadtbücherei zu Kath. »Das ist tabu, wenn Sie stillen.«
»Ich habe die ganze Zeit über Bier geschluckt, als ich gestillt habe«, sagte die Frau auf dem Hocker. »Ich glaube, es wurde sogar empfohlen. Das meiste davon pinkelt man sowieso wieder aus.«
Die Augen der Frau waren mit schwarzem Lidstrich umrandet, der die Augenwinkel verlängerte, und ihre Lider waren bis zu den glänzenden schwarzen Brauen mit rotstichigem Blau angemalt. Ihr übriges Gesicht war kreidebleich oder so geschminkt, und ihre Lippen waren so blassrosa, dass sie fast weiß wirkten. Kath hatte solche Gesichter schon gesehen, aber nur in Modezeitschriften.
»Das ist Amy«, sagte Sonje. »Amy, das ist Kath. Entschuldigt, ich habe euch nicht vorgestellt.«
»Sonje, du entschuldigst dich andauernd«, sagte die ältere Frau.
Amy nahm sich ein Stück Käse, das gerade abgeschnitten worden war, und aß es.
Amy war der Name der Geliebten. Der Geliebten von dem Mann der älteren Frau. Plötzlich wollte Kath sie gern kennenlernen, sich mit ihr anfreunden, wie sie sich einmal mit Sonje hatte anfreunden wollen.
Inzwischen war es Nacht geworden, und die Grüppchen am Strand waren nicht mehr so deutlich zu erkennen; sie zeigten stärkere Neigung zusammenzufließen. Unten am Rand des Wassers hatten Frauen die Schuhe ausgezogen, streiften die Strümpfe herunter, falls sie welche trugen, und stippten die Zehen ins Wasser. Die meisten tranken nicht mehr Bier, sondern Punsch, und der Punsch machte bereits eine Reihe von Wandlungen durch. Anfangs hatte er hauptsächlich aus Rum und Ananassaft bestanden, doch inzwischen waren andere Fruchtsäfte und Mineralwasser und Wodka und Wein hinzugefügt worden.
Die, die ihre Schuhe auszogen, wurden angefeuert, mehr auszuziehen. Manche rannten fast vollständig angezogen ins Wasser, legten dann die Sachen ab und warfen sie Fängern am Ufer zu. Andere zogen sich aus, wo sie waren, und machten sich gegenseitig damit Mut, dass es zu dunkel sei, um etwas zu sehen. Aber man konnte sehr wohl nackte Körper ins dunkle Wasser rennen und hineinstürzen und herumplanschen sehen. Monica hatte einen großen Stapel Handtücher aus ihrem Haus geholt und rief allen zu, sich eins umzuwickeln, wenn sie herauskamen, damit sie sich nicht den Tod holten.
Der Mond ging hinter den schwarzen Bäumen oben auf den Klippen auf und sah so riesengroß aus, so feierlich und atemberaubend, dass es Ausrufe des Erstaunens gab. Was ist denn das? Und auch, als er höher am Himmel stand und zu normaler Größe geschrumpft war, sprachen viele immer wieder von ihm und sagten: »Der Vollmond zu Herbstanfang« oder »Hast du ihn gesehen, als er aufgegangen ist?«
»Ich habe wirklich gedacht, es wäre ein gigantischer Ballon.«
»Ich bin gar nicht drauf gekommen, was das war. Ich hätte nie gedacht, dass der Mond so riesig sein kann.«
Kath stand unten am Wasser und unterhielt sich mit dem Mann, dessen Frau und dessen Geliebte sie vorher in Sonjes Küche gesehen hatte. Seine Frau badete jetzt, ein wenig abseits von den Kreischern und Planschern. In einem anderen Leben, sagte der Mann, sei er Geistlicher gewesen.
»›Einst wogte auch das Meer des Glaubens auf der höchsten Flut‹«, sagte er scherzhaft. »›Und schmiegte rings sich um die irdischen Gestade wie ein lichter Gürtel‹ – damals war ich mit einer völlig anderen Frau verheiratet.«
Er seufzte, und Kath dachte, er suchte nach dem Rest des Verses.
»›Doch nun‹«, sagte sie, »›vernehm ich weithin nur sein trostlos Brausen fernab der öden Ufer und steinig nackten Küsten dieser Welt.‹« Dann verstummte sie, denn was danach kam, war ihr zu viel: »O Liebe, lass uns treu sein –«
Seine Frau schwamm auf sie zu, bis das Wasser ihr nur noch an die Knie reichte, dann richtete sie sich auf. Ihre Brüste schwangen hin und her und schleuderten Wassertropfen um sich, als sie herauswatete.
Ihr Mann breitete die Arme aus. »Europa«, rief er im Tonfall kameradschaftlicher Begrüßung.
»Dann sind Sie Zeus«, sagte Kath kühn. Sie wollte auf der Stelle von einem solchen Mann geküsst werden. Von einem Mann, den sie kaum kannte und an dem ihr nichts lag. Und wirklich küsste er sie, fuhr mit seiner kühlen Zunge in ihrem Mund herum.
»Man stelle sich vor, ein Erdteil, benannt nach einer Kuh«, sagte er. Seine Frau stand dicht vor ihnen und atmete dankbar nach ihrem anstrengenden Bad. Sie stand so nah, dass Kath Angst hatte, von ihren langen, dunklen Brustwarzen oder ihrem Mopp schwarzer Schamhaare gestreift zu werden.
Jemand hatte ein Feuer gemacht, und die, die im Wasser gewesen waren, standen jetzt herum, in Decken oder Handtücher gewickelt, oder hockten hinter Baumstämmen und krabbelten in ihre Sachen.
Und Musik spielte. Die Leute, die neben Monica wohnten, besaßen einen Anlegesteg und ein Bootshaus. Ein Plattenspieler war heruntergeholt worden, und einige fingen an zu tanzen. Auf dem Bootssteg und, mühsamer, im Sand. Sogar auf einem Baumstamm machte jemand ein oder zwei Tanzschritte, bevor er stolperte und herunterfiel oder -sprang. Frauen, die sich wieder angezogen oder nie ausgezogen hatten, Frauen, die zu ruhelos waren, um an einem Ort zu verharren – wie Kath auch –, gingen am Wasserrand spazieren (niemand badete mehr, Baden war völlig vorbei und vergessen), und wegen der Musik gingen sie anders. Sie wiegten sich in den Hüften, anfangs noch gehemmt, im Scherz, dann frecher, wie schöne Frauen im Film.
Miss Campo saß immer noch an derselben Stelle und lächelte.
Die junge Frau, die Kath und Sonje Debbie Reynolds nannten, saß an einen Baumstamm gelehnt im Sand und weinte. Sie lächelte Kath zu und sagte: »Glauben Sie ja nicht, dass ich traurig bin.«
Ihr Mann hatte für ein College Football gespielt und besaß jetzt eine Karosseriewerkstatt. Wenn er in die Bücherei kam, um seine Frau abzuholen, sah er immer aus wie ein gestandener Footballspieler, den der Rest der Welt ein wenig anwiderte. Aber jetzt kniete er neben ihr und spielte mit ihren Haaren.
»Schon gut«, sagte er. »So ist das jedes Mal bei ihr. Nicht wahr, Schatz?«
»Ja, stimmt«, sagte sie.
Kath fand Sonje beim Feuer, sie ging herum und verteilte Marshmallows. Manche schafften es, sie auf Stöckchen zu spießen und zu toasten, andere warfen sie hin und her und verloren sie im Sand.
»Debbie Reynolds weint«, sagte Kath. »Aber alles in Ordnung. Sie ist glücklich.«
Beide fingen an zu lachen, sie umarmten sich und drückten die Tüte mit Marshmallows zwischen sich platt.
»Ach, du wirst mir fehlen«, sagte Sonje. »Unsere Freundschaft wird mir fehlen.«
Beide nahmen sich ein kaltes Marshmallow und aßen es, lachten und sahen einander an, erfüllt von süßer Wehmut.
»Tue dies zum Gedenken an mich«, sagte Kath. »Du bist meine wahrste, echteste Freundin.«
»Und du meine«, sagte Sonje. »Die wahrste, echteste. Cottar sagt, er will heute Nacht mit Amy schlafen.«
»Verbiet es ihm«, sagte Kath. »Verbiet es ihm, wenn du dich schlecht dabei fühlst.«
»Ach, das ist keine Frage des Verbietens«, sagte Sonje tapfer. Sie rief: »Wer möchte Chili? Cottar teilt da drüben das Chili aus. Chili? Chili?«
Cottar hatte den Kessel mit Chili die Treppe heruntergetragen und in den Sand gestellt.
»Vorsicht, heiß«, sagte er immer wieder mit väterlicher Stimme. »Vorsicht, der Kessel ist heiß.«
Er hockte da, um den Gästen aufzutun, nur mit einem Handtuch bekleidet, das aufklappte. Amy stand neben ihm und gab Näpfe aus.
Kath trat vor Cottar und wölbte die Hände zu einer Schale.
»Bitte, Hochwürden«, sagte sie, »ich bin eines Napfes nicht würdig.«
Cottar sprang auf, ließ die Schöpfkelle fallen und legte ihr die Hände auf den gesenkten Kopf.
»Sei gesegnet, mein Kind, die Letzten werden die Ersten sein.« Er küsste sie auf den Nacken.
»Ahh«, sagte Amy, als erhielte oder gäbe sie diesen Kuss selbst.
Kath hob den Kopf und sah an Cottar vorbei.
»Ich würde zu gern solchen Lippenstift auflegen«, sagte sie.
Amy sagte: »Komm mit.« Sie stellte die Näpfe ab und legte Kath sanft den Arm um die Taille und zog sie zur Treppe.
»Hier hinauf«, sagte sie. »Wir werden dich komplett schminken.«
Im winzigen Badezimmer hinter Cottars und Sonjes Schlafzimmer legte Amy Näpfchen und Tuben und Stifte aus. Es gab dafür keinen anderen Platz als den Klodeckel. Kath musste sich auf den Rand der Badewanne hocken, ihr Gesicht berührte beinahe Amys Bauch. Amy verteilte eine Flüssigkeit auf ihren Wangen und rieb eine Paste auf ihre Augenlider. Dann tupfte sie Puder auf. Sie bürstete und tuschte Kaths Augenbrauen und pinselte drei Schichten Mascara auf ihre Wimpern. Sie umrandete ihre Lippen mit einem Konturstift und trug Lippenstift auf und tupfte ihn ab und trug noch einmal Lippenstift auf. Sie nahm Kaths Gesicht in die Hände und neigte es zur Lampe.
Jemand klopfte an die Tür und rüttelte dann daran.
»Moment«, rief Amy. Dann: »Was ist los mit dir, kannst du nicht hinter einen Baumstamm pinkeln?«
Sie ließ Kath erst in den Spiegel schauen, als alles fertig war.
»Und nicht lächeln«, sagte sie. »Das verdirbt die Wirkung.«
Kath zog die Mundwinkel herunter und starrte finster ihr Spiegelbild an. Ihre Lippen waren wie fleischige Blütenblätter, Lilienblütenblätter. Amy zog Kath fort. »So doch nicht«, sagte sie. »Besser, du siehst dich überhaupt nicht, versuch nicht, irgendwie auszusehen, du siehst gut aus.«
»Kneif deine Pobacken zusammen, wir kommen raus«, brüllte sie der neuen Person oder vielleicht derselben Person zu, die an die Tür hämmerte. Sie stopfte ihre Siebensachen in ihr Schminktäschchen und schob es unter die Badewanne. Sie sagte zu Kath: »Komm, meine Schöne.«
Lachend und einander herausfordernd tanzten Amy und Kath auf dem Bootssteg. Männer versuchten, sich zwischen sie zu drängen, aber für eine Weile gelang es ihnen, das zu verhindern. Dann gaben sie auf, sie wurden getrennt, blickten verzweifelt und flatterten mit den Armen wie im Boden feststeckende Vögel, als jede von einem Partner in dessen Umlaufbahn gezogen wurde.
Kath tanzte mit einem Mann, den sie an dem Abend bislang noch nicht gesehen hatte. Er schien etwa in Cottars Alter zu sein. Er war groß, mit den Anfängen eines Schmerbauchs, einem Wust stumpfer, krauser Haare und einem kaputten, verprügelten Ausdruck um die Augen.
»Ich falle gleich runter«, sagte Kath. »Mir ist schwindlig. Ich falle gleich über Bord.«
Er sagte: »Ich fange Sie auf.«
»Mir ist schwindlig, aber ich bin nicht betrunken«, sagte sie.
Er lächelte, und sie dachte, das sagen Betrunkene immer.
»Ist wahr«, sagte sie, und es stimmte, denn sie hatte nicht mal eine Flasche Bier ausgetrunken oder gar den Punsch angerührt.
»Es sei denn, ich hab’s durch die Haut aufgenommen«, sagte sie. »Osmose.«
Er antwortete nicht, zog sie nur an sich und ließ sie wieder los, schaute ihr aber unverwandt in die Augen.
Sex mit Kent war gierig und zielstrebig, aber zugleich zurückhaltend. Sie hatten einander nicht verführt, sondern waren in eine intime Beziehung oder das, was sie dafür hielten, mehr oder weniger hineingestolpert und dann dort geblieben. Wenn es nur den Einen oder die Eine im Leben geben soll, braucht nichts zu etwas Besonderem gemacht zu werden – es ist es schon. Sie hatten einander nackt betrachtet, sich aber dabei – außer durch Zufall – nicht in die Augen geschaut.
Genau das tat Kath jetzt mit ihrem unbekannten Partner ohne Unterlass. Sie näherten und entfernten und umkreisten und entschlüpften sich, setzten sich füreinander in Szene und schauten sich in die Augen. Ihre Augen behaupteten, alles das sei nichts im Vergleich zu der wilden Balgerei, die sie veranstalten könnten, wenn sie nur wollten.
Dabei geschah alles im Spaß. Sobald sie sich berührten, ließen sie wieder los. Wenn sie sich nahe waren, öffneten sie den Mund und fuhren sich sinnlich mit der Zunge über die Lippen und wichen sofort zurück, in gespielter Lustlosigkeit.
Kath trug einen kurzärmeligen Angorapullover mit tiefem V-Ausschnitt, vorn zu knöpfen, was für das Stillen praktisch war.
Als sie sich das nächste Mal nahe kamen, hob ihr Partner wie zum Schutz den Arm und streifte mit dem Handrücken und dem bloßen Unterarm über ihre unter der elektrisch aufgeladenen Wolle steifen Brüste. Beide taumelten, brachen beinahe ab. Tanzten weiter – Kath schwach und mit weichen Knien.
Sie hörte jemanden ihren Namen rufen.
Mrs Mayberry. Mrs Mayberry.
Es war die Kinderfrau, auf der Treppe vor Monicas Haus.
»Ihr Baby. Ihr Baby ist wach. Können Sie kommen und es stillen?«
Kath erstarrte. Auf unsicheren Beinen bahnte sie sich einen Weg durch die Tanzenden. Außerhalb des Lichtkegels sprang sie herunter und stolperte durch den Sand. Sie wusste, ihr Partner war hinter ihr, sie hörte ihn herunterspringen. Sie war bereit, ihm ihren Mund oder ihre Kehle darzubieten. Aber er packte sie bei der Hüfte, drehte sie herum, fiel auf die Knie und küsste durch die Baumwollhose ihre Scham. Dann stand er auf, behände für einen Mann seiner Größe, und beide wandten sich im gleichen Augenblick voneinander ab. Kath hastete ins Licht und stieg die Treppe zu Monicas Haus empor. Keuchend zog sie sich am Geländer hoch, wie eine alte Frau.
Die Kinderfrau war in der Küche.
»Ach, Ihr Mann«, sagte sie. »Ihr Mann ist gerade mit der Flasche gekommen. Ich wusste nicht, wie die Absprache war, sonst hätt ich mir die Brüllerei sparen können.«
Kath ging weiter in Monicas Wohnzimmer. Das einzige Licht dort kam aus der Diele und der Küche, aber sie konnte erkennen, dass es ein richtiges Wohnzimmer war, keine umgebaute Veranda wie bei ihr und bei Sonje. Sie sah einen modernen skandinavischen Couchtisch und Polstermöbel und Vorhänge.
Kent saß in einem Sessel und gab Noelle die Flasche.
»Hi«, sagte er und sprach leise, obwohl Noelle viel zu kräftig nuckelte, um auch nur halb zu schlafen.
»Hi«, sagte Kath und setzte sich aufs Sofa.
»Ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz vernünftig«, sagte er. »Falls du was getrunken hast.«
Kath sagte: »Ich habe nichts getrunken.« Sie hob die Hand, um zu erkunden, wie milchgefüllt ihre Brüste waren, aber die Berührung der Wolle versetzte ihr solch einen Schock des Verlangens, dass sie nicht weitertasten konnte.
»Jetzt kannst du, wenn du willst«, sagte Kent.
Sie blieb vorgebeugt auf der Sofakante sitzen und hätte ihn zu gern gefragt, ob er auf dem vorderen oder dem hinteren Weg hergekommen war. Also auf der Straße oder über den Strand. Wenn er über den Strand gekommen war, hätte er sie eigentlich tanzen sehen müssen. Aber auf dem Bootssteg tanzten jetzt viele, so dass ihm einzelne Tänzer vielleicht nicht aufgefallen waren.
Immerhin hatte die Kinderfrau sie erspäht. Und er musste deren Rufe gehört haben. Dann brauchte er nur zu schauen, in welche Richtung sie rief.
Falls er über den Strand gekommen war. Denn wenn er von der Straße hergekommen und durch die Diele, nicht durch die Küche, ins Haus gegangen war, hatte er die Tanzenden überhaupt nicht sehen können.
»Hast du gehört, dass sie mich gerufen hat?«, fragte Kath. »Bist du deshalb nach Hause gegangen und hast die Flasche geholt?«
»Ich hatte schon vorher daran gedacht«, sagte er. »Ich dachte, es wäre an der Zeit.« Er hielt die Flasche hoch, um zu sehen, wie viel Noelle getrunken hatte.
»Hungrig«, sagte er.
Sie sagte: »Ja.«
»Das ist jetzt deine Gelegenheit. Wenn du dir einen ansaufen willst.«
»Und du? Hast du dir einen angesoffen?«
»Ich habe mein Quantum intus«, sagte er. »Geh ruhig, wenn du willst. Mach dir einen netten Abend.«
Sie fand, seine Großspurigkeit klang traurig und vorgetäuscht. Er musste sie tanzen gesehen haben. Denn sonst hätte er gefragt: »Was hast du denn mit deinem Gesicht angestellt?«
»Ich warte lieber auf dich«, sagte sie.
Er sah stirnrunzelnd das Baby an und hielt die Flasche schräg.
»Fast leer«, sagte er. »Von mir aus können wir.«
»Ich muss nur mal auf die Toilette«, sagte Kath. Und im Badezimmer, wie sie es in Monicas Haus nicht anders erwartet hatte, fand sie einen reichlichen Vorrat an Kleenextüchern. Sie ließ das Wasser laufen, bis es heiß war, weichte und wischte, weichte und wischte, und von Zeit zu Zeit warf sie einen Klumpen schwarzer und violetter Tücher in die Toilette und spülte.
IV
Beim zweiten Gin Tonic, als Kent über die heutzutage horrenden, geradezu unanständigen Immobilienpreise in West Vancouver redete, sagte Sonje: »Weißt du, ich habe eine Theorie.«
»Diese Häuser, in denen wir mal gewohnt haben«, sagte er. »Die sind lange verkauft. Für ein Butterbrot, im Vergleich zu heute. Jetzt würde man wer weiß was für sie kriegen. Nur für das Grundstück und die Abrissgenehmigung.«
Was hatte sie für eine Theorie? Über die Immobilienpreise?
Nein. Über Cottar. Sie glaubte nicht, dass er tot war.
»Anfangs natürlich schon«, sagte sie. »Es kam mir nie in den Sinn, daran zu zweifeln. Und dann bin ich plötzlich aufgewacht und habe gesehen, dass es nicht unbedingt zu stimmen brauchte. Es brauchte überhaupt nicht zu stimmen.«
»Bedenke die Umstände«, sagte sie. Ein Arzt hatte ihr geschrieben. Aus Jakarta. Das heißt, der Mann, der ihr schrieb, behauptete, Arzt zu sein. Er schrieb, dass Cottar gestorben war und woran er gestorben war, er benutzte einen medizinischen Fachausdruck, den sie vergessen hatte. Jedenfalls war es eine ansteckende Krankheit. Aber woher wusste sie, dass dieser Mann wirklich Arzt war? Oder selbst wenn er vielleicht Arzt war, woher wusste sie, dass er die Wahrheit geschrieben hatte? Es wäre für Cottar nicht schwer gewesen, einen Arzt kennenzulernen. Sich mit ihm anzufreunden. Cottar hatte alle möglichen Freunde.
»Oder ihn sogar dafür zu bezahlen«, sagte sie. »Das ist auch nicht außerhalb des Möglichen.«
Kent fragte: »Warum sollte er so was tun?«
»Er wäre nicht der erste Arzt, der so was getan hat. Vielleicht brauchte er das Geld für ein Armenkrankenhaus, woher sollen wir das wissen? Vielleicht wollte er es einfach für sich selbst. Ärzte sind keine Heiligen.«
»Nein«, sagte Kent. »Ich meinte Cottar. Warum sollte Cottar das tun? Und hatte er überhaupt Geld?«
»Nein. Er selbst hatte keins, aber – ich weiß nicht. Es ist sowieso nur eine Hypothese. Das Geld. Und ich war hier, weißt du. Ich war hier, um für seine Mutter zu sorgen. An seiner Mutter hing er wirklich. Er wusste, ich würde sie nie im Stich lassen. Also war das geregelt.
Und das war es wirklich«, sagte sie. »Ich mochte Delia sehr. Sie war mir keine Last. Ich habe mich vielleicht wirklich besser dazu geeignet, für sie zu sorgen, als mit Cottar verheiratet zu sein. Und weißt du, etwas Merkwürdiges. Delia dachte dasselbe wie ich. Über Cottar. Sie hatte denselben Verdacht. Und sie hat nie mit mir darüber gesprochen. Ich habe ihr auch nie etwas gesagt. Jede dachte, es würde der anderen das Herz brechen. Dann eines Abends, gar nicht lange, bevor sie – gehen musste, habe ich ihr einen Krimi vorgelesen, der in Hongkong spielte, und sie sagte: ›Da ist Cottar jetzt vielleicht. In Hongkong.‹
Sie sagte, hoffentlich hätte sie mich nicht erschreckt. Dann habe ich ihr erzählt, was ich die ganze Zeit gedacht hatte, und sie hat gelacht. Wir haben beide gelacht. Man sollte erwarten, dass es eine alte Mutter todtraurig macht, davon zu reden, dass ihr einziges Kind auf und davon ist und sie verlassen hat, aber nein. Vielleicht sind alte Leute gar nicht so. Sehr alte Leute. Sie werden nicht mehr todtraurig. Sie denken wohl, es lohnt sich nicht.
Er wusste, ich würde mich um sie kümmern, obwohl er nicht wissen konnte, wie lange das dann gedauert hat«, sagte sie. »Ich würde dir gern den Brief von dem Arzt zeigen, aber ich habe ihn weggeworfen. Das war sehr dumm von mir, aber ich war zu der Zeit verzweifelt. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich den Rest meines Lebens bewältigen sollte. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich dem nachgehen und mich nach seiner Approbation erkundigen oder einen Totenschein verlangen müsste oder irgendwas. An so was habe ich erst später gedacht, und da hatte ich die Adresse nicht mehr. Ich konnte nicht an die amerikanische Botschaft schreiben, denn das waren die Letzten, mit denen Cottar irgendwas zu tun haben wollte. Und er war kein kanadischer Staatsbürger. Vielleicht hatte er sogar einen anderen Namen. Eine falsche Identität, in die er schlüpfen konnte. Falsche Papiere. Er hat immer wieder so was angedeutet. Das war für mich ein Teil seiner Faszination.«
»Einiges davon könnte eine Art Selbstinszenierung gewesen sein«, sagte Kent. »Meinst du nicht?«
Sonje sagte: »Aber sicher.«
»Es gab keine Lebensversicherung?«
»Wo denkst du hin?«