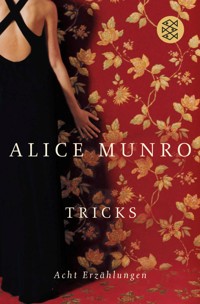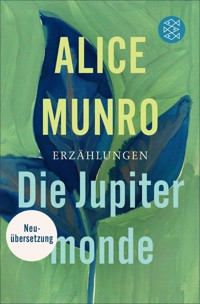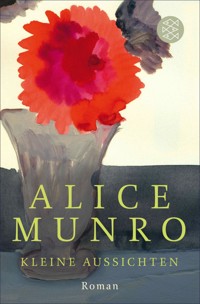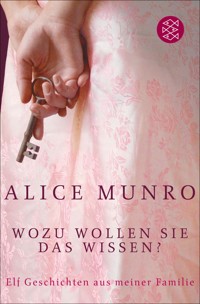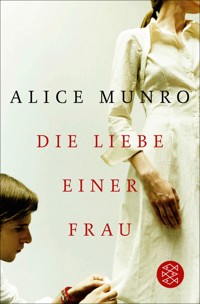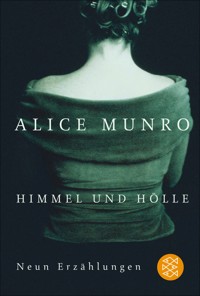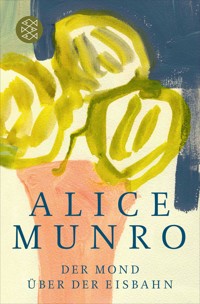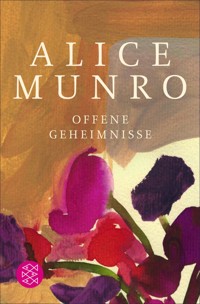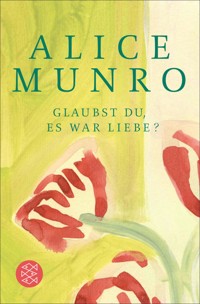
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nobelpreis für Literatur 2013 Endlich wieder lieferbar! In einer der Geschichten aus ›Glaubst du, es war Liebe?‹ lernt Georgia den Tiefseetaucher Miles kennen. Sie schläft mit ihm, im Auto und am Strand, beginnt eine Affäre. Sie ist nicht im Geringsten verliebt, fühlt sich "vom Kosmos beschenkt", bis sich ihr Leben mit Lügen füllt… Ein Band mit Geschichten, wie sie nur die Nobelpreisträgerin Alice Munro schreiben kann – über Frauen, die Vieles verlieren und Großes gewinnen: ein Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alice Munro
Glaubst du, es war Liebe?
Über dieses Buch
In einer der zehn Geschichten aus ›Glaubst du, es war Liebe?‹ lernt Georgia den Tiefseetaucher Miles kennen. Sie schläft mit ihm, im Auto und am Strand, beginnt eine Affäre. Sie ist nicht im Geringsten verliebt, fühlt sich »vom Kosmos beschenkt«, bis sich ihr Leben mit Lügen füllt… Ein Band mit Geschichten über Sehnsüchte, das Ankommen und Ausbrechen, wie sie nur die Nobelpreisträgerin Alice Munro schreiben kann – über Figuren, die Vieles verlieren und Großes gewinnen: ein Leben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alice Munro, geboren 1931 in Wingham, Ontario, ist eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie erhielt 2013 die höchste Auszeichnung für Literatur – den Nobelpreis. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde zuvor bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Giller Prize, dem Book Critics Circle Award sowie dem Man Booker International Prize. Alice Munro lebt in Ontario, Kanada.
Im Fischer Taschenbuch Verlag liegen vor: ›Himmel und Hölle‹ (Bd. 15707), ›Die Liebe einer Frau‹ (Bd. 15708), ›Der Traum meiner Mutter‹ (Bd. 16163), ›Tricks‹ (Bd. 16818), ›Wozu wollen Sie das wissen?‹ (Bd. 16969), ›Zu viel Glück‹ (Bd. 18686), ›Tanz der seligen Geister‹ (Bd. 18875), ›Was ich dir schon immer sagen wollte‹ (18876) und ›Offene Geheimnisse‹ (03096).
Bei S. Fischer erschien zuletzt der Band ›Liebes Leben‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Leanne Shapton
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel ›Friend Of My Youth‹ bei
McClelland and Stewart, Toronto
© Alice Munro, 1990
Der Band wurde 1991 zum ersten Mal
im Klett-Cotta Verlag auf Deutsch veröffentlicht.
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403080-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Freundin aus meiner Jugendzeit
Five Points
Meneseteung
I
II
III
IV
V
VI
Halt mich fest, lass mich nicht los
Äpfel und Birnen
Bilder vom Eis
Güte und Barmherzigkeit
Ach, wozu …
I – Die Blindschleiche
II – Eisschlamm
III – Rose Matilda
Anders
Glaubst du, es war Liebe?
Zur Erinnerung an meine Mutter
Freundin aus meiner Jugendzeit
Für R.J.T. mit Dank
Eine Zeitlang träumte ich häufig von meiner Mutter, und obwohl die Details im Traum sich veränderten, blieb die Überraschung immer gleich. Der Traum hörte auf, vermutlich weil er in seiner Hoffnung zu durchsichtig, in seiner Versöhnlichkeit zu einfach war.
In dem Traum war ich gewöhnlich so alt wie in Wirklichkeit, lebte mein wirkliches Leben und entdeckte dann, dass meine Mutter noch am Leben war. (Tatsache ist, dass sie starb, als ich Anfang zwanzig und sie Anfang fünfzig war.) Manchmal befand ich mich in unserer alten Küche, wo meine Mutter auf dem Tisch Mürbteig ausrollte oder in der angeschlagenen altweißen Schüssel mit dem roten Rand Geschirr spülte. Aber manchmal traf ich sie zufällig auf der Straße, an Orten, wo ich sie nie vermutet hätte. Es konnte sein, dass sie durch ein elegantes Hotelfoyer spazierte oder an einem Flughafen in der Schlange stand. Sie sah immer recht munter aus – nicht gerade jugendlich, nicht gänzlich unberührt von der lähmenden Krankheit, die sie vor ihrem Tod über ein Jahrzehnt lang in den Klauen hielt, aber so viel besser als in meiner Erinnerung, dass ich staunte. Ach, ich habe nur dieses kleine Zucken im Arm, sagte sie zum Beispiel, und mein Gesicht ist auf dieser Seite ein bisschen steif. Es ist lästig, aber ich komme zurecht.
Damals fand ich etwas wieder, was mir im wachen Leben verloren gegangen war – das lebhafte Gesicht und die Stimme meiner Mutter, bevor ihre Halsmuskeln starr wurden und sich eine kummervolle, unpersönliche Maske über ihre Züge legte. Wie konnte ich das alles vergessen, dachte ich im Traum – ihren ungezwungenen, nicht ironischen, sondern heiteren Humor, ihre Unbekümmertheit und Ungeduld und ihr Vertrauen? Ich sagte dann stets, wie leid es mir tue, dass ich sie so lange nicht besucht hatte – und meinte damit nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, sondern dass ich bedauerte, anstelle dieser Realität ein Schreckgespenst im Kopf behalten zu haben –, und bekam von ihr eine nüchterne Antwort, die für mich das Seltsamste, Beglückendste des Ganzen war:
Na ja, sagte sie, lieber spät als nie. Ich war sicher, dass ich dich eines Tages wiedersehen würde.
Als meine Mutter eine junge Frau war, mit einem weichen, schelmischen Gesicht, blickdichten Seidenstrümpfen an den kräftigen Beinen (ich habe ein Bild von ihr gesehen, mit ihren Schülern), ging sie als Lehrerin an eine Zwergschule im Ottawa-Valley, die Grieves-Schule. Sie lag an einer Ecke der Grieves’schen Farm – einer für die Gegend sehr guten Farm. Gut entwässerte Felder ohne die präkambrischen Felsen, die sich sonst überall aus dem Boden schoben, ein von Weiden gesäumtes Flüsschen neben dem Grund, ein Zuckerahornwald, Scheunen aus dicken Baumstämmen und ein großes schmuckloses Holzhaus, dessen Wände nicht angestrichen, sondern einfach verwittert waren. Und wenn Holz im Ottawa-Valley verwittert, sagte meine Mutter, ich weiß nicht, warum, aber dann wird es nicht grau, sondern schwarz. Es muss an der Luft liegen, sagte sie. Sie sprach vom Ottawa-Valley, wo sie zu Hause war – sie war ungefähr zwanzig Meilen von der Grieves-Schule aufgewachsen –, oft in belehrendem, staunendem Ton und stellte die Dinge heraus, die es von allen anderen Orten der Welt unterschieden. Häuser werden schwarz, Ahornsirup hat einen Geschmack, mit dem sich kein anderswo gewonnener Ahornsirup messen kann, Bären trollen in Sichtweite der Farmhäuser vorbei. Natürlich war ich enttäuscht, als ich das Tal endlich zu sehen bekam. Es war gar kein Tal, wenn man damit einen Einschnitt zwischen Bergen meint; es war ein Sammelsurium aus flachen Feldern und niedrigem Gestein und dichten Wäldern und kleinen Seen – eine zusammengewürfelte, unordentliche Landschaft ohne einfache Harmonie, die sich nur schwer beschreiben ließ.
Die Scheunen aus Baumstämmen und das ungestrichene Haus, die auf armen Höfen nur allzu üblich sind, waren im Fall der Grieves kein Zeichen von Armut, sondern ihrer Einstellung. Sie hatten Geld, aber sie gaben es nicht aus. Die Grieves arbeiteten hart, und sie waren alles andere als ungebildet, aber sie waren äußerst rückständig. Sie hatten weder ein Auto noch Strom oder Telefon noch einen Traktor. Manche Leute glaubten, das liege daran, dass sie Cameroner waren – sie waren die einzigen Leute dieses Glaubens im Schulbezirk –, aber tatsächlich verbot ihre Kirche (die sie selbst immer als reformiert presbyterianisch bezeichneten) weder Motoren noch Elektrizität noch andere derartige Erfindungen, sondern bloß Kartenspielen, Tanzen, Lichtspiele und am Sonntag jede Tätigkeit, die nicht religiös oder unvermeidbar war.
Meine Mutter wusste nicht zu erklären, wer die Cameroner waren oder woher der Name kam. Irgendeine verrückte Religion aus Schottland, sagte sie vom hohen Ross ihres gehorsamen und unbeschwerten Anglikanismus herab. Die Lehrerin wohnte immer in Pension bei den Grieves, und meine Mutter bedrückte der Gedanke, in dem schwarzen Holzhaus mit seinen lähmenden Sonntagen und Petroleumlampen und primitiven Ansichten leben zu sollen. Aber sie war damals schon verlobt, sie wollte an ihrer Aussteuer arbeiten, anstatt in der Gegend herumzusausen und sich zu amüsieren, und sie überlegte, dass sie jeden dritten Sonntag nach Hause fahren könnte. (Sonntags durfte man bei den Grieves ein Feuer zum Heizen anmachen, aber nicht zum Kochen, man durfte nicht einmal den Kessel aufsetzen, um Tee zu bereiten, und man sollte keinen Brief schreiben und keine Fliege totschlagen. Aber es stellte sich heraus, dass diese Regeln sich nicht auf meine Mutter erstreckten. »Nein, nein«, sagte Flora Grieves lachend. »Sie betrifft das nicht. Sie sollen weitermachen wie gewohnt.« Und nach einer Weile hatte meine Mutter sich mit Flora so sehr angefreundet, dass sie nicht einmal an den Sonntagen heimfuhr, an denen sie es eigentlich vorgehabt hatte.)
Flora und Ellen Grieves waren die beiden Schwestern, die der Familie geblieben waren. Ellie war verheiratet, mit einem Mann namens Robert Deal, der mit im Haus wohnte und die Farm bewirtschaftete, ohne dass sie dadurch allerdings für irgendwen zur Deal’schen Farm geworden war. So, wie man von ihnen sprach, erwartete meine Mutter, dass die Schwestern Grieves und Robert Deal mindestens Mitte vierzig sein würden, doch Ellie, die jüngere Schwester, war erst um die dreißig und Flora sieben bis acht Jahre älter. Robert Deal lag vermutlich dazwischen.
Das Haus war auf unübliche Weise aufgeteilt. Das Ehepaar lebte nicht mit Flora zusammen. Als die beiden heirateten, hatte Flora die Wohnstube und das Esszimmer, die vorderen Schlafzimmer und die Treppe sowie die Winterküche an sie abgetreten. Über das Badezimmer musste keine Entscheidung getroffen werden, denn es gab keins. Flora hatte die Sommerküche mit ihren offenen Balken und unverputzten Ziegelwänden, die alte in ein schmales Esszimmer umgewandelte Speisekammer, das Wohnzimmer und die beiden hinteren Schlafzimmer behalten, von denen eines meiner Mutter zugeteilt wurde. Die Lehrerin war bei Flora untergebracht, im ärmlicheren Teil des Hauses. Aber meiner Mutter machte das nichts aus. Sie zog Flora und Floras Fröhlichkeit von Anfang an der Stille und Krankenstuben-Atmosphäre der vorderen Zimmer vor. In Floras Reich waren noch nicht einmal alle Zerstreuungen verboten. Sie hatte ein Crokinole-Brett – und brachte meiner Mutter das Spiel bei.
Die Aufteilung hatte man natürlich in der Erwartung vorgenommen, dass Robert und Ellie eine Familie gründen und den Platz brauchen würden. Das war nicht geschehen. Sie waren schon über zwölf Jahre verheiratet, ohne dass ihnen ein lebendes Kind geboren worden war. Ellie war immer wieder schwanger gewesen, aber zwei Kinder waren tot zur Welt gekommen, und die übrigen waren Fehlgeburten. Als meine Mutter im ersten Jahr dort wohnte, schien Ellie immer mehr Zeit im Bett zu verbringen, und meine Mutter dachte, sie müsse wohl wieder schwanger sein, aber davon wurde nichts verlautbart. Das wäre bei solchen Leuten auch nicht üblich. Ellie war nichts anzusehen, wenn sie aufstand und herumlief, denn sie hielt sich krumm und war im Ganzen schlaff und ausgeleiert. Sie roch nach Krankenbett, und sie jammerte über jede Kleinigkeit wie ein Kind. Flora kümmerte sich um sie und machte die ganze Arbeit. Sie wusch die Wäsche und putzte die Zimmer und kochte die Mahlzeiten, die in den beiden Haushälften auf den Tisch kamen, und half Robert außerdem beim Melken und Entsahnen. Sie stand vor Tagesanbruch auf und schien niemals müde zu werden. Während des ersten Frühlings, in dem meine Mutter dort war, wurde ein großer Hausputz unternommen, bei dem Flora selbst auf die Leitern stieg und die Sturmfenster abnahm, schrubbte und wegräumte, aus einem Zimmer nach dem andern die Möbel herausschleppte, um die Holzteile zu säubern und die Fußböden zu bohnern. Sie spülte jedes Stück Glas und Geschirr, das doch eigentlich sauber in den Schränken stand. Sie kochte jeden Topf aus und jeden Löffel. Sie war von einem solchen Tatendrang besessen, dass sie kaum schlafen konnte – meine Mutter wachte morgens davon auf, dass sie hörte, wie die Ofenrohre abmontiert wurden oder der mit einem Geschirrtuch umwickelte Besen auf die verräucherten Spinnweben eindrosch. Durch die geputzten gardinenlosen Fensterscheiben strömte unbarmherziges Licht. Die Sauberkeit war überwältigend. Meine Mutter schlief nun auf Laken, die gebleicht und gestärkt waren und ihr einen Hautausschlag besorgten. Die kranke Ellie beschwerte sich täglich über den Geruch von Bohnerwachs und Putzmitteln. Floras Hände wurden rau. Aber sie blieb bester Laune. Ihr Kopftuch und ihre Schürze und Roberts zu weite Overalls, die sie für die Kletterei überzog, gaben ihr das Aussehen einer Komikerin – verspielt, jederzeit für Überraschungen gut.
Meine Mutter nannte sie einen tanzenden Derwisch.
»Du wirbelst herum wie ein tanzender Derwisch, Flora«, sagte sie, und Flora hielt inne. Sie wollte wissen, was sie damit meinte. Und meine Mutter erklärte es ihr, wenngleich sie ein wenig Angst davor hatte, Floras Frömmigkeit zu verletzen. (Nicht eigentlich Frömmigkeit – so konnte man es nicht nennen. Strenggläubigkeit.) Doch da konnte sie unbesorgt sein. Floras Glaube besaß nicht die geringste Spur von Kleinlichkeit oder selbstgefälliger Berechnung. Sie kannte keine Scheu vor Heiden – sie hatte zeitlebens unter ihnen gelebt. Ihr gefiel die Vorstellung, ein Derwisch zu sein, und sie ging damit gleich zu ihrer Schwester.
»Weißt du, wie die Lehrerin mich nennt?«
Flora und Ellie waren beide dunkelhaarig und hatten dunkle Augen, sie waren groß und schmalschultrig mit langen Beinen. Ellie war natürlich ein Wrack, aber Flora hielt sich immer noch kerzengerade und hatte anmutige Bewegungen. Sie konnte wie eine Königin aussehen, sagte meine Mutter – selbst wenn sie auf ihrem alten Karren in die Stadt fuhr. Zur Kirche nahmen sie einen Einspänner oder einen leichten Pferdeschlitten, aber wenn sie in die Stadt fuhren, mussten sie oft Säcke mit Wolle transportieren – sie hielten ein paar Schafe – oder Gemüse, zum Verkauf, und sie mussten Vorräte nach Hause schaffen. Die nur wenige Meilen weite Fahrt machten sie nicht oft. Robert saß vorne, um die Pferde zu lenken – Flora war sehr wohl in der Lage, ein Pferd zu lenken, aber der Mann musste stets die Zügel in der Hand haben. Flora stand hinten und bewachte die Säcke. Sie fuhr im Stehen in die Stadt und wieder zurück, hielt dabei geschickt ihr Gleichgewicht, trug ihren schwarzen Hut. Beinahe schon lächerlich, aber nicht ganz. Auf meine Mutter wirkte sie wie eine Zigeunerkönigin, mit ihrem schwarzen Haar und der immer leicht gebräunten Haut und ihrer gewandten, unerschrockenen Gelassenheit. Natürlich fehlten ihr die goldenen Armreifen und die bunten Kleider. Meine Mutter beneidete sie um ihre Schlankheit und um ihre Wangenknochen.
Als sie im Herbst zu Beginn ihres zweiten Jahres zurückkehrte, erfuhr meine Mutter, was mit Ellie los war.
»Meine Schwester hat ein Geschwür«, sagte Flora. Damals sprach niemand von Krebs.
Meine Mutter hatte davon schon gehört. Die Leute mutmaßten so etwas. Meine Mutter kannte mittlerweile viele Leute im Bezirk. Mit einer jungen Frau, die im Postamt arbeitete, hatte sie sich richtig angefreundet; sie war als eine der Brautjungfern meiner Mutter auserkoren. Die Geschichte von Flora und Ellie und Robert – beziehungsweise das Wenige davon, was die Leute wussten – war ihr in verschiedenen Versionen erzählt worden. Meine Mutter hatte nicht das Gefühl, sich dabei Klatsch anzuhören, weil sie stets darauf achtete, dass keine abfälligen Bemerkungen über Flora gemacht wurden – gegen die wollte sie sich unbedingt verwahren. Aber es wurden überhaupt keine gemacht. Alle sagten, Flora habe sich wie eine Heilige benommen. Selbst bei den härtesten Maßnahmen, bei der Aufteilung des Hauses etwa – sei sie wie eine Heilige gewesen.
Robert kam einige Monate vor dem Tod des Vaters der Mädchen zum Arbeiten auf die Farm der Grieves. Sie kannten ihn bereits aus der Kirche. (Oh, diese Kirche, sagte meine Mutter, die einmal einen Gottesdienst besucht hatte, aus Neugier – dieses triste Gebäude Meilen hinter der Stadt, ohne Orgel oder Klavier und mit einfachem Fensterglas und einem tattrigen alten Pastor, dessen Predigten über Stunden gingen, und einem Mann, der vor jedem Lied eine Stimmgabel anschlug.) Robert war aus Schottland gekommen und war auf dem Weg nach Westen. Er hatte bei Verwandten oder Bekannten Station gemacht, die Mitglieder der kleinen Gemeinde waren. Wohl um ein bisschen Geld zu verdienen, kam er zu den Grieves. Schon bald verlobte er sich mit Flora. Sie konnten nicht wie andere Paare tanzen gehen oder Karten spielen, aber sie machten ausgedehnte Spaziergänge. Die – inoffizielle – Anstandsdame war Ellie. Ellie war damals ein übermütiger Wildfang, ein langhaariges, ungebärdiges, kindisches Mädchen voll schlaksiger Energie. Sie lief die Berghänge hinauf und hieb mit einem Stock auf die Königskerzen ein, brüllte und sprang umher und spielte, sie sei ein Krieger auf einem Pferd. Oder das Pferd selbst. Und das mit fünfzehn, sechzehn Jahren. Niemand außer Flora hatte sie in der Gewalt, und meistens lachte Flora nur über sie, denn sie war ihre Art zu sehr gewohnt, um sich zu fragen, ob Ellie vielleicht nicht ganz richtig im Kopf sei. Die beiden liebten einander sehr. Die lange, magere Ellie mit ihrem langen, schmalen Gesicht war wie ein Abbild Floras – die Art Abbild, wie man sie häufig in Familien hat, in dem zu stark oder zu schwach ausgeprägte Züge oder Farben die Schönheit der einen in die Reizlosigkeit oder Beinahe-Reizlosigkeit der anderen verwandeln. Aber Ellie war deswegen nicht neidisch. Sie liebte es, Flora zu kämmen und ihr das Haar hochzustecken. Sie liebten es, einander die Haare zu waschen. Ellie presste dann ihr Gesicht an Floras Hals, wie ein Fohlen, das sich an die Mutter schmiegt. Als Robert also Flora die Ehe antrug, oder Flora ihm – niemand weiß, wie es war – musste Ellie dazugehören. Sie zeigte keinerlei bösen Willen Robert gegenüber, aber sie verfolgte und überfiel die beiden auf ihren Spaziergängen; sprang überraschend aus dem Unterholz oder schlich sich so leise von hinten an, dass sie ihnen in den Nacken pusten konnte. Sie wurde von Leuten dabei beobachtet. Und ihre Streiche wurden bekannt. Sie war schon immer für ihre Streiche berüchtigt gewesen, und manchmal hatte sie deswegen Ärger mit ihrem Vater bekommen, aber Flora hatte sie stets in Schutz genommen. Jetzt legte sie Robert Disteln ins Bett. Sie vertauschte beim Tischdecken an seinem Platz Messer und Gabel. Sie stellte die Milcheimer um, damit er den alten mit dem Loch nahm. Vielleicht Flora zuliebe ertrug Robert sie.
Der Vater hatte von Flora und Robert verlangt, mit der Hochzeit noch ein Jahr zu warten, und daran hielten sie sich auch nach seinem Tod. Robert blieb im Haus wohnen. Keiner verstand es, Flora richtig darauf anzusprechen, dass dies anstößig sei oder anstößig aussehe. Flora fragte immer bloß, wieso. Anstatt den Tag der Hochzeit vorzuverlegen, schob sie ihn hinaus – vom kommenden Frühjahr auf den Frühherbst, damit ein volles Jahr zwischen der Hochzeit und dem Tod ihres Vaters läge. Ein Jahr zwischen Hochzeit und Beerdigung – so schien es ihr richtig. Sie vertraute vollkommen auf Roberts Geduld und auf ihre eigene Reinheit.
Warum auch nicht? Doch im Winter kam Unruhe ins Haus. Ellie erbrach sich, weinte, lief davon und versteckte sich im Heuschober, heulte, als man sie fand und herausholte, sprang in der Scheune vom Dachbalken, drehte sich im Kreis, wälzte sich im Schnee. Ellie war wie von Sinnen. Flora musste den Arzt rufen. Sie erzählte ihm, dass bei ihrer Schwester die Regelblutungen ausgesetzt hätten – war es möglich, dass der Blutstau sie um den Verstand brachte? Robert hatte sie einfangen und fesseln müssen, und mit vereinten Kräften hatten er und Flora sie ins Bett gebracht. Sie verweigerte die Nahrung, rollte den Kopf hin und her und jaulte. Es sah aus, als würde sie sprachlos sterben. Aber irgendwie kam die Wahrheit ans Licht. Allerdings nicht durch den Arzt, der nicht nahe genug an sie herankommen konnte, um sie zu untersuchen, weil sie so um sich schlug. Wahrscheinlich legte Robert ein Geständnis ab. Oder Flora musste endlich, trotz ihres Edelmuts, die Wahrheit erkennen. Jetzt musste eine Hochzeit stattfinden, wenn auch nicht die geplante.
Keine Torte, keine neuen Kleider, keine Hochzeitsreise, keine Glückwünsche. Nur ein verschämter, überstürzter Besuch im Pfarrhaus. Einige, die die Namen in der Zeitung lasen, dachten, der Redakteur müsse die Schwestern verwechselt haben. Sie dachten, es müsse sich um Flora handeln. Eine überstürzte Hochzeit für Flora! Aber nein, Flora war diejenige, die Roberts Anzug bügelte – wer sonst? – und Ellie aus dem Bett holte und sie wusch und zurechtmachte. Es konnte auch nur Flora gewesen sein, die eine Geranie aus dem Blumenkasten am Fenster pflückte und sie ihrer Schwester ans Kleid steckte. Und Ellie hatte sie nicht abgerissen. Ellie war jetzt lammfromm, schlug nicht mehr um sich und weinte nicht mehr. Sie ließ sich von Flora zurechtmachen, sie ließ sich verheiraten, sie war von dem Tag an nie mehr wild.
Flora ließ das Haus aufteilen. Sie half Robert eigenhändig, die notwendigen Trennwände zu bauen. Das Baby wurde ausgetragen – keiner tat auch nur so, als wäre es eine Frühgeburt –, aber es kam nach langen, peinigenden Wehen tot zur Welt. Vielleicht hatte Ellie es verletzt, als sie vom Balken in der Scheune gesprungen war und sich im Schnee gewälzt und sich kasteit hatte. Selbst wenn sie all das nicht getan hätte, wären die Leute davon ausgegangen, dass irgendetwas schiefgehen würde, mit diesem oder vielleicht einem späteren Kind. Gott bestrafte überstürzte Ehen – das glaubten nicht nur die Presbyterianer, sondern auch fast alle anderen Leute. Gott belohnte Wollust mit toten oder schwachsinnigen Kindern, Hasenscharten und verkümmerten Gliedern und Klumpfüßen.
In diesem Fall setzte sich die Strafe fort. Ellie erlitt eine Fehlgeburt nach der anderen, dann eine weitere Totgeburt und anschließend wieder Fehlgeburten. Sie war pausenlos schwanger, und während der Schwangerschaften litt sie unter tagelangem Brechreiz, Kopfschmerzen, Krämpfen, Schwindelanfällen. Die Fehlgeburten waren genauso quälend wie die normalen Geburten. Ellie war nicht in der Lage, ihre Arbeit zu machen. Sie hielt sich, wenn sie durchs Haus ging, an Stühlen fest. Ihr benommenes Schweigen verging, und sie wurde zur Nörglerin. Wenn jemand zu Besuch kam, redete sie über die Besonderheiten ihrer Kopfschmerzen oder beschrieb ihren jüngsten Ohnmachtsanfall oder erging sich gar – vor Männern, vor unverheirateten jungen Mädchen oder Kindern – in blutigen Einzelheiten über das, was Flora als ihre »Enttäuschungen« bezeichnete. Wenn die Gäste das Thema wechselten oder die Kinder aus dem Zimmer schafften, wurde sie mürrisch. Sie verlangte neue Arzneien, beschimpfte den Arzt, machte Flora die Hölle heiß. Sie beschuldigte Flora, aus Bosheit beim Abwaschen laut mit dem Geschirr zu klappern, sie beim Kämmen an den Haaren zu reißen, ihr aus lauter Geiz Wasser mit Melasse statt ihrer richtigen Medizin zu verabreichen. Was sie auch sagte, Flora besänftigte sie unbeirrt. Alle, die ins Haus kamen, warteten mit Geschichten dieser Art auf. Flora sagte: »Wo ist denn mein kleines Mädchen? Wo ist meine Ellie? Das hier ist nicht meine Ellie, das ist ein zänkisches Weib, das sich an ihrer Stelle hier eingeschlichen hat!«
An den Winterabenden, nachdem sie Robert bei den Arbeiten in der Scheune geholfen hatte, wusch sich Flora und zog sich um und ging nach nebenan, um Ellie bis zum Einschlafen vorzulesen. Dann lud sich meine Mutter öfters selbst ein und nahm dazu die Näharbeit mit, die sie gerade für ihre Aussteuer fertig machte. Ellies Bett war im großen Esszimmer aufgebaut, wo eine Gaslampe über dem Tisch hing. Meine Mutter saß an einer Seite des Tisches und nähte, Flora an der anderen Seite und las vor. Manchmal sagte Ellie: »Ich kann dich nicht hören.« Oder wenn Flora eine kleine Pause machte, um sich auszuruhen: »Ich schlafe noch nicht.«
Was las Flora vor? Geschichten über das Leben in Schottland – keine Klassiker. Geschichten über Lausejungen und komische Großmütter. Der einzige Titel, an den meine Mutter sich erinnern konnte, war Wee Macgregor. Sie konnte den Geschichten nicht sehr gut folgen und nicht mitlachen, wenn Flora lachte und Ellie leise wimmerte, weil vieles in schottischem Dialekt gehalten war oder mit schwerem Akzent gelesen wurde. Sie war überrascht, dass Flora ihn beherrschte – normalerweise redete Flora überhaupt nicht so.
(Aber sprach Robert nicht vielleicht so? Womöglich ist das der Grund, weshalb meine Mutter nie etwas wiedergibt, was Robert gesagt hat, ihn nie an einer Szene teilhaben lässt. Er muss doch da gewesen sein, er muss mit im Zimmer gesessen haben. Sie heizten bestimmt nur den Hauptaufenthaltsraum. Ich sehe ihn vor mir: schwarzhaarig, breitschultrig, stark wie ein Ackergaul und von der gleichen düsteren, zurückgenommenen Schönheit.)
Schließlich sagte Flora: »Genug davon für heute Abend.« Damit nahm sie ein anderes Buch zur Hand, ein altes Buch von einem Prediger ihres Glaubens. Darin standen Sachen, wie sie meine Mutter noch nie vernommen hatte. Was für Sachen? Das konnte sie nicht sagen. Das ganze Zeug, das zu ihrer grässlichen altbackenen Religion gehörte. Ein paar Seiten davon, und Ellie schlief ein oder tat zumindest so, als ob sie schliefe.
Die ganze Ordnung der Auserwählten und Verdammten, das muss meine Mutter gemeint haben – die ganzen Argumente über Illusion und Notwendigkeit des freien Willens. Das Verhängnis und der schmale Weg zur Erlösung. Die quälende, niederschmetternde, für einige Geister jedoch unwiderstehliche Anhäufung miteinander verketteter und widersprüchlicher Vorstellungen. Meine Mutter konnte dem widerstehen. Ihr Glauben war unbeschwert, ihre Stimmung damals nicht leicht zu trüben. Ideen machten sie nie neugierig, nie.
Aber war das eine geeignete Lektüre, fragte sie (stumm), für eine Sterbende? Das war das deutlichste Wort der Kritik an Flora.
Die Antwort – dass es die einzig mögliche war, wenn man daran glaubte – ist ihr offenbar nie in den Sinn gekommen.
Mit dem Frühling war eine Krankenschwester eingezogen. Das machte man damals so. Man starb zu Hause, und eine Krankenschwester kam, um sich um alles zu kümmern.
Die Krankenschwester hieß Audry Atkinson. Sie war eine kräftige Person mit einem Korsett steif wie Fassreifen, das ondulierte Haar messinggelb wie ein Kerzenleuchter, ein von Lippenstift über die schmalen Ränder hinaus geformter Mund. Sie kam mit einem Auto auf den Hof gefahren – ihrem eigenen Wagen, einem dunkelgrünen Coupé, blank und schnittig. Die Nachricht von Audry Atkinson und ihrem Auto verbreitete sich schnell. Man stellte Fragen. Woher hatte sie das Geld? Hatte irgendein reicher Narr sein Testament zu ihren Gunsten geändert? Hatte sie nachgeholfen? Oder sich einfach an einem Bündel Scheine unter der Matratze bedient? Wie sollte man ihr vertrauen?
Ihr Auto war das erste, das je über Nacht auf dem Grieves’schen Hof gestanden hatte.
Audry Atkinson sagte, in ein solch primitives Haus habe man sie noch nie zu einem Pflegefall geholt. Sie begreife nicht, sagte sie, wie Leute so leben könnten.
»Dabei sind sie ja nicht einmal arm«, sagte sie zu meiner Mutter. »Das ist es doch nicht, oder? Das könnte ich verstehen. Und wegen ihrer Religion ist es auch nicht. Weshalb also sonst? Es ist ihnen egal, deshalb!«
Sie versuchte zunächst, sich bei meiner Mutter einzuschmeicheln, so als wären sie hier an diesem rückschrittlichen Ort natürliche Verbündete. Sie redete, als wären sie beide ungefähr gleich alt – zwei flotte, intelligente Frauen, die sich gern mal ein Vergnügen gönnten und moderne Ansichten hatten. Sie bot meiner Mutter an, ihr das Autofahren beizubringen. Sie bot ihr Zigaretten an. Meine Mutter verlockte die Vorstellung, fahren zu lernen, mehr als das Rauchen. Aber sie sagte, nein, sie wolle warten, bis ihr Mann es ihr beibrachte. Audry Atkinson zog ihre bräunlich rosa Augenbrauen hoch und warf meiner Mutter hinter Floras Rücken vielsagende Blicke zu, und meine Mutter schäumte. Sie konnte die Krankenschwester viel weniger leiden als Flora.
»Ich wusste sie einzuschätzen, und Flora nicht«, sagte meine Mutter. Sie meinte damit, dass sie bei ihr etwas Ordinäres witterte, vielleicht sogar Gasthäuser und unappetitliche Männer und knallharte Abmachungen, die der weltfremden Flora vollkommen entgingen.
Flora machte sich wieder ans Großreinemachen. Sie spannte die Gardinen auf Rahmen, sie klopfte die Teppiche über der Leine, sie sprang auf die Trittleiter, um dem Staub oben auf den Simsen zu Leibe zu rücken, wurde aber in einem fort durch Klagen von Schwester Atkinson aufgehalten.
»Ach bitte, könnten wir vielleicht ein bisschen weniger Rennerei und Radau haben?«, fragte Schwester Atkinson mit anzüglicher Höflichkeit. »Ich spreche nur für meine Patientin.« Sie nannte Ellie immer »meine Patientin« und tat so, als wäre sie die Einzige, die sie beschützte und für die nötige Rücksicht sorgte. Sie selbst allerdings behandelte Ellie nicht sehr rücksichtsvoll. »Hauruck«, sagte sie und hievte das arme Geschöpf auf ihre Kissen. Und sie machte Ellie klar, dass Jammern und Wehklagen bei ihr sinnlos waren. »Sich selbst tun Sie damit keinen Gefallen«, sagte sie. »Und mich bringen Sie bestimmt nicht dazu, schneller zu kommen. Da können Sie doch besser gleich lernen, sich zu beherrschen.« Über Ellies wundgelegene Stellen schimpfte sie, als wären auch sie eine Schande für das Haus. Sie verlangte Lotionen, Salben, teure Seife – das meiste zweifellos für ihre eigene Haut, die, wie sie behauptete, unter dem harten Wasser litt. (Wie konnte es hart sein, fragte meine Mutter sie – um für den Haushalt einzutreten, wenn schon niemand das tat –, wie konnte es hart sein, da es doch direkt aus der Regentonne kam?)
Schwester Atkinson verlangte auch Sahne – sie sagte, sie sollten einen Teil für sich behalten, nicht alles an die Molkerei verkaufen. Sie wolle ihrer Patientin nahrhafte Suppen und Nachspeisen kochen. Und sie machte Pudding und Götterspeisen – aus Fertigpulver, wie es vorher noch nie ins Haus gekommen war. Meine Mutter war überzeugt, dass sie sie allesamt alleine aß.
Flora las Ellie immer noch vor, aber jetzt nur kurze Stücke aus der Bibel. Wenn sie fertig war und aufstand, versuchte Ellie, sie festzuhalten. Ellie weinte, manchmal brachte sie lächerliche Klagen vor. Sie sagte, draußen wäre eine Kuh mit Hörnern, die versuchte ins Zimmer zu kommen und sie umzubringen.
»Auf so fixe Ideen kommen die oft«, sagte Schwester Atkinson. »Sie dürfen nicht darauf eingehen, sonst lässt sie Sie Tag und Nacht nicht mehr los. So sind die nun mal, sie denken nur an sich. Also, wenn ich mit ihr allein bin, benimmt sie sich recht gut. Ich habe überhaupt keine Scherereien. Aber jedes Mal, wenn Sie hier waren, geht der Kummer wieder von vorne los, weil sie Sie sieht und sich aufregt. Sie wollen mir die Arbeit doch nicht schwerer machen, nicht wahr? Ich meine, Sie haben mich doch hergeholt, damit ich die Sache in die Hand nehme, oder?«
»Ellie, Ellie, mein Liebes, ich muss gehen«, sagte Flora, und an die Krankenschwester gewandt: »Ich verstehe es. Ich verstehe wirklich, dass wir uns nach Ihnen richten müssen, und ich bewundere Sie, ich bewundere Sie für Ihre Arbeit. Bei Ihrer Arbeit müssen Sie so viel Geduld und Güte aufbringen.«
Meine Mutter staunte – war Flora wirklich so blind, oder hoffte sie, Schwester Atkinson durch dieses unverdiente Lob zu der Geduld und Güte anzuhalten, an der sie es fehlen ließ? Schwester Atkinson war zu dickfellig und selbstherrlich, als dass ein solcher Trick hätte funktionieren können.
»Ja, es ist schon ein harter Job, damit wird nicht jede fertig«, sagte sie. »Das ist nicht wie bei den Schwestern im Krankenhaus, wo alles fix und fertig vorbereitet ist.« Sie hatte keine Zeit mehr für Konversation – sie versuchte gerade »Geschichten aus dem Ballhaus« in ihrem Kofferradio einzustellen.
Meine Mutter hatte in der Schule mit den Abschlussprüfungen und dem Unterrichtsmaterial für Juni zu tun. Sie steckte mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit im Juli. Freunde kamen mit dem Auto und brausten mit ihr zum Schneider, zu Partys, zum Aussuchen der Einladungskarten und zum Kuchenbestellen. Der Flieder blühte auf, die Abende wurden länger, die Vögel waren wieder da und bauten Nester, und meine Mutter erblühte durch die viele Aufmerksamkeit so kurz vor dem Aufbruch in das herrlich ernste Abenteuer der Ehe. Ihr Kleid sollte mit Seidenrosen bestickt, ihr Schleier von einer Kappe aus Staubperlen gehalten werden. Sie gehörte zu der ersten Generation junger Frauen, die sparten und ihre Hochzeit mit dem eigenen Geld ausrichteten – viel prächtiger als es sich ihre Eltern hätten leisten können.
An ihrem letzten Abend kam die Freundin aus dem Postamt, um sie abzuholen, samt ihren Kleidern und Büchern und den Sachen, die sie für ihre Aussteuer genäht hatte, und den Geschenken, die sie von ihren Schülern und anderen bekommen hatte. Es gab viel Theater und Gelächter darüber, wie man alles ins Auto bekommen sollte. Flora kam heraus, um zu helfen. Diese Heiraterei ist ja noch schlimmer, als ich dachte, sagte Flora lachend. Sie schenkte meiner Mutter ein Spitzendeckchen für die Frisierkommode, das sie heimlich gehäkelt hatte. Schwester Atkinson durfte bei keinem wichtigen Anlass ausgeschlossen bleiben – sie überreichte ein Sprühfläschchen mit Eau de Cologne. Flora stand am Abhang neben dem Haus und winkte zum Abschied. Sie war zur Hochzeit eingeladen, hatte aber natürlich abgesagt, weil sie in einer solchen Zeit nicht »feiern« könne. Das Letzte, was meine Mutter je von ihr sah, war diese einsame, eifrig winkende Gestalt in Kittelschürze und Kopftuch auf dem grünen Abhang neben dem schwarzen Haus, im Abendlicht.
»Na, vielleicht kriegt sie ja jetzt, was ihr eigentlich beim ersten Mal zugestanden hätte«, sagte die Freundin aus dem Postamt. »Vielleicht können sie jetzt heiraten. Ist sie zu alt, um eine Familie zu gründen? Wie alt ist sie überhaupt?«
Meine Mutter fand es geschmacklos, so über Flora zu reden, und entgegnete, das wisse sie nicht. Aber im Stillen musste sie zugeben, dass sie genau das Gleiche gedacht hatte.
Nachdem meine Mutter geheiratet und sich dreihundert Meilen entfernt in den eigenen vier Wänden eingerichtet hatte, bekam sie von Flora einen Brief. Ellie war tot. Sie sei fest im Glauben gestorben, berichtete Flora, und für ihre Erlösung dankbar gewesen. Schwester Atkinson bleibe noch eine Weile, bis es Zeit für sie sei, ihre nächste Aufgabe zu übernehmen. Das war im Spätsommer.
Die Nachricht von dem, was dann geschah, kam nicht von Flora. Als sie zu Weihnachten schrieb, schien sie selbstverständlich anzunehmen, dass ihr die Neuigkeit vorausgeeilt sei.
»Du wirst höchstwahrscheinlich gehört haben«, schrieb Flora, »dass Robert und Schwester Atkinson geheiratet haben. Sie bleiben hier wohnen, in Roberts Teil des Hauses. Sie renovieren es nach ihrem Geschmack. Es ist nicht recht von mir, sie Schwester Atkinson zu nennen, wie ich es, so sehe ich, eben getan habe. Ich hätte sie Audrey nennen sollen.«
Natürlich hatte die Freundin von der Post geschrieben, und andere auch. Es war ein großer Schock und ein Skandal und eine Angelegenheit, die die ganze Gegend erregte – die Hochzeit so heimlich und überraschend wie Roberts erste (wenn auch gewiss nicht aus dem gleichen Grund), Schwester Atkinson auf Dauer in der Gemeinde zu Hause, Flora zum zweiten Mal die Unterlegene. Keiner hatte mitbekommen, dass er Schwester Atkinson den Hof machte, und sie fragten sich, wie die Frau ihn wohl betört hatte. Hatte sie ihm Kinder versprochen und verschwiegen, wie alt sie war?
Die Überraschungen sollten nicht mit der Hochzeit enden. Die Braut nahm sofort die von Flora erwähnte »Renovierung« in Angriff. Ein Stromanschluss wurde gelegt, und dann Telefon. Von da an hörte man Schwester Atkinson – sie sollte für immer Schwester Atkinson heißen – über den Gemeinschaftsanschluss Maler und Tapezierer und Lieferanten zusammenstauchen. Sie ließ alles neu machen. Sie kaufte einen Elektroherd und ließ ein Bad einbauen, und nur der Himmel wusste, woher sie das Geld nahm. War es ihres, erworben durch ihre Geschäfte am Totenbett, durch zwielichtige Erbschaften? Gehörte es Robert, ließ er sich seinen Anteil auszahlen? Ellies Anteil, ihm und Schwester Atkinson zum Vergnügen hinterlassen, diesem schamlosen Paar?
Sämtliche Neuerungen kehrten nur in einer Haushälfte ein. Floras Seite blieb, wie sie war. Kein elektrisches Licht, keine neuen Tapeten und keine neuen Jalousien. Als das Haus von außen gestrichen wurde – cremefarben mit dunkelgrünen Leisten –, blieb Floras Seite ungestrichen. Diese merkwürdige, offene Erklärung wurde anfangs mit Mitleid und Missbilligung aufgenommen, später dann mit weniger Mitgefühl als Zeichen für Floras Sturheit und Verschrobenheit (sie hätte doch auch Farbe kaufen können, damit es anständig aussah) und schließlich als Witz. Viele fuhren eigens einen Umweg, um es sich anzusehen.
Für frischverheiratete Paare wurde im Schulhaus immer ein Tanz veranstaltet. Ein gesammelter Betrag – »Geldbörse« genannt – wurde ihnen überreicht. Schwester Atkinson ließ verlauten, sie hätte nichts dagegen, wenn man dieser Sitte folgte, auch wenn die Familie, in die sie eingeheiratet hatte, gegen das Tanzen sei. Manche Leute meinten, es wäre eine Schande, ihr nachzugeben, ein Schlag ins Gesicht für Flora. Andere waren zu neugierig, um sich zu bremsen. Sie wollten sehen, wie die Frischvermählten sich verhielten. Würde Robert tanzen? Wie würde die Braut sich ausstaffieren? Man schwankte eine Weile, aber schließlich fand der Tanz statt, und meine Mutter erhielt ihren Bericht.
Die Braut trug das Kleid, das sie bei ihrer Trauung getragen hatte, jedenfalls behauptete sie das. Aber wer würde ein solches Kleid zu einer Trauung im Pfarrhaus anziehen? Es war mehr als wahrscheinlich, dass sie es eigens für ihren Auftritt beim Tanz gekauft hatte. Leuchtend weißer Satin mit einem herzförmigen Ausschnitt, lachhaft jugendlich. Der Bräutigam steckte in einem neuen dunkelblauen Anzug, und sie hatte ihm eine Blume ins Knopfloch gesteckt. Sie waren beide sehenswert. Ihr frisch gemachtes Haar blendete das Auge mit Messingblitzen, und ihr Gesicht sah aus, als würde es am Jackett hängenbleiben, wenn sie es ihrem Partner beim Tanzen an die Schulter legte. Natürlich tanzte sie. Sie tanzte mit jedem der anwesenden Männer bis auf den Bräutigam, der sich in eine der Schulbänke an der Wand gezwängt hatte. Sie tanzte mit jedem der anwesenden Männer – die behaupteten alle, sie müssten es tun, weil es so Sitte sei –, und dann schleppte sie Robert hinaus, um das Geld in Empfang zu nehmen und allen für ihre guten Wünsche zu danken. Den Frauen in der Garderobe gab sie sogar zu verstehen, dass sie sich unwohl fühle, aus dem bei Frischvermählten üblichen Grund. Keiner glaubte ihr, und es wurde in der Tat nie etwas aus dieser Hoffnung, wenn sie sie denn wirklich hegte. Einige der Frauen fühlten sich böswillig belogen und beleidigt, weil sie ihnen so viel Leichtgläubigkeit unterstellte. Aber niemand nahm es mit ihr auf, niemand behandelte sie unhöflich – vielleicht weil allen klar war, dass sie, wenn sie beschloss unhöflich zu werden, jeden plattmachen konnte.
Flora war beim Tanz nicht dabei.
»Meine Schwägerin tanzt nicht«, sagte Schwester Atkinson. »Sie ist noch ganz von gestern.« Sie forderte die Leute dazu heraus, sich über Flora lustig zu machen, und nannte sie stets ihre Schwägerin, obwohl sie keinerlei Recht dazu hatte.
Meine Mutter schrieb Flora einen Brief, nachdem sie von alledem gehört hatte. Weil sie dem Ort des Geschehens entrückt und vielleicht von der Wichtigkeit ihres neuen Status als verheiratete Frau eingenommen war, mag es sein, dass ihr der Charakter der Empfängerin ihres Briefes ein wenig aus dem Blick geriet. Sie äußerte Mitleid und Empörung und fand deutliche, verächtliche Worte für die Frau, die – in den Augen meiner Mutter – Flora so übel mitgespielt hatte. Als Antwort kam ein Brief von Flora, in dem sie schrieb, sie wisse nicht, woher meine Mutter ihre Informationen habe, doch habe sie anscheinend einiges falsch verstanden oder böswilligen Menschen zugehört oder falsche Schlüsse gezogen. Was in Floras Familie geschehe, gehe niemanden etwas an, und ganz gewiss müsse niemand sie bemitleiden oder ihretwegen wütend sein. Flora schrieb, sie sei mit ihrem Leben glücklich und zufrieden, sei es immer gewesen, und sie mische sich auch nicht in das ein, was andere täten oder wollten, weil diese Dinge sie nichts angingen. Sie wünsche meiner Mutter Glück und Segen in ihrer Ehe und hoffe, sie werde bald zu sehr mit ihren eigenen Pflichten beschäftigt sein, um sich Sorgen über das Leben von Menschen zu machen, die sie früher gekannt habe.
Dieser sorgfältig abgefasste Brief traf meine Mutter, wie sie sagte, bis ins Mark. Sie und Flora hörten auf, sich zu schreiben. Meine Mutter wurde wirklich vollkommen von ihrem eigenen Leben in Anspruch genommen und schließlich ganz davon gefangen.
Aber sie machte sich Gedanken über Flora. In späteren Jahren redete sie gelegentlich davon, was aus ihr hätte werden können, und dann sagte sie manchmal: »Wenn ich Schriftstellerin hätte werden können – ich glaube wirklich, ich hätte das Zeug dazu gehabt; ich hätte Schriftstellerin werden können –, dann hätte ich Floras Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und weißt du, wie ich sie genannt hätte? ›Die edle Jungfrau‹.«
Die edle Jungfrau. Diese Worte sagte sie in einem ernsten, sentimentalen Tonfall, der mir nicht passte. Ich wusste genau, welchen Wert sie in ihnen sah – oder meinte es zu wissen. Die Würde und die Rätselhaftigkeit. Der Hauch von Spott, der sich zu Ehrfurcht wandelt. Ich war damals fünfzehn oder sechzehn und glaubte, meiner Mutter in den Kopf sehen zu können. Ich konnte sehen, was sie mit Flora machen würde, was sie schon gemacht hatte. Sie würde sie zu einer edlen Figur machen, einer Figur, die Treuebruch und Verrat verkraftet, vergibt und sich hintan stellt, und das nicht einmal, sondern zweimal. Ohne sich auch nur einen Moment zu beklagen. Flora erledigt munter ihre Arbeiten, sie putzt das Haus und mistet den Kuhstall aus, sie entfernt blutigen Auswurf aus dem Bett ihrer Schwester, und als sich endlich die Zukunft für sie aufzutun scheint – Ellie wird sterben, und Robert wird um Vergebung bitten, und Flora wird ihn, indem sie sich ihm stolz zum Geschenk macht, zum Schweigen bringen –, kommt Audrey Atkinson auf den Hof gefahren und schließt Flora wieder aus, bei diesem zweiten Mal auf noch unverständlichere Weise und gründlicher als beim ersten. Sie muss den Hausanstrich, das elektrische Licht, das glückliche Tun und Treiben nebenan ertragen. »Geschichten aus dem Ballhaus«, »Amos ’n’ Andy« statt schottischer Schwänke und alter Predigten. Sie muss zusehen, wie sie zum Tanz fahren – ihr einstiger Verehrer und diese kaltherzige, dumme, nicht einmal hübsche Person in ihrem weißen Satinbrautkleid. Sie wird verspottet. (Und natürlich hat sie die Farm Ellie und Robert überschrieben, natürlich hat er sie geerbt, und jetzt gehört alles Audrey Atkinson.) Die Bösen prosperieren. Aber das ist in Ordnung. Es ist gut so – die Auserwählten sind von Geduld und Demut verhüllt und erhellt von einer Gewissheit, die von Ereignissen nicht zu erschüttern ist.
Das, glaubte ich, würde meine Mutter aus der Geschichte machen. In ihrer eigenen Not hatte sie sich mystischen Vorstellungen zugewandt, und in ihrer Stimme lag bisweilen so etwas Stilles, ein feierliches Beben, das ich widerwärtig fand und als eine Art Warnung vor einer persönlichen Gefahr auffasste. Ein großer Nebel voll Platitüden und Frömmeleien schien zu lauern, eine unbezwingbare Verkrüppelte-Mutter-Macht, die mich umfangen und ersticken würde. Es würde kein Ende nehmen. Ich musste achtgeben, dass ich scharfzüngig und zynisch blieb, streitbar und ernüchternd. Mit der Zeit ließ ich sogar diese Einsicht fahren und setzte mich stumm gegen sie zur Wehr.
Dies ist eine umständliche Art zu sagen, dass ich ihr kein Trost und keine gute Gesellschaft war, als sie fast niemanden mehr hatte außer mir.
Ich hatte zu Floras Geschichte meine eigene Meinung. Ich glaubte nicht, dass ich einen Roman hätte schreiben können, sondern dass ich einen schreiben würde. Ich würde anders herangehen. Ich durchschaute die Geschichte meiner Mutter und fügte ein, was sie ausgelassen hatte. Meine Flora würde so schwarz sein, wie ihre weiß war. Sie würde schwelgen in den an ihr verübten Missetaten und ihrer eigenen Bereitschaft zur Vergebung, sich ergötzen am Scherbenhaufen des Lebens ihrer Schwester. Eine presbyterianische Hexe, die aus ihrem giftigen Buch vorlas. Nur eine herausfordernde Ruchlosigkeit, die vergleichsweise unschuldige Dreistigkeit der dickfelligen Krankenschwester vermag ihr Einhalt zu gebieten, in ihrem Schatten zu blühen. Doch das gelingt tatsächlich; die Macht von Sex und schlichter Gier vertreiben sie und sperren sie in ihren Teil des Hauses ein, bei den Petroleumlampen. Sie schrumpft, sie wird krumm, ihre Knochen werden gläsern und ihre Gelenke dick, und – ja, das ist es, ich hab’s, ich sehe die klare Schönheit des Schlusses, den ich ersinnen werde! – sie wird selbst zum Krüppel, durch Arthritis, und kann sich kaum noch rühren. Damit ist Audrey Atkinsons Stunde gekommen, sie fordert das ganze Haus. Sie will, dass die Trennwände herausgerissen werden, die Robert mit Floras Hilfe eingebaut hatte, als er Ellie heiratete. Sie wird Flora ein Zimmer zuteilen, sie wird sie pflegen. (Audrey Atkinson möchte nicht für ein Scheusal gehalten werden und ist vielleicht wirklich keines.) Eines Tages also trägt Robert Flora – zum ersten und letzten Mal hält er sie in seinen Armen – in das Zimmer, das seine Frau Audrey für sie zurechtgemacht hat. Und sobald Flora in ihrer gut beleuchteten, gut geheizten Ecke eingerichtet ist, geht Audrey Atkinson daran, die frei gewordenen Zimmer auszuräumen, Floras Zimmer. Sie trägt einen Haufen alter Bücher in den Garten. Es ist wieder Frühling, Zeit für das Großreinemachen, die Jahreszeit, in der Flora selbst ihre Meisterleistungen vollbracht hat, und nun erscheint ihr blasses Gesicht hinter den neuen Tüllgardinen. Sie hat sich aus ihrer Ecke dorthin geschleppt, sie sieht den hellblauen Himmel mit den hohen, schnell dahinziehenden Wolken über den nassen Feldern, die zeternden Krähen, die über die Ufer getretenen Bäche, die sich rötenden Zweige. Sie sieht den Rauch von der Feuerstelle im Garten aufsteigen, wo ihre Bücher verbrennen. Die stinkigen alten Bücher, wie Audrey sie genannt hat. Wörter und Seiten, die unheimlichen dunklen Rücken. Die Auserwählten, die Verdammten, die schwachen Hoffnungen, die gewaltigen Qualen – sie gehen in Flammen auf. Das war der Schluss.
Für mich war das wirkliche Rätsel der Geschichte, wie meine Mutter sie erzählte, Robert. Er hat nie ein Wort zu sagen. Er verlobt sich mit Flora. Er spaziert neben ihr am Fluss, als Ellie sie anspringt. Er findet Ellies Disteln in seinem Bett. Er erledigt die Schreinerarbeiten, die durch seine Heirat mit Ellie nötig werden. Er hört zu oder hört weg, wenn Flora vorliest. Und schließlich sitzt er in die Schulbank gezwängt da, während seine fesche Braut mit einem Mann nach dem andern vorbeitanzt.
So weit seine öffentlich bekannten Handlungen und Auftritte. Dabei war er doch derjenige, der alles in Gang gesetzt hat, heimlich. Er hat es Ellie besorgt. Er hat es dem kleinen, dünnen wilden Mädchen zu einer Zeit besorgt, als er mit ihrer Schwester verlobt war, und er hat es ihr immer wieder besorgt, als sie nur noch ein armer geschundener Körper war, eine gescheiterte, bettlägerige Gebärerin.
Er musste es auch Audrey Atkinson besorgt haben, wenngleich mit weniger katastrophalen Folgen.
Dies Wort ›besorgt‹ – dieses Wort, das meine Mutter ebenso wenig wie Flora über die Lippen brachte – faszinierte mich. Ich verspürte weder moralischen Abscheu noch verstandesmäßige Entrüstung. Ich wies die Warnung zurück. Nicht einmal das Schicksal von Ellie konnte es mir verleiden. Nicht, wenn ich an das erste Zusammentreffen dachte – die Verzweiflung, das Reißen, den Hunger. In der Zeit damals warf ich Männern heimlich sehnsüchtige Blicke zu. Ich bewunderte ihre Handgelenke und ihre Nacken und jedes kleinste Stückchen Oberkörper, das durch einen offenen Knopf zu sehen war, sogar ihre Ohren und ihre beschmutzten Füße. Ich erwartete nichts Vernünftiges von ihnen, sondern wollte nur von ihrer Leidenschaft verschlungen werden. Auch Robert löste ähnliche Gedanken in mir aus.
Was Flora in meiner Geschichte böse machte, war genau das, was sie in der meiner Mutter bewundernswert machte – ihre Abkehr vom Sex. Ich wehrte mich gegen alles, was meine Mutter mir zu diesem Thema mit auf den Weg geben wollte; ich verachtete schon ihre gesenkte Stimme, die triste Behutsamkeit, mit der sie es anging. Meine Mutter war in einer Zeit und in einer Gegend aufgewachsen, in der Sex für Frauen ein finsteres Wagnis war. Sie wusste, dass man davon sterben konnte. Deswegen hielt sie den Anstand in Ehren, die Prüderie, die Frigidität, die einen davor schützen konnten. Und ich wuchs mit einem Horror vor eben diesem Schutz auf, vor der zarten Tyrannei, die sich mir auf alle Lebensbereiche auszudehnen schien, mir Kaffeekränzchen aufzwang und weiße Handschuhe und alle möglichen anderen Dämlichkeiten. Ich benutzte gern Kraftausdrücke und ging mit dem Kopf durch die Wand, ich stimulierte mich mit Phantasien über die Rücksichtslosigkeit und Dominanz von Männern. Das Seltsame ist, dass die Ansichten meiner Mutter den progressiven Vorstellungen ihrer Zeit entsprachen, während meine die Vorstellungen spiegelten, die zu meiner Zeit gängig waren. Und dies der Tatsache zum Trotz, dass wir uns beide für unabhängig hielten und in rückständigen Nestern lebten, die derlei Veränderungen nicht registrierten. Es ist fast so, als würden Einstellungen, die besonders tief in uns verwurzelt, ureigen und einzigartig scheinen, wie Sporen mit dem gerade herrschenden Wind eindringen, bereit, sich überall einzunisten, wo sie einen geeigneten Fleck und freundliche Aufnahme finden.
Nicht lange vor ihrem Tod, aber als ich noch zu Hause lebte, bekam meine Mutter einen Brief von der echten Flora. Er kam aus jenem Ort in der Nähe der Farm, in den Flora früher mit Robert auf dem Karren gefahren war und dabei die Säcke mit Wolle oder Kartoffeln festgehalten hatte.
Flora schrieb, sie wohne nicht mehr auf der Farm.
»Robert und Audrey leben noch dort«, schrieb sie. »Robert hat ein wenig Kummer mit seinem Rücken, aber ansonsten geht es ihm sehr gut. Audrey hat einen schwachen Kreislauf und leidet oft unter Atemnot. Der Doktor sagt, sie muss abnehmen, aber keine Diät scheint anzuschlagen. Die Farm läuft bestens. Sie haben die Schafzucht ganz aufgegeben und halten jetzt Milchkühe. Wie du vielleicht gehört hast, kommt es heute hauptsächlich darauf an, dass man vom Staat sein Milchkontingent zugeteilt bekommt, und dann hat man ausgesorgt. Der alte Stall ist mit Melkmaschinen und den neuesten Geräten ausgestattet, da kann man nur staunen. Wenn ich sie dort draußen besuche, weiß ich kaum, wo ich bin.«
Sie schrieb weiter, dass sie schon seit einigen Jahren im Ort lebe und in einem Geschäft als Verkäuferin arbeite. Sie muss erzählt haben, was für ein Geschäft das war, aber daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Natürlich erzählte sie nichts darüber, was sie zu diesem Entschluss bewogen hatte – ob man sie tatsächlich von ihrer eigenen Farm vertrieben hatte oder ob sie ihren Anteil verkauft hatte, allem Anschein nach nicht zu ihrem Vorteil. Sie betonte die Freundlichkeit ihres Umgangs mit Robert und Audrey. Sie sagte, gesundheitlich gehe es ihr gut.
»Ich höre, dir ist es in dieser Hinsicht weniger glücklich ergangen«, schrieb sie. »Ich bin Cleta Barnes über den Weg gelaufen, der früheren Cleta Stapleton vom Postamt bei uns draußen, und sie erzählte mir, du hättest irgendwas mit den Muskeln, was dich auch beim Sprechen behindert. Es tut mir leid, das zu hören, aber man kann heutzutage schon so wunderbare Dinge tun, dass ich hoffe, die Ärzte werden dir vielleicht helfen können.«
Ein beunruhigender Brief, der viele Dinge unerwähnt ließ. Kein Wort vom Willen Gottes oder seinem Beistand in unserer Bedrängnis. Keine Erwähnung davon, ob Flora noch in dieser Kirche war. Ich glaube nicht, dass meine Mutter je geantwortet hat. Ihre schöne, leserliche Handschrift, ihre Lehrerinnenschrift, hatte gelitten, und es fiel ihr schwer, einen Stift zu halten. Sie fing immer wieder Briefe an und schrieb sie dann nicht zu Ende. Ich fand sie überall im Haus. Meine liebe Mary, fingen sie an. Liebste Ruth, Meine liebe kleine Joanne (auch wenn ich weiß, dass du gar nicht mehr klein bist), Meine liebe alte Freundin Cleta, Du liebe Margaret. Diese Frauen waren Freundinnen aus ihrer Zeit als Lehrerin, aus dem Lehrerinnenseminar und aus der Highschool. Ein paar waren ehemalige Schülerinnen. Ich habe überall im ganzen Land Freundinnen, pflegte sie trotzig zu sagen. Ich habe viele liebe Freundinnen.
Ich erinnere mich, einen Brief gesehen zu haben, der so anfing: Liebe Freundin aus meiner Jugendzeit. Ich weiß nicht, an wen er gerichtet war. Sie waren alle Freundinnen aus ihrer Jugend. Ich erinnere mich an keinen Brief, der mit Meine liebe, vielbewunderte Flora anfing. Ich sah sie mir immer an und versuchte die Anrede und die paar Sätze zu entziffern, die sie geschrieben hatte, und weil ich es nicht ertragen konnte, traurig zu sein, schaute ich mit Ungeduld auf die blumige Sprache, die offene Bitte um Liebe und Mitgefühl. Davon würde sie mehr bekommen, dachte ich (und meinte, mehr von mir), wenn es ihr gelänge, sich in Würde zurückzuziehen, anstatt in einem fort ihren leidgeprüften Schatten über alles zu werfen.
Mein Interesse an Flora war inzwischen verflogen. Mir gingen ständig Geschichten im Kopf herum, und vermutlich war ich gerade mit einer neuen beschäftigt.
Aber seither denke ich immer mal wieder an sie. Ich habe mich nach der Art des Geschäfts gefragt. War es eine Eisen- und Haushaltswarenhandlung oder ein billiges Kaufhaus, in dem sie einen Kittel tragen musste, oder eine Drogerie, in der sie in Schwesterntracht herumlief, oder ein Damenoberbekleidungsgeschäft, in dem sie sich modisch-elegant kleiden musste? Vielleicht musste sie sich Wissen über Mixgeräte oder Kettensägen aneignen oder über Negligés, Kosmetik oder gar Kondome. Sie hat vermutlich den ganzen Tag lang bei elektrischem Licht arbeiten, eine Kasse bedienen müssen. Ob sie sich eine Dauerwelle machen ließ, die Nägel lackierte, die Lippen schminkte? Sie hat offenbar eine Bleibe gefunden – eine kleine Wohnung mit Kochnische und Blick auf die Hauptstraße oder ein Zimmer in einer Pension. Wie sollte sie dort weiter Cameronerin bleiben? Wie sollte sie zu der abgelegenen Kirche kommen, wenn sie kein Auto kaufte und den Führerschein machte? Und wenn sie das tat, dann fuhr sie vielleicht nicht nur zur Kirche, sondern auch anderswohin. Vielleicht unternahm sie Urlaubsreisen. Vielleicht mietete sie für eine Woche ein Häuschen am See, lernte schwimmen, machte Sightseeing in einer Stadt. Vielleicht nahm sie ihre Mahlzeiten in einem Restaurant ein, womöglich einem, in dem es Alkohol zu trinken gab. Vielleicht freundete sie sich mit Frauen an, die geschieden waren.
Vielleicht lernte sie einen Mann kennen. Den verwitweten Bruder einer Freundin. Einen Mann, der nicht wusste, dass sie Cameronerin war oder was Cameroner waren. Der nichts von ihrer Geschichte wusste. Einen Mann, der nie vom Teilanstrich des Hauses oder den beiden Enttäuschungen gehört hatte oder davon, dass sie nur durch Aufbietung aller Würde und Unschuld nicht zum Gespött der Leute wurde. Womöglich würde er mit ihr tanzen gehen wollen, und sie müsste erklären, warum das nicht ging. Er wäre überrascht, aber nicht befremdet – diese Cameroner-Geschichten kämen ihm kurios vor, fast liebenswert. So würde es allen gehen. Sie ist in so einem komischen Glauben erzogen worden, würde man sich erzählen. Sie hat lange draußen auf einer gottverlassenen Farm gelebt. Sie ist ein bisschen wunderlich, aber eigentlich ganz nett. Sieht auch nett aus. Besonders mit der neuen Frisur.
Ich könnte in ein Geschäft gehen und sie dort antreffen.
Nein, nein. Sie muss längst tot sein.
Aber angenommen, ich wäre in ein Geschäft gegangen – vielleicht ein Kaufhaus. Ich stelle mir eins vor mit der nüchtern-geschäftigen Atmosphäre, den schlichten Auslagen, dem altmodisch-modernen Stil der fünfziger Jahre. Angenommen, eine große, gutaussehende Frau, hübsch gekleidet, wäre gekommen, um mich zu bedienen, und ich hätte gewusst, hätte irgendwie trotz der gelockten und mit Haarspray fixierten Frisur und der rosa oder korallenroten Lippen und Fingernägel gewusst, dass es Flora war. Ich hätte ihr erzählen wollen, dass ich über sie Bescheid wusste, ihre Geschichte kannte, obwohl wir einander nie begegnet waren. Ich stelle mir vor, wie ich versuche, es ihr zu sagen. (Das ist jetzt ein Traum, ich verstehe es als Traum.) Ich stelle mir vor, wie sie mit freundlicher Miene zuhört. Aber sie schüttelt den Kopf. Sie lächelt mich an, und in ihrem Lächeln liegt ein Anflug von Spott, eine leichte, selbstsichere Bosheit. Auch ein gewisser Überdruss. Sie ist nicht überrascht, dass ich ihr dies erzähle, aber sie ist es leid, ist mich und meine Vorstellung von ihr leid, mein Mitteilungsbedürfnis, die Vorstellung, dass ich etwas über sie wissen kann.
Natürlich ist es meine Mutter, an die ich denke, meine Mutter, wie sie in jenen Träumen war, in denen sie sagte, es ist nichts, nur dieses kleine Zucken, und dabei so erstaunlich heiter und versöhnlich klang. Oh, ich wusste, dass du eines Tages kommen würdest. Meine Mutter, die mich überraschte, und das fast beiläufig. Ihre Maske, ihr Schicksal, auch ihr Gebrechen größtenteils verschwunden. Wie erleichtert ich war, wie froh. Aber jetzt erinnere ich mich, dass ich zugleich auch beunruhigt war. Ich muss zugeben, dass ich mich ein wenig betrogen fühlte. Ja. Beleidigt, überlistet, betrogen von dieser willkommenen Wendung, dieser Gnade. Meine Mutter, die sich unbekümmert aus ihrem alten Gefängnis herausbewegte, über Entscheidungsfreiheit und Kräfte verfügte, die ich mir für sie nie hätte träumen lassen, Veränderungen, die weit über sie hinausgingen. Sie verwandelt den bitteren Klumpen Liebe, den ich die ganze Zeit über mit mir herumgetragen habe, in ein Hirngespinst – etwas, das so unnütz und so unnötig ist wie eine Scheinschwangerschaft.
Die Cameroner sind oder waren, wie ich festgestellt habe, ein kompromissloses Überbleibsel der Covenanters – jener Schotten, die im siebzehnten Jahrhundert bei Gott schworen, sich gegen Gebetbücher, Bischöfe, jeden Ruch von Pfaffentum und jede Einmischung durch den König zur Wehr zu setzen. Sie sind nach Richard Cameron benannt, einem geächteten sogenannten »Feldprediger«, der früh zu Tode kam. Die Cameroner – sie selbst bevorzugten die Bezeichnung Reformierte Presbyterianer – zogen unter Absingen des vierundsiebzigsten und achtundsiebzigsten Psalms in die Schlacht. Sie erschlugen den selbstherrlichen Bischof von St. Andrews auf der Landstraße und zertrampelten ihn mit den Hufen ihrer Pferde. Einer ihrer Pfarrer war noch bei seiner eigenen Hinrichtung durch den Strang so fest und froh von seinem Glauben erfüllt, dass er alle anderen Priester der Welt exkommunizierte.