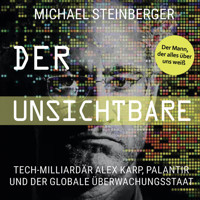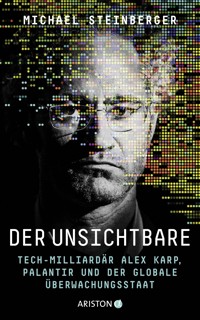
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ariston
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alex Karp - der Mann, der alles über uns weiß
Das Softwareunternehmen Palantir vertreibt eine der weltweit leistungsstärksten Technologien zum Sammeln von großen Datenmengen. Damit handelt Palantir mit Informationen, die westliche Demokratien schützen sollen, aber auch ihren Zusammenbruch herbeiführen könnten. An der Spitze des Unternehmens steht der unkonventionelle CEO und Mitbegründer Alex Karp, der in Sozialtheorie promovierte und überraschende politische und philosophische Ansichten vertritt. Erstmalig hat Michael Steinberger vom New York Times Magazine exklusiven Zugang zu Alex Karp und beleuchtet in seinem Buch die Wahrheit hinter der öffentlichen Fassade dieses Mannes. Er liefert dabei eine treffende Analyse der Risiken von Big Data für unsere Privatsphäre und Bürgerrechte und zeigt auf, wie uns die Existenz von gefährlichen Datenmengen in Zukunft beeinflussen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über den Inhalt:
Das Softwareunternehmen Palantir entwickelt und vertreibt eine der weltweit leistungsstärksten Technologien zum Sammeln von großen Datenmengen. Damit handelt Palantir mit Informationen, die westliche Demokratien schützen sollen, aber in den falschen Händen ihren Zusammenbruch herbeiführen könnten. An der Spitze des Unternehmens steht der unkonventionelle CEO und Mitbegründer Alex Karp, der in Frankfurt in Sozialtheorie promovierte und überraschende politische und philosophische Ansichten vertritt. Erstmalig hat Michael Steinberger, Starautor des New York Times Magazine, exklusiven Zugang zu Alex Karp und beleuchtet in seinem Buch die Wahrheit hinter der öffentlichen Fassade dieses Mannes. Steinberger liefert dabei eine treffende Analyse der Risiken für Privatsphäre und Bürgerrechte, die das Sammeln und Handeln mit Big Data wirklich mit sich bringen und zeigt auf, wie uns die Existenz von gefährlichen Datenmengen in Zukunft beeinflussen wird.
Über den Autor:
Michael Steinberger ist preisgekrönter Journalist und schreibt für das New York Times Magazine, die britische Times und die Financial Times und erlangte hohe Bekanntheit durch seine umfassenden Porträts bekannter Größen wie Joe Biden, George Soros und Alex Karp. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im Bundesstaat Delaware.
Michael Steinberger
Der Unsichtbare
Tech-Milliardär Alex Karp, Palantir und der globale Überwachungsstaat
Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Schmid
Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel The Philosopher in the Valley bei Avid Reader Press, Simon & Schuster.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach §44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © by Michael Steinberger
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Ariston,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
www.penguin.de/verlage/ariston
Alle Rechte vorbehalten.
Übersetzung: Bernhard Schmid
Redaktion: Jan W. Haas
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch nach einer Vorlage von Pete Garceau unter Verwendung von Bildmaterial von Gettyimages / Bloomberg, Aleksandra Konoplia
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-30585-7V001
Inhalt
Prolog Eine gefahrlosere Welt für Alex Karp
Kapitel 1 Die Schmattes-Fabrik
Kapitel 2 Irgendwie aus einer anderen Welt
Kapitel 3 Stiefkind im Silicon Valley
Kapitel 4 Sehende Steine und neugierige Blicke
Kapitel 5 Durchbruch im kommerziellen Geschäft
Kapitel 6 Krieg gegen die Army
Kapitel 7 Das Peter-Problem
Kapitel 8 Proof of Concept
Kapitel 9 Der voll durchgeknallte CEO
Kapitel 10 Es geht ums Überleben
Kapitel 11 Der Sieg der Rebellen
Epilog
Dank
Für Kathy, James und Ava (und auch Patches)
PrologEinegefahrlosereWeltfürAlexKarp
»Hier muss wohl irgendwo ein Meth-Labor sein.«
Alex Karp hatte sich zu einer Joggingrunde aufgemacht. Es war ein Dienstagnachmittag im September 2021, und auch wenn es noch warm war in diesem nördlichen Zipfel New Hampshires, lag bereits der Herbst in der Luft – der Sonne fehlte die Kraft. Karp, in Radlerhose und T-Shirt, trabte langsam die an sein Anwesen grenzende Straße entlang. Das gemächliche Tempo war beabsichtigt, Teil eines Konditionstrainings, das ihm die Norweger aus seinem Personenschutzteam verordnet hatten, ehemalige Kommandosoldaten, die Karp auch im Skilanglauf trainieren, einem Sport, von dem er geradezu besessen ist. Vor dem Jogging hatte er, unter Anleitung seines langjährigen Lehrers, des Großmeisters Yang Yang, der aus New York zu Besuch war, ein Tai-Chi-Training absolviert und – als Mittagsmahlzeit – rasch einige dick mit Erdnussbutter beschmierte Brezeln verdrückt.
Karp befand sich am Fuße eines Hügels, als plötzlich ein arg ramponierter Wagen in sein Blickfeld gekrochen kam – im Schneckentempo wie er, als hätte sich jemand verfahren oder suchte ein schwer zu findendes Haus. Am Steuer saß ein Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau. Die beiden mochten Ende zwanzig, Anfang dreißig sein, und ihren hageren Gesichtern nach zu urteilen, ließen sie in ihrem Leben nichts aus. Es gehört zu Karps Geschäft, auf alles zu achten: Er leitet ein Unternehmen, das mit der Erkennung von Mustern befasst ist, und ihm waren jüngst in der eher spärlich besiedelten Gegend mehrere mysteriöse Fahrzeuge aufgefallen, was ihn auf den Gedanken brachte, dass ganz in der Nähe womöglich ein echter Walter White sein Unwesen trieb. Als sich das Auto näherte, hob Karp die Hand zum Gruß, aber das Paar reagierte nicht, sondern starrte ihn nur misstrauisch an.
Ihr Misstrauen war verständlich: Sie befanden sich auf einer gewundenen Landstraße, drei Meilen von der nächsten Ortschaft und vielleicht eine Stunde südlich der kanadischen Grenze, und plötzlich trottete da mitten auf der Straße ein drahtiger Typ mit einem gewaltigen Schopf graumelierten Haars auf sie zu, hinter ihm ein paar stämmige Typen auf Fahrrädern und hinter diesen wiederum ein schwarzer Chevy Suburban mit getönten Scheiben. Wenn Karp Grund hatte, sich zu fragen, was sie dort verloren hatten, dann hatten sie doppelt Grund, sich über ihn und seine Entourage Gedanken zu machen. Drogenfahnder? Eine Falle? Jemand im Zeugenschutzprogramm? Ein Drogenboss? Falls die beiden tatsächlich auf dem Weg zu einem Deal waren, dürften sie angesichts der merkwürdigen Begegnung ins Schwitzen geraten sein. Hätten sie Karps wahre Identität gekannt, sie hätten womöglich auf die Tube gedrückt. So aber fuhren sie ganz vorsichtig an ihm vorbei, wie um zu signalisieren, dass sie keinen Ärger wollten.
Als der Wagen vorbei war, verfiel Karp wieder in seinen Trab. Während er so dahinschlenkerte, erzählte er mir von den 180 000 Dollar, die er kürzlich einem gewissen »River Dave« geschenkt hatte, einem Einsiedler aus der Gegend, dessen Zuhause abgebrannt war. Es war nicht nur eine nette Geste gewesen, sondern auch Ausdruck der Solidarität eines Introvertierten gegenüber einem Artgenossen. Das Geschenk sorgte landesweit für Schlagzeilen. Einigen Artikeln zufolge war Karp – mit einem Gehalt von 1,1 Milliarden Dollar – 2020 der höchstbezahlte CEO eines börsennotierten Unternehmens der Welt.
Nachdem er einen Augenblick innegehalten hatte, um einige Füchse über die Straße huschen zu lassen, sprach er die Aussicht auf einen Krieg mit China an und betonte dabei, wie wichtig es sei, die amerikanische Vorherrschaft bei der Softwareentwicklung aufrechtzuerhalten. Was ihn auch gleich zu einigen gehässigen Bemerkungen über die »Wokeness« des Silicon Valley veranlasste und die seiner Ansicht nach unentschuldbare Ambivalenz der Tech-Branche hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Militär. Und wie so oft brachte ihn das Thema »Wokeness« auf unsere Alma Mater, das Haverford College, und dessen Versäumnis, ihn zu einer Rede auf dem Campus einzuladen, ganz zu schweigen von seinen halbherzigen Bemühungen um ihn als potenziellen Spender, was er ebenso beleidigend findet wie verrückt.
Nach etwa einer halben Stunde erreichte Karp eine Kreuzung, die den Endpunkt seiner üblichen Strecke markierte. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, trank einen Schluck Wasser und stieg auf der Beifahrerseite in den Suburban. (Fahren hat Karp nie gelernt.) Während der kurzen Fahrt zurück zum Haus zog er über Facebook vom Leder, nannte die Plattform ein »parasitäres Unternehmen« und erzählte mir, dass dessen Mitbegründer und CEO Mark Zuckerberg kürzlich ihren gemeinsamen Freund Peter Thiel angerufen hatte, um sich über Karps Breitseiten gegen seinen Konzern zu beschweren. Karps zwei Quadratkilometer großes Anwesen liegt an einem sanft abfallenden Hang. Das Haus selbst steht inmitten hoch aufragender Kiefern und bietet einen herrlichen Blick auf die White Mountains. Karp ging hinein und traf dort auf Günter, einen der vier Österreicher seines persönlichen Assistententeams; die anderen heißen Gabriel, Hermann und Agnes. Dann war da noch ein Schweizer namens Martin, der ebenfalls zum Team gehörte. Karp und Günter wechselten einige Worte auf Deutsch; überhaupt unterhält er sich mit seinen Assistenten fast ausschließlich auf Deutsch. Mehrere Mitglieder von Karps Sicherheitsteam, zu dem neben den fünf Norwegern auch eine Handvoll Amerikaner, zwei Österreicher, ein Ire und ein Schotte gehören, saßen in der Küche bei einem späten Lunch. Die Szene hatte etwas geradezu Surreales – als befände man sich im Schlupfwinkel eines Bond-Schurken. Nur dass Karps Unternehmen mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeitet, nicht gegen ihn. Und dann war da noch die Mesusa an der Eingangstür, die man wohl eher nicht in Bond-Filmen sieht.
Karp schlug vor, auf die Schießbahn hinterm Haus zu gehen, ließ den Gedanken aber angesichts meines Mangels an Begeisterung gleich wieder fallen. Als wir ins Wohnzimmer traten, legte er sein Telefon in eine Faraday-Box und bat mich, seinem Beispiel zu folgen. »Die Chinesen wären verrückt, würden sie nicht versuchen, meine Anrufe abzuhören«, erklärte er. Karp, ein lebenslanger Junggeselle und mittlerweile Mitte fünfzig, besitzt mehrere Häuser in den Vereinigten Staaten und Europa. Das Haus in New Hampshire ist sein Hauptwohnsitz. Er fühlt sich dem Norden Neuenglands sentimental verbunden, hat er doch dort die Sommer seiner Kindheit verbracht, als seine Eltern noch zusammen waren, mit anderen Worten: vor deren bitterer Scheidung, die ein furchtbarer Schlag für ihn war.
Das Haus ist spärlich möbliert; es gibt eine Couch und einige Sessel, aber man hat nicht das Gefühl, dass dort tatsächlich jemand wohnt. Dies spiegelt sowohl Karps asketischen Lebensstil als auch seine rastlose Reisetätigkeit wider. Vor dem pandemiebedingten Hausarrest war er etwa 300 Tage im Jahr unterwegs und blieb selten länger als ein oder zwei Nächte am selben Ort. Er rechtfertigt die vielen Reisen mit seinen beruflichen Anforderungen, aber einige seiner Kollegen sind da skeptisch. »Der Typ läuft eindeutig vor etwas weg«, sagte einer von ihnen mit amüsiertem Unterton. Vereinzelt lagen Bücher herum, auf dem Tisch im Esszimmer eine Biografie von Albert Einstein auf Deutsch, daneben eine Handvoll Romane von John le Carré. Dieses Nebeneinander mag einem merkwürdig vorkommen, aber im Haus eines Alex Karp hat es eine gewisse Logik.
Karp ist Chief Executive Officer von Palantir Technologies, einem auf Datenanalyse spezialisierten Unternehmen. Benannt nach den sehenden Steinen in J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe, entwickelte Palantir eine Software, die durch Analyse enormer Datenmengen Muster, Trends und Verbindungen zu erkennen vermag, die zu sehen menschliche Analysten womöglich Tage, Wochen oder gar Monate bräuchten. Gegründet wurde das Unternehmen nach dem 11.September 2001 mit der Maßgabe, dem amerikanischen Staat bei der Terrorismusbekämpfung beizustehen; finanziert wurde es zum Teil von In-Q-Tel, dem Risikokapitalarm der CIA. Heute arbeiten eine ganze Reihe von Geheimdiensten mit Palantir zusammen, darunter auch Israels Mossad. Spekulationen darüber, dass Palantirs Technologie eine Rolle bei der Kommandoaktion zur Tötung Osama bin Ladens gespielt haben könnte, verliehen dem Unternehmen einen geheimnisvollen Nimbus, der sich bis heute hält.
Die Arbeit des Unternehmens beschränkt sich jedoch nicht auf den Kampf gegen den Terrorismus. Alle sechs Teilstreitkräfte des US-Militärs nutzen seine Technologie. Mehr als drei Dutzend Bundesbehörden sind Kunden von Palantir, darunter das FBI, das Finanzamt (IRS) und die Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH). Konzernriesen wie Airbus und BP nutzen Palantir, um die tagtäglich generierte Datenflut zu entschlüsseln. Obwohl Palantir ein relativ kleines Unternehmen mit nur etwa viertausend Mitarbeitenden ist, verfügt es über die Reichweite eines Kraken. Ob Terrorismus, Klimawandel, Hungersnöte, Zuwanderung, Menschenhandel, Finanzbetrug oder die Zukunft der Kriegsführung – Palantir wirkt an der Schnittstelle der wichtigsten Probleme des 21.Jahrhunderts. Was während der Pandemie besonders deutlich wurde, als mehr als ein Dutzend Länder die Technologie des Unternehmens nutzten, um das neuartige Coronavirus aufzuspüren und einzudämmen. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien baten Palantir auch um Unterstützung bei der Verteilung von Impfstoffen.
Doch bei aller geschäftlichen Entwicklung blieb die Kernaufgabe des Unternehmens unverändert: Karp zufolge existiert Palantir, um zur Verteidigung des Westens beizutragen (ein Auftrag, dem man intern den Spitznamen »Rettung des Auenlandes« verpasst hat, eine Anspielung auf die literarischen Wurzeln von Palantir; die Unternehmensleitung bezeichnet die Mitarbeitenden auch gerne als »Hobbits«). Die explizit ideologische Agenda macht Palantir zu einem Kuriosum der Unternehmenswelt. So verweigerte man von Anfang an jedwedes Geschäft mit China und Russland, da man in beiden Ländern Gegner des Westens sieht. Diese Entscheidungen sollten sich letztlich als richtig erweisen, aber Mitte der 2000er-Jahre fand sie der eine oder andere potenzielle Investor grotesk: Warum sollte ein Unternehmen sich dem boomenden chinesischen Markt verschließen? Bei Palantir jedoch war das Streben nach Profitabilität – ein Ziel, das zu erreichen sich als frustrierend schwierig erweisen sollte – stets dem untergeordnet, worin Karp und Kollegen ihr höchstes Ziel sahen: Palantir zu Schwert und Schild Amerikas und im weiteren Sinne des ganzen Westens zu machen.
Fast schon widernatürlich wirkte Palantir im Silicon Valley, dessen beherrschende Unternehmen größtenteils auf Produkte und Dienstleistungen für den Endverbrauchermarkt spezialisiert waren. Aber die Palantirianer waren stolz auf ihr Anderssein: Statt Gadgets und Games herzustellen, sahen sie sich an vorderster Front im Kampf um den American Way of Life. Und auch wenn das Unternehmen seinen Sitz in Palo Alto hatte, hegten Karp und seine Kollegen eine tiefe Abneigung gegen das Valley und seine Kultur – wobei Facebook zur besonderen Zielscheibe ihres Hohns wurde – und schöpften zusätzliche Motivation aus diesem Gefühl der Entfremdung. (2020 verlegte man denn seinen Hauptsitz nach Denver, womit man auch offiziell mit dem Valley brach).
Zweifelsohne war Karp ein Ausreißer in der Tech-Branche. Er hatte weder Informatik noch Wirtschaft studiert, und mit seinem persönlichen Hintergrund war er ein höchst unwahrscheinlicher Kandidat für die Leitung eines Unternehmens, das sich zum bevorzugten Softwarelieferanten des Geheimdienstapparats mausern sollte. Als multi-ethnischer Jude aus einem streitbar linken Haushalt erwarb Karp in Haverford seinen Bachelor mit dem Hauptfach Philosophie. Anschließend studierte er Jura an der Stanford University und erwarb einen Doktor in Gesellschaftstheorie an der Frankfurter Goethe-Universität, wo sein Mentor für kurze Zeit Jürgen Habermas war, Europas womöglich bekanntester lebender Philosoph. Dass Karp Legastheniker ist, macht seine akademischen Leistungen umso beeindruckender.
Er hatte jedoch keine Lust auf eine akademische Laufbahn, und als Peter Thiel, Mitbegründer von Paypal und ein Kommilitone aus Karps Jahrgang in Stanford, 2004 bei ihm anfragte, ob er nicht Interesse habe, bei einem Startup einzusteigen, das Software zur Bekämpfung des Terrorismus herstelle. packte Karp die Gelegenheit beim Schopf. Schon wenig später übernahm Karp als CEO die Leitung von Palantir. Seine akademischen Referenzen, potenziert durch seine exzentrische Erscheinung und sein nicht weniger exzentrisches Verhalten, machten ihn zu einem überzeugenden Frontmann für ein Unternehmen wie Palantir. Dasselbe galt für seine politischen Ansichten: Eine Zeit lang bezeichnete er sich als Neosozialist, was ungewöhnlich schien für jemanden an der Schnittstelle von Technologie und Landessicherheit. Außerdem bot er einen interessanten Kontrast zu Peter Thiel, dem Libertären (der sich einige Jahre später in Richtung der extremen Rechten zu orientieren begann). Und auch wenn einige Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley Palantir als jungem Startup die kalte Schulter zeigten, entpuppte Karp sich als überzeugender Fürsprecher für sein Unternehmen.
Karp pitchte Palantir, als ginge es um sein Leben – was nicht zuletzt daran lag, dass er das tatsächlich so sah. Schon als Kind litt er unter einem schmerzlichen Gespür für seine Verwundbarkeit als Jude und Schwarzer in einer Welt, die Juden und Schwarzen mit so unerbittlicher Abneigung zu begegnen schien. Und dann war da noch die Lernschwäche. Überleben und erfolgreich sein könne einer wie er seiner Überzeugung nach nur in einer Gesellschaft, die Minderheiten und anderen Risikogruppen einen robusten Schutz bot. »Nichts macht mir so Angst wie der Faschismus«, sagte er mir 2019 bei einem unserer ersten Gespräche. Damals war er ungeteilt der Überzeugung, die Verteidigung der liberalen Demokratie sei gleichbedeutend mit der Verteidigung des Westens, und für ihn war Palantirs Mission eine zutiefst persönliche: Palantir machte die Welt sicherer für Alex Karp. So wurde denn auch das Unternehmen in einem geradezu unheimlichen Maß zum Spiegelbild seiner selbst: seiner Gewohnheiten, Marotten, prägenden Erfahrungen, vor allem aber seiner düsteren Weltsicht und der Ängste, die ihm zu schaffen machten. Seine ungute Vorahnung, so sagte er mir einmal, sei »die Triebkraft hinter vielen Entscheidungen für das Unternehmen«.
Karps Hingabe an Palantir ist absolut, wie er 2013 in einem Interview mit der Zeitschrift Forbes betonte: »Es gibt nur drei Beschäftigungen, bei denen ich nicht an Palantir denke: Schwimmen, Qigong und Sex.« (Schwimmen war damals seine Hauptsportart.) Er hat keine Kinder, ist aber gleichzeitig in zwei Langzeitbeziehungen mit zwei Frauen, ein Arrangement, das zum Teil deshalb funktioniere, weil er »geografisch monogam« sei, wie jemand aus dem Kreis seiner Kollegen so treffend sagte. (Dieselbe Person bezeichnete beide Frauen als »altersgemäß«.) Wenn Karp nicht arbeitet, geht er gern Skilaufen. Die meisten seiner Häuser befinden sich in abgelegenen Gegenden und nicht zufällig ganz in der Nähe von Langlaufloipen. Wann immer es die Zeit gestattet, läuft er zwanzig oder fünfundzwanzig Kilometer am Tag. Aber Karp zufolge steht selbst der Langlauf im Dienst von Palantir: Seiner Ansicht nach braucht es die Kondition eines Spitzensportlers, um seinen mörderischen Terminplan durchzustehen.
Unter Karps unkonventioneller Leitung wurde Palantir zu einer dominanten Kraft im Bereich der Datenanalyse, einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit schicken Dependancen rund um die Welt und einer – sorgfältig kultivierten – Aura des Geheimnisvollen, mit der man sich selbst in der Treibhausatmosphäre des Silicon Valley vom Rest des Felds unterschied. Die Bestätigung, sowohl für Palantir als auch für Karp selbst, kam 2020, als das Unternehmen nach jahrelangem Zögern schließlich doch an die Börse ging. Die erfolgreiche Börsennotierung bestätigte Palantirs Lebensfähigkeit und machte Karp offiziell zum Milliardär. Vom Kauf weiterer Häuser (und schließlich auch eines eigenen Jets) abgesehen, hat der Reichtum sein Leben nicht wirklich verändert, und wie Karp beteuert, lässt ihn die Größe seines Nettovermögens kalt, auch wenn er davon nicht alle in seinem Umfeld zu überzeugen vermag. »Geld motiviert ihn wahrscheinlich mehr, als er denkt«, sagte mir Thiel, »und mich motiviert Geld weniger, als die Leute denken.« Immerhin genießt Karp sein gestiegenes Ansehen. Bei Events wie dem alljährlichen Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos steht er heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Staats- und Regierungschefs rund um den Globus sind erpicht auf seine Ansichten, und auch als Redner ist er zunehmend gefragt. Außer in Haverford.
Völlig überraschend ist die Zurückhaltung seiner Alma Mater Karp gegenüber freilich nicht. Palantir ist nicht unumstritten. Die Software des Unternehmens könnte sehr wohl der Massenüberwachung dienen, und seine Verbindungen zu Geheimdiensten und Polizeibehörden machen es in den Augen von Datenschützern und Bürgerrechtlern mehr als suspekt. Donald Trumps erste Präsidentschaft hatte Palantir in den Augen zahlreicher Beobachter toxisch gemacht. Das Unternehmen war in den Skandal um Cambridge Analytica verwickelt, bei dem man 2016 mittels heimlicher Verwendung ihrer Facebook-Daten Millionen von Amerikanern dazu bringen wollte, Donald Trump zu wählen. Ein noch brisanterer Aspekt war Palantirs Zusammenarbeit mit der Einwanderungs- und Zollbehörde, kurz ICE. Mit dem Beginn von Trumps hartem Durchgreifen gegen Einwanderer sah Palantir sich dem Vorwurf der Unterstützung unmenschlicher und rassistischer Maßnahmen ausgesetzt. Dass Thiel einer der prominentesten Unterstützer Trumps gewesen war, heizte die Entrüstung der Öffentlichkeit weiter an.
Es kam zu Protesten vor Niederlassungen des Unternehmens sowie vor Karps Haus in Palo Alto, und bald war Palantir auch an einigen Universitäten nicht mehr willkommen – darunter offenbar auch unsere Alma Mater. Davon abgesehen, dass sie für Palantir ein PR-Fiasko waren, brachten die ersten vier Trump-Jahre auch eine unangenehme Wahrheit ans Licht: Die Technologie des Unternehmens wäre eine wirksame Waffe in den Händen eines autoritären Regimes.
Doch abgesehen von der Geschichte mit Haverford war das alles nur noch eine bittere Erinnerung, als ich Karp im September 2021 in New Hampshire besuchte. Ich war hingefahren, um mit ihm über mein Interesse an einem Buch über ihn und Palantir zu sprechen. Im Jahr zuvor hatte ich einen Artikel über Palantir für das New York Times Magazine geschrieben. Bevor ich den Auftrag für den Artikel im Times Magazine erhielt, hatten Karp und ich einander nicht persönlich gekannt. Wir waren in Haverford im selben Jahrgang, schafften es aber irgendwie, nie auch nur ein Wort miteinander zu wechseln, was man kaum glauben möchte bei einem College mit gerade mal 1500 Studierenden. Wir begegneten uns zum ersten Mal im April 2019, als ich das New Yorker Büro von Palantir aufsuchte, um ein inoffizielles Gespräch mit Karp zu führen. (Womöglich um den Geist der Collegezeit – oder wenigstens etwas in dieser Richtung – zu beschwören, trank er während unseres Gesprächs ein alkoholfreies Bier.) In den darauffolgenden Monaten schrieb ich die Magazinstory und traf Karp in New York, Washington, Paris und Vermont. Wir verstanden uns; Karp schien sich durchaus wohlzufühlen im Gespräch mit mir. Jedenfalls sprach er mit entwaffnender Offenheit über Palantir und sich selbst.
Der Artikel, der im Oktober 2020 erschien, wenige Wochen nach Palantirs Börsengang, war mit zirka 9000 Wörtern alles andere als kurz. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass es da noch mehr zu sagen gab. Karp war eine einzigartige Persönlichkeit in der Geschäftswelt, und Palantir war das vielleicht interessanteste Unternehmen der Welt – und womöglich auch eines der gefährlichsten. Seine Technologie hatte nicht nur das Potenzial, das globale Machtgleichgewicht im 21.Jahrhundert mitzugestalten, sie hatte auch das Potenzial, die Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Staat zu verändern. Palantir schien mir einen so faszinierenden wie beunruhigenden Einblick in die eben angebrochene panoptische Zukunft zu bieten, doch ohne Verständnis der ungewöhnlichen Person an seiner Spitze ließe sich das Unternehmen unmöglich verstehen.
Karp hatte ein offenes Ohr für die Idee mit dem Buch. Er ging davon aus, so sagte er mir, dass irgendjemand früher oder später ein Buch über Palantir schreiben würde – warum also nicht mit einem Autor zusammenarbeiten, den er kannte und den er sympathisch fand? Was er nicht sagte, obwohl es sicherlich zutraf: Er wollte das Thema eines Buches sein. Karp mochte der CEO sein, aber für die Presse war das Unternehmen für gewöhnlich »Peter Thiels Palantir«. Das galt insbesondere während der ersten Trump-Administration, als der Name Thiel massenhaft Klicks versprach. Doch auch wenn Palantir Thiels Idee war und er dem Board vorsaß, hatte er nie eine Rolle im Tagesgeschäft des Unternehmens gespielt. Entsprechend stand Karp nach Palantirs Börsengang als Hauptverantwortlichem für diesen Erfolg der Sinn nach Anerkennung, was denn auch der wesentliche Grund für sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir war.
Karp war so großzügig mit seiner Zeit wie mit seinen Gedanken. Für viele unserer Gespräche trafen wir uns persönlich, für gewöhnlich in New York oder Washington. Darüber hinaus unterhielten wir uns immer wieder telefonisch oder per Video. Ich hatte ein stehendes Angebot, mit ihm in seinem Privatjet zu reisen, entschied mich aber gleich zu Anfang dagegen; ich hatte Sorge, damit womöglich die Integrität des Buches zu untergraben. Außerdem wollte ich nicht mit ihm fliegen, weil ich befürchtete, ihm an Bord irgendwann zur Last zu fallen. Karps Aufmerksamkeit war schwer zu fesseln. So einige seiner Kollegen vermuten ein gewisses Maß an ADHS. Bei Meetings spielt er gern mit einem Rubik’s Cube, und wenn nicht damit, tändelt er mit etwas anderem herum. Bei Gesprächen im Stehen übt Karp für gewöhnlich Tai-Chi-Bewegungen, egal ob er zuhört oder selbst spricht. Für gewöhnlich konnte ich mich 30 bis 45 Minuten produktiv mit ihm unterhalten, dann begann er abzudriften.
So ungern Karp einem Einblicke in sein Privatleben gewährt, verstand er doch, dass sich kaum ein Buch über ihn schreiben ließe ohne Input der Menschen, die ihn am besten kennen. Sein Bruder Ben, der in Japan lebt, sprach des Öfteren mit mir, und ich verdanke ihm eine Menge Erinnerungen und Einsichten. Außerdem sprach ich mit seiner Mutter. Zu einem Gespräch mit seinem Vater kam es dessen schwindender Gesundheit wegen nicht. Unbegrenzt war Karps Kooperationsbereitschaft freilich nicht: So verweigerte er mir etwa den Kontakt mit seinen Gefährtinnen. Ich begegnete einmal einer von ihnen, aber das war reiner Zufall; sie ist Amerikanerin. Eine weitere anhaltende Beziehung hat er mit einer Frau in Europa, und das seit mehr als 20 Jahren. Karps Leben ist mit anderen Worten nicht weniger kompliziert als sein Unternehmen.
Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, saß Joe Biden im Weißen Haus, die Demonstranten vor Palantirs Zweigstellen waren verschwunden, die Pandemie schien im Großen und Ganzen vorbei, und ich fragte mich, ob damit eine Zeit begann, die sich für Karp und sein Unternehmen als eher ereignislos erweisen würde. Aber ich schrieb kaum zwei Wochen an meinem Buch, da fiel Russland in der Ukraine ein – ein Konflikt, in dem Palantirs Technologie eine zentrale Rolle spielen sollte. Dramatische Fortschritte im Bereich des Maschinenlernens, wie sie im November 2022 das Debüt von ChatGPT deutlich machte, läuteten die KI-Revolution ein, und auch hier hatte Palantir – im militärischen wie im kommerziellen sprich zivilen Bereich – die Nase vorn. Dann kam der 7.Oktober 2023, der Terroranschlag der Hamas, dem 1200 Israelis zum Opfer fielen. Für Karp war diese Tragödie eines der entscheidenden Ereignisse seiner Laufbahn und damit auch ein epochaler Augenblick für Palantir – man befand sich einmal mehr im Krieg gegen den Terror in einer Welt, die für Juden plötzlich ausgesprochen unsicher geworden war und damit ausgesprochen unsicher für Alex Karp. Alle großen Themen in Karps Leben, sein Gefühl der Verwundbarkeit, seine tiefe Verbundenheit mit seinem jüdischen Erbe (die in deutlichem Gegensatz zu seiner scheinbaren Ambivalenz gegenüber seinem schwarzen Erbteil steht), seine Verachtung für die identitäre Linke und die akademische Welt, sie alle kristallisieren sich um dieses eine Problem – und ihm in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag zuzuhören, vermittelte mir besonders tiefe Einblicke.
Das Massaker in Israel festigte auch seine politische Metamorphose. Obwohl er sich längst nicht mehr als Neosozialist bezeichnete, nannte er sich, als ich ihn zum ersten Mal traf, immer noch progressiv, und zu bestimmten Themen wie beispielsweise der Einwanderung äußerte er Meinungen, die sich mit einer liberalen Weltanschauung zu decken schienen (obwohl er gleichzeitig die »positive Diskriminierung« ablehnte und ein entschiedener Befürworter des verfassungsmäßigen Rechts auf Schusswaffen war). Während Bidens Präsidentschaft jedoch war kaum zu übersehen, dass er selten ein gutes Wort für Demokraten hatte und sie oft verächtlich abtat. Im Gegensatz dazu überschlug er sich schier vor Lob für die Republikaner – sogar für Trump. Eine Zeit lang ging ich davon aus, dass es sich dabei nur um einen Widerspruchsreflex handelte oder um eine Art, einen unabhängigen Geist zu signalisieren. Aber irgendwann wurde mir klar, dass er sich nach rechts bewegte, und das Pogrom vom 7.Oktober sowie der Ausbruch antiisraelischer Proteste an Colleges und Universitäten führten schließlich zum entschiedenen Bruch mit den Demokraten brach.
Im Zuge meiner Recherchen konnte ich auch den Wandel von Karps Bild in den Augen der Öffentlichkeit verfolgen. Falls man früher überhaupt Notiz von ihm genommen hatte, dann in erster Linie als Exzentriker, als komischem Kauz. Lange bediente er dieses Bild bewusst und bezeichnete sich stolz als »den voll durchgeknallten CEO«. Doch im Gefolge von Ukraine, KI und Israel begann sich der Eindruck von ihm zu ändern. Er äußerte sich sehr offen zu allen drei Themen und vertrat eine interessante, oft provokante Meinung. Außerdem bewies er Zivilcourage: Im Mai 2022, drei Monate nach Beginn des Krieges, reiste er nach Kiew, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Karp wirkte plötzlich gemessen, ein Eindruck, den der scheinbare Mangel an Seriosität einiger anderer Größen der Tech-Welt noch verstärkte. Während Karp Kriegsgebiete besuchte und über Krieg und Frieden sprach, planten Mark Zuckerberg und Elon Musk, sich in einem Cage-Fight zu messen.
Aber so sehr sein Ansehen und Einfluss auch zunehmen mochten, schien es Karp nicht möglich, sich von seinem Groll zu befreien. Nie agierte er lebhafter als in den Augenblicken, in denen er sich über Wall Street oder Silicon Valley ereiferte. Eine Zeit lang war mir das unerklärlich. Seine Firma floriert, der Mann ist Milliardär, er hat in jeder Hinsicht »gewonnen«. Warum kann er es nicht dabei belassen? Schließlich wurde mir klar, dass der Mann einfach Feinde braucht. Die Zweifler und Neider, seien sie nun eingebildet oder tatsächlich vorhanden, geben ihm den Kick der zusätzlichen Motivation. Sie sind Teil der größeren Erzählung, die Karp über sich und Palantir geschaffen hat: dass sie von Anfang an Außenseiter gewesen seien – die sprichwörtlichen Barbaren vor dem Tor.
Karp und sein Unternehmen hatten sich dieses rebellische Image effektvoll zunutze gemacht, aber in der Zeit, in der ich an diesem Buch saß, gewann der Erfolg von Palantir dramatisch an Fahrt. Das Ringen des Unternehmens um Rentabilität war eine Quelle anhaltender Frustration für Palantirs Investoren gewesen, nicht zuletzt für Thiel selbst. Doch Ende 2022, nach fast zwei Jahrzehnten Geschäftstätigkeit, schrieb das Unternehmen endlich schwarze Zahlen, und das erwies sich als Wendepunkt. Seither ist Palantir Quartal für Quartal profitabel, und dank des Booms auf dem Gebiet der generativen KI stieg sein Umsatz sprunghaft an. Im September 2024 wurde Palantir in den S&P 500 aufgenommen, nach Ansicht Karps der bislang wichtigste Meilenstein des Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt und stieg weiter an. Am 4.November, nach einem weiteren fantastischen Quartalsbericht, legte das Papier um fast 10 Dollar pro Anteilschein zu und schloss zum ersten Mal über der Marke von 50 Dollar.
Kaum mehr als 24 Stunden später war Donald Trump zum zweiten Mal Präsident. Diesen Sieg verdankte er in erster Linie seinem Versprechen, noch schärfer gegen die Einwanderung vorzugehen, was potenziell dazu führen würde, dass man Millionen von Menschen ohne Papiere in Internierungslagern zusammentrieb, um sie dann abzuschieben. Wesentliches Merkmal von Trumps Wahlkampf war seine gewaltstrotzende Rhetorik, die von vielen Fachleuten (und Wählern) als faschistisch bezeichnet wurde. Zwei Generäle aus Trumps erster Amtszeit, John Kelly und Mark Milley, erklärten öffentlich, ihrer Ansicht nach sei Trump ein Faschist. Trump hat ganz offensichtlich wenig Respekt vor Rechtsstaat und Verfassung, wie nicht zuletzt sein Versuch belegt, die Wahl von 2020 zu kippen. Nach Trumps Rückkehr an die Macht sieht es nun fast so aus, als hätte der Autoritarismus in den Vereinigten Staaten gesiegt. Fortan, so scheint es, wird Palantir, von Karp immer als Bollwerk der internationalen liberalen Weltordnung gepriesen, der Agenda eines Präsidenten dienen, der nichts als Verachtung übrig hat für Amerikas politische Tradition und das westliche Bündnis, dafür aber eine merkwürdige Schwäche für einige der brutalsten Tyrannen der Welt.
Kapitel 1DieSchmattes-Fabrik
Am 14.April 2021 gab Präsident Joe Biden seine Absicht bekannt, die letzten in Afghanistan verbliebenen US-Truppen bis zum 11.September des Jahres abzuziehen – dem zwanzigsten Jahrestag des Terroranschlags, der zu Amerikas militärischem Engagement dort geführt hatte. Die US-Geheimdienste hatten Biden versichert, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in der Lage sein würden, die wiedererstarkten Taliban lange genug aufzuhalten, um den USA und ihren Verbündeten eine geordnete Evakuierung zu ermöglichen. Biden hatte im Wahlkampf versprochen, den »ewigen Krieg« in Afghanistan zu beenden, und jetzt, kaum vier Monate nach Amtsantritt, hatte er beschlossen, sein Versprechen einzulösen.
Wie sich herausstellte, hatten die Geheimdienste die Lage jedoch unterschätzt. Schon Ende Juni war das afghanische Militär so gut wie zusammengebrochen, die Regierung wankte, und die Taliban hatten weite Teile des Landes eingenommen und rückten immer näher an die Hauptstadt Kabul heran. Im Juli verlegte Biden angesichts der sich zuspitzenden Lage den Termin für den Abzug der letzten US-Truppen auf den 31.August vor. Die meisten der 2500 US-Soldaten, die sich in Afghanistan befanden, als Biden den Abzug ankündigte, hatten das Land bereits verlassen, aber einige Hundert waren noch dort. Darüber hinaus versuchten nach wie vor Hunderte von westlichen Diplomaten und Mitarbeitende von Hilfsorganisationen sowie Zehntausende von Afghanen, die die USA und ihre Koalitionspartner unterstützt hatten, das Land zu verlassen. Sie sahen sich zunehmend in Gefahr. Am 13.August gab Biden bekannt, zur Unterstützung der mittlerweile so dringlichen wie gefährlichen Evakuierung von Nichtkombattanten unverzüglich 3000 zusätzliche Soldaten nach Kabul zu schicken.
Die Operation erforderte Hunderte von Flugzeugen und Tausende von Flügen. Außerdem musste das Pentagon zusätzliche Humvees und andere Fahrzeuge nach Kabul verbringen, darüber hinaus Lebensmittel und Wasser für die US-Soldaten und all die Zivilisten, die zu evakuieren waren. Gleichzeitig waren Militärstützpunkte in Europa und im Nahen Osten auf die Ankunft Zehntausender Flüchtlinge vorzubereiten. Man musste also sicherstellen, dass genügend Lebensmittel, Wasser, Feldbetten, Toiletten und andere lebenswichtige Dinge zur Stelle waren. Darüber hinaus würde man jeden Afghanen, der in den Vereinigten Staaten bleiben wollte, überprüfen müssen, um zu verhindern, dass man bekannte oder mutmaßliche Terroristen ins Land ließ. Erschwert wurde diese logistische Herausforderung dadurch, dass viele der zur Durchführung der Evakuierung benötigten Informationen in Datensilos gespeichert waren, auf die der Planungsstab nicht ohne Weiteres zugreifen konnte. Womit die Mission gefährdet war, bevor sie überhaupt begonnen hatte.
Einen Tag nach Bidens Ankündigung, zusätzliche Truppen nach Afghanistan zu entsenden, ging das Pentagon Palantir um Hilfe an. Die Army nutzte zur Verwaltung von Personal und Nachschub bereits seit 2018 Software von Palantir. Das Unternehmen hatte für sie eigens ein System namens Vantage entwickelt und darin über 150 Datenbanken mit mehr als 30 000 Datensätzen integriert, was der Army zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen kaleidoskopischen Überblick über ihre Bereitschaft gab. Jetzt beabsichtigten die für den Afghanistan-Einsatz zuständigen Joint Chiefs of Staff, Vantage bei der Evakuierung einzusetzen. Die Anfrage aus dem Verteidigungsministerium vermittelte ein Gefühl akuter Dringlichkeit. Die Ansage aus dem Pentagon, so Mitchell Skiles, der die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Army koordinierte, war eindeutig: »… da so schnell wie möglich zu verschwinden und dabei so viele Menschenleben zu retten wie nur möglich.« Binnen weniger Stunden waren Skiles und ein Team von Palantirianern in den Stab der Joint Chiefs integriert. Kurz darauf trugen bereits etwa 150 Palantir-Ingenieure zu den Bemühungen bei. Größtenteils arbeiteten sie von den Vereinigten Staaten aus, aber eine Handvoll saß auch in Übersee, sodass Palantir die Operation trotz der unterschiedlichen Zeitzonen rund um die Uhr unterstützen konnte.
Mithilfe von Vantage ließen sich in kürzester Zeit Daten aus allen an der Evakuierung beteiligten Behörden, militärischen wie zivilen, abrufen und integrieren, vom United States Transportation Command (Transcom), das für alle amerikanischen Militärtransporte verantwortlich ist, über das Außenministerium bis hin zur Zoll- und Grenzschutzbehörde, der Customs and Border Protection (CBP). Binnen weniger Tage baute die Palantir-Crew den Joint Chiefs ein voll integriertes Datenökosystem auf, sodass sich etwa Wartungsdaten einsehen ließen, um sicherzugehen, dass Flugzeuge und Unterstützungsfahrzeuge tatsächlich einsatzbereit waren; man konnte problemlos Nachschub lokalisieren und ausgehenden Flügen zuweisen; und es ließ sich jederzeit überprüfen, wie viele Evakuierte sich an Bord jeder Maschine befanden, die Kabul verließ. Die Palantirianer bedienten sich hinsichtlich der benötigten Informationen sowohl bei bestehenden Datenbanken als auch bei Ad-hoc-Quellen: Einer der Datenströme, die sie in Vantage integrierten, war ein Gruppenchat amerikanischer Soldaten am Flughafen von Kabul. Die Software von Palantir half darüber hinaus beim Erkennen großer wie kleiner Probleme. So machte sie einmal auf ein Problem mit einem amerikanischen Soldaten aufmerksam, der nach Afghanistan ausreisen wollte: Er war erst 17 Jahre alt, und nach US-amerikanischem Recht muss man für den Dienst in einem Kriegsgebiet 18 oder älter sein.
Eine entscheidende Rolle spielte die Technologie von Palantir auch bei der Sicherung des internationalen Flughafens von Kabul. Diese Aufgabe oblag der 82. Luftlandedivision (82nd Airborne Division) der Army unter dem Kommando von Generalmajor Chris Donahue. Als die 82nd Airborne in Kabul eintraf, war der afghanische Präsident bereits aus dem Land geflohen, die Regierung war implodiert, die Taliban waren in die Hauptstadt eingedrungen, am Flughafen drängten sich Tausende von verzweifelten Afghanen. Es war eine Situation, die für Soldaten und Zivilisten gleichermaßen gefährlich war. Um sicherzustellen, dass die Evakuierung ohne Behinderungen durch die Taliban oder Terroranschläge über die Bühne ging, stattete man Donahue und seine Soldaten mit mehreren Tools zur Gefechtsfeldaufklärung aus, die ebenfalls auf der Basis von Palantirs Software liefen. Diese Software kam auch auf der heimischen Seite zum Einsatz, um bei der Ankunft von Flüchtlingen in den USA deren Hintergrund zu durchleuchten. Die Technologie von Palantir wurde mit anderen Worten zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Operation.
Die Entscheidung des Pentagons, Palantirs Hilfe in Anspruch zu nehmen, belegte nicht nur die Effektivität seiner Produkte und die Fähigkeiten seiner Ingenieure, sie war auch Ausdruck einer grundlegenden Erkenntnis: Selbst so gut finanzierte und scheinbar hoch entwickelte Organisationen wie das US-Militär tun sich oft schwer mit der sinnvollen Nutzung ihrer Daten. Eines der Axiome dieses informationsgetränkten Zeitalters lautet: In so gut wie allen Bereichen menschlichen Wirkens können Daten zu besseren Entscheidungen beitragen – vom Operationssaal über Fließband und Schlachtfeld bis hin zum Baseballplatz. Fünfzehn Jahre vor der Evakuierung Kabuls stellte ein britischer Mathematiker und Unternehmer namens Clive Humby in einem Vortrag in London eine kühne Behauptung auf. »Daten«, so sagte er, »sind das neue Öl.« Womit er meinte, dass Daten fortan der Treibstoff wirtschaftlichen Wachstums und materiellen Fortschritts seien. Sein cleveres Bonmot wurde alsbald zum Slogan der Big-Data-Revolution. Im selben Vortrag ergänzte Humby seine Metapher noch durch eine weitere Beobachtung. Wie Rohöl, sagte er, müssten Daten erst raffiniert werden, um wirklich von Wert zu sein.
Rohdaten können durchaus zur Herausforderung werden. Zum einen sind Rohdaten oft ungeordnet und voller Fehler – mal sind Namen falsch geschrieben, mal ist eine Null zu viel, mal ist ein Eintrag veraltet oder kommt zweimal vor. Außerdem liegen Daten in einer Vielzahl von Formen vor. Sie können strukturiert (Diagramme, Tabellenkalkulationen, Anrufprotokolle) oder unstrukturiert (Textnachrichten, Fotos, Instagram-Posts) sein. Die Daten können in verschiedenen Programmiersprachen wie Python, SQL oder Java vorliegen. Als weitere Komplikation kommt hinzu, dass Organisationen ihre Daten grundsätzlich in mehreren Datenbanken speichern, die nicht miteinander vernetzt sind – und je größer die Organisation, desto mehr solcher Datensilos gibt es in der Regel. Hinzu kommt die schiere Menge an Daten, die heute über Telefone, Uhren, Züge, Flugzeuge, Satelliten, Autos, Ampeln, Toaster und sogar Toiletten erzeugt werden. Schätzungen zufolge werden 2025 weltweit 180 Zettabyte an Daten erzeugt werden, was einer Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein Zettabyte entspricht einer Trilliarde (1021) Bytes, das sind … eine Menge.
Palantirs Software hilft, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Sie ist ein Tool zum Zusammenführen, Verwalten und Analysieren großer Datenmengen. Weder sammelt Palantir Daten im Auftrag seiner Kunden noch speichert oder verkauft das Unternehmen welche; seine Technologie ermöglicht Organisationen vielmehr die bessere Nutzung ihrer eigenen Daten. Einige Jahre lang hatte Palantir zwei Softwareplattformen. Die eine, Gotham, war für Geheimdienste und Militär konzipiert; das andere, Metropolis, war hauptsächlich für Finanzinstitute gedacht. Mitte der 2010er-Jahre stellte Palantir Metropolis ein und ersetzte es durch ein System namens Foundry, das auf ein breiteres Spektrum kommerzieller Nutzer ausgerichtet war. Foundry erwies sich als so effektiv, dass man es bald auch an Behörden und das Militär zu verkaufen begann. Später kam man darauf, dass Foundry auch als übergreifende Plattform für nachrichtendienstliche und militärische Aufgaben geeignet war. Heute ist Foundry Palantirs Flaggschiffprodukt und Gotham eine darauf aufgebaute Applikationssuite. Foundry wurde bei der afghanischen Evakuierungsaktion eingesetzt und bildet heute die Basis für Palantirs gesamte Tätigkeit. Es sind Konkurrenzprodukte auf dem Markt, aber die meisten von Palantirs Kunden scheinen der Ansicht zu sein, dass die Software des Unternehmens unübertroffen ist (und den Preis wert ist, den es dafür verlangt).
Wie Palantirianer jederzeit eingestehen werden, ist die Datenintegration eine wichtige, aber banale Aufgabe. »Im Grunde ist das Klempnerarbeit«, sagt Louis Mosley, Chef von Palantirs Londoner Dependance. Und die Analogie ist durchaus treffend. Die Daten werden über virtuelle Pipelines in Palantirs Software eingespeist (die Kunden können diese Pipelines mithilfe von Palantirs Software selbst bauen, oder Palantirs Ingenieure erledigen das für sie, wie im Fall der Evakuierung Kabuls). Die Software bereinigt und standardisiert dann die Daten und macht daraus ein sogenanntes Composite-Dataset (das sich aus all den unterschiedlichen Quellen zusammensetzt). Der Kunde führt darüber Abfragen durch, um Antworten zu erhalten. Er kann beispielsweise einen Namen eingeben, einen Ort oder ein Ereignis und dazu angeben, wie das Ergebnis dargestellt werden soll. Das wiederum können Tabellen sein, Zeitleisten, Diagramme, Heatmaps, Histogramme, Spinnendiagramme, Geodatenanalysen oder KI-Modelle. Die Software geht jedoch noch einen Schritt weiter und hilft (im Unterschied zur Konkurrenz) bei der eigentlichen Entscheidungsfindung: Palantir ermöglicht es dem Kunden, Simulationen durchzuführen, neue Arbeitsabläufe zu erstellen und auf andere Weise auf die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse zu reagieren.
Darüber hinaus zeichnet sich Palantirs Software durch ihre Anpassungsfähigkeit aus. Sie lässt sich passgenau auf die speziellen Bedürfnisse oder Denkmuster eines Unternehmens oder einer Behörde zuschneiden, kann problemlos neue Datenquellen absorbieren und bei der Lösung eines ganz erstaunlichen Spektrums von Problemen behilflich sein. So nutzen die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Foundry zur Nachverfolgung durch Lebensmittel übertragener Krankheiten; das deutsche Pharmaunternehmen Merck nutzt es zur Beschleunigung der Entwicklung von Medikamenten; Airbus behebt damit Produktionsengpässe und sortiert und analysiert damit die Daten, die Sensoren in so gut wie allen in Betrieb befindlichen kommerziellen Airbus-Maschinen generieren; die amerikanische Börsenaufsicht (SEC) bekämpft damit den Insiderhandel; das Tampa General Hospital optimiert damit Personalbestand und Zeitpläne; das Welternährungsprogramm (WFP) verwaltet damit Hilfslieferungen und Logistik; und der italienische Automobilhersteller Ferrari optimiert damit die Leistung seiner Formel-1-Rennwagen.
Dennoch bleiben Terrorismusbekämpfung und Landesverteidigung der Eckpfeiler von Palantirs Geschäft. Ein Großteil dieser Arbeit findet zwangsläufig unter dem Radar der Öffentlichkeit statt (so wurde zum Beispiel nie darüber berichtet, dass Palantirs Software 2024 bei der Sicherung der Olympischen Spiele von Paris eine Hand mit im Spiel hatte). Immer wieder hat Karp im Laufe der Jahre durchblicken lassen, wie bedeutend – und gelegentlich entscheidend – Palantirs Mitwirkung im Kampf gegen den Terrorismus war. Bei einem unserer ersten Gespräche 2019 sagte er mir, dass Palantirs Technologie in Europa mehrmals zur Verhinderung von Terroranschlägen beigetragen habe, die, wären sie erfolgreich gewesen, zu hohen Opferzahlen geführt und damit unweigerlich in einer Reihe von Ländern die extreme Rechte an die Macht gebracht hätten. Und wo er nun mal zu dramatischen Statements neigt, trug Karp auch die folgende Perle mit der für ihn typischen Verve vor: »Ich glaube, die westliche Zivilisation ruhte in den letzten 15 Jahren mehrmals auf unseren eher schmalen Schultern«, sagte er und schob nach, dass Palantirs Technologie der Grund dafür sei, dass die Menschen nicht im »Stechschritt« durch europäische Hauptstädte marschierten. Aber so ganz ohne Beweise vorgebracht, begegnet man solchen Behauptungen eher skeptisch.
Immerhin muss man anerkennen, dass Palantir meist im Hintergrund operiert und das nicht selten in heiklen Situationen, in denen ein eindeutig positives Ergebnis nicht erreichbar oder ein größerer Misserfolg damit schlecht zu kaschieren ist. So zum Beispiel in Falle des afghanischen Airlifts. Dieser entwickelte sich zur größten Evakuierung von Nichtkombattanten in der Geschichte der USA. Innerhalb von 17 Tagen flog man damals mit rund 800 Flugzeugen fast 125 000 Menschen aus – im Durchschnitt also etwa 7500 Menschen am Tag. Fast jede halbe Stunde startete eine Maschine. So gesehen war dies eine imposante Leistung, die umso beeindruckender war angesichts des Tempos, mit dem man die Mission aus dem Boden stampfte, ganz zu schweigen von den Hürden, die das Militär bei der Durchführung zu überwinden hatte. Es lässt sich unmöglich sagen, wie viele Menschenleben gerettet wurden, aber gering war die Zahl mit Sicherheit nicht. Mindestens drei Babys erblickten an Bord der Flüge aus Afghanistan das Licht der Welt; amerikanisches Militärpersonal half bei den Entbindungen.
Unterm Strich jedoch wurde der Erfolg der Evakuierung durch zwei Tragödien getrübt. Am 26.August tötete ein Selbstmordbomber am Abbey Gate, einem der Tore des Kabuler Flughafens, mindestens 180 Menschen, darunter 13 amerikanische Soldaten. Drei Tage darauf tötete das US-Militär bei einem Drohnenangriff versehentlich zehn unschuldige Afghanen, darunter sieben Kinder. Diese Vorfälle und die chaotischen Szenen verzweifelter Menschen auf dem Flughafen führten zu der weitverbreiteten Auffassung, dass die Operation ein Fiasko gewesen sei. Außerdem überschattete den Erfolg des Airlifts der Umstand, dass viele der Afghanen, die auf eine Ausreise gehofft hatten, diese nicht antreten konnten, und mehr noch die harsche Tatsache, dass die zwei Jahrzehnte währenden Bemühungen um Stabilität und Demokratie in Afghanistan gescheitert waren. Palantir war ein Kind des Kriegs gegen den Terrorismus. Es schien daher irgendwie passend, dass Palantir eine entscheidende Rolle dabei spielen sollte, einen Abschnitt dieses Krieges zu beenden, so schmachvoll dieses Ende auch war. Aber wie Karp es einmal ausdrückte: »Palantir ist die Schnittmenge von Software und schwierigen Positionen.«
»Willkommen in der Schmattes-Fabrik.«
In seiner üblichen Arbeitskleidung – T-Shirt, Skihose und Espadrilles – trottete Karp einen Flur der Washingtoner Zweigstelle von Palantir entlang. Auf dem Kopf trug er ein Basecap mit dem Emblem von Veidekke Vest, einem der besten norwegischen Skilanglauf-Teams. Karp scheint einen ganzen Schrank voll von deren Ausrüstung zu haben und lässt sich gern damit fotografieren. Die Skikleidung ist sein modischer Tusch – seine Antwort auf Steve Jobs’ schwarzen Rollkragenpullover und Mark Zuckerbergs Kapuzenpulli. Sein Zugang zu Team-Veidekke-Vest-Sachen sorgte jedoch in Norwegen neben Neugier auch für einigen Unmut. Karp war weder Mitglied des Teams, noch war Palantir in irgendeiner Weise mit ihm involviert. Der norwegische Rundfunk (NRK) nahm sich der Angelegenheit an und fand heraus, dass ein namentlich nicht genanntes Mitglied des Teams Karp mit den Sachen versorgt hatte (NRK unterschlug in seinem Bericht, dass diese Person Karp gegen Entgelt privat trainierte). Ein Sprecher von Veidekke, dem skandinavischen Baukonzern, der das Team sponsert, machte seinem Unmut über Karp Luft. »Es ist einfach nicht in Ordnung«, meinte er, »dass man ihn für einen Angestellten, Partner oder für von Veidekke gesponsert halten könnte.«
Karps Schmattes-Scherz war seine Art, mich zu begrüßen, obwohl er meine Anwesenheit gewöhnlich mit den Worten quittierte: »Oh, mein Biograf ist hier. Seid vorsichtig!« – eine Bemerkung für jeden, der jeweils in Hörweite war. Karps Gang ist der eines Menschen, der viel Zeit auf Skiern verbringt: eine Art Gleiten, bei dem er mit den Schultern rollt, als wäre er im Schnee unterwegs. Hier und da blieb er stehen, um mit Angestellten zu plaudern. Die meisten waren jung, und eine ganze Reihe von ihnen sahen aus, als wären sie frisch von der High School gekommen. Obwohl Karp der Chef war, nahm niemand Haltung an, wenn er in der Nähe war. Seine Mitarbeitenden sprachen ihn mit »Dr.Karp« an, und einige hatten bei der Unterhaltung mit ihm ein Leuchten in den Augen. Aber keiner wirkte nervös in seiner Gegenwart. Karp fragte sie, woran sie arbeiteten und ob sie vom Management die nötige Unterstützung bekamen, sprach aber manchmal auch andere Themen an. Einmal beschloss er, mir zu beweisen, dass Haverford als Einrichtung im Niedergang begriffen sei. Er sprach zwei junge Mitarbeiterinnen an und fragte sie, ob sie jemals von unserer Alma Mater gehört hätten. Beide gestanden, dass ihnen der Name nichts sagte. Karp nickte verdrießlich. »In ein paar Jahren gehört die Schule nicht mal mehr zu den Top 50«, sagte er.
Karp unterhält seine Angestellten gern mal und kann dabei durchaus witzig sein; ab und an gehen seine Witze und Sticheleien freilich etwas zu weit. Als er mich einem seiner norwegischen Bodyguards vorstellte, erklärte er lauthals: »Wissen Sie, dass wir die ersten Juden sind, die er je gesehen hat?« Er verglich sich mit Larry David und meinte einmal, man könnte seine Art Humor – in Anspielung auf Davids TV-Serie Curb Your Enthusiasm – als »Karp Your Enthusiasm« bezeichnen. Sein Wunsch, die Leute um ihn zu erheitern, kommt von Herzen, aber wie er mir sagte, diene das auch einem Zweck: Humor sei eine Möglichkeit, das Unterbewusstsein zu erreichen, und er sehe seine Aufgabe unter anderem auch darin, sicherzustellen, dass das Unterbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeitenden sich mit den Zielen von Palantir decke. »Laut Freud diktiert der Primärprozess, also das Unterbewusste, dem Sekundärprozess, dem Bewussten, wie man die Welt sieht«, erklärte Karp. »Wenn man viel mit Menschen zu tun hat, die etwas gelernt haben, das nicht stimmt, zum Beispiel wie eine Organisation angeblich funktioniert, muss man das ändern, damit die Organisation tatsächlich funktioniert. Das bedeutet, dass man zum Primärprozess durchdringen muss, und das funktioniert ziemlich gut über Humor.«
Im Gespräch neigt Karp zu gewundenen Gedankengängen und Weitschweifigkeit. Eines Tages, er hatte gerade einige Minuten an einer Klimmzugstange vor seinem Büro gehangen, hielt er einer Gruppe von Palantirianern einen improvisierten Vortrag über Features und Bugs. Worauf er hinauswollte, war, soweit sich das erkennen ließ, dass Features nicht immer Features, aber Bugs auch nicht immer Features sind, und dass wider die Intuition zu denken nützlich sein kann oder auch nicht. Seinem Gedankengang war freilich schwer zu folgen, da er im nächsten Augenblick mitten in einem Diskurs über unglücklich verheiratete Freunde, Scheidungsanwälte und Eheverträge war. Es war geradezu eine Orgie freier Assoziationen, aber irgendwie auch unterhaltsam, was vermutlich der Zweck der Übung war. Karp ist im Büro grundsätzlich voller Energie und guter Laune. Ihm geht es um eine gewisse Stimmung. Lange Arbeitszeiten sind bei Palantir obligatorisch, und auch wenn die Annehmlichkeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen von Montag bis Freitag, Bier im Kühlschrank, Snacks in Hülle und Fülle, Hunde willkommen) sich sehen lassen können, sollte die Arbeit auch Spaß machen. Hier und da gibt er seinen Leuten Unterricht in Tai-Chi.
Wie andere Tech-Tycoons scheint auch Karp nicht ganz von dieser Welt zu sein – er hat etwas Ungelenkes, etwas, das ihn ein klein wenig schräg wirken lässt. Seine Exzentrizitäten hat er definitiv. Einmal besuchte ich ihn in seinem New Yorker Büro, als er beim Lunch saß. Er hatte damals einen Muffin-Fetisch und eine besondere Art, sie zu verzehren: Er köpfte die kleinen Napfkuchen und aß nur die Oberseite – im Grunde war ihm nur nach der Glasur – und ließ den Rest des Gebäcks unberührt. An diesem Nachmittag hatte er zwei von den Dingern zum Lunch. Einer war offenbar für mich gedacht, was Karp wohl nicht mitbekommen hatte, sodass er beide verschlang. Nicht vollauf gesättigt, stand er auf und klopfte lautstark gegen die Glaswand, die sein Büro von den anderen trennte. »Kann ich noch ein paar Muffins haben?«, rief er, an niemand Bestimmten gewandt. Umgehend tauchte jemand mit mehreren Muffins auf, die Karp dann halbierte und aß.
In einigen wesentlichen Punkten jedoch unterscheidet Karp sich von anderen Tech-Mogulen, und das nicht nur wegen seines geisteswissenschaftlichen Hintergrunds. Er scheint über ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz zu verfügen und hat ein feines Gespür für die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Menschen um ihn herum. »Einen Raum zu lesen – das ist Alex’ Superpower«, sagte mir Ward Breeze aus unserem Jahrgang in Haverford, der mit Karp befreundet war und später einer seiner persönlichen Anwälte wurde. Das trifft zu, wenn es potenzielle Kunden zu überzeugen gilt; vor allem aber trifft es hinsichtlich seines Umgangs mit seinen Mitarbeitenden bei Palantir zu. Er hat Adjutanten, die ihn über Personalfragen und Dramen im Büro auf dem Laufenden halten, aber er hat auch ein feines Ohr für das, was außerhalb der vier Wände seines Büros passiert. Er scheint sich wirklich für die Menschen zu interessieren, die für ihn tätig sind.
Und es ist ihm ausgesprochen wichtig, was sie von ihm halten. Auf dem Davoser Weltwirtschaftsforum 2022 gab er Andrew Ross Sorkin von CNBC ein Interview. CNBC hat Karp immer gern zu Gast, denn im Gegensatz zu den meisten anderen CEOs kann man sich darauf verlassen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt – nicht zuletzt aufgrund seiner Gepflogenheit, sich vorher mit Mexican Coke (der mit weißem Zucker gesüßten mexikanischen Variante von Coca-Cola) zu dopen. Karp zu buchen, garantiert so gut wie immer Schlagzeilen. Ich war damals mit Karp in Davos. Auf dem Weg zum CNBC-Set vertraute er mir an, dass er vor Fernsehauftritten zwar nie nervös sei, aber eine ganz eigene Art von Druck verspüre: »Ich möchte einfach nichts sagen, was Palantirianer in Verlegenheit bringen würde.« Das Interview mit Sorkin war typisch für Karp – er war abwechselnd witzig, sarkastisch (er zog wie gewohnt über Wall-Street-Analysten vom Leder) und apokalyptisch hinsichtlich des Zustands der Welt (drei Monate zuvor war Russland in der Ukraine eingefallen und Karp meinte, die Chancen, dass Moskau in dem Konflikt eine Atomwaffe einsetze, lägen bei 20 bis 30 Prozent). Irgendwann bat Sorkin Karp, ihm einige Tai-Chi-Bewegungen beizubringen, was Karp denn auch tatsächlich tat. CNBC zeigte im Lauf des Tages Ausschnitte aus dem Interview. Einer dieser Ausschnitte lief, als Karp und eine Reihe von Palantirianern sich in dem Pavillon aufhielten, den das Unternehmen gemietet hatte. Alle drehten sich nach dem Bildschirm um, nur Karp nicht – er beobachtete, wie seine Kollegen ihn im Fernsehen sahen. Als sie über seine Kommentare lachten, blieb er ausdruckslos, beobachtete nur. Es war deutlich zu sehen, dass ihm ihr Urteil eine ganze Menge bedeutete.
Karp rühmt sich gern der leistungsorientierten Kultur seines Unternehmens – Palantir stelle, darauf besteht er, Mitarbeitende ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen ein. Was nicht ganz stimmt: Palantir hat sehr wohl seinen Anteil an Mitarbeitenden, die ihren Job auf Vitamin-B-Basis bekommen haben. Alles in allem scheinen Palantirianer jedoch durch die Bank ausgesprochen intelligent und fähig zu sein. Wie zu erwarten, sind die Ivy-League-Universitäten und Hochschulen mit vergleichbarem Renommee überrepräsentiert (mit Ausnahme von Haverford: Karp betont, unsere Alma Mater keineswegs ausschließen zu wollen, aber er war nun mal der einzige Haverford-Absolvent bei Palantir). Auf der Gehaltsliste des Unternehmens stehen darüber hinaus auch Leute mit beeindruckenden außerschulischen Leistungen. So beschäftigt man eine Reihe ehemaliger Soldaten, außerdem gehörte zum Team zeitweise ein Ex-Olympionike, und mit Kellie Gerardi ist auch eine gegenwärtige Astronautin an Bord.
Karp ist gut zu seinen Mitarbeitenden. Er schreit nicht, droht nicht, noch tadelt oder demütigt er jemanden, jedenfalls nicht vor anderen. Was nicht nur an seinem Temperament liegt, sondern auch an dem Umstand, dass die die Palantirianer de facto seine Familie sind. Und er behandelt sie auch so (wenn nicht gar zu sehr: Manchmal kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass er seine Mitarbeitenden wie Kinder behandelt, und einige von ihnen wirkten ihrerseits wie liebesbedürftige Kinder, die ständig um seine Anerkennung und Aufmerksamkeit buhlten). Womöglich ist er hier und da sogar zu loyal, zeigt ein Maß an Loyalität, das durchaus zu Starrköpfigkeit werden kann. So ist Palantir, um nur ein Beispiel zu nennen, im Großen und Ganzen ein angenehmer Arbeitsplatz, aber es gibt einige wenige Mitarbeitende, die bei den anderen nicht sonderlich beliebt sind oder denen man nicht vertraut. Dennoch mag Karp sich ihrer nicht entledigen. Er kann in dieser Hinsicht sehr stur sein, obwohl er schon aus Prinzip nicht gern Leute entlässt.
Karp sagt immer wieder mal augenzwinkernd, sein Job bestehe im »Handling von Leuten, die nicht zu handeln sind«. Damit meint er vor allem die fast 2000 Softwareingenieure, die das Unternehmen beschäftigt, und er ist überzeugt von seiner fast einzigartigen Fähigkeit, sie zu führen. »Ich kam zufällig