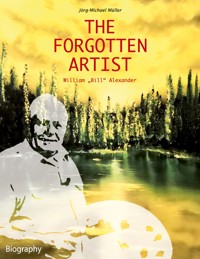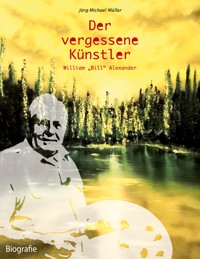
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nanu, Sie kennen den Kunstmaler William "Bill" Alexander nicht? Seine Biografie liest sich wie ein Roman und ist für dieses Buch wohl erstmals umfassend recherchiert worden! Er war ein charmanter "Fuchs" und Idealist, der zwei Weltkriege überlebte und viele Jahre lang in Nordamerika mit seinem VW-Bus als fahrender Künstler umher zog. Sein Leben war ein Abenteuer, sein Ende dramatisch. Der in Berlin geborene und später nach Nordamerika ausgewanderte Künstler wurde als TV-Maler mit eigener Fernseh-Show berühmt. Nur 30 Minuten benötigte Alexander für ein komplettes Ölgemälde, und das brachte er auch seinen zahlreichen Schülern bei. Dank der von ihm entwickelten "Alexander-Maltechnik" kann jeder so malen. Und auch heute noch wird seine Methode rund um den Globus angewendet und gelehrt. Aber den weltweiten Ruhm für diese absolut geniale Technik erhielt ein Anderer: Sein Schüler Bob Ross. Dringend überfällig also, sich an diesen herzlichen Künstler zu erinnern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Das Leben ist eine große leere Leinwand, und wir füllen sie selbst mit der Magie unseres Lebens. Jeder von uns steht vor dieser Leinwand, um dieses eine besondere, allmächtige Gemälde zu erschaffen. Für manche ist es einfach, für viele nicht. Für mich war es eine lange Reise.“
William „Bill“ Alexander, 1983 1)
Inhaltsangabe
Von verborgenen Quellen im Nebel und kleinen Glücksfällen
Eine entbehrungsreiche Kindheit in Ostpreußen
Als Frontsoldat im zweiten Weltkrieg
Über den großen Teich
Wir müssen kurz darüber reden: „Gutes Geld“ und „lausiges Geld“
Der lange Weg zum „Happy Painter“
Die Geschichte von William und seinem Ziehsohn „SandyBandy“
Eine Künstlerkolonie entsteht
Die geniale Alexander-Maltechnik
Die großen Träume werden endlich wahr
„The Magic of Oil Painting“
Das Paradies am Ende von Highway 101
William Alexander und sein Schüler Bob Ross
Das Drama nimmt seinen Lauf
Die letzten großen Projekte, und Bills schlimmster Fehler
Über den eigenen Tellerrand geschaut - Bills „Meister-Serie“
Die letzten Jahre
Epilog
Quellenangaben und Erläuterungen
Von verborgenen Quellen im Nebel und kleinen Glücksfällen
William „Bill“ Alexander, der in Berlin geborene und nach Nordamerika ausgewanderte Künstler, entwickelte die geniale „Alexander-Maltechnik,“ mit der er innerhalb kürzester Zeit komplexe Ölgemälde erstellen konnte. Als TV-Maler mit eigener Show wurde er so im ganzen Land berühmt, und seine Maltechnik wird heute noch weltweit von begeisterten Menschen verwendet. Rund um den Globus verdienen noch immer unzählige Mallehrer mit dieser Technik ihren Lebensunterhalt, und der Verkauf der speziellen Farben und Pinsel war und ist noch immer ein Millionengeschäft. William Alexander geriet nach seinem Tod allerdings in Vergessenheit, im deutschsprachigen Raum kennt ihn eh kaum jemand. Den weltweiten Ruhm für die geniale Alexander-Maltechnik erhielt ein Anderer. Sein Schüler und ehemaliger Angestelleter Bob Ross. Dringend überfällig also, diesen Künstler in Erinnerung zu bringen. Er war ein charmantes Schlitzohr und ein Filou, der zwei Weltkriege überlebte und Jahrzehnte lang in Nordamerika und Kanada mit seinem VW-Bus als fahrender Künstler umher zog, bis er Anfang der 1970er dann entdeckt wurde und ein gefeierter Star wurde. Er träumte von einem besseren Morgen, liebte die Natur und die Menschen. Zeitlebens sprach er sich gegen Gier und Krieg aus. Sein Leben war kurvenreich, mitunter dramatisch. Besonders seine letzten Jahre, und seine abenteuerliche Biografie liest sich so spannend, wie ein Roman.
Als ich mit der Recherche zu William Alexander anfing, war es zunächst nicht sehr schwierig, Informationen über ihn zusammen zu stellen. Es gab eine Dokumentation2) aus dem Jahr 1983 über William und auch eine Autobiografie.3) Viele Details erfuhr man auch, in dem man aufmerksam die einzelnen Folgen seiner TV-Show4) sah. Heute findet man sie fast nur noch auf Youtube. Doch ab einem gewissen Punkt stockte plötzlich die Recherche, es gab keine weiterführenden Quellen mehr. Von seiner Kindheit an, über die Zeit als Wehrmachtssoldat, ließ sich sein Leben, wenn auch mitunter lückenhaft, erzählen. Vieles auf dem verschlungenen Weg bis zu seinem Durchbruch liegt im Dunkeln. Bis ins Jahr 1992 war er in Nordamerika einem Millionenpublikum durch seine TV-Sendungen bekannt, von seinem Privatleben weiß man wenig. Doch dann wurde es abrupt gänzlich still um ihn, und die letzten Jahre seines Lebens lagen vollkommen im Nebel. So soll er angeblich, laut Online-Quellen, bis zu seinem Tod in einem schwer zugänglichen Örtchen namens Powell River5) gelebt haben. Doch schon das ist falsch. Lediglich sein Sterbedatum ließ sich noch zweifelsfrei ermitteln, der 24. Januar 1997. Auch sein Begräbnisort wirft Fragen auf. Eine Quelle sagt, er liegt auf dem Friedhof in Powell River. Andere Quellen behaupten jedoch, er sei in Port Albemi6) begraben. Beides trifft allerdings nicht zu. Er fand weder auf dem einen noch dem anderen Friedhof seine letzte Ruhestätte, und als ich mich in die Recherche vertiefte war vollkommen unklar, ob sich sein Grab überhaupt lokalisieren ließe. Je mehr ich grub, desto mehr ungeklärte Fragen und Ungereimtheiten entstanden. Am Ende wäre diese Biografie beinahe unzufriedenstellend lückenhaft geblieben, wenn nicht der Zufall zur Hilfe gekommen wäre, so dass ich nun seine gesamte dramatische Lebensgeschichte erzählen kann.
Routinemäßig hatte ich zunächst alle in Frage kommenden Friedhöfe angeschrieben und um Auskunft gebeten, ob der Kunstmaler William Alexander dort beerdigt wurde. Aus Powell River erhielt ich innerhalb von nur weniger Stunden eine Antwort. Zwar lag die besagte Person nicht auf ihrem Friedhof, teilte mir eine freundliche Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung mit, doch erhielt ich die Anschrift eines Bestattungsunternehmens. Möglicherweise, so die Dame, könnte man mir dort weiter helfen. Also sandte ich dem Bestatter meine Anfrage zu, die ebenfalls nach wenigen Stunden beantwortet wurde. Mir wurde mitgeteilt, dass die betreffende Person nicht von dem Unternehmen beerdigt wurde, aber der Mitarbeiter habe mal ins Zentralregister geschaut, und mir die Sterbeurkunde von Herrn Alexander kopiert. Ich traute meinen Augen nicht. In Deutschland wäre das schon aus Gründen des Datenschutzes absolut unmöglich, aber in Kanada scheinen die Uhren anders zu ticken. Dieses amtliche Dokument war überaus hilfreich, der Clou des Ganzen aber war, dass die Sterbeurkunde von einem Angehörigen von William Alexander unterschrieben wurde, der mir bis dato gänzlich unbekannt war. Er hatte eine Tochter, das ist dokumentiert. Laut dieses Dokumentes gab es aber auch noch einen Ziehsohn. Manchmal hilft das Glück dem Tüchtigen, denn es gelang mir tatsächlich, diesen Ziehsohn irgendwo in den Tiefen Kanadas ausfindig zu machen. Ich schilderte dem 74jährigen mein Anliegen, und er war tatsächlich bereit, alle meine unzähligen Fragen zu beantworten. Monatelang tauschten wir uns aus, und ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, die spannende Lebensgeschichte von William „Bill“ Alexander, mit all ihren Facetten, zu erzählen.
21.12.2023, Jörg-Michael Müller
Eine entbehrungsreiche Kindheit in Ostpreußen
Die Familie von William Alexander (geboren wurde er mit dem Namen Wilhelm), lebte im damals dünn besiedelten Ostpreußen. Zu jener Zeit, als dort adelige Großgrundbesitzer wie die Grafen von Dohna,7) derer zu Finckenstein8) oder Döhnhoff 9) herrschten. Die Landwirtschaft machte sie reich und mächtig, und Ostpreußen war eine prall gefüllte Komkammer. Die großen und herrschaftlichen zweigeschossigen Gutshäuser zeugen noch heute von dem einstigen Reichtum der „Blaublütigen." wie das einfache Landvolk spöttisch den Land- und Geldadel nannte. Freilich, das gemeine Volk, von dem rund Dreiviertel in der Landwirtschaft arbeiteten und somit direkt vom Adel abhängig waren, lebte deutlich bescheidener. Ihre Häuser waren klein und einstöckig, meist hatten sie nur einen einfachen Lehmboden, eine kleine Kochstelle, einen spärlichen Ofen, und zum Schlafen dienten in der Regel mit Stroh gefüllte Säcke, auf denen man sich nach einem harten Tag bettete. Die Familie Alexander lebte in einem Dorf namens Rautenberg,10) bestehend aus einer Ansammlung von gut drei Dutzend kleinen, hauptsächlich einstöckigen Häusern. Es gab dort eine kleine Bahnstation mit einem einzelnen Gleis in Richtung Tilsit, das rund 40 Kilometer entfernt ist, einen Schmied, einen Friseur, einen Sattler, eine kleine Schule, in deren Obergeschoss der Lehrer zugleich auch wohnte. Ebenso gab es eine Poststelle, eine Kirche und einen kleinen Warenladen für das Nötigste: Also Zucker, Salz, Pfeffer und Mehl. Das war es dann aber auch schon. Es gab weder einen richtigen Arzt, es gab keine Apotheke, keinen Schuster und erst recht keinen elektrischen Strom. Elektrischer Strom erreichte Rautenberg erst im Jahr 1927, und der Generator, der den Strom für die spärliche Straßenbeleuchtung produzierte, wurde fortan vom ortsansässigen Schmied betreut. Zwar gab es dort auch einen alten Polizisten, aber es war damals eine raue Zeit mit harten Kerlen. Und wenn es dann mal Streit unter den Nachbarn gab, etwa, weil einer den Grenzstein zum Nachbargrundstück ein wenig zu seinen Gunsten verschob, dann regelte man das für gewöhnlich direkt untereinander. Mit den Fäusten oder auch gerne mit der Flinte. So war das damals. Da wurde kein großes Aufhebens gemacht, wenn denn mal im Dorf einer „umgeschossen“ wurde, so berichtete William viele Jahre später, dann war halt zukünftig einer weniger von denen da.
Bereits in jenen Tagen wurden in Ostpreußen moderne Agrartechniken entwickelt, die mit verantwortlich waren für die hohen landwirtschaftlichen Erträge. Williams Vater, auch er hieß Wilhelm, arbeitete damals als Bauleiter und setzte diese Techniken um. Bis zu 200 Arbeiter unterstanden ihm zeitweilig dabei, und sie errichteten modernste Drainage-Systeme und Pumpen, um so den Mooren das Wasser zu entziehen,11) und so neue Ackerflächen zu gewinnen. Auch legten sie Wege und Kanäle an oder reinigten die Flüsse. Die Mutter, ihr Name war Ida, geborene Pasanau, versorgte indes den zweijährigen Sohn Paul und kümmerte sich um das kleine Haus. Auch hatten sie ein bescheidenes Stückchen Land von dem dortigen Gutsherren gepachtet, das sie für den Eigenbedarf bewirtschafteten. Man baute das Nötigste an und hielt ein paar Rinder, Hühner und auch Gänse. Neben einigen Hunden besaß die Familie Alexander auch ein in die Jahre gekommenes Pferd.
Im Sommer des Jahres 1914 wurde die Mutter dann mit William schwanger. Zur selben Zeit braute sich auf der großen Weltbühne das Drama des ersten Weltkrieges zusammen, an dessen Ende 17 Millionen Opfer zu beklagen sein würden. Nach dem Attentat vom 28. Juni in Sarajevo auf das österreichische Thronfolgeipaar sagte das Deutsche Reich im Juli Österreich zu, an dessen Seite zu stehen, wie auch immer Österreich auf das Attentat reagieren würde. Mit diesem „Blankoscheck“ ausgestattet, erklärte Österreich dann Serbien den Krieg, das jedoch von Russland unterstützt wurde. Am 30. Juli waren Österreicher und Russen bereits im Kriegszustand. Das Deutsche Reich erklärte darauf hin ihrerseits sofort Russland, Frankreich und England den Krieg, und der Wahnsinn nahm seinen Lauf. Die Militärführung des Deutschen Reiches wusste wohl um die Gefahr eines Zweifrontenkrieges. Und um diesen zu verhindern, wurde schon Jahre zuvor der so genannte „Schlieffen-Plan“ entwickelt. Dieser sah vor, dass durch einen schnellen Angriff auf Frankreich von Norden und Süden her, unter Missachtung der belgischen Neutralität, Frankreich so schnell besiegt werden würde, dass das Heer sich danach direkt nach Osten wenden könnte, noch bevor die russische Mobilmachung abgeschlossen wäre. Man war siegessicher in Berlin, doch es sollte ein Irrtum ein. Von all diesen Plänen wusste die Familie Alexander natürlich nichts, oder nur sehr wenig. Wohl aber machte man sich in Ostpreußen Sorgen, denn es gab nur geringe Truppen zu ihrer Verteidigung vor Ort. Und entgegen der kaiserlichen Erwartung standen schon nach 14 Tagen zwei zaristische Armeen im Lande. Gräueltaten, Flucht und Verwüstung waren die Folge, von der die Familie Alexander aber bislang noch verschont blieb. Der ostpreußische Adel jedoch fürchtete um Land und Wohlstand und wandte sich direkt an Kaiser Wilhelm II. mit der Bitte um Hilfe. Bei dem Hohenzoller12) fanden sie dann auch Gehör, und von der nach Westen ziehenden Angriffearmee, sie hatte noch nicht einmal die Marne erreicht, wurden zwei Korps herausgelöst und nach Osten in Marsch gesetzt. Unter Hindenburg und Ludendorff wurde bei der Schlacht von Tannenberg13) eine der beiden zaristischen Armeen vernichtet, und die Zweite nach Osten abgedrängt. Doch noch immer kontrollierte diese Armee große Teile Ostpreußens. Im Februar des Jahres 1915, in der „Winterschlacht in Masuren,“14) erfolgte dann der deutsche Angriff auf die noch vorhandene zweite zaristische Armee. Nun musste auch die Familie Alexander eiligst fliehen, um Leib und Leben zu retten. Da der Vater längst als Soldat verpflichtet war und kämpfte, drei Mal wurde er im Verlauf des Krieges verwundet, sein Sohn William würde diese Zahl im nächsten Krieg noch überbieten - so war es dann der Großvater, der an einem nasskalten und regnerischen Morgen im Februar das Pferd eiligst vor den Karren spannte, während die hochschwangere Mutter das Nötigste zusammen sammelte. In einem langen Flüchtlingstreck machten sie sich auf den beschwerlichen und gefährlichen Weg in Richtung Berlin, wo am 02. April, nach sicherer Ankunft, William Alexander gesund und munter das elektrische Licht dieser Welt erblickte. Niemals in seinem Leben hatte William Alexander übrigens seine Geburtsstadt Berlin besucht.
Über den Großvater berichtete William später mit einem Augenzwinkern. Dieser war damals als Landpostbote angestellt und fuhr meist mit der Kutsche tagelang von Ort zu Ort, und lange Jahre nach dem Krieg erst fand die Familie dann heraus, dass der Großvater recht umtriebig war, denn in fast jedem Örtchen auf seiner Strecke besaß er eine Freundin. Doch das tut hier eigentlich nichts zur Sache, und so wollen wir es einfach übergehen.
Nach dem Krieg kehrte die Familie Alexander nach Rautenberg zurück, und der Sohn Heinrich wurde geboren. Das Land war durch Bomben und Granaten umgepflügt, die Häuser allesamt zerstört. Und noch immer lagen die halb verwesten Soldatenkörper an der Stelle, an der sie einst starben, und das gesamte Land lag unter einer übelst stinkenden Glocke von Verwesung. Verkohlte Waffenteile und Gerät, halb verrostete Granaten und Munition lagen überall herum. Der Vater musste einen Kredit aufnehmen, um ein neues Haus zu bauen. Doch für die Kinder war es ein riesengroßer, spannender Abenteuerspielplatz, wenn auch ein übel stinkender. William Alexander berichtete später, sie hielten es anfänglich für eine gute Idee, den Leichen die Soldatenstiefel auszuziehen, damit sie selber Schuhe hätten, oder sie diese verkaufen könnten. Doch der Gestank im Innern der Schuhe ließ sie schnell diese Idee über Bord werfen. Statt dessen widmeten sie sich fortan den halb verrosteten Granaten, auf die sie mit Steinen warfen, um sie zur Explosion zu bringen. Es wurde schnell ein geflügeltes Wort, „es einmal richtig krachen zu lassen.“ So manches von den Kindern verlor so einen Arm, ein Auge oder auch das ganze Leben.
Die ostpreußischen Winter waren lang und hart, es wurde schnell eiskalt, und es fiel sehr viel Schnee. Jeder in der Familie musste mit anpacken und helfen, um über die Runden zu kommen. Der junge William stellte sich dabei sehr geschickt bei der Hasenjagd an. Die Schneehasen hatten ein so wunderbares weiches Fell, aus denen man wärmende Kleidung herstellen konnte. Ein Winter jedoch war so bitterkalt, dass die Familie Alexander nicht umhin kam, ihren alten Schäferhund Hector zu töten, um an sein Fell zu kommen. Die anderen Hunde der Familie folgten bald. Wie gesagt, es war eine harte Zeit, und wir können uns das heute kaum mehr vorstellen. Fast das gesamte Jahr über ging William mit seinen Brüdern zum Angeln. Für sie war es Spaß, aber auch eine Ergänzung des Speiseplanes. Barsche und Karpfen fingen sie. Und den Wels, den er Schlammfisch“ nannte, und den die Kinder am Liebsten roh aßen. Das Angeln brachte ihm so viel Spaß, dass sein Traumberuf in jenen Tagen der des Fischwartes war. Das war früher eine angesehene Stelle, man stand im Staatsdienst und achtete darauf, dass das Gewässer intakt war, es keine Verschmutzungen gab, auch war man immer an der frischen Luft. Das bedeutete Freiheit für William. Leider musste man dafür studieren und Prüfungen absolvieren. All das konnte sich die Familie Alexander aber nicht leisten. Im Laufe der Jahre besserte sich einiges, da der Vater wieder als Bauleiter arbeitete. Und auf dem Stückchen Land wurde nun wieder fleißig für den Eigenbedarf angebaut, auch hatte man wieder ein paar Kühe und Hühner. William verstand sich besonders darauf Bienen, zu halten. Er liebte ihren süßen Honig. In seinen Memoiren schrieb William später, wie die Kinder es genossen, mit der Familie zusammen zu sitzen, und gemeinsam zu singen und zu musizieren. Einer der Brüder spielte die Mundharmonika, William die Geige. Wenn der Frühling kam und es wärmer wurde, da stromerten die Jungs durch die Natur. William liebte schon als Kind die Felder, die Weiden und die Wälder rundherum, durch die er so gerne lief. Allerdings gehörten die Wälder dem ostpreußischen Landadel, und die sahen es gar nicht gerne, wenn Dörfler sich dort auf hielten. Wenn die „Blaublütigen“ mal einen Jungen erwischten, dann gab es schnell mal ein paar auf die Mütze. Aber das hatte keinen ernstlich davon abgehalten, immer wieder in die Wälder zu gehen. Die Kinder besuchten im Ort die kleine Schule. Die Mädchen saßen vorne, dahinter die Jungs. Und ihr Lehrer, genannt „Graubart,“ brachte schlecht oder recht alles bei, was man damals in der Volksschule so lernte. Und immer, wenn die Haare der Kinder länger wurden, so mussten Sie ein Blatt Papier vor sich auf den Tisch legen und sich die Haare auskämmen. Heerscharen von Läusen kamen so zu Tage.
Es gibt noch eine besonders schöne Anekdote. Am Rande von Rautenberg, da gab es ein Haus, in dem schon seit Ewigkeiten eine uralte Frau lebte. Immer wieder sahen die rumstrolchenden Jungs diese alte Frau in den Wald gehen, und die Jungs waren sich sicher, dass sie bestimmt eine Hexe war, die im Wald nach Kräutern suchte, um schwarze Magie zu praktizieren. Eines Tages in der Schule, als die Halbwüchsigen mal wieder über die Hexe sprachen, da setzte sich ihr Lehrer „Graubait“ zu ihnen. „Ich erzähle Euch einmal eine Geschichte über die alte Frau,“ sagte er, und lugte die Jungs über seine runde Brille hinweg an. Gespannt rückten alle näher zusammen und lauschten, denn „Graubart“ konnte gut Geschichten erzählen. Die alte Frau war nämlich vor langer Zeit das schönste Mädchen im ganzen Dorf gewesen, so begann er die Geschichte. Und alle jungen Männer verliebten sich in sie, auch die von den „Blaublütern.“ Doch die junge Frau entschied sich für einen aus dem Dorf. Er war der Schönste und Stärkste von allen. So bauten sie sich ein Haus am Rande des Dorfes und machten das Land rundherum urbar. In bunten Farben strichen sie die Hauswände und überall wurden wunderschöne und duftende Blumen gepflanzt. Sie schworen sich ewige Liebe, doch dann musste der Mann 1870 in den Krieg gegen die Franzosen ziehen.15) Beim Abschied sagte er, dass er bald zurück käme, und sie versprach, auf ihn so lange zu warten. Doch als der Krieg beendet war, da kam er nicht zurück. Und seit dem wartet sie jeden Tag, dass er heimkehren möge. Und jede Nacht brennt eine Laterne am Fenster, damit er auch den Weg zu ihr finden würde. Nachdem William die Geschichte hörte, und er beim nächtlichen umherstromern mal wieder an ihrem Haus vorbei lief und die Laterne sah, da berührte es ihn sehr, und er wünschte sich, ihr Mann würde doch recht bald heimkehren. „Hexe“ nannte die alte Frau von den Jungen seit dem niemand mehr.
Dann erkrankte Mutter Ida an Rindertuberkulose. Eine Krankheit, die von einer infizierten Kuh auf den Menschen überspringen kann, wenn man ihre Milch trinkt. Schnell baute die zierliche Mutter körperlich ab. Doch ließ sie sich nichts anmerken, so weit es ging, kümmerte sie sich weiter tapfer um Haus und Kinder. Im Frühjahr 1929 gab es aber keine Hoffnung mehr. Sie spuckte Blut und litt ganz fürchterlich. Wenige Stunden vor Sonnenaufgang verstarb sie dann. Der anwesende Geistliche sprach von Erlösung. Der erst 14jährige William lief weinend aus dem Haus, hinein in den Wald. Er lief tiefer und tiefer hinein. Auf einer kleinen Lichtung blieb er sitzen und trauerte, betete zu Gott. Schon früh spürte er die Kraft der Natur, „Mutter Natur,“ wie er sie nannte, und ihre Schönheit, sie gab ihm neuen Mut. Gottgläubig war William zeitlebens. Und er hatte eine klare Vorstellung von Gott, und wie er mit ihm kommunizieren würde. Er faltete nicht seine Hände oder schaute zu Boden. Gott, so sagte William, würde die nach seinem Ebenbild geschaffenen Kinder auf Augenhöhe sehen wollen. Nicht auf dem Boden. William stand der Institution Kirche bis ins hohe Alter durchaus skeptisch gegenüber. Ein von oben herab lehnte er ab. Nicht nur durch Geistliche, generell im Leben gefiel es ihm nicht, wenn über ihn bestimmt wurde. Frei wollte er sein. Und das kommunizierte er auch in seiner späteren TV-Karriere. Williams Mutter wollte, dass ihre Söhne einen Beruf erlernen würden. So fingen sie dann alle nach ihrem Tod eine Lehre an. Einer wurde Schlachter, der Andere stellte Käse her. William erlernte im Dorf den Beruf des Sattlers und Polsterers. Er wurde von Herrn Tomescheit ausgebildet, der viel für die „Blaublütigen“ arbeitete. Herr Tomescheit hatte ein zweigeschossiges Haus im Ort. Unten war das Geschäft, oben wohnte er mit seiner Frau. Auch die Lehrlinge wohnten dort und arbeiteten sechs Tage die Woche. Nur der Sonntag war frei, und an diesem Tag spielten die Jungs dann immer Fußball. Oh, William liebte Fußball. Eines Tages kam ein durchs Land ziehender Kunstmaler nach Rautenburg. Er ging von einem Gutshof zum Nächsten und malte die Häuser der Gutsherren, oder ein Portrait oder auch Landschaften. Die Kinder nannten den Künstler „Froschmann,“ weil er aussah wie ein Frosch und auch so breit aus den Mundwinkeln heraus sprach. Wann immer William konnte, schaute er beim Froschmann zu. In Windes Eile konnte er eine Landschaft malen. Dieser Mann beeindruckte ihn, und William wollte auch malen. So, wie der Froschmann. Jahrzehnte später erinnerte er sich noch an den umherziehenden Maler, der ihn so beeindruckt hatte. Nachdem William schon zwei Jahre in der Lehre war, da rückte sein Traum vom Malen ein Stück näher. Herr Tomescheit, sein Lehrmeister, kümmerte sich auch um die Kutschen der Adeligen. Er polsterte sie auf, versah sie mit ledernem Geschirr, auch bemalte er die Kutschen mit schönen Dekorationen. Da William sich geschickt anstellte, durfte er diese Arbeit fortan verrichten und schmückte die Kutschen mit gemalten Rosen und in sich verschlungenen Blätterranken. Sein Lehrmeister war zufrieden und William fühlte sich erstmals wie ein Künstler. Ein gutes Gefühl! Einer seiner Schulfreunde, das war der Heinz Höller. Sein Vater war einer der wohlhabenden Gutsherren in der Gegend. Und als dieser in seinem Haus eine Wand mit einer Malerei versehen haben wollte, da sorgte Heinz dafür, dass sein Freund William diesen Auftrag bekam. William war begeistert, als er die große leere Wand sah, die von schweren dunklen Holzvertäfelungen umgeben war. Er mischte Farbpigmente und Öl zusammen und überlegte sich, was dem Gutsherren wohl gefiele. Eigentlich wollte er ein Pferd malen. Galoppierend und mit wehender Mähne. Doch kannte er die beliebten Motive jener Tage und malte eine Jagdszene mit einem Hirsch und einem Löwen, einen dichten Wald und Berge. Alles in allem, ein wunderschönes Bild, der Gutsherr war begeistert, und fortan durfte William in vielen Gutshäusern malen. Viele Jahre später besuchte er seinen Freund Heinz im Haus seines Vaters. Das Wandgemälde war noch da, doch die Farben waren alle verblasst oder abgeplatzt. Die von ihm angemischten Farben hatten nicht das richtige Mischungsverhältnis, und, so berichtete William, in vielen Gutshäusern malte man seine Werke deshalb einfach weiß über.
Als die Weltwirtschaftskrise16) kam, und immer mehr Menschen ihre Arbeit verloren, da spürte man es auch in Ostpreußen. William hatte seine Ausbildung absolviert, doch Herr Tomescheit konnte und wollte ihn nicht weiter beschäftigen. Eine Einnahmequelle musste her. Da er ja die Geige sehr gut spielen konnte, schloss er sich mit einigen seiner Freunde zusammen. Auch Heinz war dabei. Zu fünft gründeten sie dann eine „ungarische Zigeuner-Kapelle,“ wie man es in jenen fernen Tagen nannte. So tingelten sie durch ganz Ostpreußen und klapperten alle Ortschaften ab. Im Sommer schliefen sie unter freiem Himmel, im Winter spielten sie auch für ein Nachtquartier und etwas zu essen. Sie trugen beim Musizieren bunte Westen und Hemden und spielten überall auf. Bei Hochzeiten, Dorffesten und in Gasthäusern, sie nutzten jede Gelegenheit. Zwar erhielten sie meist nur wenig Geld, aber dafür bekamen sie umso mehr Bier für ihre Darbietungen. Es war eine, wie er später sagte, schöne und vor allem durch Freiheit geprägte Zeit.
Als Frontsoldat im zweiten Weltkrieg
So um 1935 lernte er seine spätere Frau Margaret kennen. Sie stammte aus einem der Nachbardörfer, und nachdem sie heirateten, kam zwei Jahre später Tochter Heidi zur Welt. Margaret war eine wunderschöne und warmherzige Frau, mit dunklem gelockten Haar und einem herzlichen Lächeln. Doch das Glück der jungen Familie dauerte nicht lange, denn als der zweite Weltkrieg ausbrach, da musste auch William zum Militär. Vor dem Krieg irgendwann starb sein Vater durch einen Arbeitsunfall, er wurde von einem Zug überrollt. William gab den Nazis die Schuld daran, Näheres ist aber nicht bekannt