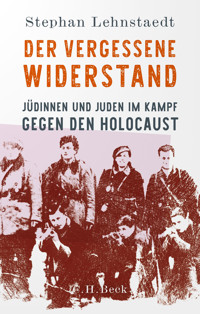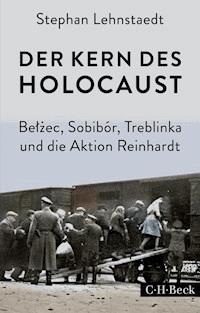10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Polnisch-Sowjetische Krieg (1919 - 1921) ist die Urkatastrophe des osteuropäischen 20. Jahrhunderts. An seinem Ende stand eine labile Friedensordnung, deren Spannungen durch den Zweiten Weltkrieg nicht aufgelöst wurden. Bis heute streiten die osteuropäischen Staaten um nationale Minderheiten und historische Grenzen - und der gegenwärtige Konflikt in der Ukraine wirkt geradezu wie eine Neuauflage der Kämpfe vor einhundert Jahren. Stephan Lehnstaedt schildert eine Auseinandersetzung, die für das Verständnis des heutigen Osteuropa so wesentlich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Stephan Lehnstaedt
Der vergessene Sieg
Der Polnisch-Sowjetische Krieg 1919/20 und die Entstehung des modernen Osteuropa
C.H.Beck
Inhalt
Prolog
1. Osteuropa am Ende des Ersten Weltkriegs
2. Das lange Jahr 1919
3. «Międzymorze» – Zukunftsvorstellungen für ein Polen «zwischen den Meeren»
4. Die Ukraine: Aufgerieben zwischen Polen und Russland
5. Expedition nach Kiew
6. Die Rote Armee marschiert nach Warschau
7. Zwischen allen Fronten: Juden und andere Zivilisten
8. Die Schlacht um Warschau
9. Helden und Versager: Der Piłsudski-Mythos und die Schuldzuweisungen in der Sowjetunion
10. Die Flucht der Roten Armee und die letzten Kämpfe um ein polnisches Imperium
11. Der Friedensvertrag von Riga
12. Bewunderer und Revisionisten – Das Erbe des Krieges
13. Der Polnisch-Sowjetische Krieg heute
Dank
Anmerkungen
Prolog
1. Osteuropa am Ende des Ersten Weltkriegs
2. Das lange Jahr 1919
3. «Międzymorze» – Zukunftsvorstellungen für ein Polen «zwischen den Meeren»
4. Die Ukraine: Aufgerieben zwischen Polen und Russland
5. Expedition nach Kiew
6. Die Rote Armee marschiert nach Warschau
7. Zwischen allen Fronten: Juden und andere Zivilisten
8. Die Schlacht um Warschau
9. Helden und Versager: Der Piłsudski-Mythos und die Schuldzuweisungen in der Sowjetunion
10. Die Flucht der Roten Armee und die letzten Kämpfe um ein polnisches Imperium
11. Der Friedensvertrag von Riga
12. Bewunderer und Revisionisten – Das Erbe des Krieges
13. Der Polnisch-Sowjetische Krieg heute
Archivalien
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Personenregister
Geographisches Register (ohne Staaten)
Karten
Frontverlauf Mai 1920
Frontverlauf Mitte August 1920
«Der ganze Krieg basiert auf Ideen, Vorstellungen und Fiktionen, nicht auf realer Prosa, denn für letztere würde niemand töten.»[1]
Stanisław Rostworowski, 1919
«Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Vor allem – unsere gehen, gleichgültig, und plündern, wo sie nur können, reißen den Ermordeten die Sachen vom Leib. Der Hass ist einhellig, die Kosaken sind genauso, die Grausamkeit ist dieselbe, verschiedene Armeen, was für ein Unsinn.»[2]
Isaak Babel, 1920
Prolog
Am Anfang steht ein weltgeschichtlicher Zusammenbruch. Am Ende zwei Wiedergeburten. Aber der Reihe nach, von einem Ende zum anderen.
Die Februarrevolution 1917 setzte einen Schlusspunkt unter die jahrhundertelange Herrschaft der russischen Zaren. Nikolaus II. dankte am 2. März ab, danach amtierte eine provisorische Regierung. Sie konnte sich nur kurz halten, denn schon ein halbes Jahr später nahm die Oktoberrevolution ihren Lauf und brachte die Bolschewiki an die Macht – weil Deutschland im April den Berufsrevolutionär Wladimir Iljitsch Lenin aus seinem Schweizer Exil nach St. Petersburg geschickt hatte, um den Ersten Weltkrieg im Osten zu entscheiden.[1] Einen anderen Berufsrevolutionär aus Russland, den Polen Józef Piłsudski, steckten die Mittelmächte im Juli 1917 in Magdeburg in Festungshaft: Weil Russland implodiert war, hatte die Zusammenarbeit mit Polen deutlich an Bedeutung verloren.
In jenem Sommer 1917 lagen ihre größten Tage noch vor Lenin und Piłsudski. Für Lenin kamen sie bereits im Oktober, Piłsudski musste ein Jahr länger warten, denn erst das Kriegsende und die Niederlage der Mittelmächte brachten im November 1918 die Wiedergeburt Polens und ihm eine triumphale Rückkehr nach Warschau. Völlig unklar war zu diesem Zeitpunkt allerdings, wie der Staat aussehen sollte, dessen Oberhaupt er nun war, denn mit allen Nachbarn gab es Konflikte um die Grenzen. In Moskau stellte sich die Situation für die «Roten» nicht viel anders dar: Konterrevolutionäre «weiße» Einheiten bedrängten sie aus allen Himmelsrichtungen. Und selbst wenn es gelingen sollte, diese Angriffe zu überleben, stellte sich immer noch die Frage nach dem Verhältnis zu denjenigen neuen Ländern, die auf bisher zarischem Gebiet wie Pilze aus dem Boden schossen – alleine sieben davon im Westen: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Belarus, die Ukraine und Polen.
Unter ihnen erwies sich Polen sehr schnell als der dominante Akteur. Eine von erfahrenen Offizieren organisierte Armee und ein Staatswesen, das unmittelbar aus den von den Mittelmächten vor 1918 errichteten Strukturen hervorging, erlaubten eine außenpolitische Handlungsfähigkeit, die weit über bloße Diplomatie hinausging. In der politischen Debatte setzte sich Józef Piłsudski gegen seine Rivalen durch: Polen sollte als Land zwischen Ostsee und Schwarzem Meer wiederentstehen und an die glorreiche Geschichte dieser Rzeczpospolita des 17. Jahrhunderts anknüpfen. In der Frühen Neuzeit war sie der größte Staat Europas gewesen, bis sie Preußen, Russland und Österreich in drei Etappen 1772, 1793 und 1795 unter sich aufteilten. Von dieser alten Herrlichkeit längst vergangener Zeiten schwärmte Piłsudski, er träumte von Wilna und Lemberg, ja sogar von Minsk und Kiew – und würde diese Städte binnen weniger Monate tatsächlich erobern.
Noch 1918 traten Polen, die Bolschewiki, Litauen und die Ukraine gegeneinander an. Hier kämpften keine Besiegten,[2] sondern Gewinner gegeneinander. Der Untergang der Monarchien der Habsburger, Romanows und Hohenzollern ermöglichte erst ihre Nationen und ihre politischen Projekte. Aber deshalb fand der Erste Weltkrieg im Osten sein Ende nicht im November 1918, sondern setzte sich bis 1921 fort.
Die Banner, unter denen gekämpft wurde, waren neu. Die Soldaten blieben die alten. Abgesehen von einigen enthusiastischen Freiwilligen waren es ausgezehrte Männer, völlig unzureichend ausgerüstet und müde von vier Jahren Krieg, erschöpft wie die Länder und ihre Menschen. Aber endlich ging es um die eigene Sache, nicht mehr um den Konflikt überlebter Imperien, die die Region viel zu lange beherrscht hatten. In dieser Hinsicht war 1918 eine Zäsur – und stellte abermals einen Unterschied zum Westen dar, wo die Waffen schwiegen und die Staaten weiter existierten.
Das Jahr 1919 sah das Ende der ukrainischen Staatlichkeit, sah polnische Truppen in Minsk, Wilna und Lemberg, aber zunächst nur Geplänkel mit sowjetischen Einheiten. 1920 brachte einen Bewegungskrieg an einer über tausend Kilometer langen Front. Die Polen nahmen Kiew – und trugen so dazu bei, dass viele «Weiße» nun die Reihen mit den Bolschewiki schlossen, um das Vaterland zu verteidigen. Daraufhin ging die Rote Armee zum Gegenangriff über, trieb die Polen in nur acht Wochen 500 Kilometer nach Westen. Es waren die letzten glorreichen Tage der Kavallerie und zugleich die ersten Vorboten des modernen Bewegungskriegs mit Panzern und Flugzeugen. Der Fall Warschaus schien sicher, ein Weitertragen des Bolschewismus bis nach Deutschland auf einmal gar nicht mehr unvorstellbar. Aber der entscheidende Schlag misslang, Piłsudski glückte mit knapper Not ein Sieg, der als «Wunder an der Weichsel» in die Geschichte eingehen sollte. Der sowjetische Traum von der Weltrevolution war ausgeträumt, Lenin musste die Doktrin vom «Kommunismus im eigenen Land» entwickeln.
Und dann ein Friedensschluss im neutralen Riga. Kein Sieg für Polen, viel weniger Landgewinn als erhofft, aber auch keine Niederlage. Die neue Republik war nicht kommunistisch geworden. Doch sie stand alleine gegen die 1922 gegründete Sowjetunion: Eine Ukraine gab es nicht mehr, Belarus war sowjetisch, Litauen verfeindet. Der ukrainische Fall war besonders tragisch, denn unter Symon Petljura existierte dort eine große antibolschewistische Bewegung. Polen hatte mit ihr paktiert, aber aus letztlich ganz eigennützigen Gründen. Als der Friede kam, ließ Piłsudski seinen Verbündeten fallen. Die Ukraine war zwischen West und Ost zerrieben worden. Selbst Litauen, traditionell einer von zwei Teilen der Rzeczpospolita, war Polen entfremdet, denn der Nachbar hatte seine Hauptstadt Wilna erobert. Der siegreiche Hegemon fand sich außenpolitisch isoliert.
In Moskau saßen die Bolschewiki nach dem Rigaer Vertrag fest im Sattel eines neuen russischen Reiches und sannen auf Rache, insbesondere jener Heerführer, der für den Fehlschlag vor Warschau verantwortlich gemacht wurde: Josef Stalin. Der eigentliche Oberbefehlshaber, Michail Tuchatschewski, konnte deshalb trotz seines Misserfolgs als strahlender Held nach Moskau zurückkehren. Im «Großen Terror» ließ Stalin ihn 1937 als einen der Ersten beseitigen.
Die Friedensordnung stellte in jeder Hinsicht eine gigantische Hypothek dar. Halb Osteuropa war zum Schlachtfeld eines Krieges geworden, der ebenso sehr ins 18. wie ins 20. Jahrhundert gehörte. Hunderttausende toter Soldaten und Zivilisten waren zu beklagen, riesige Landstriche verwüstet, und wieder einmal sah man in den Juden – wie schon seit Ewigkeiten – die Ursache allen Übels. Der Antisemitismus war allerdings um eine weitere, entscheidende Komponente bereichert worden: Juden galten nun außerdem noch als Volksverräter und Anhänger des Kommunismus. Das erleichterte den Deutschen später nicht unwesentlich den Holocaust, weil auch andere Nationen ihre Nachbarn als Feinde betrachteten.
Der brüchige Friede in Osteuropa sollte gerade 18 Jahre halten. Und es war Deutschland, das ihn beendete. Zwar bewunderten die Nationalsozialisten Piłsudski für seinen Sieg über den Bolschewismus und für seine innenpolitische Durchsetzungskraft. Doch als Polen nicht als Juniorpartner gegen die Sowjetunion zur Verfügung stehen wollte, trat der Hass wieder offen zutage. Deutschland griff am 1. September 1939 an, und am 17. September drang auch die Rote Armee nach Polen vor. Der Zweite Weltkrieg übertraf die Schrecken des Polnisch-Sowjetischen Krieges um ein Vielfaches. Dessen Nachwirkung blieb indes unübersehbar. Im Pakt mit Hitler sicherte Stalin sich den Teil Polens, den die Sowjets in Riga 1921 hatten abtreten müssen. Und 1945 in Jalta wich er nicht von dieser sogenannten Curzon-Linie ab. Er argumentierte gegenüber Churchill, dass sie auf einem alliierten Vorschlag von 1920 beruhe und Sowjetrussland damals in seiner schwächsten Stunde nur notgedrungen auf Gebiete verzichtet habe. Die Kresy, jene ethnisch so heterogenen und stets umkämpften Regionen zwischen Polen und Russland, wechselten damit einmal mehr die Herrschaft.
Bis heute wirft der Polnisch-Sowjetische Krieg seine Schatten. Moskau und Warschau streiten über die Behandlung der damals gefangen genommenen Soldaten; Polen diskutiert mit Litauen, Belarus und der Ukraine über nationale Minderheiten und historische Denkmäler; Polen sind uneins darüber, ob Piłsudskis Vorgehen gegen Sowjetrussland nicht den eigentlichen Feind – Deutschland – gestärkt und somit indirekt zur Niederlage 1939 beigetragen habe. Zugleich feiert man ihn als Vater des modernen Polens und als Retter ganz Europas vor dem Bolschewismus, sieht das «Wunder an der Weichsel» als Verteidigung der christlich-abendländischen Zivilisation und als einen weiteren ignorierten polnischen Opfergang für den Westen.
Und so ist das Geschehen der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg nach wie vor aktuell, vielleicht sogar aktueller denn je. Nicht zuletzt lässt sich der heutige Konflikt in der und um die Ukraine mit gewisser Berechtigung als eine Fortsetzung oder Neuauflage der Kämpfe jener Zeit sehen: Schon damals gab es ein zwischen West und Ost gespaltenes Land, das seine jeweiligen Verbündeten zum Schlachtfeld machten und so letztendlich den Untergang von dessen Eigenstaatlichkeit herbeiführten. Ob das erneut geschehen wird, ist schwer zu sagen. Dieses Buch jedenfalls handelt nicht von der Zukunft, sondern von der Vergangenheit. Es erzählt von einem hierzulande vergessenen Sieg, ohne den sich Geschichte und Gegenwart Ostmitteleuropas nicht verstehen lässt.
Anders als in der deutschen Geschichtsschreibung so häufig, steht dabei nicht Russland im Zentrum. Die Aufmerksamkeit gilt zuvorderst Polen und der Ukraine, und erst in zweiter Linie den weiteren Konfliktparteien des Polnisch-Sowjetischen Krieges. Entscheidend dafür ist, dass dieser Konflikt für Russland nur ein Kapitel des weit größeren Bürgerkriegs war – und nicht unbedingt das wichtigste. Die Wahrnehmung der anderen Beteiligten hätte nicht unterschiedlicher sein können – und ist es bis heute: Für sie ging es um Sein oder Nichtsein, um die Existenz als lebensfähiger Staat oder bloß als Minderheit in einem anderen Land. Die Auseinandersetzungen der Jahre 1919/20 sind deshalb Teil der polnischen und ukrainischen nationalen Identität.
1. Osteuropa am Ende des Ersten Weltkriegs
Das eigene Vaterland war den meisten Osteuropäern ausgangs des 19. Jahrhunderts eine geliebte Idee – aber keine, mit der sie auf einen eigenen Nationalstaat hoffen konnten. Zu fest saßen die Kaiser in Wien, St. Petersburg und Berlin auf ihren Thronen. Doch nur wenige Jahre später brachte der Erste Weltkrieg das Ende der Dynastien, brachte Revolutionen und Republiken, und er brachte neue Staaten im östlichen Europa. Er brachte aber auch unvorstellbare Zerstörungen und Leid über die Menschen zwischen Ostsee und Schwarzem Meer. Im künftigen Polen hatten die Bauern 1918 – und noch immer war Landwirtschaft die alles dominierende Erwerbsquelle – die Hälfte ihres Viehbestands verloren, und im gleichen Maße hatten sich ihre Ernten reduziert. Die Industrie beschäftigte in der einst florierenden Region um die Städte Warschau und Lodz nur mehr 15 Prozent der Arbeiter im Vergleich zu 1914. Zwei Drittel aller Bahnhöfe und die Hälfte der Brücken des Landes existierten nicht mehr. Und schlimmer noch: Zählte man alle Kriegstoten, Deportierten und Geflüchteten zusammen, hatte sich die Einwohnerzahl des Landes um etwa vier Millionen verringert, auf nunmehr 26 Millionen.[1]
Im Baltikum, der Ukraine und weiten Teilen des westlichen Russlands sah es kaum anders aus. Nach wie vor prägte der Kampf ums tägliche Überleben den Alltag von Millionen – und die Schlachten und Kriege nach 1918 trugen nicht dazu bei, diese Situation schnell zu ändern. Noch bis Mitte der 1920er Jahre stellten insbesondere die Wintermonate für viele Menschen eine enorme Herausforderung dar. Die zivilisatorischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts blieben weitere lange Jahre auf die Städte beschränkt, während man auf dem Land wie in vormodernen Zeiten lebte, ohne befestigte Straßen, Eisenbahn, Telefon und Strom und mit wenig mehr als der allerrudimentärsten medizinischen Versorgung. Glücklich durfte sich schätzen, wer in einem gemauerten Haus lebte und ein Pferd als Fortbewegungsmittel sein Eigen nannte.
Das Straßenbild bestimmten Hunderttausende von heimgekehrten Soldaten in ihren Uniformen, auf der Suche nach Angehörigen, nach Arbeit oder einfach nur etwas zu essen. Doch auch sonst blieben die Spuren des Weltkriegs sichtbar. Da war das, was fehlte, was vernichtet worden war. Und da war das, was hinzugetreten war. Der sowjetische Schriftsteller Isaak Babel berichtete bei seinem Marsch nach Polen mit der Roten Armee im Juli 1920 davon: «Immer häufiger trifft man auf die Schützengräben des alten Kriegs, überall Stacheldraht, er würde noch 10 Jahre für Weidenzäune reichen, zerstörte Dörfer, überall wird aufgebaut, aber nur schlecht, es gibt nichts, kein Baumaterial, keinen Zement.»[2]
Für die neuen Regierungen stellten diese Gegebenheiten ebenso enorme Herausforderungen dar wie für die Bürger. Es ließ sich kaum von einer echten Kontrolle über das Land sprechen, weil Kommunikationsmittel und Personal fehlten. Und wo die implodierten Kaiserreiche ihre Beamten zwar abzogen, hinterließen sie doch Verwaltungstraditionen, die wenig miteinander kompatibel waren. Alleine in Polen waren Anfang 1919 sechs verschiedene Währungen im Umlauf, allesamt von untergegangenen Reichen.
All das hinderte Politiker verschiedener Ethnien im Herbst und Winter 1918 nicht daran, endlich die ersehnten Staaten zu proklamieren. Einige von ihnen blieben kurzlebig, weil ihnen weder eine nennenswerte territoriale Ausdehnung noch der Aufbau einer schlagkräftigen Armee gelang. Auf internationalem Parkett war zudem die Anerkennung insbesondere der Westmächte von Vorteil, weil sie diplomatischen Druck ausüben oder sogar Waffen liefern konnten. In der Region selbst war gegenseitige Akzeptanz zwar von noch höherer praktischer Bedeutung, aber angesichts sich oft überschneidender territorialer Forderungen weit schwieriger zu erlangen. Als letzter Faktor für das politische Überleben trat die Unterstützung des Volks hinzu, das in vielerlei ethnische und soziale Gruppen gespalten war, die sich nicht selten ablehnend oder sogar offen feindlich gegenüberstanden. In Ungarn beispielsweise baute die kurzlebige Räterepublik auf das Industrieproletariat, während sich der ukrainische Hetman-Staat vorwiegend auf Großgrundbesitzer stützte. Diese jeweils vergleichsweise schmale Basis war ein entscheidender Grund für den schnellen Niedergang beider Regime.
Andere Länder waren erfolgreicher darin, unterschiedliche Interessen zu vereinen und so eine gewisse Ausgeglichenheit und vor allem Stabilität zu erreichen. Dennoch sind die bis heute gepflegten Narrative von Wiedergeburt und Wiedererlangung der Unabhängigkeit kaum die Erfolgsgeschichten großer Staatenlenker, als die sie propagiert werden. Ganz im Gegenteil waren sie in einem hohen Maße von der Kriegsmüdigkeit und dem Desinteresse gerade der Landbevölkerung an Grenzziehungen und ethnischer Politik geprägt.[3]
Als ersten Schritt zur Stabilität mussten sich die neuen, selbsternannten Regierungen durch Wahlen legitimieren lassen. In Polen geschah das bereits im Januar 1919, aber nur in den polnisch dominierten Kernregionen der neuen Republik, die sich noch auf der Suche nach ihren Außengrenzen befand. Immerhin wurden später zu den anfänglich dreihundert Abgeordneten des Sejm aus den dann eroberten Gebieten weitere hundert nachgewählt. Von einem Linksruck wie in Russland konnte indes keine Rede sein, das Land zeigte sich konservativ und nationalbewusst – und dementsprechend marginalisiert waren die Kommunisten, die zudem zu einem Wahlboykott aufgerufen hatten.
In schneller Folge verabschiedete der Sejm zuerst die «Kleine Verfassung» und fällte am 20. Februar 1919 den Beschluss, Józef Piłsudski im Amt des Staatsoberhauptes zu lassen. Damit verfügte er über eine beispiellose Machtstellung weit jenseits der des Premierministers, weil er neben der Exekutive auch noch das Militär befehligte. Immerhin gab das Parlament seine gesetzgeberischen Kompetenzen nicht aus der Hand, so dass demokratische Formen gewahrt blieben.[4]
Zu diesem Zeitpunkt war Polen bereits in mehrere militärische Auseinandersetzungen involviert und hatte erste Erfolge erzielen können. Tatsächlich war es schon vor der Unabhängigkeitserklärung zu Konflikten gekommen, weil ukrainische Politiker in Lemberg am 31. Oktober 1918 die Westukrainische Volksrepublik proklamiert hatten. Anders als der Name suggeriert, handelte es sich dabei nicht um einen kommunistischen Staat, sondern um ein recht bürgerliches Unterfangen, das sich als Teil der bereits Ende 1917 in Kiew entstandenen Ukrainischen Volksrepublik sah, aber seinen formalen Beitritt erst später erklärte. Die historischen Ursachen für diese doppelte Staatlichkeit liegen wiederum im zeitlichen Verlauf des Zusammenbruchs der Kaiserreiche, denn während die Mittelmächte die Zentralukraine nach der Russischen Revolution 1917 besetzten und dort eine mehr oder weniger von ihnen abhängige Regierung duldeten,[5] kam für das habsburgische Kronland Galizien mit seiner Hauptstadt Lemberg eine Selbständigkeit nicht in Frage.
Lemberg wiederum war eine mehrheitlich polnische Stadt mit einem überwiegend ukrainischen Umland. Die schwelenden Nationalitätenkonflikte hatten Österreich-Ungarn vor große Herausforderungen gestellt, aber mit dem Untergang der Monarchie verschwand auch der mühsam ausgehandelte innenpolitische Frieden. Die polnische Bevölkerung in Lwów musste deshalb überrascht feststellen, plötzlich in L’viv zu leben – und war damit gar nicht einverstanden. Ab dem 1. November 1918 kam es daher zu Kämpfen zwischen anfangs etwa 750 polnischen Aufständischen und rund 3000 westukrainischen Soldaten, die kaum in der Lage waren, eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern unter Kontrolle zu halten. Und während Letztere weitgehend von Nachschub abgeschnitten waren, verdoppelte sich die Zahl der aufständischen Polen in den nächsten zwei Wochen und wuchs auf annähernd 5000 bis zum 20. November. Auf beiden Seiten war man weit entfernt von den waffenstarrenden Truppen des Weltkriegs – so standen auf polnischer Seite etwa 1000 Jugendliche –, aber das machte die Kämpfe nicht weniger blutig.[6]
Die Ukrainer mussten ihre Niederlage am 22. November eingestehen und sich aus Lemberg zurückziehen. Polen triumphierte dort vergleichsweise mühelos, anders als in Wilna, einer weiteren großen multiethnischen Stadt in Ostmitteleuropa, die auch Belarus und vor allem Litauen für sich beanspruchten. Das Weißrussische Nationalkonzil hatte bereits im März 1918 erklärt, Wilna als Teil des eigenen Landes zu sehen. Doch die von den Deutschen tolerierte Unabhängigkeitsbewegung erwies sich als kurzlebig und wenig durchsetzungsfähig – aus ihrer Hauptstadt Minsk mussten die Politiker im Dezember 1918 vor der Roten Armee fliehen. Sie schlugen daraufhin den Litauern eine Föderation vor, an der Letztere nicht interessiert waren. Die Taryba als nationales litauisches Parlament hatte, ebenfalls unter deutscher Herrschaft, am 11. Dezember 1917 die Unabhängigkeit erklärt und Loyalität gegenüber den Mittelmächten bekundet. Bei Kriegsende sah sich das Land starkem Druck durch vorrückende sowjetische Einheiten ausgesetzt, konnte sich aber weder mit Belarus noch mit Polen auf ein Verteidigungsbündnis einigen, eben weil alle Wilna für sich beanspruchten – als Vilnius, Wilnjus oder Wilno.[7]
Ähnlich wie in Lemberg lebte auch dort eine polnische Mehrheit inmitten ländlicher Gebiete mit vielfach litauischer und weißrussischer Bevölkerung. Aber der Zensus von 1916 sprach deutlicher zugunsten der polnischen Argumente als in Galizien. In der Stadt mit ihren 140.000 Einwohnern dominierten die Polen mit 50 Prozent, gefolgt von 43 Prozent Juden, und auch auf dem Land stellten sie oft zumindest eine relative Mehrheit. Diese Polen in Litauen hatten schon im November 1918 einen Zusammenschluss mit der Rzeczpospolita gefordert.[8] In Warschau argumentierten Statistiker außerdem, dass «katholische Weißrussen» nichts anderes als vom Zarenregime diffamierte Polen seien.[9] Und so begründeten die Zahlen einen territorialen Anspruch, der mindestens ebenso schwer wog wie emotionale Bindungen: War nicht der Nationaldichter Adam Mickiewicz ebenso aus Wilno wie der Vater der polnischen Oper, Stanisław Moniuszko? Und stammte nicht Piłsudski selbst aus der Gegend?
Zugleich sahen die litauischen Politiker in Vilnius ihre angestammte Hauptstadt und deren Einwohner lediglich als polnisch sprechende Litauer.[10] In Zeiten der alten Rzeczpospolita des 17. Jahrhunderts war beides kein Widerspruch gewesen, denn es handelte sich um eine Union aus einem polnischen und einem litauischen Landesteil. Aber im nationalistischen 20. Jahrhundert war dergleichen nicht mehr denkbar. Und da außerdem Kommunisten an die Macht gekommen waren und auf baldige Verstärkung durch die Rote Armee hofften, griffen einige wenige polnische Soldaten unter den Generälen Władysław Wejtko und Adam Mokrzecki am Neujahrstag 1919 zu den Waffen. Doch trotz Unterstützung durch eine Bürgerwehr konnten sie die Eroberung Wilnas durch sowjetische Einheiten fünf Tage später nicht verhindern.[11]
Es war der Auftakt zum Polnisch-Sowjetischen Krieg, der allerdings nie offiziell erklärt wurde. Die Diplomatie verhinderte ihn auch nicht, denn es existierten schlicht keine formalen Beziehungen. Die Bolschewiki hatten Aleksander Lednicki, den Warschauer Gesandten, in Moskau ins Gefängnis geworfen, weil sie die polnische Regierung nicht anerkannten. Umgekehrt hatte man in Warschau die sowjetische Mission um den polnischen Kommunisten Bronisław Wesołowski zunächst arretiert und ausgewiesen, aber ihn und zwei weitere seiner drei Mitarbeiter am 2. Januar 1919 kurz vor der Demarkationslinie erschossen.[12]
Unterdessen waren die polnischen Verteidiger von Wilna ohne Unterstützung aus dem Mutterland nicht in der Lage, sich zu behaupten. Zwischen den späteren Kriegsgegnern standen zu diesem Zeitpunkt noch deutsche Truppen, deren Rückzug bis Februar 1919 dauerte. Zwar wollten diese Männer nach der Niederlage möglichst schnell nach Hause, aber in Berlin legte man viel Wert auf einen geordneten Rückzug. Dafür mussten Eisenbahnverbindungen für den Abtransport über Ostpreußen gesichert werden – viele Hunderttausend Landser aus Russland und der Ukraine fuhren über Białystok und Grajewo Richtung Westen. Fast eine halbe Million kampferprobte und gut ausgerüstete deutsche Soldaten im ehemaligen Besatzungsgebiet «Ober Ost» deckten ihre Heimreise. Sie standen dort durchaus mit Zustimmung der Warschauer Regierung, denn diese konnte so eine kurze Atempause für die Ausrüstung und Ausbildung ihres eigenen Militärs nutzen, ohne bereits in Kämpfe mit den Sowjets verwickelt zu sein, die keinen Angriff auf die in jeder Hinsicht überlegenen Deutschen wagten. Außerdem hatte deren General Max Hoffmann mit den Polen bereits vereinbart, die Stellungen an sie zu übergeben und einiges schwere Gerät zurückzulassen.[13]
Während sich die früheren Besatzer offiziell neutral verhielten, tobten im nördlichen Baltikum blutige Auseinandersetzungen. «Weiße» russische Truppen um General Nikolaj Judenitsch mit 60.000 Mann versuchten vergeblich, auf St. Petersburg vorzustoßen. Sie bekämpften neben der Roten Armee außerdem die 24.000 sogenannten Lettischen Schützen, die mit den Bolschewiki sympathisierten. Verwickelt in diesen Bürgerkrieg waren neben den estnischen Streitkräften mit über 70.000 und den litauischen mit nur rund 10.000 Soldaten auch baltendeutsche Einheiten sowie Abspaltungen des deutschen Heeres mit etwa 30.000 Mann, die sogenannten Freikorps. Erst im Frühjahr und Sommer 1920, nach dem Abschluss von Friedensverträgen der drei neuen Staaten mit Moskau, sollte die Region zur Ruhe kommen.[14]
Die polnische Armee bestand bei Kriegsende 1918 aus etwa 30.000 Soldaten der Polnischen Legionen, die bis dato in den Reihen der Mittelmächte gedient hatten. Dank vieler Freiwilliger und dem Anschluss zahlreicher paramilitärischer Verbände war die Zahl im Januar 1919 bereits auf 110.500 gewachsen.[15] Damit kommandierte Piłsudski das größte Heer in Osteuropa jenseits Russlands – und weitere Verstärkungen zeichneten sich ab. Die Keimzelle bildeten die Offiziere aus der aufgelösten deutschen Armee, nicht wenige kamen aber auch aus den Korps von Österreich-Ungarn, Russland und der Entente. Zweifellos brachten sie viel Erfahrung und eine gründliche Ausbildung mit, aber die unterschiedlichen Militärdoktrinen sorgten zugleich für verschiedenartige Herangehensweisen, Disziplinvorstellungen und Kommunikationsmethoden. Im Frühjahr 1919 traf außerdem eine französische Militärmission mit rund 1500 Mann ein, die beratend tätig wurde und wichtige Schulungsaufgaben übernahm; eine Folge davon war die Übernahme des Pariser Offiziershandbuchs.[16]
Dieser Armee konnten Ukrainer und Litauer bereits Ende 1918 keinen ernsthaften Widerstand entgegensetzen. Das galt in noch größerem Maße für die Weißrussen, aber deren Staatsbildungs- und Militarisierungsprozesse kamen über ein allererstes Stadium sowieso nicht hinaus. Schon im Februar 1919 sagte Piłsudski daher einem Korrespondenten der Zeitung «Le Matin»: «Leider ist dieses Land von Feinden umgeben. Die gefährlichsten sind die Deutschen und die Bolschewisten, denn unsere Wiedergeburt wird Preußen zerstückeln und vernichten und die Marxisten in den Osten Europas zurückdrängen.»[17] Es waren martialische Worte, und wie die Zukunft zeigte, war die Prognose zutreffend: Zunächst waren die Sowjets der Hauptfeind. Den Krieg mit Deutschland sollte der 1935 verstorbene Piłsudski nicht mehr erleben.
2. Das lange Jahr 1919
Am 5. Januar 1919 hatte die Rote Armee die polnischen Einheiten vollständig aus Wilna vertrieben. Es waren nur kleine Gefechte, von einer Schlacht lässt sich nicht sprechen. War das trotzdem der Kriegsbeginn? Aus polnischer Perspektive ja, denn sowjetische Truppen hatten gewaltsam Territorium erobert, das als nationaler Besitz galt. Aber wie so oft bei dieser Auseinandersetzung sind die Dinge so eindeutig nicht – aus Moskauer Sicht sollte es ein weiteres Jahr dauern, bis man von einem Kriegszustand mit Polen sprechen konnte. Noch am 27. Februar 1920 schrieb Lenin an Leo Trotzki, Russland müsse eine militärische Auseinandersetzung überhaupt erst vorbereiten.[1] Der Konflikt sei bisher lediglich einer zwischen Warschau und der Litauisch-Weißrussischen Sowjetrepublik gewesen, erst mit dem Ausgreifen auf genuin russisches Territorium – in der heutigen Ukraine und Belarus – habe sich dies geändert.
Viele westliche Historiker folgen zwar nicht dieser russischen Sichtweise, erkennen aber trotzdem in Polen den Aggressor und lassen den Krieg im Februar 1919 beginnen, mit Piłsudskis Angriff auf Wilna. Es handelt sich dann nicht um die Rückeroberung des polnischen Wilno, sondern um eine Expansion ins litauische Vilnius. Wie bei den meisten modernen Konflikten instrumentalisierten damals beide Seiten ethnisch-nationale Aspekte, verteidigten vorgeblich die Interessen der Bevölkerung und leisteten sowieso nur Hilfe, während die andere Partei der illegitime Aggressor war. Niemand will schließlich verantwortlich sein für einen Kriegsausbruch. Selbst objektiv betrachtet lässt sich kaum eine Hauptschuld beimessen – aber das wäre sowieso eine moralische Bewertung der Nachgeborenen, die nicht angebracht ist. Fest steht: Beide Seiten waren nicht bereit, kampflos zurückzustecken.
Zumindest für die Frage nach dem Kriegsbeginn ist entscheidend, dass die ersten Schüsse Anfang Januar 1919 gefallen sind. Und für die polnische Bevölkerung Wilnas waren die darauffolgenden Wochen eindeutig eine Besatzung. Die Versorgung verschlechterte sich, Hamsterfahrten aufs Land wurden notwendig, und der Hass wuchs. Der deutsche Jesuit Friedrich Muckermann, der bei der Rückkehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft in Wilna Station machte, schrieb: «Unter der Herrschaft dieser Asiaten belebte sich die Russifizierung in Wilna wieder wie zu den ‹besten› zarischen Zeiten, nur noch rücksichtsloser.»[2]
Zeitgleich betonte in Moskau Außenminister Georgi Tschitscherin, nun saturiert und an Frieden interessiert zu sein. Allerdings wolle Russland auch eine Föderation mit Belarus und Litauen, diese also als kommunistische Vasallen in eine noch zu gründende Sowjetunion eingliedern. Über den Grenzverlauf zu Polen äußerte er sich gegenüber dessen Premierminister Ignacy Jan Paderewski nicht; Wilna oder gar Minsk würde er jedenfalls freiwillig nicht hergeben.[3] Und so kam es am 14. Februar in Bereza Kartuska zum ersten, gewissermaßen offiziellen Aufeinandertreffen regulärer polnischer und sowjetischer Truppen. Moskau protestierte gegen das Vorgehen Warschaus bei der Entente, aber das blieb ohne Konsequenzen, weil Paris und London wenig Sympathien für die Bolschewiki hegten.
Die sowjetische Westarmee umfasste Ende Januar 1919 weniger als 20.000 Soldaten.[4] Von seinem Massenheer des Ersten Weltkriegs hatte sich Russland weit entfernt, zumal die Kämpfer auf ein Gebiet halb so groß wie das heutige Deutschland verstreut waren. Aber Warschau konnte selbst dem wenig entgegensetzen, zumal es auch in der Ukraine Krieg führte. Piłsudskis Generalstabschef Stanisław Szeptycki, Angehöriger eines alten Adelsgeschlechts und erfahrener Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, forderte deshalb, dort Frieden zu schließen und erst dann im Norden aktiv zu werden. Die Sowjets seien der viel gefährlichere Feind und man brauche dringend Nachschub, bevor an die Rückgewinnung von Wilna zu denken sei.
Zweifrontenkriege müssen um jeden Preis vermieden werden. Das diktiert die militärische Logik. Aber innenpolitisch ließ sich in Warschau weder ein Verzicht auf Wilna noch auf Lemberg vermitteln, selbst wenn er nur vorübergehend wäre. Die Nationaldemokraten um Roman Dmowski, Piłsudskis innenpolitische Rivalen, drängten auf eine Offensive in Galizien. Ministerpräsident Paderewski war zwar persönlich für einen Vorstoß in Litauen, er schien ihm jedoch außenpolitisch riskant, denn die Westalliierten, bisher Verbündete des jungen Polens, würden ihn nicht billigen. Piłsudski teilte diese Einschätzung – und wollte gerade deshalb energisch im Norden angreifen. Wenn man Wilna sowieso nicht auf diplomatischem Wege erhalten könne, müsse man Fakten schaffen und insbesondere den Litauern zuvorkommen, die ebenfalls den Kampf gegen die Rote Armee und um ihre Hauptstadt planten.[5]
Um überhaupt Truppenverlagerungen in dieser Gegend möglich zu machen, mussten die Deutschen vorher die Haupteisenbahnverbindung von Brest über Białystok nach Ostpreußen freigeben, was nach einem Abkommen vom 5. Februar auch geschah. Doch Polen standen nur wenige Männer zur Verfügung, während alleine 7000 vergleichsweise gut gerüstete Rotarmisten Wilna verteidigten. Und selbst wenn es irgendwie gelänge, die weit hinter den feindlichen Linien gelegene Stadt zu erreichen, wäre keine Verstärkung vorhanden. Piłsudskis Berater, neben Szeptycki auch der General der französischen Militärmission Paul Henrys, hielten den Plan für eine Selbstmordmission wider jede Vernunft. Aber Piłsudski war kein ausgebildeter Stabsoffizier mit langjähriger Erfahrung in einer der kaiserlichen Armeen, sondern ein militärischer Autodidakt und Draufgänger.