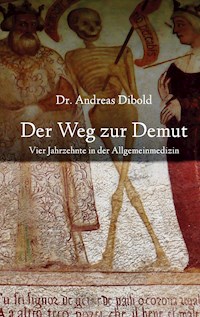
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich bin der Tod mit Zepter und Krone, der Herr des Volkes, der Herr der Throne. Ich lade zum Tanze die Bösen, die Frommen, und sie müssen alle, alle kommen. Wie auf den Inschriften des Totentanzes von Pinzolo zu lesen, der den Einband meines Buches ziert, holt uns der Tod unweigerlich eines Tages ein. Kein Kraut, keine Heilkunst kann ihm jemals gewachsen sein. Oh, glanzvoller Ruhm der Mediziner, doch auch wir sind davor nicht gefeit. In meinem Gewerbe ist die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit das täglich Brot. Der Arzt muss sich eingestehen, keine Allheilmittel zu haben und schon gar nicht über ein Rezept zu verfügen, das für alle gelten kann. Wenn wir das Leben betrachten, sehen wir, dass wir ihm ausgeliefert sind. Wir sind alle nicht perfekt, auch nicht der Arzt. Es ist aber nicht notwendig, daran zugrunde zu gehen. Wir Menschen dürfen uns freuen, wenn wir etwas zustande bringen. Den Rest müssen wir aushalten. Das ist das Geschenk. Aus dieser Perspektive lade ich den Leser ein, sich meine Lebensbetrachtung nach über vierzig Jahren als Landarzt zu Gemüte zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser!
Warum schon wieder ein Arztbuch?
Ein Kollege meines Vaters, der mich schon als kleines Kind zusammengeflickt hat, und bei dem ich eine schöne Zeit als Famulant verbringen durfte, hat beim Begräbnis meines Vaters, nachdem ich ihm schon einiges über mein Dasein in der Praxis erzählt hatte, zu mir gesagt:
“Wenn du kein Buch schreibst, dann komme ich aus dem Grab zu dir und ziehe dich an den Ohren.”
Das hätte ich nicht gut brauchen können. Also habe ich mich ans Werk gemacht. Nicht um Geschichten zu erzählen – diese kommen natürlich auch vor – sondern um meine subjektive Sicht des Werdeganges vom Studenten zum Arzt darzustellen. Es ist ein weiter Weg, sozusagen hin zum Gelehrten und dann wieder zurück zum Lehrling, der nie zu Ende geht, denn was es bedeutet Arzt zu sein ist ein ständiger Lernprozess – nämlich “Der Weg zur Demut”.
Vorangestellt sei auch eine Erklärung zu meiner Ausdrucksweise. Selbst wenn ich von “dem Patienten” spreche, meine ich damit die Frauen auch mit. Sie werden dadurch, wie mir der Schnabel gewachsen ist, nicht ausgegrenzt!
Andreas Dibold
INHALT
Danksagung
Kurzbiografie
1 Das Ende meiner Unterlagen
L
ERNEN UND
W
ACHSEN
2 Halte aus und werde hart
3 Im Galopp durchs Studium
4 Mit Wissen abgefüllt ins Krankenhaus
A
UFFAHRUNFALL MIT DER
W
IRKLICHKEIT
5 Politik und Krankenhaus
6 Der Tod
T
HEORIE OFF,
P
RAXIS ON
7 Start in meiner Praxis
8 Die Endlichkeit ist Grundpfeiler in meinem Gewerbe
9 Runterkommen vom hohen Ross
H
UMANMEDIZIN
10 Jeder Patient ist einzigartig
11 Sinnvoll sind die Sinne
12 Der Kreis des Lebens
13 Wir wollen alle möglichst lange leben
M
ITEINANDER
,
GEGENEINANDER
,
FÜREINANDER
14 Die Mehrheit ist der Unsinn
15 Collegialität wird falsch geschrieben
16 Teamwork in der Notfallmedizin
D
IE
G
RAUEN UNSERES
Z
EITALTERS
17 Wellness soll nicht weh tun
18 “Rettet diesen Planeten, er ist der einzige auf dem es Bier gibt!”
19 Ein Gefangener des Telefons
20 Der Teufelskreis im Überfluss
21 Burnout – eine moderne Groteske
W
IR SIND KEINE
H
EILIGEN
22 Wir sind keine Heiligen
23 Wie die Italiener in den Restaurants den Fuß vom Gas nehmen
24 Meine drei Medikamente
25 Klinke dich wieder ein
26 Nicht der Weg, das “Wie” ist das Ziel
E
RZÄHL MIR VON DEINEN
W
ANDERUNGEN
27 Mein Vater der “praktische” Arzt
Konklusion
FÜR CHRISTINE
DANKSAGUNG
Mein Werdegang zum Arzt ist geprägt von der Hilfe meiner Gattin Christine, die mich durch alle Höhen und Tiefen in Liebe begleitet hat. Schon zu Studienzeiten war sie meine Stütze und der Ansporn mein Studium raschest möglich zu absolvieren. Immer für mich und für die Familie da, ist und war sie der Rückhalt unseres gemeinsamen Lebens, seit nunmehr 46 Jahren.
Ein Dank auch meinen Kindern, die es mit mir als Sturschädel1 nicht immer leicht gehabt haben.
Dank meinen Eltern, die mir diese Ausbildung ermöglichten.
Viele Kollegen haben mich in der Krankenhausausbildung geprägt und mir vieles auf meinem Weg mitgegeben. Namen zu nennen möchte ich vermeiden: mein Herz hat niemanden vergessen, die Worte würden es vielleicht.
Dank meinen Ausbildnern und Kameraden im Bergrettungsdienst, die mich gelehrt haben, wie Zusammengehörigkeit und Kameradschaft funktionieren. Ein aufrichtiges Danke auch an alle Mitarbeiter der Rettungsorganisationen, der Exekutive und der Feuerwehr. Wir haben viel gelitten miteinander.
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle meinen Patienten, die mir das Vertrauen geschenkt haben und mir den Weg zur Demut zu suchen gelehrt haben. Ohne Euch wäre ich diesen Werdegang zu gehen nicht in der Lage gewesen.
Möge uns das Schicksal die Gnade geben noch viel Zeit auf diesem schönen Planeten als Menschen verbringen zu dürfen. Ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft.
1 der österreichische Dickkopf
KURZBIOGRAFIE
1948 Am 6. Dezember in Linz geboren
1967 Matura Akademisches Gymnasium Linz
1967 Oktober bis 1968 Oktober
Präsenzdienst mit Verlängerung der Wehrpflicht wegen des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes in der CSSR
1968 Beginn Medizinstudium in Wien
1974 April Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde
1974 Mai Hochzeit mit Christine
1977 bis Oktober Krankenhausausbildung
1977 Oktober Eröffnung der Praxis für Allgemeinmedizin in Luftenberg an der Donau. Tätigkeiten als Notarzt und bei der Flugrettung im Rahmen der Tätigkeit beim österreichischen Bergrettungsdienst.
2018 Dezember Ende der Praxis wegen Erreichen des 70. Lebensjahres
1 Das Ende meiner Unterlagen
Ich habe jetzt, als ich aufgehört habe, alles was älter war, alle Aufzeichnungen von vor dem Computerzeitalter, entsorgen müssen. Das waren 620 kg. Ich habe mir alles aufgehoben, alle Krankengeschichten. Meine Nachfolger sagten, sie bräuchten sie nicht. Mit Recht, denn die kennen die Patienten ja auch nicht, zumindest nicht in dieser Weise.
Das ordnungsgemäße Entsorgen ist gar nicht so einfach. Man kann es ja nicht einfach in den Müll werfen, denn das sind schließlich lauter personenbezogene Daten. Es gibt dafür eigene Aktenvernichtungsfirmen. Ich hab’ halt alle Ordner selbst weggetan, weil das hätte noch mehr gekostet, doch es waren trotzdem insgesamt fünf Container. 620 kg, wenn man es genau nimmt! Ich tat das schweren Herzens, weil man sozusagen sein Lebenswerk wegwirft. Natürlich behalte ich einiges im Kopf, doch das Schriftliche ging fort.
Es hätte ohnehin niemand etwas damit anfangen können, denn meine “Sauklaue”2 hab’ ja sowieso nur ich lesen können. Einmal – als noch alles handschriftlich war – wurde ich wegen einer Körperverletzung als Zeuge vor Gericht geladen und der Richter konnte meine Karteikarte überhaupt nicht entziffern. Schon damals habe ich geantwortet, dass es ja reiche, wenn ich sie lesen könne. Gott sei Dank hatte ich mir bereits angewöhnt, die Verletzungen meiner Patienten auch zu fotografieren.
Ab 2004 ist sowieso alles digitalisiert worden. Und dann …
Dann kommt doch dann und wann noch ein Anruf meiner Nachfolgerin: “Weißt du noch was vom Herrn Y.?”
Nur ein Beispiel, eine junge Dame hat eine angeborene Anomalie im Bereich des Gehirns, die im Computer-Tomogramm aussieht wie eine Hirnblutung. Sie wird in Spanien bei einem Autounfall verletzt, kommt bewusstlos in die Krankenhausaufnahme und als sie wieder zu Bewusstsein kommt, befindet sie sich schon auf dem Weg in den Operationssaal. Sie ruft aufgeregt,
“¡No, no, no! Das sieht bei mir immer so aus!”
Sie war Spanisch-Studentin und konnte sich wenigstens gut mitteilen. Sie sagt dem Arzt, er solle bei mir anrufen. Der Doktor antwortet, sein Deutsch beschränke sich auf ‘Prost’ und ‘Dankeschön’”, also kommt um eins in der Früh der Anruf von ihr selbst:
“Haben Sie den CT-Befund von damals noch?”
Ich hätte da in Spanien einen Kollegen, der ihr jetzt unbedingt den Kopf aufschneiden will. Daraufhin hab’ ich den Befund irgendwo in die Gegend von Alicante hingefaxt und wie ihn der Doktor liest, sagt er, “ist in Ordnung, Sie können heimgehen. Nichts für ungut.”
Das ist etwas, auf das man erst mit den Jahren draufkommt – dass jeder ein absolut einzigartiges Wesen ist.
Man wird auf der Hochschule unheimlich gescheit und im Krankenhaus wird man noch gescheiter. Der Medizinstudent muss fast so reinwachsen in das ganze Ding. Und dann steht man auf einmal vor Dingen, die man nie gelernt hat.
Ein Arzt sagte mir: “Ich bin Doktor der Medizin, in der Schule war ich immer der Erste. Als ich meine Praxis aufmachte war ich mir ganz gewiss, zum besten Arzt [im ganzen Land] zu werden. Doch keiner der Patienten, die zu mir kamen, war so, wie ich es im Lehrbuch gelesen hatte. Wenn ich meine Medizin nicht noch einmal ganz von neuem erfinde, habe ich nichts, womit ich meinen Patienten helfen könnte.” So ist das Leben. Wenn ein [Mönch] sich darauf verlässt, dass seine [Erleuchtung] von gestern auch heute noch Gültigkeit hat, dann macht er sich große Illusionen.
Jeder einzelne Augenblick ist der erste in deinem Leben, jeder einzelne Augenblick ist der letzte in deinem Leben. Die Wahrheit ändert sich in jedem Moment, und gleichzeitig ist die Wahrheit das ewige Leben.
–Kodo Sawaki
Es ist jetzt gut, dass die jungen Ärzte ein halbes Jahr raus in die Praxis müssen, doch in diesem halben Jahr wird man nur beschränkte Mengen in sich aufnehmen können. Man wird sehen wie die Dinge funktionieren – trotzdem fällt wahrscheinlich alles immer auf den Lehrpraxisleiter zurück. Das Wichtigste ist, für sich freizulegen, dass man selber Mensch bleibt und den Menschen, den man behandelt, versteht – nicht als Professor, sondern als Mensch. Selbst der chronischte “Wartezimmerlauscher”, den man vielleicht schon in eine Schublade gesteckt hat, weil er sowieso meistens aus gesellschaftlichen Gründen zum Arzt in der Gemeinde kommt, kann auf einmal wirklich krank sein. Man muss jeden Patienten einzeln kennenlernen und dann jeden einzelnen Patienten immer wieder aufs Neue.
Das ist auch die Diskrepanz zwischen Krankenhaus und Niederlassung. Man bekommt eine ganz andere Bindung zu den Patienten. Das ist am Land noch viel stärker als in der Stadt. Ich hab’ das Glück gehabt, meine Pappenheimer 41 Jahre lang kennenlernen zu dürfen – und trotzdem kenne ich sie immer noch nicht. Es ist eine Dynamik.
Und am Ende ereilt uns alle das gleiche Schicksal.
In meinem Gewerbe ist die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit das täglich Brot. Der Arzt muss sich eingestehen, keine Allheilmittel zu haben und schon gar nicht über ein Rezept zu verfügen, das für alle gelten kann. Die Versuchung ist natürlich groß, sich aus Bequemlichkeit ein bisschen drüber zu stellen und alles mit einem Nimbus zu beurteilen. Oh, glanzvoller Ruhm der Mediziner! Man kann sich auf diese Weise das Unbekannte und Neue vom Leib halten und muss sich seine eigene Machtlosigkeit nicht eingestehen. Natürlich passiert es auch, dass der Patient den Arzt darin bestärkt und zu ihm aufsieht und irgendein unfehlbares Wissen bei ihm vermutet, aber es sollte umgekehrt sein. Der Arzt sollte zum Patienten aufsehen. Keiner kennt ihn besser als er selbst.
Wir wissen letztendlich alle nicht genau, wie der menschliche Körper reagieren wird und was wir genau brauchen. Nur mit Erfahrung und in Zusammenarbeit der verschiedenen Elemente kann man in der Medizin manchmal zu schönen, wenn auch immer kurzfristigen Erfolgen gelangen.
Wenn wir das Leben betrachten, sehen wir, dass wir ihm ausgeliefert sind. Wir sind alle nicht perfekt, auch nicht der Arzt. Es ist aber nicht unbedingt notwendig, daran zugrunde zu gehen. Wir Menschen dürfen uns freuen, wenn wir etwas zustande bringen. Den Rest müssen wir aushalten. Das ist das Geschenk. Aus dieser Perspektive lade ich den Leser ein, sich meine Lebensbetrachtung zu Gemüte zu führen.
2 unleserliche Handschrift
LERNEN UND WACHSEN
2. Halte aus und werde hart
Geboren wurde ich als viertes Kind meiner Mutter und meines Vaters, welcher erst im November 1947 aus russischer Gefangenschaft mit nur knapp 40 kg Gewicht nach Hause gekommen war. Mein Vater agierte bereits im Krieg als Arzt, was später mein Leben stark beeinflussen sollte. Meine Mutter war zu dieser Zeit Krankenschwester und musste Jahre in Ungewissheit über das Schicksal des Vaters mit meinen Geschwistern verbringen. Man konnte nicht ahnen, ob er zurückkommen würde. Seine Schriften über diese unbeschreiblich schwierige Zeit3 wurden recht bekannt und auf Englisch und Französisch übersetzt.
In der Nachkriegszeit war meine Kindheit wild und schön und nach der Volksschule kam dann endlich der Tag an dem ich ins Gymnasium durfte. Es war gleich die erste Erfahrung mit jenen akademisch gebildeten Sadisten, die mein frühes Leben prägen sollten. Sie fühlten sich vorgeblich als Pädagogen, verstanden diesen Begriff aber trotz oder gerade wegen ihrer klassischen altphilologischen Prägung niemals in der Tiefe. Nur als Beispiel, die erste Lateinstunde: Der Herr Professor betritt wortlos die Klasse. Nach einem kurz gebrüllten “Setzen!” schreibt er an die Tafel: Vitupero. Dann zeigt er erstmals sein Gesicht und zischt:
“Das heißt ‘Ich tadle’ und das werde ich die nächsten Jahre tun.”
Er hatte seinen Spitznamen an die Tafel geschrieben und über die Jahre wirklich Wort gehalten. Die unterdrückerisch erbarmungslose, beständig psychisch gewalttätige und autoritäre Form der Ausbildung könnte man sich heute nur mehr schwer vorstellen. Die Auswüchse der sogenannten Nachkriegspädagogen waren mitunter fürchterlich. Ohne wahre pädagogische Ausbildung agierten sie als reine Wissensvermittler, die glaubten, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Der Schüler hatte das zu schlucken, Punkt aus und Basta. Es ging um reines Macht ausüben.
Unser Englischprofessor in dieser Zeit hat uns Grammatik und Lautschrift beigebracht – geredet haben wir dabei kein Wort. Danach haben wir zwar einen lieben älteren Herren bekommen; bei dem haben wir aber auch ausschließlich nur übersetzt: Shakespeares “Sommernachtstraum”, “Tom Sawyer” und alle möglichen Dinge, ohne jemals zu reden! Dafür konnten mir zuverlässigerweise meine zehn Jahre älteren Brüder je nach Jahreszeit mitteilen, was zur Schularbeit kommen würde, weil aus Bequemlichkeit einfach immer die gleichen kamen.
Außerhalb der Schule war der Zugang der Erwachsenen zu den Kindern noch vielfach ein ganz anderer. Kriegsheimkehrer etwa haben uns Kindern erklärt, welche der Fabrikate der Handgranaten, die man aus der Rodl4 rauftauchen konnte, gefahrlos verwendet werden konnten und welche nicht. Gar kein Gerede von wegen “ja nicht angreifen!” Wir haben die tatsächlich dann zum Fischen verwendet. Oberhalb von Bäckerwinkel haben wir sie reingeschmissen und unterhalb haben wir die Fische rausgeholt; dann sind wir mit der ganzen Bladern5 in einen Steinbruch bei Eschelberg marschiert, mit dem Roller oder mit dem Radel hingefahren und haben uns dort auf einem improvisierten Grill die Fische gebraten und gegessen.
Aber auch die Jahre der Antipädagogik im Gymnasium überstand ich und am Schluss hatten wir nur neunzehn aus 120 “Überlebenden” im Jahr 1967 das begehrte Zeugnis in der Hand. Es gab zur Ehrenrettung der Professoren einige Wenige, die uns nicht nur mit Wissen vollpumpten, sondern uns auch Manches für das Leben mitgeben wollten. Trotzdem konnte ich mir damals alles in allem gar nicht vorstellen, dass jetzt noch Schlimmeres nachfolgen könne.
Welch ein Irrtum – Im Herbst begann die Militärzeit. Ich hatte mich für ein Jahr freiwillig gemeldet. Es sollte ein Jahr werden, in dem ich mein Gehirn gar nicht mehr gebrauchen durfte. Es dachte stets immer einer für mich, dem auch seinerseits wieder einer das Denken abgenommen hatte. Sowas nennt man dann Befehlskette. Es war zwar nicht nur schlecht nach dem zwanghaften Lernen der Schule eine Auszeit zu bekommen, in blind akzeptierten Hierarchien sollte ich aber auch später nie meine Heimat finden.
Da wir durch das politische Geschehen – Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der ČSSR – nicht rechtzeitig abrüsten durften, mussten wir noch als Soldaten immatrikulieren und inskribieren, was zu einem organisatorischen und finanziellen Vorteil für mich wurde. In der 1968 noch nicht ausgestandenen sogenannten Tschechenkrise, sagte mein Kompaniekommandant zu mir,
“Ihr Vater ist Arzt, also studieren Sie Medizin. Da kriegen Sie eine Woche frei.”
Ich entgegnete, “Ich will aber nicht Medizin, ich will Wetterkunde und Geophysik studieren!”
Darauf er, “Na, dafür reichen aber zwei Tage!”
Er hatte den Unterschied anscheinend nicht verstanden und dachte, je komplizierter das Studium, desto komplizierter die Einschreiberei. Eine Woche frei? Der Entschluss wurde so relativ einfach mich auf der medizinischen Fakultät zu immatrikulieren. Ich hab’ in die ursprünglich gewünschten Sachen zwar ein bisschen reingeschnuppert, aber es ist vom Umfang einfach viel zu viel geworden. Ich bin bei der Medizin geblieben und bin relativ rasch vorangekommen. Die Strecke war vorgegeben.
Nach den Jahren der Schinderei hatte ich das Zitat des römischen Dichters Ovid verstanden:
Perfer et obdura, multo graviora tullisti.
Halte aus und werde hart, viel schlimmeres hast du erlitten.
–Tristae (Original eigentlich in der Odyssee)
Wie bei Odysseus wurde der Buckel hart. Je dreckiger der Schlamm durch den du dich kämpfen musst, umso mehr hast du gelernt. Das ist eine gute Schule des Lebens. Odysseus, der verzweifelte, weil er nicht und nicht heimgekommen ist, dem aber eine göttliche Stimme riet, durchzuhalten, hatte verstanden, dass er mit jedem Problem, das auf seinen Wegen lag, höher schreiten würde.
Man muss zusehen, aus seinen Möglichkeiten das Beste zu machen und irgendwie seine eigene Art finden, um aus Schwierigkeiten lernen zu können. So werden die Lektionen zu deinem Treibstoff und du kannst dich stärken. Ich wurde langsam bereit aus dem ständigen sich Aufreiben eine wunderbare Zeit gewinnen zu können.
3 Hans Dibold: Arzt in Stalingrad, Passion einer Gefangenschaft
4 Fluss im Mühlviertel in Oberösterreich, nördlich der Donau
5 in diesem Fall umgangssprachlich für eine Gruppe von Gleichaltrigen
3 Im Galopp durchs Studium
Im Gegensatz zu den Absichten meiner sadistischen Lehrer, fiel meine Prägung allgemein humanistisch aus. Dies ist vor allem meinem Vater zu verdanken, mit dem ich als Schüler und später als Student tiefgehende Gespräche über die ganze Problematik des Arztseins geführt habe. Zur Anschauung dieser Prägung dient im Folgenden der Osterspaziergang in Goethes Faust. Ein alter Bauer lobt ihn da, genau wie ihn andere Bürger verehren, doch Doktor Faust schließt, dass alle wissenschaftlichen Anstrengungen nicht zu der Erkenntnis geführt hatten, die er brauchte:
Alter Bauer:
Herr Doktor, das ist schön von Euch,
Daß Ihr uns heute nicht verschmäht,
Und unter dieses Volksgedräng,
Als ein so Hochgelährter, geht.
So nehmet auch den schönsten Krug,
Den wir mit frischem Trunk gefüllt,
Ich bring ihn zu und wünsche laut,
Daß er nicht nur den Durst Euch stillt:
Die Zahl der Tropfen, die er hegt,
Sei Euren Tagen zugelegt.
Faust:
Ich nehme den Erquickungstrank
Erwidr' euch allen Heil und Dank.
Alter Bauer:
Fürwahr, es ist sehr wohl getan,
Daß Ihr am frohen Tag erscheint;
Habt Ihr es vormals doch mit uns
An bösen Tagen gut gemeint!
Gar mancher steht lebendig hier
Den Euer Vater noch zuletzt
Der heißen Fieberwut entriß,
Als er der Seuche Ziel gesetzt.
Auch damals Ihr, ein junger Mann,
Ihr gingt in jedes Krankenhaus,
Gar manche Leiche trug man fort,
Ihr aber kamt gesund heraus,
Bestandet manche harte Proben;
Dem Helfer half der Helfer droben.
Alle:
Gesundheit dem bewährten Mann,
Daß er noch lange helfen kann!
Faust:
Vor jenem droben steht gebückt,
Der helfen lehrt und Hülfe schickt.
Wagner (Fausts Famulus):
Welch ein Gefühl mußt du, o großer Mann,
Bei der Verehrung dieser Menge haben!
O glücklich, wer von seinen Gaben
Solch einen Vorteil ziehen kann!
Der Vater zeigt dich seinem Knaben,
Ein jeder fragt und drängt und eilt,
Die Fiedel stockt, der Tänzer weilt.
Du gehst, in Reihen stehen sie,
Die Mützen fliegen in die Höh;
Und wenig fehlt, so beugten sich die Knie,
Als käm das Venerabile.
Faust:
Nur wenig Schritte noch hinauf zu jenem Stein,
Hier wollen wir von unsrer Wandrung rasten.
Hier saß ich oft gedankenvoll allein
Und quälte mich mit Beten und mit Fasten.
An Hoffnung reich, im Glauben fest,
Mit Tränen, Seufzen, Händeringen
Dacht ich das Ende jener Pest
Vom Herrn des Himmels zu erzwingen.
Der Menge Beifall tönt mir nun wie Hohn.
O könntest du in meinem Innern lesen,
Wie wenig Vater und Sohn
Solch eines Ruhmes wert gewesen!
Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
Der über die Natur und ihre heil'gen Kreise
In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
Mit grillenhafter Mühe sann;
Der, in Gesellschaft von Adepten,
Sich in die schwarze Küche schloß,
Und, nach unendlichen Rezepten,
Das Widrige zusammengoß.
Da ward ein roter Leu, ein kühner Freier,
Im lauen Bad der Lilie vermählt,
Und beide dann mit offnem Flammenfeuer
Aus einem Brautgemach ins andere gequält.
Erschien darauf mit bunten Farben
Die junge Königin im Glas,
Hier war die Arzenei, die Patienten starben,
Und niemand fragte: wer genas?
So haben wir mit höllischen Latwergen
In diesen Tälern, diesen Bergen
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben:
Sie welkten hin, ich muß erleben,
Daß man die frechen Mörder lobt.
Diese Thematik – nämlich die des Arztes, der glaubt auch Herr über die Krankheit werden zu können, sich erheben zu können über Leben und Tod, obwohl er letzten Endes ohne es zu wollen manchmal sogar mehr Schaden anrichtet als zu heilen – entbrennt in der Person von Faust. Er zerbricht daran, nicht perfekt werden zu können und fühlt sich zu unrecht gelobt. Faust sieht nur sein Versagen. Der Tod rafft alle nieder. Auch als Fausts Famulus Wagner berühmterweise zu ihm sagt,
Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.
weiß Faust, dass dieses Anliegen vergeblich sein würde. Wagner würde sich lediglich in dieselbe hoffnungslose Situation wie ihn selbst manövrieren.
So ist das im Wesentlichen auch mit unserer Arbeit. Sie hilft dem Menschen zwar, aber im Endeffekt gibt es keine endgültige Ausflucht. Am Ende steht immer der Tod. Das ist der wesentliche Irrglaube: mit Wissen über allem stehen zu können. Mephisto ergreift zu Lebzeiten die Herrschaft über Faust mit diesem gefährlichen Trugbild.
Jene Gespräche mit meinem Vater fanden während der Schulzeit und auch während der Studienzeit statt. Wir waren immer im Herbst in Südtirol, sind viel auf die Berge gegangen und haben da die einzigen Male über die Problematik des Arztseins gesprochen: dass der Mensch, jeder Mensch, immer ein Lernender sein sollte. Es gibt kein Ende, keinen Endpunkt in dieser Sache, sondern wir bleiben im Gesamten stets in einem ständigen Lernprozess. Kurz bevor er verstarb, war
Du musst arbeiten, arbeiten, arbeiten.
das Letzte, was er auf einem Zettel notierte.
Mein Vater hat mir jedoch immer freie Wahl gelassen. Arzt bin ich, wie schon erwähnt, Dank an das Bundesheer geworden. Was tut ein Soldat nicht alles, damit er ein paar Tage frei bekommt?
Heiter war auch das Immatrikulieren selbst. Wir mussten zwar in Uniform antreten, haben dort aber lauter eigene Schalter bekommen, waren überall auf der Überholspur, während alle anderen in langen Schlangen gewartet haben. Das Lustigste dabei war das militärärztliche Gesundheitszeugnis. Geschrieben hat es der Sanitärunteroffizier und es wurde aufgrund seiner kreativen Rechtschreibung in der gesamten Quästur herumgereicht. Auf uraltem braunen Papier stand da feierlich geschrieben,
Diehnt zua Vorlage
bei da UNIFERSITÄT Wien
Aber er war ein recht guter Pistolenschütze.
Es war richtig erfrischend, nach der Militärzeit endlich wieder das Hirn benutzen zu dürfen. Die erste Hälfte als Gebirgsjäger in Klagenfurt war – weil wir viel draußen waren – ja noch erträglich, aber die sogenannte Einsatzeinheit in Ried im Innkreis später, die war fürchterlich. Das war eine lupenreine Trinkerausbildung. Damals gab es noch kein Alkoholverbot während der Dienstzeit und in der Kantine sind bereits zur Vormittagspause 60 gefüllte Halbegläser6 gestanden. Das war das Einzige, wo meine Leute freiwillig gerannt sind. Wenn du schnell warst, hast du mehr erwischt. Ansonsten haben wir nur daran gedacht, unsere Zeit einfach irgendwie nur herunterzubiegen, ohne jeden Sinn und Zweck.
Die Hinwendung zur Medizin vollzog sich als Prozess. In der Schulzeit hatte mein Interesse noch vornehmlich der Mathematik gegolten, da wir von einem sehr guten Mathe- und Physiklehrer unterrichtet wurden. Einmal habe ich zufällig in der Linzer Studienbibliothek ein Lehrbuch der Geophysik entdeckte, das ich mir dann auslieh. Das schien eine noch spannendere Geschichte zu sein. In Kombination mit der Wetterkunde hab’ ich mir im Studium einige Vorlesungen angehört. Dass man aber beides mit der Medizin verbindet, ist sich zeitmäßig einfach nicht ausgegangen und weil es mit der Medizin relativ flott voran gegangen ist, bin ich einfach dabei geblieben.
Es sind keine Zweifel aufgekommen. Es war zwar ein Irrsinnsstoff zum Lernen, aber um das Lernen an sich zu lernen wurde ich ja die ganzen Jahre über erzogen! Ähnlich wie eine große Rolle im Theater – wie der Faust –, war ich es bereits gewohnt große Mengen zu lernen. Hier zeigt sich eine gewisse Dankbarkeit an meine frühen Schinder.
Erst beim Riesenstoff Pathologie hab’ ich gewusst, jetzt muss ich mich sozusagen in die wissenschaftliche Einsiedelei zurückziehen, weil sonst derlerne7 ich das nie. Das Buch, das wir damals hatten, war auf Englisch und hatte 7000 Seiten. Fünf Monate habe ich meine Bude nicht mehr verlassen. Und das Buch war ja auch nicht alles, es sind noch andere Sachen dazu gekommen! Nach fünfeinhalb Monaten war es dann endlich soweit und ich meldete mich zur Prüfung an.
Zusätzlich kam noch dazu, dass man mir einen eitrigen Zahn herausoperiert hatte. Der ganze Kieferknochen war entzündet, Antibiotika wurden geschluckt und an Lernen war nicht mehr zu denken. Ich hab’ außer Schmerzmitteln nichts runtergebracht (Bier nebenbei, aber das war schon notwendig). Ich bin dann um Ostern, weil mein Vater in Mallnitz auf Skiurlaub war, zu ihm gefahren, hab’ mein Pathologie-Buch mitgehabt und bin am Vormittag skigefahren. Am Nachmittag hat es mir so draufgebrannt, dass es weh tat, und so bin ich im Fremdenzimmer gesessen und habe ein bisserl was gelernt. Im Gegensatz zu den anderen bin ich braun gebrannt zur Prüfung angetreten. Alle waren kasweiß8 vor lauter Strebern.
Die Prüfung ging dann ruckzuck, weil ein anderer als der gefürchtete Professor uns in der Pathohistologie, der Gewebelehre, prüfte. Er sagte uns leise ein, aber es war auch teilweise was Falsches dabei und so gab ich genauso leise zurück,
“Herr Professor, das ist aber sicher nicht die Bindegewebezelle, die sie jetzt gesagt haben.”
Schaut er mich an. Schaut er nochmal rein. Und flüstert schnell,
“Sag’ das aber ja nicht weiter!”
Es war eine spezielle, die sogenannte Kupffersche Sternzelle, die er mir da eingestellt hat. Ich war lang als Praktikant auf der Histologie und kannte mich ganz gut aus. Ich habe ja hunderte Leberpräparate am histologischen Institut untersucht und eingefärbt. So durfte ich bei der schwierigsten Prüfung den Professor korrigieren! Eine schöne kleine Freude.
Mir fiel das Lernen auch sonst leichter als anderen. Es ging schon im Kapitel 1 los: “Inflammation and Repair”9: das spielt sich immer nach dem gleichen Motto ab, die Basis im Bindegewebe ist immer dieselbe, nur das Organ ist anders. Diese Zusammenhänge zu erkennen erleichterte mir das Studium. Es hat oft schnell gefunkt, während andere ein und denselben Stoff immer wieder von Neuem lernen mussten.





























