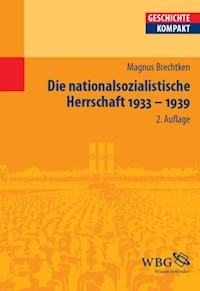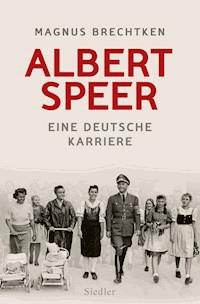2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus der Geschichte lernen: Was sie uns für unsere Zukunft lehrt!
Einer der führenden deutschen Historiker öffnet uns die Augen: In seiner fulminanten Tour durch die Geschichte zeigt Bestsellerautor Magnus Brechtken an vielen Beispielen, wie Freiheit und Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Teilhabe erkämpft wurden - und warum diese Errungenschaften, die wir oft allzu selbstverständlich nehmen, heute auf dem Spiel stehen, durch Verschwörungstheorien, Nationalisten und Populisten von rechts wie links. Dabei zeigt sich, dass wir die Zukunft nur gestalten können, wenn wir die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
MAGNUS BRECHTKEN
DER WERT DER
GESCHICHTE
ZEHN LEKTIONEN
FÜR DIE GEGENWART
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Siedler Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Suffragetten in Gefängniskleidung nach ihrer Freilassung, 1908 © Museum of London/Heritage Images/Getty Images
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
Karten und Grafiken: Peter Palm, Berlin
Reproduktion: Lorenz & Lechner, Inning, a. A.
ISBN 978-3-641-25430-8V003
www.siedler-verlag.de
Für Zenkers Mia,
eine von Natur vernünftige Frau
Inhalt
Mut zur Geschichte!
Was ist der Mensch?
Göttergeschichten:
Religion
Das Bild der Frau:
Geschlechterverhältnisse
Die Stimme finden:
Politik und Partizipation
Wir und die anderen:
Nationalismus
Ordnung der Macht:
Krieg und Frieden
Das Ringen um den fairen Markt:
Wirtschaft und Gesellschaft
Zehn Lektionen für die Gegenwart
Dank
Anmerkungen
Literatur
Mut zur Geschichte!
Wer im Jahr 2020 mit entzündetem Blinddarm zum Arzt geht, darf erwarten, dass dieser sein neuestes, in Jahren erprobtes Wissen anwendet, die korrekte Diagnose stellt und einen Termin in der Chirurgie arrangiert. Dort wird die diensthabende Chirurgin den Befund prüfen und höchstwahrscheinlich den Eingriff vornehmen. Der Patient wird mit getesteten Medikamenten versorgt und kann nach einigen Tagen das Krankenhaus verlassen. Wenn er sich dort per Smartphone ein Taxi ruft, erwartet er ohne Zögern, dass dessen Bremsen funktionieren und andere Autofahrer sich an die Verkehrsregeln halten.
Er geht davon aus, dass er beim Passieren der Stadtteilgrenzen keinen Zoll entrichten muss und die Brücke, die er überquert, von Ingenieuren so berechnet ist, dass sie beim Befahren nicht einstürzt. Zu Hause angekommen, wird er annehmen, dass seine über Tage ungenutzte Wohnung noch immer ihm gehört und nicht von anderen Menschen bevölkert ist. Er mag sich dann im Kühlschrank mit Lebensmitteln bedienen, die noch immer bedenkenlos essbar sind und sich in ein frisch bezogenes, sauberes Bett legen, das – frei von Krabbeltieren – ihm allein zur Ruhe dient.
All dies ist heute so selbstverständlich, dass wir über die zugrundeliegenden Prinzipien kaum nachdenken: etwa, dass der Arzt eine Diagnose stellt, die auf wissenschaftlichen Analysen und jahrzehntelanger Erfahrung gründet. Wie würde unser Patient reagieren, wenn der Mediziner stattdessen ein Huhn schlachten und in dessen Eingeweiden nach der Erklärung für die Bauchschmerzen fahnden würde? In der Chirurgie eingetroffen, wäre der Patient wohl irritiert, wenn die diensthabende Ärztin, statt in keimfreier Umgebung sorgfältig präparierte Instrumente zu führen, im Jogginganzug ein Küchenmesser aus der Schublade zöge. In Lebensgefahr könnte unser Patient vielleicht noch mit letzter Kraft darüber staunen, dass sich die Pflegekräfte zum Gebet versammeln, statt ihm Antibiotika zu verabreichen.
Uns erscheint diese Szenerie grotesk, weil unsere Erwartungen auf der Erfahrung von rationalen Fakten gründen. Wir können erwarten, dass den Verhaltensweisen erprobte Erkenntnisse und Überlegungen zugrunde liegen, die von allen Beteiligten dem Prinzip nach geteilt werden. Wir können darauf vertrauen, dass all diese Handlungen auf Wissen beruhen, das sich über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte angesammelt hat.
Ein Kühlschrank, ein Operationssaal, ein Smartphone als Produkte des Erfahrungswissens in Physik, Chemie, Elektronik und Informatik – dies können wir im Alltag verstehen. Wir sehen und erleben wie selbstverständlich deren Nutzen und Wirkung. Nennen wir diesen Bereich der Einfachheit halber die harte Welt.
Merkwürdig ist, dass das Lernen aus der Vergangenheit in der harten Welt der Medizin oder des Ingenieurswesens für uns ganz selbstverständlich und alltäglich ist, während wir in der weichen Welt des menschlichen Zusammenlebens – in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – immer wieder feststellen, dass Menschen in Haltungen und Handlungsweisen zurückfallen, die einer Blinddarmoperation mit dem Küchenmesser gleichen.
Dabei gibt es wie beim Smartphone in der harten Welt auch in der weichen Welt einen Fortschritt unseres Wissens und Produkte langer Erfahrung – den Rechtsstaat, die repräsentative Demokratie oder die offene, solidarische Gesellschaft, um nur drei zu nennen. Sie sind nicht so leicht mit den Händen zu greifen. Aber auch sie können wir erkennen und verstehen.
Wenn wir die Geschichte betrachten, steht uns ein riesiger Fundus an Erfahrung und Wissen zur Verfügung. Das gilt zum Beispiel für das Bild vom Menschen, der sich über viele tausend Jahre entwickelt hat. Oder für die Formen seines Zusammenlebens in Familie und Gesellschaft.
Wir können wissen, wie unsere Vorfahren gelebt haben, kennen ihre Essgewohnheiten und ihre Kleidung, ihren Lebensalltag und ihre Weltsicht. Auch für unser Handeln in Politik und Wirtschaft, das Verhältnis der Geschlechter und unsere Erkenntnisse in der Philosophie, unser Verständnis für Literatur, Musik oder die bildenden Künste steht uns das Wissen aus Jahrtausenden zur Verfügung.
Wir können heute wissen, welche Konsequenzen sich aus ideologischen Konstruktionen für das menschliche Zusammenleben ergeben und welche Folgen für unseren Alltag und für die Gesellschaft bestimmte politische oder ökonomische Regeln und Entscheidungen mit sich bringen. Denn wir haben im Rückblick über die Jahrhunderte nahezu alle Varianten menschlichen Handelns vor Augen.
Dabei sind die Entwicklungsstufen in der Geschichte nicht ganz so offensichtlich wie der technische Fortschritt beim Griff zum Smartphone, der Fahrt mit dem Auto oder dem Flug in den Urlaub. Das ist wenig überraschend. Um im Bild zu bleiben: Wer sein Smartphone benutzt, muss nicht alle wissenschaftlichen Formeln der harten Welt kennen, nach denen es funktioniert. Ihm genügt die praktische Anwendung.
In der großen weichen Welt von Politik und Gesellschaft ist die Sache komplizierter. Denn durch unser Handeln verändern wir Menschen diese Welt permanent, ob wir wollen oder nicht. Wir können uns rational verhalten. Doch drängen unsere irrationalen Leidenschaften und Gefühle immer wieder in unser Handeln hinein. Sie zu kontrollieren ist für uns eine ständige Herausforderung. Aber wir können mit ihr umgehen, wenn wir es wollen. Und wir können aus der Geschichte lernen, wie dies möglich ist. Das gilt für jeden Einzelnen. Aber erst recht gilt es für die Gemeinschaft.
Wenn wir die Geschichte betrachten, können wir verstehen, wie sich Rationalität, Aufklärung und Vernunft als Prinzipien des Fortschritts erwiesen haben. Demokratie, Rechtsstaat und Parlamentarismus, Gleichberechtigung der Geschlechter und politische Teilhabe aller Menschen – sie alle sind das Äquivalent technischer Errungenschaften der harten Welt. Die Fortschritte der weichen Welt haben vielen Menschen überhaupt erst ermöglicht, sich als freie Wesen zu erkennen und selbstbestimmt zu handeln. Und nicht zuletzt schaffen sie die Voraussetzung für die Freiheit, die wir heute genießen dürfen.
Wir leben in beiden Welten und müssen uns um beide kümmern. In der harten Welt erscheint uns das selbstverständlich: Die Forschung in Medizin oder Physik schreitet täglich voran. In der weichen Welt dagegen müssen wir feststellen, dass nicht wenige Prinzipien des Fortschritts, die das Fundament unser freiheitlichen Ordnung bilden, immer wieder in Frage gestellt werden.
Das Aufkommen des Populismus, die Wiedergeburt des Nationalismus, der Einfluss des Religiösen auf die Politik und ein offenbar wachsendes Bedürfnis nach autoritärer politischer Führung, sie alle fordern Prinzipien unser freiheitlichen Ordnung massiv heraus – die repräsentative parlamentarische Demokratie, die Freiheitsrechte des Einzelnen, das Prinzip der Gewaltenteilung, die Verständigung auf den rational begründeten Diskurs, die Akzeptanz ethischer Standards im Umgang miteinander und den Respekt gegenüber anderen Menschen, um nur einige zu nennen.
Im weltweiten Vergleich leben die meisten Europäer seit vielen Jahrzehnten auf einer Insel der Freiheit und des materiellen Wohlstands, die historisch beispiellos ist. Wer im Jahr 2020 lebt, kann auf ein Dreivierteljahrhundert ohne Krieg und gewaltsame Konfrontation zwischen Völkern und Staaten zurückblicken. Keiner unserer Vorfahren war jemals in dieser glücklichen Lage. Es gibt historische Gründe, warum das so ist. Und es gibt historische Erkenntnisse, warum diese Errungenschaften bedroht sind.
Derzeit scheint es, als sei das Bewusstsein für die historischen Erfolge von Demokratie und Parlamentarismus, Marktwirtschaft und Sozialstaat, für die offene Gesellschaft oder das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bei vielen Bürgern verblasst. Deshalb sollten bestimmte Werte, Errungenschaften, Begriffe und Regeln immer wieder in Erinnerung gerufen werden, die uns möglicherweise allzu selbstverständlich erscheinen. Und bei vielen Menschen wächst das Gefühl, dass diese Errungenschaften aktiv verteidigt werden müssen.
Dies ist der besondere Wert der Geschichte: dass wir erkennen können, welche Entwicklung der Mensch als selbstständiges Wesen und die Menschheit als Ganzes in den vergangenen 250 Jahren und vor allem in den vergangenen 70 Jahren vollzogen hat – auch als Folge der Aufklärung und des Lerneffekts aus historischer Erfahrung.
Dieser Lerneffekt betrifft alle Lebensbereiche: politisch durch fortschreitende Demokratisierung und Parlamentarisierung; gesellschaftlich durch die Partizipation immer größerer Bevölkerungsgruppen und die Entwicklung des modernen Sozialstaats; wirtschaftlich mit der fortschreitenden Durchsetzung der Marktwirtschaft als Prosperitätsmotor; international mit der Bildung multilateraler Institutionen und dem Rückgang kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen jenen Staaten, die durch Demokratisierung, Parlamentsherrschaft und Rechtsstaatlichkeit geprägt sind; schließlich wissenschaftlich und technisch in nahezu allen Bereichen des Lebens.
An vielen Beispielen werde ich in diesem Buch zeigen, wie sich bestimmte Errungenschaften, Regeln und Werte im Verlauf der Geschichte entwickelt haben, die heute die Grundlagen unserer freiheitlichen Ordnung bilden. Es geht um zentrale Bereiche der weichen Welt: die Frage nach dem Menschenbild, das unseren Vorstellungen zugrunde liegt; den Einfluss von Religionen; die Bedeutung der Geschlechterverhältnisse; den Wert politischer Partizipation; die historische Wirkung von Nationalismus und die Lehren, die wir daraus ziehen können, die wiederum eng verbunden sind mit der Geschichte von Krieg und Frieden und den Grundlagen unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes.
Wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, dann stellen wir fest, wie sich Erkenntnisse, Werte und Prinzipien herausgebildet haben, die uns heute zusammenhalten. Wenn wir wissen, wie sie – trotz aller Rückschläge – erkämpft wurden, können wir ermessen, was heute, wo immer mehr von ihnen bedroht sind, auf dem Spiel steht.
Dieses Buch versammelt Erkenntnisse und Erfahrungen, die für jedermann verfügbar sind. Es richtet sich an jene, die sich alltägliche Fragen zur Gegenwart stellen und dazu historisch informierte Antworten suchen. Es verzichtet auf Fachsprache, soweit das für eine präzise Analyse und Beschreibung möglich ist. Jeder kann die Argumente durch eigene Lektüre und eigenes Denken weiter vertiefen.
Dies ist kein Fachbuch der Geschichtswissenschaft. Es wendet sich an Menschen, die nicht notwendigerweise Geschichte, Politik, Philosophie oder Soziologie studiert haben müssen. Und die dennoch wissen wollen, warum die Erkenntnisse aus all diesen Disziplinen Bedeutung für ihr Leben und ihren Alltag haben können.
Können wir aus der Geschichte lernen? Oft ist zu hören, man lerne aus der Geschichte, dass man aus ihr nichts lernen könne. Dabei ist die Antwort recht einfach: Wir können, wenn überhaupt, nur aus der Geschichte lernen. Etwas anderes ist uns gar nicht verfügbar.
Wir können aus der Fülle wissenschaftlicher Forschungen der zurückliegenden Jahrzehnte viele Erkenntnisse destillieren. Über die Bestandteile eines realistischen Menschenbildes; über die Triebkräfte des Menschen als Individuum und über die verschiedenen Formen von Gesellschaft, die über die Jahrhunderte bereits erprobt wurden.
Die Erinnerung an das Vergangene, die Sammlung verfügbarer Erkenntnisse, die Prüfung historischer Fakten, kurz: unser Erfahrungswissen und das Bewusstsein für die Ressourcen der Geschichte bilden jenes Potential, aus dem unser Verständnis für die Gegenwart möglich ist. Und auch die Orientierung für die Zukunft.
Dieses Buch ist geschrieben als möglichst barrierefreie Zusammenschau, eine historische Perspektive für unsere Gegenwart, die Mut machen soll für die Gestaltung einer humanen, friedlichen und für alle Menschen gleichermaßen lebenswerten Welt. Die Chancen sind uns Menschen gegeben. Ob und wie das gelingt, ist offen. Aber aller Anstrengung wert!
»Wenn wir den Mächten widerstehen wollen, die zu einer Unterdrückung der geistigen und persönlichen Freiheit drängen, müssen wir uns klar vor Augen halten, was auf dem Spiel steht, was wir jener Freiheit verdanken, die unsere Vorfahren unter schweren Kämpfen errungen haben. Ohne jene Freiheit hätte es keinen Shakespeare, keinen Goethe, keinen Newton, keinen Faraday und keinen Pasteur gegeben. Es gäbe keine geräumigen Häuser für die Masse des Volkes, keinen Schutz gegen Epidemien, keine billigen Bücher, keine Bildung und keine Segnungen der Kunst für alle. Keine Maschinen würden den Menschen die grobe Arbeit für die Erzeugung der lebensnotwendigen Dinge abnehmen, die meisten Menschen würden ein Leben dumpfer Sklaverei führen wie ehemals in den großen Despotien Asiens. Denn nur der freie Mensch schafft jene Erfindungen und geistigen Werte, die uns modernen Menschen das Leben lebenswert erscheinen lassen.«
(Albert Einstein, Oktober 1933)1
Was ist der Mensch?
»Die Leute mögen die Idee der Meinungsfreiheit, bis sie etwas hören, was ihnen missfällt.«
(Ricky Gervais, Januar 2020)2
Seit vielen zehntausend Jahren lebt der Mensch auf einem vieltausendfach älteren Planeten. Er kann als einziges Wesen seine Instinkte kontrollieren, Werkzeuge nutzen und mittels Sprache kommunizieren. Seine Fähigkeit zur Selbstreflexion, zum Denken und Lernen markiert den grundsätzlichen Unterschied zur Tierwelt und steht am Anfang dessen, was wir als Menschsein und menschliche Kultur bezeichnen.
Durch DNA-Analysen, Funde von Werkzeugen und Felszeichnungen lässt sich diese Evolution zu einem Bild formen, das uns die Menschheitsgeschichte als einen über die Jahrtausende fortschreitenden Prozess vor Augen führt. In dessen Verlauf entstanden – unter anderem in Babylonien und Ägypten, China und Südamerika, Griechenland und Rom – jene Schöpfungen menschlicher Kultur, die Archäologie, Vor- und Frühgeschichte, Altertumskunde, historische Anthropologie und andere Gebiete der Wissenschaften seit Jahrhunderten erforschen und für uns alle zugänglich machen.
Im Verlauf dieser Geschichte haben Menschen die unterschiedlichsten politischen und ökonomischen Ordnungen erprobt. Auf den ersten Blick mag die Vielfalt historischer Formen menschlichen Zusammenlebens verwirrend erscheinen, aber mit wenigen Fragen lassen sich Muster, die den Modellen zugrunde liegen, erkennen und sortieren. Das wohl wichtigste Kriterium, mit dem sich Gesellschaftsentwürfe der Vergangenheit und der Gegenwart ordnen lassen, ist die Frage nach dem Menschenbild, das darin herrscht.
Wer Politik und Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft, kurzum: die Hintergründe unseres Alltagslebens verstehen will, muss sich zunächst klarmachen, auf welcher Vorstellung vom Menschen jedes Argument, jedes Gespräch, jede Behauptung – ob bewusst oder unbewusst – beruht; jeder Ordnung, jeder Regel, mit der Menschen ihr Zusammenleben zu organisieren suchen, liegt solch eine Vorstellung zugrunde; jedes politische Programm, jede ökonomische Theorie, jede religiöse Formel orientiert sich an einem Menschenbild, das sie für gültig hält und von dem alle weiteren Annahmen und Forderungen abgeleitet werden.
Wenn wir also fragen, was der Mensch »von Natur aus« sei, erkennen wir, vereinfacht, zwei Extrempole, zwischen denen sein Wesen und seine Lebensmöglichkeiten gedacht werden: Auf der einen Seite die Vorstellung, dass er genetisch, historisch, gesellschaftlich oder durch welche Faktoren auch immer festgelegt, also determiniert ist.
Demnach ist der Mensch ein nach vorgegebenen Mustern funktionierendes Lebewesen. Die bestimmenden Muster können dabei unterschiedlichster Art sein: die Gene etwa, die ihn prägen; übersinnliche Vorgaben, die er befolgen muss, weil sie angeblich »von der Natur« oder »den Göttern« vorgegeben sind. Der Mensch hat also keine Wahl, er muss funktionieren, was übertragen auf menschliche Gesellschaften bedeutet: gehorsam folgen – jenen, die behaupten zu wissen, welche »vorgegebenen Bestimmungen« das sind.
Das andere Extrem ist die Vorstellung, der Mensch sei vollkommen frei von Vorprägungen und Regeln. Wie ein weißes Blatt und ohne jede vorbestimmte Eigenschaft komme er in die Welt, sei abgelöst von der biologischen Natur seiner Eltern und Vorfahren. Alles ist möglich und offen ab der Geburt. Entsprechend prägend sind in dieser Vorstellung die Bedeutung von Erziehung und die Einflüsse der Gesellschaft. Sie entscheiden, was der frei formbare Mensch zu werden vermag.
Determiniertheit einerseits, vollständige Offenheit andererseits – alle Menschenbilder bewegen sich zwischen diesen beiden Polen, im englischen Sprachraum als »nurture versus nature«-Debatte bekannt. Tatsächlich ist jederMensch eine Mischung aus genetischen Anlagen seiner Eltern und Vorfahren sowie der Umwelt und Erziehung, die auf ihn einwirken. Zugleich ist jeder Mensch immer ein von Instinkten beeinflusstes und zugleich zur Rationalität fähiges Wesen. Wobei alle Menschen diese Fähigkeiten in je eigener Weise und nach je individueller Lage nutzen. Einen Automatismus der Vernunft gibt es ebenso wenig wie eine vollständige Bestimmtheit durch Instinkte.
Jedes politische Programm, jede Wirtschaftstheorie, jedes Konzept über das Wesen einer Gesellschaft lässt sich zuordnen nach dem Grad der Selbst- oder Fremdbestimmung, die sie dem Menschen zuschreiben. Deshalb müssen wir in allem, was wir politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich diskutieren, stets zunächst die Frage stellen: Welches Menschenbild verbirgt sich hinter dem Argument, das wir gerade hören? Wie verhält es sich zum Wissen um die immerwährende offene Mischung von nurture und nature?
Der Mensch war schon immer überwältigt von der Komplexität der Welt um ihn herum. Naturgewalten und Unglücksfälle, Krankheiten und Tod forderten den menschlichen Verstand heraus. Im Unterschied zu anderen Lebewesen, die allein ihrem Instinkt folgen, kann der Mensch über seine Existenz reflektieren – wir nennen das Bewusstsein – und seinen Verstand nutzen, um sich Erklärungen ausdenken für das, was in der Welt um ihn herum geschieht; diese Neugier und dieses Nach-Erklärungen-Suchen ist geradezu eine anthropologische Grundkonstante.
Zugleich versuchen Menschen von jeher, ihrem Leben einen Sinn zuzuschreiben. Sie mutmaßen (und wünschen sich wohl), mehr zu sein als »nur« besonders hoch entwickelte Lebewesen, die sich von anderen Tieren eigentlich nur in dieser wichtigen Eigenschaft unterschieden: sich ihres Menschseins bewusst sein und denken zu können. Das muss doch einen Grund haben!
Diese Sinnsuche ließ Menschen Motive und Erklärungen ausmalen für all das, was ihnen in der Natur und im Verhalten ihrer Mitmenschen begegnete. Dabei blieb vieles rätselhaft, Ursachen und Gründe von Naturereignissen oder Schicksalsschlägen erschienen unverständlich. Antworten meinten Menschen über die Jahrtausende in der Vorstellung von übersinnlichen, metaphysischen Mächten zu finden: Sie stellten sich Götter vor, die sie mit allen Kräften versahen, die menschliche Phantasie zu denken vermag. So erschuf und imaginierte sich der Mensch einen Platz in der jeweils gedachten Ordnung.
Diese Vorstellungen variierten nach Lebensort und natürlicher Umgebung, Klima und Lebensumständen, Nahrungsmöglichkeiten und Kulturentwicklung. Aber im Kern gleichen sie sich: Alle unverständlichen Ereignisse des menschlichen Lebens – Krankheit, Unfall oder Tod, alle Erscheinungen der Natur und der Umwelt, ob Gewitter oder Sturmflut, Kometenschweif oder Vulkanausbruch – erhalten ihren geordneten Platz.
Im Zweifel sind es »Götter«, die als Schlüssel und Bezugspunkt für die eigene Welterklärung vorgestellt werden. Entsprechend können wir vereinfacht sagen, dass Menschen sich auf diesem Weg der Phantasie und der Imagination von Erklärungen für ihre Existenz und ihr persönliches Schicksal über viele Jahrtausende als Teil einer Ordnung verstanden, die sie stets selbst entwarfen.
Auf die Menschenbilder der zahllosen Religionen kann hier nur hingewiesen werden. So unterschiedlich die Religionen und die mit ihnen verbundenen Menschenbilder sein mögen, ihnen gemeinsam ist die Vorstellung, dass der Mensch einer außerweltlichen Instanz unterworfen ist, die seine Freiheit einschränkt. Er ist ein Geschöpf imaginierter Götter oder jedenfalls Objekt ihrer Macht und muss sich deren Anweisungen entsprechend verhalten, die ihm – immer von anderen Menschen – als »Regeln der Götter« präsentiert werden.
Die für die europäische Geschichte bis ins 20. Jahrhundert bekanntesten Menschenbilder liefern die Erzählungen der Bibel. Bis in die Gegenwart hören wir die Formulierung vom »alten Adam«, der sich nicht verändert habe. In dieser Vorstellung bleibt der Mensch auch nach Jahrtausenden unterschiedlichster Zivilisationsprozesse vor allem von seinen Trieben und Begierden, Instinkten und irrationalen Wünschen bestimmt.
Die biblischen Geschichten führen den Gläubigen die Verlockungen, Ängste und Sehnsüchte vor Augen, denen der Mensch ausgesetzt ist, und präsentieren Lebens- und Verhaltensregeln, die es zu befolgen gelte. Ähnliche Symbole und Schriften gibt es in anderen Religionen – im Islam den Koran, im Buddhismus die Texte des Pali-Kanons oder Tripitakain. Im Hinduismus wiederum finden sich zahlreiche Glaubensvorstellungen und eine Vielzahl von Gottheiten in bunter Vielfalt unterschiedlichster Traditionen und Lehren verbunden, aus denen sich Verhaltensregeln für Menschen ableiten.
Dass es in allen Religionen, Traditionen und Texten stets Menschen sind, welche die Regeln der imaginierten Götter mitteilen, hat deren Autorität nicht geschmälert, und die Phantasie beim Götterausdenken und Anweisungenformulieren blieb unerschöpflich. So spiegeln Religionen und Göttervorstellungen das über Jahrtausende laufende Nachsinnen des Menschen über sein Wesen und die Suche nach Regeln, Ordnung und Struktur. Sie sollen dem immerwährenden Zwiespalt zwischen seinen naturhaften, potentiell gewaltvollen Instinkten einerseits und einem der Gemeinschaft zuträglichen, »zivilisierten« Verhalten andererseits ein sicherndes Gerüst geben.
Entsprechend sind etwa die »Zehn Gebote« des sogenannten Alten Testaments für den europäischen Kulturkreis exemplarische Regeln, die dieses Bedürfnis nach Ordnung und Struktur repräsentieren. Ähnliche Grundregeln, die demselben Bedürfnis entspringen, finden sich in anderen Religionen.
Die Kernfrage des menschlichen Bewusstseins wurde bereits in der antiken griechischen Philosophie angesprochen: »Erkenne dich selbst« stand über einem Eingang des Apollo-Tempels von Delphi. In Platons Dialog Phaidros sagt Sokrates, er könne sich noch nicht »gemäß dem delphischen Spruch« erkennen – und erforsche deshalb sich selbst.
In anderen Dialogen verbindet sich dieses Streben mit dem Bewusstsein vom eigenen Nichtwissen, aus dem der Drang, das Wissen stetig zu erweitern, resultiert. Letztlich geht es um die menschliche Haltung, durch dauerndes Selbsterforschen und Immer-wieder-Befragen des Wissens allen möglichen Aspekten und Fragen systematisch nachzugehen, immer wieder zu prüfen und so Scheinwissen zu dekonstruieren.
Solange er »noch atme und es vermag, werde ich nicht aufhören, nach Weisheit zu suchen«, lässt Platon Sokrates in seiner Verteidigungsrede sagen.3 Sokrates bezahlte seine Wissenssuche, wie Platon schilderte, mit dem Leben, weil er angeblich die staatlichen Götter ablehnte und die Jugend verderbe. Platons vielgelesene Schilderung wirkt auch als Warnung, dass Wissbegier und Infragestellen stets mit Misstrauen beantwortet und von Gefahr begleitet sein können. Aber auf dieses Streben nach Wissen und Verstehen ist der Mensch seinem Wesen nach angelegt, wenn er sich seines Menschseins bewusst ist und seinen Verstand nutzt.
Dieses Menschenbild des sich selbst und die Welt erforschenden, befragenden, prüfenden Lebewesens blieb bis in die Frühe Neuzeit weitgehend aufgehoben in den Vorstellungen einer alles bestimmenden »göttlichen Ordnung«. Dann kam – auch als Produkt des unaufhörlichen Selbstbefragens – die Epoche der Aufklärung und mit ihr die Aufforderung an alle Menschen, sich des eigenen Verstandes zu bedienen.
Diese Aufforderung gilt bis heute, und sie ist bis heute umkämpft.
Seit etwa Mitte des 17. bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich das moderne Naturrecht gegen religiöse und andere philosophische Vorstellungen vom Menschen durch. Die wesentlichen Überlegungen über den Menschen gingen nun davon aus, dass er von Natur frei, individuell und zur Vernunft fähig ist. In ihren Konsequenzen revolutionierten diese Erkenntnisse »das juristische und politische Denken«.4 Während »positives Recht« durch menschliche Setzung stets etwas Geschaffenes ist, das geändert oder auch wieder beseitigt werden kann, gilt Naturrecht aus eigener, »natürlicher« Legitimation. Es kann deshalb erkannt und verstanden, nicht aber in Frage gestellt oder gar beseitigt werden.
Als Begründer des modernen Naturrechts gilt Thomas Hobbes (1588–1679), nach dessen Überlegungen es sich durch »den Willen und die Einsicht des Einzelnen«5 begründen lässt. Jeder Mensch kann erkennen, dass es für ihn richtig ist, so zu denken, und zugleich Sinn macht für alle.
Aus der Vorstellung, dass der einzelne Mensch im Naturzustand mit seinem Menschsein ein Recht in sich trägt, folgt, dass er für alle Ordnungen, die er mit anderen Menschen schafft – schaffen muss, um der Komplexität des Lebens und den Erfordernissen des Überlebens gerecht zu werden –, Verfahren der gegenseitigen Verpflichtung zu entwickeln hat,6 die als Verträge (zwischen gleichberechtigten Vertragspartnern) zu denken sind. Dem liegt die »Idee der Autoritäts- und Herrschaftslegitimation durch freiwillige Selbstbeschränkung aus eigenem Interesse« zugrunde.7 Die Herrschaft von Menschen über Menschen wird nicht länger als »gegeben« akzeptiert, sondern auf ihre Gründe befragt.
Verträge sind nicht nur erforderlich, sie nützen am Ende allen und spiegeln die Legitimität der Annahme vom Naturrecht aller Menschen. Die entscheidende Frage lautet nun: Wie legitimiert sich Herrschaft?
Denn auch der Staat ist eine menschliche Einrichtung, die erklären muss, warum und mit welcher Legitimität sie Autorität, Macht und Herrschaft beansprucht. Das ist ein Bruch mit allen vorher dominierenden Auffassungen, die den Menschen nicht als Individuum denken, sondern als durch »Götter« oder andere »äußere« Mächte in eine vorgegebene Ordnung und Gemeinschaft eingebunden.
Die Erkenntnis von der Selbstständigkeit des Menschen und seinen natürlichen Rechten entfaltete sich im 17. und 18. Jahrhundert in vielfältigen Schriften und Diskussionen, die allgemein unter dem Begriff der Aufklärung zusammengefasst werden. Die bedeutendsten Autoren lebten in Großbritannien, auf dem europäischen Kontinent, vor allem im französisch- und deutschsprachigen Raum, und waren, insbesondere seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, eng mit den geistig-politischen Entwürfen in Nordamerika verbunden.
In Frankreich spielte René Descartes (1596–1650) eine wichtige Rolle, der mit seiner Formel »ich denke, also bin ich« (»cogito ergo sum«) gleichsam das Leitmotiv vorgab. Charles Montesquieu (1689–1755) wiederum entwickelte in seinem Werk Vom Geist der Gesetze die Hauptbegriffe einer modernen Gewaltenteilung und einer von Menschen konzipierten Verfassungsordnung. John Locke (1632–1704), David Hume (1711–1776) und Adam Smith (1723–1790) in Großbritannien, Jean-Jacques Rousseaus (1712–1778) und die sogenannten Enzyklopädisten mit ihrem wichtigsten Repräsentanten Denis Diderot (1713–1784) bezogen sich bei aller Eigenständigkeit ihrer Werke auf dasselbe: die Vorstellung vom Potential des vernunftbegabten, selbstständig denkenden, aufklärungsfähigen Menschen. In den Vereinigten Staaten propagierte Thomas Paine (1737–1809) mit Publikationen wie Common Sense (1776) und The Rights of Man (1791/92) die prinzipiell universale Konzeption der Menschenrechte.8
Im deutschen Sprachraum formulierte Immanuel Kant (1724–1804) im Jahr 1784 die klassische Antwort auf die Frage Was ist Aufklärung?, die zugleich das Menschenbild umreißt: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (…), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. (…) Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.«9 Damit präsentierte Kant das Konzentrat eines Diskurses, der um die Neuformulierung des Menschenbildes kreist.
Kant formulierte mit dem »kategorischen Imperativ« auch die Anleitung für ein Verhalten, das diesem Menschenbild entspricht: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.«10 In einer anderen Formulierung heißt es: »Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.«11 Dieser Grundsatz ist die ebenso einfache wie logische Folge aus einem Menschenbild, das die Freiheit des Einzelnen und zugleich den Menschen als Gemeinschaftswesen anerkennt. Er bietet eine Anleitung für jeden Menschen, sich so zu verhalten, dass er oder sie dabei stets die Grundprinzipien des vernünftigen Zusammenlebens mitdenkt.
Wirkungsmächtig wurden die zentralen Erkenntnisse der Aufklärung in den Formulierungen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 und in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 in Frankreich. In der Präambel der Unabhängigkeitserklärung von 1776 heißt es: »Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören«.12 Und im ersten Artikel der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, an deren Erörterung Thomas Jefferson als Botschafter seines Landes in Paris beteiligt war, heißt es: »Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es.«13
Gerade die Formulierungen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung machen deutlich, dass die Prinzipien des Naturrechts sich stets in konkreten Lebenswelten Geltung verschaffen, auf den jeweiligen Reflexionshorizont der Zeit bezogen sind und historisch eingeordnet werden müssen. Daher sind die Umsetzungen dieser Prinzipien auch immer wieder aufs Neue zu überprüfen.
Die Zeitgebundenheit zeigt sich insbesondere in zwei Aspekten: Erstens reflektierten die Autoren (allesamt Männer) weder über ihre Rolle als Sklavenhalter – allein Jefferson besaß im Laufe seines Lebens mehr als 600 Sklaven –, noch hatten sie Frauen als gleichberechtigte Teilhaber ihrer Menschenrechtsdefinition im Blick. Zweitens imaginierten sie einen »Schöpfer« – die Evolution als Entwicklungsgeschichte des Menschen war ihnen noch unbekannt –, auf dessen Plan bzw. Willen sie sich beriefen; der Einsicht in die Freiheit und Gleichheit aller Menschen, die sie proklamierten, war damit allerdings wenig gedient, zumal sich der König in London, gegen den sich die Erklärung richtete, mit demselben Recht auf seinen Gott berufen konnte.
Aber auch wenn das Menschenbild noch durch den damaligen Wissenshorizont begrenzt war und selbst Gegenstand weiterer Reflexionen bleiben musste – auch das gehört zum Wesen selbstständigen Denkens –, so ist die Zäsur gegenüber früheren Menschenbildern doch eindeutig und revolutionär. Nun war potentiell jeder aufgerufen, über sich und sein Handeln nachzudenken, über seine Vernunft, seine Verantwortung und alles, was sich aus der grundsätzlichen Vorstellung von individueller Freiheit und dem Recht auf Selbstbestimmung ergibt.
Wenig überraschend kollidierte dieses Menschenbild nicht nur mit den überkommenen Vorstellungen der Religionen oder autoritärer Philosophien. Es bedeutete zugleich eine politische Herausforderung. Wie sollte Macht legitimiert, wie eine politische Ordnung begründet werden?
Antworten sollten fortan politische Ideologien liefern, die Ordnungssysteme entwarfen, mit denen die bisherigen religiös-obrigkeitlichen Weltbilder im Lichte des neuen Menschenbildes transformiert oder ganz überwunden werden konnten. Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus sind die bekanntesten dieser politischen Ideologien, die sich nun als Konzepte der Staats- und Gesellschaftsordnung mit einem je spezifischen Menschenbild entwickelten.
Das konservative Menschenbild, das oft mit der Metapher vom »alten Adam« arbeitet oder auf Thomas Hobbes’ Formulierung hinweist, dass »der Mensch dem anderen Menschen ein Wolf« sei (»homo homini lupus«), drängt auf einen starken, ordnenden, sichernden Staat, der gesellschaftliche Freiheit limitieren müsse, da ein Zuviel in Anarchie und gegenseitiger Gewalt münden könne.
Der Liberalismus hingegen betont die individuelle Freiheit gegen die Ansprüche von Staat und Gesellschaft, die er auf das Notwendigste beschränkt sehen möchte. Seinem Menschenbild gemäß wiegt die Freiheit des Individuums mehr als die Furcht vor Anarchie oder den Unberechenbarkeiten des »alten Adam«. Von der Französischen Revolution bis zum Ende des Ersten Weltkriegs dominierten in Europa und Nordamerika im Wesentlichen verschiedene Varianten und Interpretationen dieser beiden Grundrichtungen.
Daneben entstand seit den 1860er Jahren aus der Arbeiterbewegung die Sozialdemokratie, die bei allen Unterschieden der politischen Praxis und der gesellschaftlichen Ziele ebenso wie Liberalismus und Konservatismus von der grundsätzlichen Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung ausgeht.14 Als Bewegung zur Förderung sozialer Emanzipation und politischer Teilhabe ist das Menschenbild der sozialdemokratischen Bewegungen sogar in ganz spezieller Weise mit dem der Aufklärung verbunden: Individuelle Bildung, soziale Mobilität und Aufstieg durch Gleichberechtigung aller Menschen im Leistungswettbewerb sind allesamt Vorstellungen, die sich direkt aus dem Menschenbild der Aufklärung ergeben.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich neben diesen dominierenden Strömungen grundlegend andere, strikt in sich geschlossene politische Weltbilder, die für die längste Zeit des 20. Jahrhunderts welthistorische Bedeutung erlangten. Seit den 1840er Jahren formulierten Karl Marx (1818–1883) und seine Anhänger die Theorien vom geschichtsbestimmenden ewigen Klassenkampf.
Hier ist der Mensch das Produkt eines fest und vorhersehbar verlaufenden historischen Prozesses. Das Individuum hat keine Wahl, vielmehr bestimmen anonyme Kräfte und Strukturen sein Denken und seine Zukunft. Es kann die Geschichte nicht aufhalten, sondern ihre Gesetze nur »erkennen« und sich entsprechend verhalten, indem es den vorgegebenen Weg seines Lebens und seiner Gesellschaft hin zum Kommunismus selbst mit vorantreibt. Als Marxismus-Leninismus wurde dieses Menschenbild seit 1917 zum Leitbild aller kommunistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts.15
Nahezu parallel zur Entwicklung des marxistischen Geschichts- und Menschenbildes verbreitete sich seit den 1850er Jahren die Ideologie eines globalen Rassenkampfes. Der französische Graf Joseph Gobineau (1816–1882) legte 1853–1855 seinen »Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen« vor. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verbanden »Rassentheoretiker« Gobineaus Konstrukte mit dem Darwinismus zu einem Modell, das auch die Menschengeschichte erklären sollte.
Dieser »Sozialdarwinismus« predigte, dass der Überlebenskampf zwischen Tierarten in gleicher Weise für Menschen gelte. Die Formel der Radikalisierung lautete: Von der Verschiedenartigkeit von Menschen zur Verschiedenwertigkeit, von der Verschiedenwertigkeit zum Wettbewerb, vom Wettbewerb zum Überlebenskampf – und damit zum Ringen auf Leben und Tod.
Das Menschenbild der Rassentheorien mündete im Nationalsozialismus; der Zweite Weltkrieg war der Versuch, es weltweit durchzusetzen. Dem Einzelnen bleibt auch hier nur die Wahl: entweder seine Rolle als Angehöriger »seiner Rasse« anzunehmen und sich im dauernden Kampf gegen »andere Rassen« zu behaupten, denen er dieselben Motive unterstellt – oder unterzugehen.
Sowohl der Marxismus als auch der Rassismus setzen sich bewusst ab vom Menschenbild der Aufklärung. Sie sehen den Menschen als unfrei und gefangen – im Klassenkampf oder im Rassenkampf. Wer diesen Glauben nicht teilen möchte, schließt sich aus und ist deshalb selbst zu bekämpfen; wer sich weigert, der angenommenen Bestimmung zu folgen, muss umerzogen und diszipliniert, vielleicht sogar vernichtet werden.
Vereinfacht lassen sich diese Ideologien seit der Aufklärung somit in zwei grundsätzliche Strömungen kategorisieren: jene, die – wie Konservatismus, Liberalismus und Sozialdemokratie – im Prinzip von der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen ausgehen, seiner Fähigkeit zur Vernunft und seinem Recht auf persönliche Entwicklung – wobei sich die Konzepte der politischen Ordnungen, mit denen dies am besten zu sichern sei, je nach den Varianten des Menschenbildes unterscheiden.
Ihnen gegenüber stehen jene dogmatischen Ideologien, die dem einzelnen Menschen eine Rolle als Objekt in einem historisch vorbestimmten Prozess zuweisen – so wie dies in den Zeiten vor der Aufklärung für Religionen galt.
Diese grundsätzliche Dichotomie zwischen dem Naturrecht der Freiheit des Einzelnen und dem Anspruch dogmatischer Ideologien oder Religionen auf Gehorsam und Unterwerfung strahlt aus bis zur Gegenwart.
Nicht zuletzt aus der erbitterten globalen Konfrontation zwischen dem Menschenbild der Aufklärung und dem des nationalsozialistischen Rassismus speiste sich nach dem Zweiten Weltkrieg der Drang, die Prinzipien, die diesen Kampf von Seiten der demokratischen Staaten bestimmt hatten, als Lehre und Orientierung festzuhalten.
Daher beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ihr lag die Einsicht zugrunde, dass »die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet«.
Die Erfahrungen der jüngeren Gegenwart aufnehmend, hielt die Resolution fest, dass »die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben« und dass »es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen«.16
Die Erklärung fasste im Wesentlichen Gedanken der Menschenrechte zusammen, wie sie schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Französischen Revolution ausgedrückt worden waren. »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen«, heißt es im ersten Artikel. Entscheidend ist jedoch der Fortschritt im Wissen und der Reflexion, so dass im Unterschied zu Vorstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts nun tatsächlich die universale Existenz aller Menschen und ihrer Rechte explizit formuliert war: »Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.«17
Nun waren die Autorinnen und Autoren der Erklärung keineswegs naiv, ebenso wenig wie die Mitglieder der Generalversammlung, die diese Formulierungen am 10. Dezember 1948 verabschiedeten. Allen war bewusst, dass hier kein globaler Ist-Zustand, sondern »das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal« beschrieben wurde.18 Aber – und das ist entscheidend für unser Verständnis der historischen Perspektive – die Formulierungen und die ihr zugrundeliegenden Analysen menschlicher Existenz spiegeln den Fortschritt historischer Erkenntnis.
Sie sind zugleich ein Appell an das Selbstverständnis, ja den Lebens-Egoismus aller Menschen. Denn wer sich als Mensch versteht und seiner selbst bewusst ist, muss ein genuines Interesse daran haben, nicht zum Objekt anderer Menschen, das heißt zum Gegenstand oder Objekt von nicht legitimer Herrschaft zu werden. Kein Mensch kann ernsthaft wollen, Sklave oder Untertan zu sein; jeder Herrschaftsanspruch bedarf der Legitimation durch Zustimmung nach festen Regeln und auf Zeit.
Wer die Universalität der Menschenrechte bestreitet, spricht folglich anderen Menschen das Menschsein ab und trifft damit nicht zuletzt sich selbst: Auch sein Menschsein wäre dann relativ. Es stünde dann jedem anderen Menschen frei, ihm ebenso das Menschsein abzusprechen.
Als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Dezember 1948 verabschiedet wurde, blieb die Weltpolitik weiterhin geprägt von Realitäten, die einer allgemeinen Durchsetzung entgegenstanden. Die globale Konfrontation des Kalten Krieges zwischen den westlichen Demokratien und der marxistisch-leninistischen Sowjetunion löste den bis 1945 dominierenden Konflikt mit dem Nationalsozialismus ab.
Zugleich betrieben demokratisch-parlamentarische Staaten weiterhin koloniale Machtpolitik, die dem Verständnis universaler Menschenrechte widersprach. Und schließlich bestanden auch in demokratischen Staaten Gesellschaftsstrukturen fort, die mit dem offiziell formulierten Menschenbild unvereinbar waren. Die Politik der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten ist das vielleicht markanteste Beispiel.
Dies zu benennen widerlegt in keiner Weise den historischen Fortschritt. Denn der Maßstab, sich auf die Universalität der Menschenrechte hin zu orientieren und die Ordnung der Gesellschaft an ihr auszurichten, ist die dauerhafte Herausforderung jeder offenen Gesellschaft – bis zur Gegenwart. So illustrieren beispielsweise die heftigen Auseinandersetzungen nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 die historische Ambivalenz dieser Entwicklung: Der Tod Floyds war die Folge eines weiterhin virulenten Rassismus, der Menschen weltweit bedroht.
Die weltweiten Proteste vom Sommer 2020 zeigen zugleich die Energie und den Willen zur Wehrhaftigkeit offener Gesellschaften, solche Gewalttaten zu ahnden und ihre Ursachen zu beseitigen – so unendlich herausfordernd diese Aufgabe auch weiterhin erscheint. Aber diese Energie und der Wille zur Besserung unterscheidet das Eintreten für universale Menschenrechte seit ihrer Formulierung von den Versuchen aller totalitären Systeme, diese Diskussion über das Menschenbild und die Menschenrechte zu meiden und zu unterdrücken.
Es ist durchaus erstaunlich, wie hartnäckig sich Menschenbilder und Geschichtsphantasien halten, die einer Vorstellung vom freien, selbstbestimmten Individuum zu widersprechen versuchen, ohne die betroffenen Menschen zu befragen und ihre Stimme ernst zu nehmen. Das galt bis zum Ende des Kalten Krieges für die Staaten und Regime im sowjetischen Machtbereich. Aber es galt und gilt auch durchweg für alle autoritären und totalitären Herrschaftssysteme, die sich neben dem marxistisch-leninistischen Geschichtsmodell etabliert haben – von den autoritären Herrschaften in Russland oder der Türkei über die religiösen Ansprüche im Iran oder Saudi-Arabien bis hin zu den dogmatischen Führungsansprüchen der Kommunistischen Partei in der Volksrepublik China.
Wer im Jahr 2020 lebt, hat einen historischen Vorteil: Im Unterschied zu unseren Vorfahren kennen wir die Realitäten und die Folgen ihrer Menschenbilder und Herrschaftsmodelle und können aus den Erfahrungen lernen. Diese Lehren und Erkenntnisse können wir abrufen, wann immer solche Ideologien uns als Rezepte für die Probleme unserer Gegenwart angeboten werden. Wenn wir folglich die politischen Entwicklungen unserer Gegenwart analysieren und verstehen wollen, müssen wir immer wieder unsere eigene Grundauffassung der menschlichen Natur klären – und die unseres politischen Gegenübers.
Wenn sich in einer Diskussion alle Seiten über die von ihnen angenommene »Natur des Menschen« im Klaren sind, werden auch die Gründe für Differenzen deutlich. Ob in Fragen der Sozialpolitik, der Wirtschaftsordnung oder auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen: Immer leitet das Menschenbild den Erkenntnisweg von der Analyse zur Bewertung – und dies ermöglicht es uns, wenn wir wollen, uns mit Vernunft zu positionieren.
In allen Analysen politischer Konflikte unserer Gegenwart müssen wir dies in Erinnerung rufen. Wir haben damit das Instrumentarium, um Argumente und Positionen einordnen und bewerten zu können. Denn in allen politischen Positionen und wirtschaftlichen Argumenten – von Wladimir Putin bis Xi Jinping, von Nicolás Maduro bis Ali Chamenei, von Viktor Orbán bis Rodrigo Duterte, von Jair Bolsonaro bis Donald J. Trump – ist die Vorstellung des Menschenbildes identifizierbar. Und wir sollten uns stets fragen, ob wir uns darin wiedererkennen und ob wir gemäß den Konsequenzen, die sich aus diesen Menschenbildern ergeben, behandelt werden wollen.
Auch dieser Text hat ein Menschenbild vor Augen: den an Vernunft und prüfbarem Wissen orientierten, am selbstständigen Denken und am Austausch von Argumenten interessierten Menschen: der über dieselben Rechte und Pflichten verfügt wie alle anderen auch; der Behauptungen übersinnlicher Wahrheit misstraut und stattdessen auf Forschung und Prüfung, Lernen und Verstehen setzt; der allen Menschen die Möglichkeit zur Vernunft zuschreibt. Und ihnen zutraut, selbst zu denken. Sapere aude.
Göttergeschichten: Religion
»Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heißt vermutlich, der Mensch schuf Gott nach dem seinigen.«
(Georg Christoph Lichtenberg, 1774)1
Viren kennen keine Religion. Die antiwissenschaftliche Naivität mancher religiöser Gruppen könnte dem individuellen Glauben überlassen bleiben – wenn sie im Alltag nicht zur Gefährdung aller anderen Menschen führen würde. In den Vereinigten Staaten wollten Fernsehprediger das Virus »per Befehl« austreiben. Die Corona-Erkrankungen in Frankreich explodierten nach einem mehrtägigen Treffen von etwa 2000 Evangelikalen im Februar 2020 in Mülhausen. Im Mai folgten ähnliche Ausbrüche unter »Evangeliums-Christen« in Frankfurt und Bremerhaven. Die Folgen trug die ganze Gesellschaft als weltliche Solidargemeinschaft.
[Getty Images (NurPhoto/David Peinado)]
Am späten Nachmittag des 23. August 1749 verfinsterte sich der Himmel im Süden des Klosters St. Salvator bei Passau. Was zunächst wie eine Gewitterwolke erschien, entpuppte sich als riesiger Heuschreckenschwarm, der die Sonne verdunkelte und tosenden Lärm verbreitete. Bald waren – wie Josef von Silbermann, der Abt des Klosters, für die Nachwelt notierte – alle Bäume, Wiesen, Äcker, Wege und Dächer bedeckt, »ganz grau und aschenfarb (…), wie in Wintter durch häuffigen schnee alles weis zu werden pfleget«.2
Im Frühjahr waren die Schwärme, von Süden kommend, in Siebenbürgen und Ungarn aufgetaucht und hatten sich von dort Richtung Bayern und Franken ausgebreitet. Die Menschen fühlten sich an die achte der biblischen Plagen erinnert, mit denen ihr Gott, dem Buch Exodus zufolge, einst Ägypten geschlagen hatte. Vor allem aber kam ihnen die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, in den Sinn, jene Vision des Weltuntergangs, in der es heißt: »Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione auf der Erde haben. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten dem Gras auf der Erde, den grünen Pflanzen und den Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn haben.«3
Im Bistum Regensburg empfahl man, in sämtlichen Kirchen vormittags und abends »mit lauter Stimme 5 Vater Unser und so viel Englische Grüß samt einem Glauben und Litaney aller Heiligen« zu beten. In Siebenbürgen und Ungarn hatte die Obrigkeit eine dreitägige Prozession angeordnet, »auf daß der Allerhöchste und gutigste Gott seinen wegen unserer Sünden rechtmäßig geschöpfften (…) Zorn, von unserem lieben Vaterland (…) fürohin abwenden, und seine alle menschliche Missethaten übertreffende Barmhertzigkeit uns wiederum bezeigen« möge. Liturgische Bücher verzeichneten Gebete, in denen Menschen sich ihrer Sünden anklagen und ihren Gott »mit gebeugten Herzen und Knieen« anflehen sollten, »Gnade für Recht ergehen« zu lassen gegen das »schädliche Ungeziefer«.4 In allen Empfehlungen und Vorschriften ist dasselbe Prinzip erkennbar: Ein Gott rufe die sündigen Menschen mit einem Strafgericht zur Ordnung, durch Gebet und Sühne sei er umzustimmen.
Wenn wir in die Menschheitsgeschichte blicken, erkennen wir eine geradezu überwältigende Zahl von Göttervorstellungen. Diesen Göttern werden von jeher die unterschiedlichsten Rollen und Bedeutungen zugeschrieben. Dabei entspringt das menschliche Bedürfnis, sich Götter zu imaginieren, nicht selten dem Wunsch, Zufälliges und Unverstandenes, das alles Leben begleitet, durch eine transzendente, außermenschliche Kraft erklärbar und verständlich zu machen. Göttervorstellungen halfen den Menschen, ihr Gefühl von Ohnmacht, Unverständnis und Schicksalhaftigkeit des Lebens zu kompensieren – gegenüber Naturgewalten wie irdischen Mächten gleichermaßen. In einer Welt voller Rätsel können Göttervorstellungen helfen, Zufälle, Nöte und Bürden so zu deuten, dass sie für das eigene Leben erträglicher werden.
Menschen erschaffen sich Götter, und sie konstruieren Religionen ganz nach ihren Bedürfnissen. Die Natur des Menschen kennt folglich keine »natürliche« Religion. Der Mensch ist von seiner Natur her frei zu glauben, was immer er mag. Oder auch auf einen Glauben zu verzichten.
Heute existieren neben den drei bekanntesten monotheistischen Religionen – Christentum, Judentum und Islam – Tausende weitere Gottesvorstellungen. Zuletzt, im Mai 2019, konnten die Fernsehzuschauer in aller Welt live verfolgen, wie in Thailand ein neuer König und Gott inthronisiert wurde. (Sein Name ist Maha Vajiralongkorn Bodin Dradebaya Warangkun, »König der Blitze, Abkömmling von allmächtigen Gottheiten«; bis zu seiner Inthronisierung lebte er viele Jahre am Starnberger See und ist auch seither regelmäßig zu Gast in Deutschland.)
In Europa zählten die Göttererzählungen der Griechen, Römer und Germanen rund um Zeus, Jupiter und Thor jahrhundertelang zum Schulkanon. Dass unsere heutige Zeitrechnung nahezu weltumspannend »nach Christus« gezählt wird, spiegelt dabei den viele Jahrhunderte währenden Eroberungszug jener Religion, deren Anhänger sich auf den Nazarener Wanderprediger Jesus berufen.
So auch die beiden größten Religionsgruppen, Katholiken und Protestanten, in der Bundesrepublik Deutschland: Nach einer Erhebung von 2017 gehören 28 Prozent der Bevölkerung hierzulande der katholischen und 26 Prozent der evangelischen Religionsgemeinschaft an. Zehn Prozent zählen zu einer der zahlreichen anderen Religionen, davon gut die Hälfte zu den Glaubensrichtungen des Islam. Die größte Gruppe bilden mit 37 Prozent der Bevölkerung diejenigen ohne jede Religionsbindung.5
Die Erfindung der Götter
Wir wissen nicht, wann Menschen begannen, sich Religionen auszudenken. Vielleicht ist die Vorstellung, übernatürliche Wesen seien für all die unverstandenen, schicksalhaften und zufälligen Ereignisse verantwortlich, so alt wie die Menschheit selbst. Man mag in dem Befund, dass Menschen bereits vor zehntausend Jahren ihre Nächsten nach deren Tod nicht einfach liegen ließen, sondern sich um die Leiche kümmerten, schon die Form eines Rituals erkennen, ohne dass wir es religiös nennen könnten. Aber es ist, mit dem Prähistoriker Hermann Parzinger zu sprechen, »durchaus anrührend, wenn man entsprechende Begräbnisse schon von Neandertalern findet«.6
Die neuere Forschung zeigt, dass die bisherige Annahme, die Vorstellung von der Existenz strafender Götter sei eine Vorstufe komplexer Gesellschaften, wohl nicht zutrifft. Lange stand die These im Raum, die Idee von der Existenz »moralisierender Götter« habe eine Art Maklerfunktion eingenommen: Der Glaube an ein übernatürliches Wesen, das als Moralwächter und zu Strafen fähige übernatürliche Kraft imaginiert werde, habe das Zusammenleben von sich eigentlich fremden Menschen in größeren Gesellschaften erleichtert und befördert.
Eine weit gefasste Analyse von 413 menschlichen Gesellschaften in dreißig Regionen weltweit, die über einen Zeitraum von zehntausend Jahren existierten, deutet aber auf eine andere Erkenntnis: Erst schufen die Menschen komplexere Gesellschaften, dann imaginierten sie strafende Götter.7 Religionen hatten dabei schon immer auch eine machtpolitische Funktion. Zunächst wurden Glaubensinhalte und Glaubenspraktiken standardisiert durch regelmäßige Wiederholung und indem religiöse Autoritäten ritualisierte Übungen anordneten. Waren sie erst einmal etabliert, ließen sie sich auf größere Bevölkerungsgruppen übertragen. Damit konnten auch Herrschaftsgrenzen überschritten werden. Zwei Herrschaftsgebiete konnten also ähnliche Rituale befolgen und waren so gleichsam auf einer übergeordneten Ebene verbunden. Diese Rituale und die institutionalisierte Kontrolle durch religiöse Hierarchien lassen sich lange vor der Imagination moralisierender Götter nachweisen.8
Religiöse Glaubenssysteme leben durch Rituale, Zeremonien und Wiederholungen. Sie konstruieren einen geschlossenen Raum von Glaubenssätzen: – »Es gibt Götter«, »Diese Götter beobachten Dein Leben, sie haben Macht (über Dich!)«. Nun sind Menschen nicht von Natur darauf aus, sich imaginierten Autoritäten unterzuordnen. Glaubenssysteme zielen deshalb auf Vereinheitlichung und Überschaubarkeit ihrer Konstruktionen mit Hilfe von Regeln, die das individuelle Sprechen und Denken überlagern. Um diese Glaubenssysteme stabil zu halten, bilden Religionen hierarchische Strukturen von Autorität und Priestertum aus, die wiederum Macht beanspruchen und von den Gläubigen verlangen, Gehorsam zu leisten.
Dieser Anspruch ist nicht nur ein historisches Phänomen. Bis in die Gegenwart üben viele Religionen Einfluss auf politische Prozesse, gesellschaftliche Machtverteilung und wirtschaftliche Entwicklungen. Beispiele dafür werden wir später betrachten. Diese Ansprüche entstammen nicht selten historischen Traditionen, nach denen Religionen nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens in einem Maße bestimmten, das uns heute fremd erscheint. Ein kurzer Blick auf die Geschichte Europas zeigt die Bedeutung und Wirkung von Religionen. Dabei ist wichtig, die zentrale Frage im Blick zu behalten: Welches Menschenbild, welche Vorstellung von der »Natur des Menschen« liegt Religionen zugrunde?
Bis in die politischen Debatten der Gegenwart ist regelmäßig vom »jüdisch-christlichen Erbe« die Rede. Das Begriffspaar verweist auf bestimmte Texte und Vorstellungen, die hier nur kurz erwähnt werden sollen. Im Zentrum steht zunächst die Person Jesus, ein jüdischer Wanderprediger im Gebiet des heutigen Israel, von dessen Wirken einige Erzählungen berichten, die Jahrzehnte nach seinem Tod entstanden sind. Wir kennen sie unter dem Begriff »Neues Testament«. Die Erzählungen beziehen sich regelmäßig auf frühere Texte, die in derselben Region über viele Jahrhunderte vor dem Auftreten von Jesus entstanden und als »Altes Testament« bekannt sind. Darin sind eine Vielzahl mythischer Geschichten, Fabeln und Dichtungen versammelt, in denen es immer wieder um die Vorstellung eines Gottes geht, der sich sehr direkt zu den Menschen verhält und von ihnen Gehorsam erwartet.
Mit dem Auftreten von Jesus glaubte nun eine wachsende Zahl von Menschen, dass dieser der in vielen Texten angekündigte Gottessohn, der Messias, oder griechisch: der Christus, sei. Sie nannten sich Christen und beriefen sich auf die Erzählungen des Neuen Testaments. Andere glaubten, weiter auf das Erscheinen eines Gottes warten zu sollen. Manche warten noch heute.
Für die Ausbreitung des Jesus-Glaubens entscheidend wurde die Verbindung zur politischen Herrschaft im Römischen Reich, in den ersten Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung die dominierende militärisch-zivilisatorische Kraft des europäischen Kontinents. Das Christentum nahm dabei zahlreiche Riten und Glaubensvorstellungen anderer Religionen auf.
Über Jahrtausende schon war es geübte Tradition politischer Führer – von den Pharaonen Ägyptens bis zu den römischen Kaisern –, sich bei ihrem Herrschaftsanspruch auf eine transzendente Legitimation zu berufen. Diese Aufgabe übernahm nun seit dem 4. Jahrhundert in Europa zunehmend das christliche Glaubenssystem. Exemplarisch lässt sich dies im 8. Jahrhundert am fränkischen König Carolus Magnus zeigen. »Karl der Große« war ein nach zeitgenössischen Maßstäben überaus erfolgreicher Heerführer und Herrschaftsorganisator. Seine Macht beruhte im Kern auf seiner militärischen Kontrollgewalt, die er glaubwürdig und nachhaltig in einem großen Territorium zu repräsentieren vermochte.
Mittlerweile hatte sich das Christentum zu einer hierarchischen Kirchenorganisation entwickelt, an deren Spitze der Papst als oberster Priester den Anspruch erhob, die göttliche Herrschaft zu repräsentieren. Zugleich sahen sich die Anhänger des Jesus-Glaubens von dessen Aufforderung angetrieben, den Glauben an ihn zu verbreiten.9 Diese »Mission« war nicht möglich ohne Verdrängung. Die Vielfalt der Göttervorstellungen sollte der Idee des einen Gottes weichen.
Dies war auch für politische Herrscher höchst attraktiv. Denn wenn es nur einen Gott gab, der einen König legitimierte, verloren alle Konkurrenten ihre Rechtfertigung. Politische und religiöse Herrschaftsansprüche waren zudem über eine komplexe Vorstellung göttlicher Reiche verbunden. Entscheidend war: Wer Herrschaft beanspruchte, musste sich auf ein vermeintlich von einem Gott gegebenes Recht berufen. Denn eine überwältigende Zahl von Menschen lebte durch die religiösen Erzählungen in Glaubensvorstellungen, die ein Weiterleben nach dem Tod verhießen, auf das es sich vorzubereiten galt.
Den Schlüssel, so die weitere Glaubenskonstruktion, besaßen die Menschen selbst – durch ihr Verhalten im alltäglichen (und einzig realen) Leben. Wer sich hier, im Diesseits, nach den Regeln der Glaubensorganisatoren in Kirche und Priesterkaste verhielt, dem wurde ein glückliches Leben nach dem Tod, im Jenseits, versprochen. Die Furcht vor dem Schicksal in der wortreich ausgemalten Phantasiewelt nach dem Tod war der vielleicht mächtigste Antrieb zum Gehorsam.
Wer dergleichen nicht glauben mochte, gar dagegen opponierte, stellte sich gegen die überwältigende Mehrheit seiner Zeitgenossen – und, schlimmer noch, gegen den imaginierten Gott. Entsprechend beflissen zeigte sich die Mehrheit gegen Abweichler, nicht zuletzt aus Furcht um die eigene Bewährung.
Wir müssen uns die Weltvorstellungen der Menschen jener Jahrhunderte in Erinnerung rufen, um den Denkhorizont zu verstehen und die Wucht der Ereignisse zu begreifen, die all diese Bilder und Erwartungen erschütterten. Eine grundlegende Zäsur bewirkte zunächst im 16. Jahrhundert die Aufspaltung und Lagerbildung der christlichen Konfessionen im Zuge der sogenannten Reformation. Als dominierende Glaubensorganisation hatte die katholische Kirche bis dahin ihren Wahrheits- und Herrschaftsanspruch in weiten Teilen des heutigen Europa durchzusetzen vermocht.