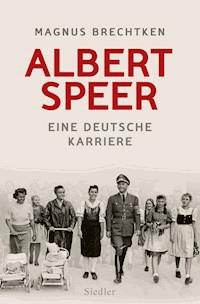
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Ende einer Legende: Speer und die Lüge von der aufrichtigen Reue
Seit 1931 NSDAP-Mitglied und bald ein Vertrauter Hitlers, wurde Albert Speer rasch zum Architekten des Rassenstaates. Im Krieg engagierte er sich als Rüstungsminister unermüdlich für den totalen Kampf und die Vernichtungsmaschinerie. Gleichwohl behauptete er nach Kriegsende, stets distanziert, ja eigentlich unpolitisch und gar kein richtiger Nazi gewesen zu sein. Magnus Brechtken zeigt, wie es Speer gelang, diese Legende zu verbreiten, und wie Millionen Deutsche sie begierig aufnahmen, um sich selbst zu entschulden.
Brechtken, renommierter Zeithistoriker und stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, beschreibt nicht nur, wie markant Speers Stilisierung als angeblich unpolitischer Techniker den historischen Tatsachen widerspricht. Auf der Basis jahrelanger Recherchen und vieler bislang unbekannter Quellen schildert er zugleich, wie Millionen Deutsche Speers Fabeln mit Eifer übernahmen, um sich die eigene Vergangenheit schönzureden, und wie sehr Intellektuelle, namentlich Joachim Fest und Wolf Jobst Siedler, diese Legendenbildung unterstützten. Die verblüffende Biographie eines umtriebigen Manipulators – und zugleich ein Lehrstück für den deutschen Umgang mit der eigenen Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1790
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
MAGNUS BRECHTKEN
ALBERT SPEER
EINE DEUTSCHE KARRIERE
Siedler
Seit 1931 NSDAP-Mitglied und bald ein Vertrauter Hitlers, wurde Albert Speer rasch zum Architekten des Rassenstaates. Im Krieg engagierte er sich als Rüstungsminister unermüdlich für den totalen Kampf und die Vernichtungsmaschinerie. Gleichwohl behauptete er nach Kriegsende, stets distanziert, ja eigentlich unpolitisch und gar kein richtiger Nazi gewesen zu sein. Auf der Grundlage vieler bisher unbekannter Quellen zeigt der renommierte Zeithistoriker Magnus Brechtken, wie es Speer gelang, diese Legende zu verbreiten, und wie Millionen Deutsche nach 1945 sie begierig aufnahmen, um sich selbst zu entschulden.
Der Autor
Magnus Brechtken, geboren 1964, wurde an der Universität Bonn im Fach Geschichte promoviert und lehrte an den Universitäten Bayreuth, München und Nottingham. Seit 2012 ist er stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte und Professor an der Universität München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen der Nationalsozialismus, die Geschichte der internationalen Beziehungen und die historische Wirkung politischer Memoiren.
Für Frauke
Inhalt
Prolog
ERSTER TEILDIE ANFÄNGE (1905 bis 1932)
Aus gutem Hause
Entscheidung für den Nationalsozialismus
ZWEITER TEILAUFBRUCH (1933 bis 1942)
Energischer Aufstieg
»Baumeister der Bewegung«
Der Eroberungsmanager
Pläne für den »Endsieg«
Exkurs: Filmpropaganda – projizierte Macht
DRITTER TEILFRONTARBEITSFÜHRER (1942 bis 1945)
Architekt des totalen Krieges
Exkurs: Volksgemeinschaftsführer und potenzieller Hitlernachfolger
Zerstörungsfachmann
Exkurs: Dynamik der Tat – der reisende Techniker
Krankheit und Legende
Krieg bis »fünf nach zwölf«
VIERTER TEILDER NOBLE NAZI (1945 bis 1966)
Vor Gericht
Spandau und die Neukonstruktion des Lebens
Mediale Mythenbildung
Einsatz für die vorzeitige Freilassung
FÜNFTER TEILFABELHAFTE ERFOLGE (1966 bis 1981)
Comeback
Erfolgsprojekt Erinnerungen
Der allgegenwärtige Zeitzeuge
Die Spandauer Tagebücher
Exkurs: Speer und Geld
Finale: Glück des Betrügens
SECHSTER TEILNACHLEBEN (1981 bis heute)
Verzögerte Dekonstruktion
Ignoranz und Wissensferne: Joachim Fest
Epilog
BILDTEIL
ANHANG
Nachwort und Dank
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Register
Bildnachweis
Prolog
Albert Speer ist vermutlich der am häufigsten zitierte Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts.1 Ein engagierter Nationalsozialist, Unterstützer Hitlers, Architekturmanager, Kriegslogistiker, Rüstungsorganisator, Mitbetreiber der NS-Rassenpolitik, eine Zentralfigur des Eroberungs- und Vernichtungskrieges: Das ist der reale Albert Speer bis 1945.
In der Nachkriegszeit hat sich ein anderes Bild von ihm verbreitet. Hier erscheint Speer meist als verführter Bürger, unpolitischer Technokrat, als fleißiger Fachmann, der vor allem seine Arbeit im Sinn hatte und dabei wenig wahrgenommen haben wollte von den Verbrechen, die sich um ihn herum ereigneten – während er in Wahrheit mit der SS paktierte, Zwangsarbeiter in den Tod trieb und europaweit die Kriegsrüstung organisierte. Allenfalls dunkle Ahnungen habe er gehabt von dem, was doch vor seinen Augen und nicht selten auf seine direkte Initiative hin geschah.
Es war die Legende vom unwissend-arglosen Bürger Albert Speer auf der schuldfreien Seite der Geschichte. Auf der anderen standen die ungehobelten Parteimänner mit ihrem lauten Benehmen und den groben Visagen. Das waren »die Nazis«. Irgendwie war er in deren Nähe geraten. Warum nur? Manche Historiker sprachen dann vom »Rätsel Speer« und mochten seine Verbrechen, die ein Blick in zeitgenössische Quellen offenbart hätte, nicht zur Kenntnis nehmen. Folgsam übernahmen sie viele seiner Erinnerungsbilder. Mit den dunklen Seiten des Dritten Reiches, so meinten sie unter dem Beifall all derer, die sich selbst gern in diesen Erzählungen wiedererkennen wollten, hatte der bürgerliche Speer – einer wie sie – kaum etwas gemein.
Speer schrieb und erzählte nun Geschichten von persönlicher Distanzierung und nachgeholter Reue. Als Bekenner, der sich mahnend an die Nachwelt wendet, gelang ihm damit nach 1966 eine zweite Karriere. Er wurde zum international gefragten Kronzeugen für das überwundene Böse. Ein nachdenklicher Zeitzeuge, jederzeit bereit, »authentische« Erinnerungen an eine schlimme Zeit zu liefern, in der es niemandem, selbst ihm nicht, leichtgefallen war, rechtschaffen zu bleiben und integer. Millionen Deutsche hörten und lasen das gern. Sie schienen sich fast zu sehnen nach immer neuen und doch immer ähnlichen Erzählungen angeblicher Einsicht und Läuterung.
Auch in anderen Ländern hatte der distinguierte ältere Herr mit dem zurückhaltenden Auftreten Erfolg. Vor allem in der angelsächsischen Welt war Speer wenige Jahre nach seiner Entlassung aus dem Spandauer Gefängnis ein gern gesehener, von Zeitungen, Film und Fernsehen geradezu hofierter Gast. Was wie zwei Leben vor und nach 1945 erscheint – Täterschaft hier, Reue dort – fügt sich bei Lichte betrachtet zu einem stringenten Narrativ: Nach dem Einsatz für den Nationalsozialismus und der Täterschaft als Verbrecher strebte Speer die Interpretationsherrschaft über die Geschichte an, um alles, was er getan hatte, umerzählen, vernebeln, in ablenkenden Fabeln auflösen zu können. In beiden Rollen war Speer ebenso energisch wie erfolgreich.
Gerade deshalb ist Speers Karriere exemplarisch, eine deutsche Karriere im zwanzigsten Jahrhundert, die bis in die höchsten Sphären der Macht führte, an die Schalthebel einer europäischen Kriegsmaschinerie mit Millionen Arbeitern, Soldaten und einem Arsenal von Waffen, wie sie in der Weltgeschichte zuvor nicht eingesetzt worden waren. Speer sorgte für die Verlängerung des Krieges um Jahre, opferte dabei unzählige Menschen, um den Sieg des Nationalsozialismus zu erreichen, und sah sich in der Endphase des Krieges sogar ernsthaft als möglichen Nachfolger Hitlers.
Sein Ehrgeiz und sein rascher Aufstieg verschafften Speer besondere Prominenz, zugleich jedoch war er auch repräsentativ. Nimmt man die nationalsozialistische Herrschaft als Ganzes in den Blick und befreit man sich von der Täuschung, dass »die Nazis« etwas »Fremdes« waren, eine mysteriöse Macht, die das Land im Januar 1933 irgendwie von außen überwältigte und im Mai 1945 wieder verschwand, wird klar: Albert Speer war einer von zahllosen Deutschen, die Nationalsozialisten sein wollten, die ihr Leben und ihr Streben danach ausrichteten. Sie wollten Hitler und damit auch sich selbst zur Macht verhelfen. Speer ragte heraus und ist doch zugleich exemplarisch für all jene, die sich mit ähnlichen, wenngleich bescheideneren Ambitionen so wie er für den Nationalsozialismus engagierten, ihn trugen und gestalteten.
Speer repräsentierte mit seinem Ehrgeiz, seinem Einsatz und seinem Willen zum Erfolg eine nationalsozialistische Funktionselite, wie sie auch in der Verwaltung, in der Justiz, dem diplomatischen Dienst, in der Medizin oder an den Hochschulen die Gesellschaft bestimmte. Ob als Beamte im öffentlichen Dienst – von der Finanzverwaltung bis zu den Fürsorgeeinrichtungen –, als Angestellte und Unternehmer, Landwirte und Akademiker, widmeten sie der nationalsozialistischen Idee ihre Arbeitskraft, der Partei und deren Gliederungen ihre Zeit im Dienste dessen, was sie selbst nicht selten als Idealismus verstanden. Sie glaubten an Hitler und teilten seine politischen Überzeugungen. Sie gestalteten mit ihm den Rassenstaat und organisierten den Eroberungs- und Vernichtungskrieg. Sie verkörperten den Nationalsozialismus. So wie Speer.
Speers Streben in die NSDAP ist nur ein Indikator von vielen. Seine frühe Mitgliedschaft ist ernst zu nehmen als Entscheidung eines Mannes aus dem bürgerlichen Milieu, aus dem sich weitere hunderttausend Gestalter des Regimes rekrutierten. In dieser Perspektive stand Speer für all jene NS-Bürger, die in Führungspositionen strebten, um dafür zu sorgen, dass die Herrschaft funktionierte – die den Rechtsstaat beseitigen halfen, beim Verschwinden ihrer jüdischen Mitbürger zusahen, sich nicht selten an deren Schicksal bereicherten und dabei meinten, eine ganz gewöhnliche Laufbahn zu verfolgen. Wie man das eben tut, wenn man alle Chancen nutzt, die einem das Leben in einem autoritären Selbstbedienungsstaat bietet, der Zugriff auf öffentliche Gelder und das Vermögen seiner Gegner erlaubt und in dem Skrupel oder Gewissen als Schwäche gelten.
Albert Speer war nicht gezwungen, sich für den Nationalsozialismus oder für Hitler einzusetzen. Freiwillig, zielstrebig und eifrig war jeder Schritt seines Einsatzes für dessen Herrschaft, gegen die deutschen Juden und andere Minderheiten, später für den Krieg und die Versklavung von Millionen Menschen. Speer hätte, wie sein Vater, Miets- und Privathäuser, Gewerbebauten, Villen oder das ein oder andere öffentliche Gebäude errichten können. Dabei hätte er sich nicht einmal besonders anstrengen müssen. Als Sohn reicher Eltern war er finanziell unabhängig. Das unterschied ihn von den meisten Angehörigen der NS-Funktionselite, die ihre nationalsozialistische Überzeugung mit der Notwendigkeit verbanden, ihre Familien zu versorgen. Aber auch viele Beamte und Angestellte mussten keine eifrigen Verfechter des neuen Rassenstaates sein. Selbst als führendes Mitglied der Funktionselite konnte man, als der Nationalsozialismus seine Ideologie in die Praxis umsetzte, durchaus beiseite stehen und auf überkommene Prinzipien und Grundrechte verweisen.
Niemand drängte Albert Speer zum Einsatz. Er hätte es sich leisten können, die ethischen und moralischen Grenzen seines Tuns zu definieren und sie nicht zu überschreiten – wenn solche Grenzen für ihn von Bedeutung gewesen wären. Die Freiwilligkeit macht seine Täterschaft auch deshalb besonders markant, weil ihm später ein Kunststück öffentlicher Schizophrenie gelang. Indem er seine Karriere zu einer Art Trance umdeutete, in die er zwölf Jahre lang gefallen sei, nahm er deren Leistungen für sich in Anspruch, um zugleich die Folgen seines Tuns von sich zu schieben. Er hatte beispielsweise auch dann noch unermüdlich weiter Fabriken bauen und Waffen produzieren lassen, als die Niederlage klar erkennbar war. Für diese Erfolge wollte Speer bewundert sein, die dadurch im letzten Kriegsjahr explodierenden Opferzahlen sollten anderen zugerechnet werden.
Auch in dieser Hinsicht war Speer ein typischer Exponent der nationalsozialistischen Funktionseliten: Sie alle taten ja nur ihre Pflicht. Die Generäle führten Krieg, die Euthanasie-Ärzte selektierten »lebensunwertes Leben«, Polizei und Verwaltungsbeamte bekämpften abweichendes Verhalten, enteigneten und deportierten Opfer, Richter orientierten ihre Urteile am Maßstab des »gesunden Volksempfindens«, Journalisten berichteten von tapferen Frontsoldaten, die ferne Regionen eroberten, um dem Reich die Vormachtstellung in der Welt zu sichern, die ihm nach der Natur des ideologischen Kampfes zustand; Akademiker lieferten historische Rechtfertigungen und entwarfen Pläne zur ethnischen Flurbereinigung. Im Empfinden dieser »Eliten« war das alles ganz normal. Auch Speer vermochte ohne jedes Bedenken ein Mordregime zu betreiben und zugleich die Opfer zu ignorieren.
In den 1970er-Jahren, im Glanz der Bewunderung für seine Bekenntnisse, meinte Speer, er würde alles noch einmal genau so tun. Der moralische Abgrund dieser Aussage ist derart bodenlos, dass seine Hörer nicht wahrnahmen, was Speer damit für sich reklamierte: Stolz auf die Errungenschaften seiner gesamten Vergangenheit, von deren Verbrechen er sich ansonsten gern in öffentlich zur Schau gestellter Reuepose distanzierte. Anders lässt sich kaum erklären, dass entsprechende Reaktionen der Fassungslosigkeit nicht überliefert sind.
Dass Speers Aussagen als Zeitzeuge nach 1945 durch und durch verlogen sind und wie virtuos er gegen die Fakten der historischen Überlieferung seine eigenen Fabeln verbreitete, konnte man schon früh erkennen. Solange Speer redete, gab es Zweifler. Aber Speer verstand es, sich über Jahrzehnte durchzusetzen, weil Historiker und Publizisten – und mit ihnen die überwältigende Mehrheit der Leserinnen und Leser – ihm folgten. Weil sie ihm und seinen Märchen folgen wollten.
Wer einen Blick in die Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus wirft, der wird – vielleicht verblüfft, vielleicht frustriert – feststellen: Ein substanzieller Teil dessen, was im Laufe der Jahrzehnte über das Dritte Reich produziert wurde, ist von Speers Legenden durchwoben. Das gilt für die Charakterisierung zentraler Personen – von Hitler über Göring bis zu Martin Bormann oder Robert Ley – nicht weniger als für wichtige politische Entwicklungen wie den Mythos vom »Rüstungswunder« oder Speers geschickte Ablenkungen von seiner zentralen Zusammenarbeit mit Himmler und Goebbels bei der Totalisierung der Kriegführung. Das gilt für Speers angebliche Attentatspläne bis zum objektiv lächerlichen Anspruch, er habe die deutsche Wirtschaft für die Nachkriegszeit gerettet. Das gilt schließlich für die weltweit in Texten und Filmen verbreiteten Szenen von Hitlers letzten Tagen im Bunker, in denen regelmäßig Speers Fabrikationen als Geschichtsdarstellung präsentiert werden statt als die literarischen Konstrukte, die sie sind. So werden seit Jahrzehnten Erdichtungen weitergetragen und vermeintliche Zitate kolportiert, die Speer einst in die Welt setzte. Sie haben seither ein Eigenleben entwickelt, dessen Ausgangspunkt allein im blinden Vertrauen auf seine Glaubwürdigkeit als Zeitzeuge liegt. Für ihn persönlich bedeutete dies einen immensen Erfolg, für seine Zuhörer und Leser, die »aus erster Hand« erfahren wollten, was jener kleine Kreis von Verbrechern mit dem unschuldigen deutschen Volk angestellt hatte, erzeugten seine Schilderungen wohlige Schauer der Erinnerung an eine Zeit der nationalen Größe. Für alle, die ernsthaft um Erkenntnis und historische Wahrhaftigkeit ringen, ist es ein Desaster.
Speer war kein Rätsel, sondern ein Repräsentant. Seine Taten liegen offen zutage, ja, sie sind sichtbarer als die vieler Euthanasie-Ärzte, Geheimpolizisten und Richter, Ministerialbeamten und Generäle. Sie alle agierten fleißig, wie es deutscher Tradition entsprach – sie taten etwas. Und diese Taten lassen sich beschreiben, analysieren, bewerten. Das gilt auch für Speer. Über ihn und von ihm sind Berge von Dokumenten überliefert. Man muss allerdings hinsehen wollen. Nicht was Speer nach 1945 über sich erzählt hat, bringt uns dem Verständnis näher, sondern die Analyse seines Tuns, wie es aus den Quellen zu erschließen ist.
Auf den folgenden Seiten wird regelmäßig deutlich werden, wie naiv und nicht selten fahrlässig es war, auf Speers Zeitzeugenerzählung zu vertrauen, namentlich dort, wo Dokumente zur Prüfung bereitlagen, aber nicht konsultiert wurden. Überhaupt ist es verblüffend, dass manche Biographen Speers, die vielhundertseitige Texte vorlegten, immer noch meinten, ohne den Gang in die Archive auskommen zu können. Das gilt für die weit verbreiteten Texte von Gitta Sereny und Joachim Fest aus den 1990er-Jahren bis hin zu dem erst jüngst erschienenen Buch von Martin Kitchen.
Gitta Sereny hat für ihre Darstellung nur einige wenige Dokumente aus den Nachlassbeständen im Bundesarchiv konsultiert, aber weder das Material zu Speers Tätigkeit als Minister noch die in sonstigen Archiven überlieferten Dokumente; zentrale wissenschaftliche Literatur nimmt sie nicht wahr. Über Joachim Fests Scheu, in Archiven zu recherchieren, mokierten sich seine Journalistenkollegen schon in den 1970er Jahren. Für seine Speer-Biographie von 1999 verzichtete er denn auch auf eigene Forschung, ignorierte zentrale Erkenntnisse der vorangehenden Jahrzehnte und konzentrierte sich ganz auf das, was Speer ihm über die Jahre erzählt hatte. Martin Kitchen schließlich hat für sein 2015 veröffentlichtes Buch zwar einen Teil der jüngeren Literatur verarbeitet, ist aber den Hinweisen auf zentrale Dokumente, die in den Archiven liegen, nicht nachgegangen.2
Demgegenüber beispielhaft aufklärend und förderlich für die Forschung war schon vor mehr als zehn Jahren Die Akte Speer von Heinrich Breloer und Rainer Zimmer. Obwohl »nur« als Begleitbuch zu einem Film konzipiert, bieten die dort präsentierten Beispiele durchweg präzise, aus den Archiven recherchierte Einsichten, von denen viele in späteren Texten und Filmen zu Speer erstaunlicherweise unbeachtet geblieben sind – auch darauf wird noch einzugehen sein.
Was immer die Motive für das Nicht-selbst-Nachforschen gewesen sein mögen – Bequemlichkeit, Ignoranz, Unwissen, Gleichgültigkeit, Scheu vor der Komplexität und Masse der Quellen –, das Ergebnis ist dasselbe: Statt selbst zu prüfen, vertraut man dem Zeitzeugen Speer und seinen Unterstützern; statt selbst die Archive zu konsultieren, werden Speers eigene, in der Literatur dicht repräsentierte Lesarten stets aufs Neue wiederholt.
Hervorzuheben sind dagegen die Arbeiten vieler meist wenig bekannter Historikerinnen und Historiker, die sich, oft aus Interesse an einem Spezialthema, in die Archive begaben und wichtige Puzzlesteine lieferten, die leider oft nicht mal für sich wahrgenommen, geschweige denn zu einem größeren Bild zusammengesetzt wurden. Exemplarisch zu nennen sind die Untersuchungen von Dietmar Arnold, Ulrich Chaussy und Eckart Dietzfelbinger, Yasmin Doosry, Werner Durth und Karl-Heinz Ludwig, Hans J. Reichhardt, Wolfgang Schäche und Angela Schönberger, Matthias Schmidt, Heinrich Schwendemann und Susanne Willems. Zwar haben ihre Veröffentlichungen eine gewisse Wirkung erzielt, der in den öffentlichen Diskursen aber jene populären Erzähler wie Fest und Sereny gegenüberstanden, die weiterhin Speers Fabeln kolportierten und Dank ihrer Medienpräsenz lange dominierten.
Es geht also weniger um das Individuum Albert Speer, sondern um den Typus des bürgerlichen Deutschen, der bewusst zum Nationalsozialisten wurde und nach 1945 nicht den Willen und die Einsicht hatte, sich über seine Taten eine ehrliche Rechenschaft zu geben. Speers Biographie ist mithin eine beispielhaft deutsche Geschichte, mit der wir nicht nur einer Analyse des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen näherkommen, sondern auch den Untiefen ihrer Aufarbeitung.
Nicht Speers Lügen sind erklärungsbedürftig – er tat nur, was er Zeit seines Lebens getan hatte, das Beste für sich herausholen –, zu analysieren und sichtbar zu machen ist vielmehr die Gläubigkeit, das offensichtliche Verlangen, mit dem seine Fabeln über Jahrzehnte nacherzählt wurden, selbst dann noch, als deren Lügenhaftigkeit geradezu ins Auge sprang. Die Karriere des Albert Speer spiegelt folglich in hohem Maße auch die deutsche Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Aus dieser Perspektive mag das Folgende mit seinen exemplarischen Details und aufklärenden Hinweisen als eine Aufforderung gelesen werden, zu prüfen und selbst weiter nachzudenken.3
ERSTER TEILDIE ANFÄNGE (1905 bis 1932)
AUS GUTEM HAUSE
Was bedeutet schon Geld – wenn man es hat?
ALBERT SPEER, ca. 19781
Unser Wissen über Albert Speers Kindheit entstammt nahezu ausschließlich seinen eigenen Erzählungen. Was darin überprüfbar ist, hat sich oft als erfunden herausgestellt. Das beginnt schon mit dem Bericht über seine Geburt. Speer hat sie literarisiert, um die Bedeutung des Ereignisses hervorzuheben: »An einem Sonntag, dem 19. März 1905, 12 Uhr mittags, kam ich in Mannheim zur Welt. Der Donner eines Frühjahrsgewitters übertönte, wie mir meine Mutter oft erzählte, das Glockengeläute von der nahen Christuskirche.«2 Abgesehen von Ort und Datum ist alles Phantasie. Auf der offiziellen Urkunde ist als Geburtszeit »Vormittags um elf ein Viertel Uhr« vermerkt, ein Gewitter ist erst für den späteren Nachmittag verzeichnet, und von der Christuskirche stand damals nicht einmal das Fundament.3
Speer war der zweite von drei Söhnen des Ehepaars Albert Friedrich und Luise Mathilde Wilhelmine Speer. Der Vater, Jahrgang 1863, stammte aus Dortmund, die Mutter war 1879 in der Mainzer Kaufmannsfamilie Hommel geboren worden. Die Familie lebte in der Prinz-Wilhelm-Straße 19, die später in Stresemannstraße umbenannt wurde. Das herrschaftliche Haus umfasste »vierzehn Zimmer auf drei Stockwerken«; im Kellergeschoss logierten, nach Speers Erzählung, »sieben Bedienstete«, die Eltern besaßen »getrennte Schlaf- und Ankleidezimmer im zweiten Stock«. In einem Nebengebäude war das Architekturbüro des Vaters untergebracht.4
Mannheim und das am anderen Rheinufer gelegene Ludwigshafen gehörten zu den Boomregionen des wilhelminischen Zeitalters. Von den zahlreichen Unternehmen, die damals zu Akteuren auf dem Weltmarkt wurden, dürfte die Badische Anilin- und Soda-Fabrik, kurz BASF, das wohl bekannteste sein. Durch die Industrialisierung, die nach immer neuen Fabrikhallen, Verwaltungs- und Wohngebäuden verlangte, machte Speers Vater ein Vermögen.
Speers Erinnerungen an seine Vorfahren sind bisweilen verklärend und widersprüchlich, darauf hat schon Gitta Sereny hingewiesen. Offenbar hielt er – und mit ihm sein Verleger Wolf Jobst Siedler und Redakteur Joachim Fest – es für wünschenswert, sich in eine lange bürgerlich-wohlhabende Tradition zu stellen, denn daraus ließ sich das spezifische Narrativ konstruieren, Speer repräsentiere eine Welt, die »irgendwie« in die Nähe des Nationalsozialismus geriet, mit dem er »eigentlich« – wie weite Teile des Bürgertums – nichts zu tun habe. Ungereimtheiten tun sich vor allem bei Berthold Speer auf, dem Großvater väterlicherseits, von dem Speer in den Erinnerungen behauptet, er sei »zwar früh« verstorben, habe aber als »wohlhabender Architekt« genügend Mittel für die Ausbildung der vier Söhne hinterlassen.5 Davon blieb später nur der frühe Tod (»angeblich Selbstmord«); das Erbe reichte nicht für ein Studium, sodass Speers Vater seine Karriere als Lehrling in einem Architekturbüro begann.6 Als Sereny Speer darauf ansprach, erwiderte er nur schulterzuckend: »Ich hielt es nicht für wichtig. Warum soll man in einem Buch auf solche persönlichen Dinge eingehen?«7 Selbstverständlich wusste Speer, dass es einen Unterschied macht, ob ein Großvater mittellos im Selbstmord endet oder als wohlhabender Versorger seiner Kinder, daher präsentierte er der Öffentlichkeit ein möglichst harmonisches Erinnerungsgebäude.
Auch ohne eine Erbschaft machte Speers Vater eine stupende Karriere. Neunundzwanzigjährig eröffnete er 1892 in Mannheim sein eigenes Büro. Der junge Architekt erhielt reichlich Aufträge und wurde binnen weniger Jahre ein wohlhabender Mann. Er investierte bevorzugt in Immobilien, die weitere Einnahmen generierten. Als Speers engster Mitarbeiter Rudolf Wolters die Familie 1943 besuchte, schildert er den Senior als »eine originale Figur; mit seinen 80 Jahren hat er eine Vitalität, die jeder Beschreibung spottet. Er ißt, trinkt, raucht dicke Zigarren und läuft jeden Tag stundenlang spazieren. (…) Er ist vollkommen anders als sein Sohn, sowohl in Figur, Gesicht und Gehabe. Er hat in seinem Leben viel gebaut und, wie er freimütig bekennt, seinen Beruf als Instrument zum Geldverdienen angesehen. ›Was ich gemacht habe, war mir gleichgültig, die Hauptsache war, ich mache Geld.‹ Das Honorar habe er oft durch Prozesse erstritten.«8
Auch Speers Großvater mütterlicherseits war ein Selfmade-man (Speer benutzte diesen Begriff9). Hermann Hommel, der »Sohn eines armen Schwarzwälder Försters«, wie Speer in den Erinnerungen schreibt, war als Inhaber eines Handelshauses für Werkzeugmaschinen reich geworden. So besaß Speers Mutter aus eigener Familie stets Geld im Überfluss, ihr Erbteil war wertvoller als das erarbeitete Vermögen ihres Mannes. Hochzeit und Umzug nach Mannheim, seinerzeit eine von rauchenden Schloten geprägte Industriestadt, bedeuteten den Abschied vom eher idyllischen Mainz ihrer Jugend. In ihrer neuen Rolle als Ehefrau stellte sie ihren Reichtum auf eine Weise zur Schau, für die der Begriff »conspicuous consumption« geprägt worden ist. Wie viele Aufsteiger der zweiten Generation versuchte sie einen Lebensstil zu pflegen, der als Signum tradierten Wohlstands erschien: Es gab zwei Autos mit Chauffeur, »französische und italienische Möbel, seidene Polsterbezüge, bestickte Vorhänge und natürlich einen ganzen Stab von Bediensteten: Köche in Weiß, Hausmädchen in Schwarzweiß und Butler und Lakaien in lila Livreen«, erinnerte sich Speer, »mit silbernen Knöpfen, die ein Wappen trugen, zu dem wir übrigens gar kein Recht hatten«.10 Auch häufige Empfänge gehörten dazu. Speer selbst behauptete gegenüber seinen Kindern, dass er diese wenig geschätzt, aber die »schöne Dekoration« genossen habe.11 Überdruss ist in den zeitgenössischen Texten dann zu spüren, wenn solche Veranstaltungen mit seinen privaten Plänen kollidierten.12
Während die Mutter zu »repräsentieren« suchte, betonte Speer selbst wiederholt die Sparsamkeit seines Vaters.13 Speers Neffe Wolf, der älteste Sohn seines Bruders Hermann, erlebte immer wieder Diskussionen um Geld, das die Großmutter verlangte, der Großvater aber nicht rausrücken wollte.14 Andererseits hieß es in der Familienüberlieferung, dass auch auf der mütterlichen Seite bei allem Reichtum bisweilen eine knauserige Sparsamkeit präsent blieb. Die Großmutter in Mainz etwa »zählte die Zuckerwürfel in der Küche«, berichtete später Speers Frau Margarete; sie habe eine »abschließbare Zuckerdose« benutzt.15
Die Stimmung im Haus der Großeltern fand Wolf Speer »distanziert«, »geziert« und künstlich. Man habe sich bemüht, Witze zu erzählen, um Heiterkeit zu erzeugen. Auch von Gästen sei dies unausgesprochen erwartet worden.16 Ähnliches findet sich in Schilderungen von Speer als Vorgesetztem, namentlich wenn es um gemeinsame Abende mit seinen Mitarbeitern geht.17
Während seine Familie sowohl in den Erinnerungen als auch in den Spandauer Tagebüchern allenfalls beiläufig erwähnt wird, erweckte Speer in Interviews häufig den Eindruck, als wolle er sich etwas von der Seele reden. Gitta Sereny hat kolportiert, wie Albert zwischen dem kleinen Bruder Ernst (im Schmonzettenton Serenys »ein süßer kleiner Schelm« und Liebling des Vaters) und dem älteren Bruder Hermann (laut Sereny »ein robuster Junge« und Liebling der Mutter) kaum elterliche Zuneigung erhalten habe.18 Obendrein sei er von seinen Brüdern gequält worden. Auch Joachim Fest und anderen Gesprächspartnern gegenüber hat Speer sich immer wieder über die Gefühlskälte seiner Eltern beklagt. »Die einzigen Leute, die mich mochten«, behauptete er 1978, »waren die Mitarbeiter im Büro meines Vaters. (…) Zwischen acht und dreizehn war ich der Liebling des Büros. Sie stellten extra einen kleinen Tisch für mich auf.« Und weiter: »Die einzige Wärme, die ich zu Hause je fühlte, ging von unserer französischen Gouvernante Mademoiselle Blum aus.« Er vergaß nicht hinzuzufügen: »Die war übrigens Jüdin.«19
Erzählungen wie diese sollten die Distanziertheit seines Charakters erklären und ihn zugleich als unprätentiösen Menschen erscheinen lassen, der sich an Standesunterschieden nicht störte. Das von Speer gezeichnete Bild seiner Kindheit soll Mitleid erregen: der einsame, unverstandene, dabei doch ganz normale und so begabte Junge. Was daran stimmt, lässt sich kaum mehr beurteilen. Auch hier tritt das Romanhafte des Rückblicks hervor, das den »Helden« gegen alle Widrigkeiten aufsteigen lässt. Die überlieferten Briefe seiner Teenager-Jahre an seine spätere Frau, Margarete Weber, die Speer in den 1970er-Jahren für einige Freunde und die Familie abschreiben und vervielfältigen ließ, enthalten jedenfalls keine Hinweise darauf, dass er unter den familiären Verhältnissen gelitten hätte – weder Eltern noch Brüder scheinen darin überhaupt erwähnenswert.
Im letzten Kriegsjahr 1918 zog die Familie von Mannheim nach Heidelberg in eine geräumige Villa mit fünfzehn Zimmern, die Speers Vater auf einem dreißigtausend Quadratmeter großen Grundstück oberhalb des Schlosses als Geldanlage und Sommerhaus errichtet hatte. Ein Grund für den Ortswechsel war, dass auf dem großen Grundstück Lebensmittel angebaut werden konnten, die im letzten Kriegsjahr knapp wurden. Die nahe gelegenen Waldgebiete boten zudem eine gesündere Umgebung als die Industriereviere Mannheims.
Ob Speer in dieser Zeit schon irgendwelche politischen Überlegungen anstellte, wissen wir nicht. In den Erinnerungen spricht er von seinem Hindenburg-Bild: Der Feldmarschall sei für ihn seit der Schulzeit »die Verkörperung der Obrigkeit schlechthin«20 gewesen. Während Rudolf Wolters als Fünfzehnjähriger die Niederlage des Ersten Weltkrieges und den Untergang des Kaiserreichs als »unfassbares Geschehen« empfunden haben will, »als ein Ereignis, das mir zum ersten Mal bewusst machte, dass es keine festen Fundamente für die Welt gab, in die ich hineingeboren war«,21 sind dergleichen elementare Projektionen von Speer nicht überliefert.
In Heidelberg mit seiner jahrhundertealten Universität, den gelehrten Zirkeln, Künstlern und Professoren musste die zugezogene Familie erst Zugang zu den tonangebenden Kreisen finden. Geld war auch hier hilfreich. In das Heidelberger Haus zog Speer 1966 nach seiner Entlassung aus dem Spandauer Kriegsverbrechergefängnis, es wurde seither bekannt durch zahlreiche Fotoreportagen und Filmaufnahmen. Nur wenige der zahllosen Besucher erwähnten in ihren Berichten nicht ihren Eindruck vom Anwesen am Schloß-Wolfsbrunnenweg 50, wie die Adresse bis heute lautet.
Speers Schilderungen der ersten Jahre in Heidelberg heben vor allem seine Leidenschaft für das Rudern hervor. In den zeitgenössischen Briefen an Margarete Weber berichtet er wiederholt darüber, etwa von den Schwierigkeiten, »im Zweier« auf dem Neckar-Hochwasser zu manövrieren.22 Aus diesen Briefen erhalten wir manche Hinweise auf die Weltsicht und den Alltag dieser Jahre. Sie erzählen von einer bequemen und zwanglosen Jugend, trivialen Schulerlebnissen, Rudern und Radfahren, Konzert- und Theaterbesuchen. Wir erfahren einiges darüber, wie Speer sein Schulleben charakterisiert sehen wollte. Als er sich im Juni 1922 einen doppelseitigen Leistenbruch zuzog und operiert werden musste, schilderte er ausführlich seine Versuche, die Rekonvaleszenz so lange wie möglich auszudehnen. Er war vom Turnen und Sport zunächst befreit, allerdings nur für ein Drittel des Schuljahres. Als er weiterhin nicht erschien, habe der Direktor mit Karzer gedroht. Daraufhin habe er sich zu »einer großen Autorität, Professor Hirschel«, begeben. Der habe Verständnis gezeigt und ihm (»ohne mich untersucht zu haben«) das gewünschte Attest ausgestellt.23 Die Schnurre ist ein Beispiel für Speers Freude am »Organisieren« zum eigenen Vorteil.
Seinen Kindern hat er später vom Beginn der Partnerschaft zu Margarete Weber erzählt. Dabei schimmert dieselbe merkwürdige Unbeholfenheit durch wie bei allen seinen Versuchen, über Gefühle zu sprechen oder zu schreiben. Er sei »noch nicht ganz 17 Jahre« alt gewesen, als er zwei Mädchen [Margarete und eine Freundin, MB] kennengelernt habe, die »selbstbewusst und unnahbar zur Schule« gingen.24 »Das kleine Stückchen Weg wurde bald ein gemeinsamer – und daraus ein sehr langer Weg von 30 Jahren (…) wenn ich nur nicht so schüchtern gewesen wäre dem schönen Geschlecht gegenüber.« Bald habe er Margarete unter dem Vorwand, ihren Vetter zu besuchen, im Haus der Schwiegereltern getroffen. Gemeinsam unternahmen sie dann Fahrten, etwa nach Mannheim ins Theater.25 »Wie freute ich mich, wenn ich in der Pause eine Schachtel Pralinen kaufen durfte; aber welch freudige Erregung durchschauerte mich, als einmal, bei einer besonders tragischen Stelle des gespielten Stückes, meine heutige Frau meine Hand ergriff.«26 Margarete sei »zurückhaltend« gewesen27, er selbst »ungeschickt«: »Warum nahm ich nicht einfach eine Tanzstunde und alles hätte sich in dem nun einmal seit Generationen vorgeschriebenen Rahmen entwickelt. Gegen Tanzen hatte ich eine Abneigung, das kam aus dem Widerspruchsgeist zu den Gesellschaften in unserem Haus.«28 Diese Formulierung von 1973 zeugt von rückblickender Uminterpretation. Tatsächlich versuchte er 1922 privaten Unterricht zu organisieren, bis er Margarete Ende November endlich von seiner ersten Tanzstunde berichten konnte:29 »Du meinst, ich soll mit Deiner Cousine üben. Ich habe schon daran gedacht, aber nach meiner Ansicht wäre es doch am schönsten, wenn Du die Erste wärst, die mit mir tanzst [sic!].«30 Für seine Kinder beschrieb er das so: »Aber je länger ich mit der Verehrten in Kontakt war, umso stärker wurde mein Wille. Sie gab mir keine sichtbaren Zeichen ihrer Gunst, aber trotzdem fühlte ich mich mit ihr verflochten.«31
Das Ehepaar Speer sprach Sereny gegenüber auffällig sachlich über die Entstehung ihrer Partnerschaft. »Er verliebte sich«, habe Margarete Speer betont: »Ich war zunächst bloß neugierig. Später habe ich auch – langsam – geliebt.«32
Margarete Webers Vater Friedrich war zwar bei Weitem nicht so reich wie die Eltern Speers, aber als selbstständiger Handwerker mit mehreren Angestellten sowie als zeitweiliger Angehöriger im Heidelberger Stadtrat gehörte er durchaus zu den tragenden Mitgliedern der Heidelberger bürgerlichen Gesellschaft. Familie Weber pflegte ein handwerkliches Alltagsleben, das Speer nach eigener Beschreibung gerade wegen der Unterschiede zu seinem Elternhaus anzog.
Speer hat die Widerstände beider Elternhäuser gegen seine Verbindung mit Margarete Weber rückblickend recht dramatisch geschildert. Das erscheint deutlich übertrieben. Zwar sandten Margaretes Eltern die Tochter 1922 für ein Jahr in ein Freiburger Mädchenpensionat. Aber dass dies eine bewusste Trennung von Albert Speer herbeiführen sollte, erscheint wenig plausibel, denn Speer verkehrte während des Freiburger Jahres weiterhin freundlich in Margaretes Elternhaus. Zugleich begann der Briefwechsel, das erste Schreiben datiert vom 6. Mai 1922.33 Die Korrespondenz ist geschrieben in dem Bewusstsein, dass vor der Adressatin die Pensionsvorsteherin ihren prüfenden Blick auf die Zeilen werfen würde.34 Der Kontakt wurde also erschwert, aber nicht unterbrochen. Eingriffe von Margaretes Eltern sind nicht überliefert.
Die in den Briefen wiederholt beschriebene Haltung der Familie Weber ist wohlwollend, stets von warmer Freundlichkeit und, zumal was Speers künftige Schwiegermutter betrifft, von einem zustimmenden Verständnis charakterisiert. Es ist kaum anzunehmen, dass Speer Widerstände nicht zumindest mit einigen Bemerkungen erwähnt hätte. In seinen zeitgenössischen Schilderungen zur Familie Weber ist davon jedoch nichts erkennbar, sie lassen vielmehr eine ehrliche Neigung zur Familie seiner zukünftigen Frau erkennen. Auch später blieb die Verbindung stets familiär und freundschaftlich.
Speers Eltern wiederum sollen mit großer Vehemenz versucht haben, den Kontakt zu Margarete zu unterbinden; das wird in der Retrospektive regelmäßig hervorgehoben. Insbesondere das anfängliche Missfallen von Speers Mutter gegen die Beziehung ist mehrfach überliefert.35 Speer erzählte seiner Familie später, wie er seinen Vater belogen habe, um Geld für eine Fahrt zu Margarete zu erhalten: »Um die Reise in das Pensionat nach Freiburg zu finanzieren, hatte ich meinem Vater erzählt, dass ein Schulausflug zum Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt stattfinden würde. Bereitwillig gab er die dazu notwendige Summe. Im Zug studierte ich im Baedeker alles, was im Städelschen Museum wissenswert ist, um auf Fragen meines kunstverständigen Vaters präpariert zu sein. Es war mein erster Besuch im Freiburger Pensionat, natürlich musste den damaligen Anstandsregeln entsprechend ein [eingeweihter, MB] Verwandter anwesend sein, um die Möglichkeit zu erhalten, mich mit meiner Freundin außerhalb des Pensionats zu bewegen. Wir machten einen Spaziergang durch die Vororte Freiburgs bis zu einem Restaurant, wo ich sie zu Kaffee und Kuchen einlud.«36
Allerdings scheint die Opposition der Eltern Speers zumindest in ihrem Ausmaß überzogen dargestellt, denn entscheidende Konsequenzen gab es nicht. Albert Speer und Margarete Weber wurden ein Paar und blieben es bis zu seinem Tod. Nach der Heirat wurde Albert weiter aus dem Familienvermögen finanziert. Die Eltern behandelten ihren Sohn mit derselben Großzügigkeit wie zuvor und brachten Anfang August 1930 auch zu seinen Gunsten einen Teil ihres Vermögens in der Liechtensteiner »Stiftung Tremonia« unter.37 Der ältere Bruder Hermann beschwerte sich später sogar, dass deren Satzung Albert »eine fast diktatorische Rolle« zuerkannt habe.38 Im Übrigen lässt die Überlieferung keinen Zweifel daran, dass Speer unabhängig von seinen Entscheidungen stets auf die Unterstützung des Elternhauses zählen konnte. Gerade in den schwierigen Jahren zwischen Kriegsende 1918 und Hyperinflation 1923 sind Wohlstandssicherung, Geldorganisation und Vermögenserwerb insbesondere beim Vater zentrale Motive.
Die Briefe an Margarete Weber sind zeittypisch-harmlose Versuche einer Annäherung unter Beobachtung. Speer spricht vom »Schreiben über die Schwierigkeit Briefe zu schreiben« und versucht auf alterstypische Weise, »originell« zu sein, formuliert etwa im Stil eines Filserbriefes (»ier … Albert Sber«)39 oder liefert Varianten, aus denen Margarete die ihr passende Formulierung wählen sollte.40
Aus der Anrede »Liebes Fräulein Gretel Weber!«41 wird im Oktober 1922 »Liebe Gretel«: »Daß wir uns duzen, weiß (außer Deinen Eltern selbstverständlich) bis jetzt noch niemand in der Familie Weber. Wenn es Dir recht ist, so sagen wir davon vorläufig noch nichts. Dann wird es, wenn Du heimkommst und wir uns feierlich begrüßen, sehr erstaunte Gesichter geben, die gewiß sehenswert sein werden.«42
Schon damals zeigte sich Speers Neigung, Anweisungen zu formulieren, wie sie später auch seine Briefe aus Spandau prägen sollten: »Nun sei recht brav, verliere keinen Schirm, setze Dich gerade hin, vergesse nicht, Dein Taschentuch zum Tanzen oder ins Theater mitzunehmen, lerne eifrig, fühle Dich nicht verpflichtet, mir schon diese Woche zu antworten, sei recht fromm, sei recht fleißig, schlafe gut, wache und stehe morgens frühzeitig auf, nächste Woche werde ich Dir wieder schreiben.«43
Das Trennungsjahr 1922/23 war auch die Zeit des Vorlaufs zu Speers Abitur. Rückblickend betonte er, dass vor allem die Nähe zu Margarete Weber ihn motiviert habe.44 Zwar kokettierte er in seinen Briefen gern damit, dass er keine Zeit auf die Prüfungsvorbereitungen verwende,45 aber die Schulnoten – das vorherige Schuljahr hatte er mit der Gesamtnote »hinlänglich« abgeschlossen, »Fleiß und Aufmerksamkeit« waren sogar »ungenügend«46 – besserten sich, namentlich dank seines Mathematiklehrers (»dessen anerkannter Liebling ich seit zwei Jahren bin«), sodass, wie er an Margarete schrieb, »sie mir das Abitur nicht mehr verweigern« können.47 Speer erhielt deutlich bessere Noten, als nach den Leistungen der Vorjahre zu erwarten gewesen war.48
Als Ende Februar 1923 die Prüfungen anstanden, gab ihm Margarete Webers Tante einige »Regeln« des Aberglaubens mit auf den Weg, die er detailliert aufzählt, um zu ergänzen: »Meine eigenen Vorsichtsmaßregeln waren schon viel konkreter. Ich ließ mir meinen schwarzen Anzug als Abitursanzug nach eigenen Angaben umbauen. In die inneren Hosennähte, unter dem Ärmel und in der Innenseite der Weste wurden Taschen eingebaut, um einen sicheren Transportplatz für meine Spickzettel zu schaffen. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass vor Beginn der Prüfung untersucht wurde.« Er berichtet weiter, wie er Mitschülern Nachhilfe in Mathematik gab und überhaupt die Abiturprüfung eher als ein kommunikatives Gemeinschaftsunternehmen der ganzen Klasse erschienen sei. »Wenn Du zurück bist, werde ich Dir meinen Anzug, Spickzettel und sonstige verbotene Hilfsmittel in Praxis vorführen.«49
Mit dem Abitur stellte sich die Frage, welchen Berufsweg Speer einschlagen wollte. Die Situation schilderte er 1953 so: »Die Eltern waren mit dem Zeugnisse zufrieden, die zukünftigen Schwiegereltern auch. Nun begann die Fahrt ins Studentenleben. Was ich werden wollte, war mir schon lange klar: Ich wollte Mathematik studieren. Was ich damit anfangen könne, war mir allerdings höchst nebelhaft. (…) Gegen diese Absicht wandte sich aber mein Vater mit einleuchtenden Gründen und ich wäre nicht ein mit der Logik vertrauter Mathematiker gewesen, wenn ich ihm nicht recht- und nachgegeben hätte. Am nächsten lag mir, nach der Mathematik, der Beruf eines Architekten, von dem ich seit früher Jugend so viel eingeatmet hatte, und so entschied ich mich zur großen Freude meines Vaters, der Dritte in der Architektengeneration zu werden. Ich war glücklich, ihm diese Freude machen zu können, nachdem ich ebenso entschlossen war, in einem anderen Punkt verschiedener Meinung zu bleiben: es war so gut wie beschlossen, das Margret und ich eines Tages heiraten werden.«50
Ob es tatsächlich eine intensive Berufsdiskussion zwischen Vater und Sohn gab, wissen wir nicht. Die Entscheidung für das Architekturstudium brachte jedenfalls die Aussicht mit sich, das väterliche Büro und die jahrzehntelangen Verbindungen zu wichtigen Auftraggebern übernehmen zu können. Wie er an seinem Vater sehen konnte, ließen sich damit hohe Einkünfte erzielen – etwas, worauf er Zeit seines Lebens achtete. Was auch immer für Speers Berufswahl ausschlaggebend gewesen sein mag: Nach allem, was wir wissen, identifizierte er sich fortan mit seinem Fach. Zugleich gilt es gegen die Behauptung von einer »Lebensentscheidung Architekturstudium« zu betonen, dass Speer später zu keinem Zeitpunkt gezwungen war, irgendeine Aufgabe anzustreben, nur weil er in diesem Beruf arbeitete.51 Ganz im Gegenteil dürfen wir vermuten, dass Speer, wie seine Ambitionen und seine Engagements zwischen 1930 und 1945 im Einzelnen zeigen werden, auch mit jedem anderen Studienfach »nach oben« gedrängt hätte. Hitlers Affinität zur Architektur erleichterte lediglich die Erfüllung seines Ehrgeizes.
Studium und Assistentenzeit
Im Herbst 1923 nahm Speer das Studium in Karlsruhe auf. Er zeigte sich bald enttäuscht. »Die Professoren sind langweilig, die Lehrveranstaltungen dumm, die Stadt ein entsetzliches Provinznest«, klagte er in einem Brief an Margarete: »Ich hasse es.«52 Zum Sommersemester 1924 wechselte er an die Technische Hochschule München. Hier traf er auf Lehrer, »bei denen«, wie er später an seine Kinder schrieb, »das Lernen Spaß machte«.53 Auch Rudolf Wolters begegnete er in dieser Zeit; eine mit wenigen Unterbrechungen lebenslange Verbindung begann, die für Speer über die Jahre von eminenter Bedeutung werden sollte.54
Speers Erinnerungen an die Münchner Zeit lesen sich wie Skizzen eines unbeschwerten Studentenlebens: »Wir arbeiteten nicht zu fleißig, aber auch nicht zu nachlässig, gerade so viel, dass es zu einer guten Prüfung ausreichen musste. Außerdem widmeten wir uns der Betrachtung von Kunst und Natur. (…) Um die Wahrheit zu sagen, lebte ich damals für die Ferien.«55
Speers Schilderungen der 1920er-Jahre, zeitgenössisch wie rückblickend, sind geprägt von der Sehnsucht nach Natur, »einfachem Leben« und selbstbestimmter Freizeit, nach Bergen zum Wandern und Skifahren, Flüssen und Seen zum Rudern, der Weltflucht mit seiner Partnerin in die Einsamkeit der Natur: »wir verbrachten viele Tage, ja sogar Wochen allein in den Bergen«.56 Diese Vorlieben decken sich mit den »grünen« Wurzeln des Nationalsozialismus – einer weitverbreiteten Suche nach dem »Reinen«, »Natürlichen«, der Flucht »aus grauer Städte Mauern« –, die sich dann bei den Ideologen dieser Bewegung zum Rausch von Blut und Boden braun verfärbten.
Speer sagte später, er habe als Student monatlich einen Wechsel über 16 Dollar von den Eltern erhalten.57 Davon ließ sich in den Weimarer Jahren komfortabel leben.58 Rudolf Wolters, immerhin Neffe des wohlhabenden Stahlindustriellen Peter Klöckner, berichtet, er habe Speer »längere Zeit hindurch am 20. jeden Monats angepumpt und am nächsten Ersten dann zurückgezahlt«.59 Speer genoss die Freiheiten des Wohlstands und ließ, so berichtet Wolters, weniger begüterte Kommilitonen Routine-Aufgaben des Studiums für sich erledigen.60
Das Dollarvermögen entstammte dem Erbe seiner Mutter. 1922 sei »das Geschäft des kürzlich verstorbenen Großvaters« – wie Speer seinen Kindern 1953 berichtete –»[a]uf Drängen der Brüder meiner Mutter« verkauft worden.61 Sein Vater habe sich angesichts der »wirtschaftlichen Verwirrung der Inflation« zunächst dagegen gesperrt.62 »Aber als der Otto-Wolff-Konzern ein Angebot machte, den Handels- und Fabrikationsbetrieb in Dollarwährung zu kaufen, konnte sich mein Vater nicht mehr dem Drängen der drei Schwager erwehren, und nach zähem Verhandeln kam ein Vertrag zustande, der uns zwar einige Häuser in Köln, München und Mainz erhielt, der aber die Fabrik und das Geschäft für eine Million Mark an den Otto-Wolff-Konzern übereignete. Diese eine Million Mark blieb, als wertbeständig in Dollarkurs umgerechnet, bei den Konten stehen und die vereinbarten Zinsen wurden ebenfalls in jeweils umgerechneten Kursen bezahlt.« Damit konnte die Familie »inmitten der nun beginnenden Inflation (…) wieder« – gemeint ist: weiterhin – »in großem Stil« leben.63
Im Sommersemester 1925 bestand Speer sein Vorexamen und wechselte im Herbst an die Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg. Hier bemühte er sich um Aufnahme ins Seminar von Hans Poelzig, der seinerzeit den besten Ruf genoss. Doch Poelzig akzeptierte nur eine begrenzte Zahl von Studierenden und Speer gehörte nicht dazu. Er ging zunächst zu Erich Blunk und wechselte dann zu Heinrich Tessenow.64 Wolters, der schon seit Herbst 1924 in Berlin war, hatte ebenfalls Tessenow, »den Philosophen unter den Architekten seines Zeitalters«,65 gewählt. Er war begeistert von dessen Fähigkeit, »seine Schüler zum Einfachen, Unkomplizierten und Allgemeinen hinzuführen«.66 Auch Speer spricht rückblickend mit respektvoller Bewunderung von seinem Lehrer. Statt vom Katheder zu dozieren, habe Tessenow sich zwischen die Studierenden gesetzt, die Atmosphäre sei »sehr informell und entspannt« gewesen, ein markanter Unterschied zum universitären Stil der Zeit. »Er sprach mit uns nicht nur über Architektur, sondern auch über das Leben, die Liebe zur Natur, zur Landschaft und auch zum eigenen Land.«67
Ein anderer Student, Carl Culemann, beschrieb die Atmosphäre, die bei den Lehrveranstaltungen herrschte, so: »Tessenow knetet die Menschen nach seinem Bilde, nimmt Eitelkeit, vorschnelles Selbstbewußtsein, begabtes aber gesetzlos spielendes Gestalten, macht klein und bildungsfähig, baut dann wieder auf. Den Architekten, wie er sein soll, gewissenhaft, sauber, klar, bewußtes Beherrschen der Form.«68 Culemanns Notizen sind auch sozialgeschichtlich bemerkenswert. Wie viele seiner Kommilitonen, zu deren Alltag materielle Not gehörte, wohnte er »in Massenquartieren des Studenten-Heims«. Zehn Mark Miete im Monat kostete seine Unterkunft in einem »Barackenlager« der Hochschule. Für den Autobesitzer Speer mochten zehn Mark einer Tankfüllung entsprechen.
Speer und Wolters schlossen ihr Studium im November 1927 mit einer Diplomarbeit ab.69 »Albert Speer Dipl. Ing.« stand bis zum Lebensende auf seinem Briefkopf. Gemeinsam besuchten die beiden Studienfreunde nun an der Akademie der Künste Tessenows »Meisterklasse und Privatatelier«.70 Im Privatatelier waren die beiden als »Gehilfen« tätig, von denen Tessenow zeitweise bis zu zehn beschäftigte. Speer begann am 15. November 1927 und blieb bis zum April 1929; danach erhielt er – im Unterschied zu Wolters, der aufgrund mangelnder Aufträge gehen musste – das Angebot, für Tessenow als Hilfsassistent an die Hochschule zu wechseln.71 Wolters hat noch in seinen Lebenserinnerungen mit Verwunderung formuliert, wie Speer vom gemeinsamen Lehrer bevorzugt wurde: »Es war in gewisser Hinsicht auch für den von der Hobelbank zum Hochschullehrer aufgestiegenen Tessenow typisch, dass er den ähnlich unkonventionellen Außenseiter Speer anderen, durch bessere Zeugnisse und Leistungen ausgewiesenen Bewerbern vorzog.«72
Später schrieb Speer an seine Kinder: »Meine Begeisterung und Hingabe an den verehrten Meister wird wohl auch ihm nicht verborgen geblieben sein, und als er seinem langjährigen Assistenten im Seminar der Technischen Hochschule die Möglichkeit gab, sich als Architekt selbständig zu machen, fiel seine Wahl auf mich als dessen Nachfolger. Mein Vorgänger war etwa 40 Jahre und ich gerade 23 Jahre alt.73 Ich konnte mich rühmen, der jüngste Assistent an den Entwurfsseminaren zu sein. Das Gehalt war auch nicht schlecht. 300 Mark bei nur drei Tagen Arbeit und dazu noch 5 Monate Ferien, die auch bezahlt wurden, das entsprach … einer Bezahlung von rd. 1000 Mark im Monat, wenn man von einer normalen Arbeitszeit ausgeht. Wenn ich wollte, konnte ich in der freien Zeit selbständig als Architekt tätig sein, und da meine Vorgänger ganz gut nebenbei zu tun hatten, warum sollte ich darum nicht auch manchen kleinen Bau bekommen?«74 Es ist bezeichnend, wie Speer die 300 Mark, die monatlich auf seinem Konto landeten, zu einem »gefühlten« Verdienst von 1000 Mark hochrechnet.75 Die Schilderung wirkt von seinem Wunsch getrieben, den Kindern einen schon immer erfolgreich aufwärts strebenden Vater zu präsentieren.
Angeblich nahm er die Assistentenstelle zum Anlass, die langjährige Partnerschaft mit Margarete Weber durch die Hochzeit zu bestätigen. Es ist unklar, seit wann die beiden zusammenlebten; vermutlich war Margarete regelmäßig in Berlin, seit Speer hier studierte. Die beiden heirateten am 28. August 1928 in einer Kapelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche – da war Speer noch Gehilfe und die Assistentenstelle stand keineswegs in Aussicht.76 Zur Hochzeit eingeladen waren Margaretes Eltern sowie ihr Cousin Fritz, mit dem sie aus den Heidelberger Jahren durch gemeinsame Theater- und Konzertbesuche verbunden waren. Speers Eltern erhielten ein Telegramm: »Wir haben geheiratet, Albert und Gretel«.77
Die Hochzeitsreise mit Faltbooten begann am Tag darauf am Spandauer Schifffahrtskanal. Margarete Speer fuhr im Einsitzer, Albert Speer »wegen des vielen Gepäcks« in einem Zweisitzer. »Damals wussten noch nicht viele Süddeutsche, wie schön die obere Havel mit ihren alten Kiefern, wie blau die Seen Mecklenburgs und wie einsam sie sind. Das war das richtige Gebiet für uns, die wir endlich zu zweit allein sein konnten«, berichtete Speer später. Drei Wochen seien sie unterwegs gewesen: »Immer im Boot und mit einer Ausnahme an Eurer Mutter Geburtstag immer im Zelt übernachtend. Ein Tag war schöner als der andere.«78 Anschließend besuchte das Paar Heidelberg und traf auch für einige Stunden Speers Eltern.79
ENTSCHEIDUNG FÜR DEN NATIONALSOZIALISMUS
Wir haben zusammen die Macht erobert, und wir werden zusammen die Macht gebrauchen.
JOSEPH GOEBBELS, 19331
Am 4. Dezember 1930 sprach Adolf Hitler anlässlich der Berliner Hochschulwahlen in der Neuköllner Hasenheide.2 Mehr als fünftausend Studenten, dazu Professoren, Assistenten und weitere Hochschulangehörige waren erschienen. Hunderte, berichteten die Zeitungen, hätten abgewiesen werden müssen, weil der Saal der »Neuen Welt«, einer der größten der Hauptstadt, dem Ansturm nicht gewachsen gewesen sei. Die Stuhlreihen waren bis zum letzten Platz gefüllt. Irgendwo in dieser Menschenmasse saß auch Albert Speer.
Speer hat diesen Auftritt Hitlers rückblickend als Erweckungserlebnis geschildert. »Hitler erschien, von seinen zahlreichen Anhängern unter den Studenten stürmisch begrüßt. Schon diese Begeisterung machte auf mich großen Eindruck. Aber auch sein Auftreten überraschte mich. Von den Plakaten und den Karikaturen kannte ich ihn in Uniformhemd mit Schulterriemen, mit Hakenkreuzbinde am Arm und einer wilden Mähne in der Stirn. Hier aber trat er in gutsitzendem blauen Anzug auf, auffallend demonstrierte er bürgerliche Korrektheit, alles unterstrich den Eindruck vernünftiger Bescheidung. Später lernte ich, dass er es durchaus – bewusst oder intuitiv – verstand, sich seiner Umgebung anzupassen.«3 Abgesehen davon, dass diese Schilderung stilistisch mehr nach Joachim Fest als nach Albert Speer klingt, steht der Besuch dieser Veranstaltung in der Linie seines schon seit Monaten sichtbaren Engagements für die NSDAP.
Der amerikanische Journalist Louis Lochner hörte zu Jahresbeginn eine ähnliche Rede Hitlers vor Berliner Studenten: »Mein erster Eindruck von ihm war der eines perfekten Schauspielers. Als die Filmkameras auf ihn gerichtet wurden, tat er, als ob er davon keine Notiz nehme, sprach ernst mit seinem Nebenmann Rudolf Heß und begann, als die Kameras weiter drehten, zu schreiben, als ob er einen Entwurf seiner Rede skizzierte. Es war gut gespielt. (…) Ich sah mich um und beobachtete, wie seine jungen Anhänger hingerissen waren, er selbst schien in Trance. (…) Seine Augen schienen alle zu hypnotisieren, die er scharf ansah, aber mich selbst ließ sein Blick unberührt. Ich verließ die Veranstaltung verwundert darüber, wie ein Mann, dessen Sprache keineswegs fehlerfrei war, der schimpfte, tobte und stampfte, junge Intellektuelle so zu beeindrucken vermochte. Gerade sie, dachte ich, sollten doch die offensichtlichen Brüche in seiner Logik erkennen. Denn während er Kriege allgemein verdammte, so rief er doch die Jugend auf, sich für den unvermeidlichen Krieg gegen Deutschlands Unterdrücker vorzubereiten.«4
Es wäre irreführend, sich Hitler aufgrund der in Filmen und Dokumentationen mit dramaturgischer Absicht gewählten Ausschnitte als stets stundenlang tobenden Brüllkopf auf der Bühne vorzustellen. Er baute seine Reden rhetorisch geschickt auf und das von Lochner geschilderte Auftrumpfen und Lautwerden war ein geübtes schauspielerisches Mittel, das Hitler gezielt einsetzte und das keineswegs einen Verlust seiner Selbstkontrolle anzeigte. Hitlers politischer Instinkt und seine Fähigkeit, sich auf ganz unterschiedliche Zuhörer einzustellen, war bekanntlich ein Schlüssel für die Anerkennung und den Jubel, den ihm seine Auftritte einbrachten. Ob Arbeiter oder Industrielle, Künstler oder, wie hier, die akademische Jugend: Hitler sprach die gemeinsamen nationalistischen Empfindungen an und traf dabei einen Ton, der ihn glaubwürdig und authentisch erscheinen ließ.
An jenem Dezemberabend in der Hasenheide verkündete Hitler wie seit Jahren seine Ideen von völkisch-rassischer Einheit und dem Wettbewerb mit anderen Völkern.5 Er behauptete, seit zwölf Jahren werde die Regierung von »Minderwertigen« geführt, und prophezeite den Sieg von »neuen heroischen Ideen« – »Die Besten werden kommen und werden das Volk zusammenschließen«. Hitler zeichnete, so der Völkische Beobachter, »das grandiose Bild dieser Besten unseres Volkes, die sich schon jetzt in der Partei zusammengeschlossen haben und opfernd in der S.A. und S.S. kämpfen«.6 Sehen wir Speers Konsequenzen, dann ist dies der Kern seines Erweckungserlebnisses: Offenbar wollte er zu diesen »Besten« gehören, Teil dieser Elitebewegung sein, so wie Hunderttausende Deutsche seiner Generation.
Jahrzehnte später noch behauptete Speer, sich vor allem an das Gefühl zu erinnern, er habe nach Hitlers Rede »allein sein« müssen. »Ich hatte unser kleines Auto in der Nähe geparkt; auf dem Weg dorthin war die Straße voller Menschen … Mein Kopf summte. Ich setzte mich ins Auto und fuhr aus der Stadt hinaus, in den Wald. Und dort machte ich einen langen Spaziergang.«7
Bei seinen späteren Recherchen, als er die Rede für die Erinnerungen nachlas, sei ihm das Wort »Minderwertige« aufgefallen. Man müsse sich, sagte er Gitta Sereny, »die Atmosphäre in der Halle und was Hitler insgesamt sagte« vergegenwärtigen. »Glauben Sie wirklich, ein einziges Wort – selbst wenn es mir aufgefallen wäre, und das ist es offensichtlich nicht – hätte etwas geändert?«8 Es ist merkwürdig, dass diese Rechtfertigung bislang kaum näher beachtet wurde. Es lohnt ihr nachzugehen. Denn Hitler predigte und Speer hörte an diesem Abend sehr viel mehr als nur ein einzelnes anstößiges Wort.9
Was hörte Speer noch? Da waren zunächst die üblichen Glaubenssätze, die Hitler als ewige Wahrheiten ausgab, etwa, dass »der Idealismus (…) den Materialismus naturnotwendig überwinden« müsse.10 Hitler wetterte gegen die »verkalkte Gesellschaftsordnung«, in der Menschen mit »inneren Höchstwerte[n]«, die selbst unter Spartakisten zu finden seien, »vom Untermenschentum organisiert werden«. Der Begriff »Untermenschentum« stand hier für die kommunistische Führung, konnte aber leicht auf die demokratische Gesellschaft erweitert werden, die dergleichen zuließ.
Eindeutig bereitete Hitler seine Zuhörer auf Kampf und Krieg vor: »Unser Volk muss sich mit seinem ganzen Krafteinsatz den Völkern gegenüberstellen, denn nicht mit der besten Wirtschaftstheorie und guter Ware setzt sich ein Volk durch, sondern nur, wenn es gewaltigsten Lebenseinsatz in die Waagschale werfen kann. Das Schwert hat noch immer zuletzt entschieden. Dazu müssen wir die Wunden im Volkskörper schließen«.11 Das war die Imagination des homogenen völkischen Rassenstaates, die Hitler schon in Mein Kampf formuliert hatte. Es war zugleich der Ruf nach Exklusion, standen doch all jene, die dem eigenen Rassenbild nicht entsprachen, für die »Wunden« im »Volkskörper«. Die Vereinigung der »arischen« Menschen Mitteleuropas zur kampfbereiten, gewaltsam sich »bewährenden« Volksgemeinschaft – auch dieser Gedanke war schon in Mein Kampf zu lesen. Hitler sprach vom »ewige[n] Band der Gemeinsamkeit unseres Blutes«, appellierte an die fünftausend Akademiker und Studenten im Saal, die vom Bürgertum mitverschuldete »Kluft zu beseitigen, die durch unser Volk geht«, und der Idee des völkischen Rassismus zu folgen. Das war eine unmissverständliche Botschaft.
Welcher Ton die Szene beherrschte, lässt sich an der Wortwahl erahnen, mit welcher Der Angriff berichtete. Dort heißt es, Hitler und seine »Volksbewegung« seien »zermalmend« über die »Verwesungsprodukte eines zermorschten, zusammenbrechenden Systems« hinweggegangen, zugleich sei der Jubel »orkanartig« gewesen, »nicht endenwollende Heilrufe« und ein »einziger Jubelschrei aus 5000 jungen Kehlen«.12
Um die Atmosphäre zu illustrieren, die Speer erfahren und in der er selbst mitgejubelt haben mag, hilft ein Blick auf die Seite derjenigen, die diesen Enthusiasmus nicht zu teilen vermochten. Über den Schauspieler Emil Jannings erhielt Carl Zuckmayer im April 1932 vier Karten für eine NSDAP-Veranstaltung zur Reichspräsidentenwahl im Sportpalast. Neben seiner Frau lud Zuckmayer seinen Verleger Gottfried Bermann und dessen Frau Brigitte Fischer ein. Bermann und die Familie des Verlegers Samuel Fischer standen für alles, was die Nationalsozialisten bekämpften: offenes Denken und freie Literatur, demokratische Haltung, republikanisches Engagement; darüber hinaus zählten sie nach NS-Kategorien zur »jüdischen Rasse«.
Erst beim Eintreffen bemerkten die vier, worauf sie sich da eingelassen hatten. Mit Jannings Ehrenkarten wurden sie von SA-Männern in die sechste Reihe eskortiert. Umgeben von Tausenden jubelnder NS-Anhänger erkannte man sie auf ihren Plätzen nahe der Tribüne bald (»Da sitzt der Zuckmayer von Ullstein!«). Zuckmayer selbst hat die Szene so beschrieben: »Alles erhob sich, und unterm langsamen Vorbeimarsch der Hakenkreuzfahnenkompanien sang die ganze, vieltausendköpfige Menge, alle stehend und mit hocherhobenem rechten Arm, im Hitlergruß, das ›Horst-Wessel-Lied‹. Die ganze Riesenmasse – alle – mit Ausnahme von uns vieren.«13 – »Wenn Blicke hätten töten können«, schrieb Bermann, »hätten wir längst entseelt unter den Stühlen gelegen. Wie aus einem glühenden Stahlblock strömte uns der Haß besonders der umsitzenden Frauen, fast körperlich fühlbar, entgegen«; am Ende gelang es ihnen mit Glück, den heranpolternden SA-Männern zu entkommen.14 Zur Ironie der Geschichte zählt, dass Zuckmayer in den 1970er-Jahren zu den profiliertesten Unterstützern Speers gehören sollte.
Wir wissen nicht, worüber Speer nachdachte, als er in den Stunden nach dem »Erweckungserlebnis« seinen langen Spaziergang unternahm. Hitler hatte sein völkisches Rassendenken und dessen Konsequenzen ausführlich und unzweideutig benannt. Wer die Äußerungen des NS-Führers auf den zahllosen öffentlichen Auftritten nachliest, wird feststellen, dass Speer am 4. Dezember 1930 genau das hörte, was Hitler seit Jahren verkündete und in Mein Kampf geschrieben hatte. Keine Überraschung, keine außergewöhnlichen Thesen. Offensichtlich trafen Hitlers Positionen bei Speer auf längst gehegte und von ihm schon aktiv verfolgte Ansichten.
Die Geschichte vom »Erweckungserlebnis« im Dezember 1930, die Speers Biographen bis in die jüngste Zeit nachgeschrieben haben, ist eine dramatisierende Erfindung – nicht nur, was die effektvolle literarische Inszenierung angeht, sondern vor allem auch, weil Speer zu diesem Zeitpunkt bereits Mitglied in einer nationalsozialistischen Organisation war und wohl schon nach der Septemberwahl seinen ersten Parteiauftrag erhalten hatte. Er hatte also den Kontakt zur NSDAP bereits zuvor etabliert und dabei sogar (»natürlich ohne Honorar«) für sie gearbeitet.15
In seinen Erinnerungen allerdings schildert Speer die entsprechenden Zusammenhänge erst nach dem Kapitel über Hitlers Dezember-Rede.16 Hier erwähnt er, dass er »Mitglied der neugegründeten Kraftfahrervereinigung der Partei« (»N.S.K.K.«) geworden sei.17 Neu gegründet (als »Kraftfahrervereinigung der Partei«) und damit offensichtlich gemeint war jedoch der Nationalsozialistische Automobil-Klub (NSAK), und zwar bereits im Frühjahr 1930.18 Speer betont, »und da das eine neue Organisation war, wurde ich gleich Leiter der Sektion Wannsee, unseres Wohnortes«. Wenn Speer, wie er sagt, zugleich einziger Autobesitzer und Leiter der neuen Orts-Organisation war, dann plausiblerweise irgendwann ab Frühjahr oder Sommer 1930. Dazu passt, dass er an gleicher Stelle vom »Wahlerfolg vom 14. September 1930« spricht, in dessen Folge er bei der »Kreisleitung West« von Karl Hanke das Angebot erhalten habe, eine Villa »als zukünftiges Quartier« der Partei »salonfähig zu machen«.19 Hanke (NSDAP-Mitglied Nr. 102.606) kam aus der Mühlenindustrie (Speer nannte ihn leicht distanzierend »Müllergesellen«) und war zunächst Gewerbelehrer, bevor er sich ganz der NSDAP-Karriere verschrieb. Ihre enge Beziehung begann offenbar in diesem Spätsommer 1930.
Speer besuchte zunächst fleißig weitere Kundgebungen. In den Erinnerungen nennt er etwa den Besuch einer Veranstaltung des »Kampfbundes Deutscher Kultur«, auf der Redner seinen Lehrer Tessenow angriffen.20 Und er ging, wahrscheinlich am 30. Januar 1931, zu einer Veranstaltung mit Goebbels in den Sportpalast, wo der Berliner Gauleiter unüberhörbar die revolutionären Ziele der Nationalsozialisten propagierte.21
Den Besuch der Goebbels-Veranstaltung hat Speer später mit einer besonderen Legende versehen, die sich in der Literatur vielfach wiederholt findet. Nach der Kundgebung, »als die Menschenmenge in Ruhe durch die Straßen abzog, erschien die Polizei zu Pferde, ritt in brutaler Weise in die Menge hinein, ihre Gummiknüppel schwingend«.22 In den zeitgenössischen Berichten findet sich kein Hinweis auf solch dramatische Szenen. Goebbels ließ üblicherweise keine Gelegenheit aus, gegen die Staatsgewalt zu polemisieren, und Gewalt gegen NS-Mitglieder schlachtete er regelmäßig propagandistisch aus. Es ist anzunehmen, dass er jede Chance genutzt hätte, ein »System« anzuprangern, das seine friedlichen Anhänger prügelte. Doch in Goebbels’ Blättern ist nichts zu finden. Nur in einem Bericht ist überhaupt von Polizisten die Rede. In seinen Tagebüchern stoßen wir eher auf das Gegenteil. Goebbels kann sich kaum halten vor Selbstzufriedenheit über die angebliche Wirkung seines Auftritts (»Stürme der Begeisterung. Sprechchöre. Abmarsch. Die Massen in der Potsdamerstr[asse] wie verrückt.«) Für Goebbels gehört die Straße schon den seinen. (»So wild war es noch nie. Das ist die Kraft, die Völker befreit.«23)
Speer dagegen imaginiert eine persönliche Bedrohung – er habe vor den schlagenden Polizisten fliehen müssen. Die Erzählung dient ihm dazu, den Staat zu diskreditieren und sich selbst eine moralische Berechtigung zu Widerstand und antidemokratischem Handeln zu erschreiben: »[D]as war nicht die Herrschaft des Gesetzes, sondern die Gewaltherrschaft des Mobs; und der Mob waren nicht die Zuschauer – wir –, sondern die Polizei – die Polizisten«.24 Seine Schilderung der Szene in den Erinnerungen endet mit dem Antrag auf Parteimitgliedschaft, die somit als eine Art »Notwehr« gegen das vermeintlich willkürliche Regime erscheint.25 Er konstruiert diese Legende, während es doch real die Polizei war, die größte Mühe hatte, die Gegner von Staat, Republik und Demokratie von öffentlichen Gewaltexzessen abzuhalten und das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen.
Am 1. März 1931 wurde Speer mit der Mitgliedsnummer 474.481 als Parteigenosse aufgenommen.26 Außerdem trat er zeitgleich der SA bei, was seinen Entschluss, die nationalsozialistische Bewegung tatkräftig voranzutreiben, ebenso unterstreicht wie anderthalb Jahre später sein Wechsel von der SA zur SS, die sich als rassische Elite verstand.27 Dem »Kampfbund Deutscher Architekten und Ingenieure« schloss er sich ebenfalls an. Bis 1932 hatte dieser »Stoßtrupp« bereits zweitausend Mitglieder; auch nach seiner Auflösung im Mai 1934 galt er als Reservoir einer »Führerauslese für die kommenden großen Staats- und Wirtschaftsaufgaben«.28
Speers Entscheidung für den Nationalsozialismus war offensichtlich Ergebnis eines Prozesses, der im Jahr 1930 greifbar wird. Als Autobesitzer engagierte er sich bereits ab Frühjahr oder Sommer für die Bewegung, nach dem NSDAP-Wahlerfolg vom September arbeitete er für die Partei. Er pflegte seine Parteikontakte, besonders zu Karl Hanke, Monate vor dem später behaupteten Erweckungserlebnis der Hitler-Rede vom Dezember 1930. Am Jahresende stand der Entschluss, endlich auch Parteimitglied zu werden. Offensichtlich sah der Großbürgersohn Speer seit diesem Jahr die NS-Bewegung als Schlüssel für seinen weiteren Lebensweg.
Speer hat später alles darangesetzt, sein damaliges Engagement kleinzureden, es als nebensächlich und irgendwie läppisch hinzustellen. Das Gegenteil ist plausibler: Speer war durchweg engagiert, ein Parteimitglied, das Zeit, Eigentum und – bedenkt man die Schilderung der wütenden Gegner – sogar die eigene Gesundheit riskierte, um die Botschaft des »Führers« zu verkünden, die Botschaft vom Rassenstaat, der sich für den Kampf der Völker rüsten müsse. Es hieße Speers Intelligenz zu missachten, wollte man annehmen, dass er nicht hörte und verstand, was Hitler sagte. Es liegt zugleich ein gewisser Hohn darin, dass Speer nach dem Krieg versuchte, seinen Lesern und Hörern weiszumachen, er sei tatsächlich so naiv gewesen. Speer war nicht naiv. Er wusste, was er tat, und er tat es, wie man zeitgenössisch wohl gesagt hätte, »mit nationalsozialistischem Idealismus«. Speer arbeitete mit an der Eroberung der Macht, um als Nationalsozialist selbst Teil daran zu haben. Dazu passt auch, dass ihm seine Stellung als Hochschul-Assistent nicht mehr ausreichend erschien.
Engagement in Mannheim und Berlin
Ein Dreivierteljahr nach seinem Partei-Beitritt beendete Speer seine Tätigkeit bei Tessenow, offensichtlich mit Ende des Wintersemesters 1931/32.29 Aus dieser Zeit blieben ihm jedoch zahlreiche Kontakte. Der Architekturhistoriker Werner Durth hat beschrieben, wie ihn Freundschaften »bald nicht nur mit Wolters und Tamms, sondern auch mit Otto Apel, Hans Peter Klinke und Willi Schelkes« verbanden, »die später den Kern der Architektengruppe um Speer in Berlin nach 1933 bilden sollten«.30
Speer gab damit freiwillig eine Position auf, die seine Studienkollegen als hohes Glück angesehen hätten. Rudolf Wolters hat vielfach die existenziellen Herausforderungen beschrieben, denen sich ihre Generation damals gegenübersah, »die nach ihrer fachlichen Ausbildung 1927 bis 1930 keine Möglichkeit fand, ihr Können praktisch anzuwenden. Es fehlten nicht nur die großen Aufgaben, auch die kleinen wurden immer weniger«, schrieb er 1943 rückblickend. Er selbst war gezwungen gewesen, sein Glück als Architekt in Sibirien zu suchen. Speers Assistentenstelle bot dagegen das Fundament für eine weitere Universitätskarriere mit Privat-Büro-Einkünften. In einer Hagiographie von 1943 erklärte Wolters, dass Speer sich seinerzeit »dem Nationalsozialismus verschrieben« habe. »Sein fester Glaube an den Sieg der Bewegung ließ ihn zum getreuen Volksmann und später zu einem der engsten Mitarbeiter des Führers werden.«31 Diese Propagandaformeln der Kriegszeit veröffentlichte Wolters als Mitarbeiter Speers in enger Abstimmung mit dessen Wünschen. Was immer daran propagandistisch überhöht sein mag – es war Speers Selbstbild bis 1945.
NS-Engagement und Karrierestreben als zeitgenössische Motive verschleierte Speer nach 1945 bei seinen Interviews damit, dass er bei Tessenow gekündigt habe, weil die Regierung Brüning die Gehälter kürzte.32 Seinen Kindern gegenüber prahlte er jedoch, wie erwähnt, mit dem guten Verdienst.
Anfangs verdiente Speer als Assistent 300 RM pro Monat, hinzu kam ein Wohngeldzuschuss von mindestens 55 RM. 1931 stieg sein Gehalt auf 325 RM monatlich plus Wohngeldzuschuss. Das war sein Einkommen zum Zeitpunkt der Kündigung. Nach Inkrafttreten der Notverordnung, die Heinrich Brüning am 8. Dezember 1931 verkündete und die eine Kürzung der Gehälter von Angestellten und Beamten zum 1. Januar um neun Prozent vorsah,33 hätte Speer daher weiterhin 295,75 RM plus Zulage erhalten. Ein Jahr später wäre er turnusgemäß in eine höhere Gehaltsgruppe eingestuft worden. Es ist nicht überliefert, wann Speer sein letztes Hochschulgehalt erhielt, aber es wird in diesen ersten Monaten des Jahres 1932 gewesen sein.34 Real verringerte sich sein Gehalt demnach ab Januar 1932 um 29,25 RM




























