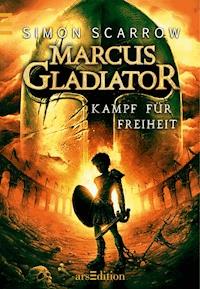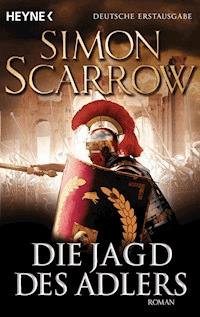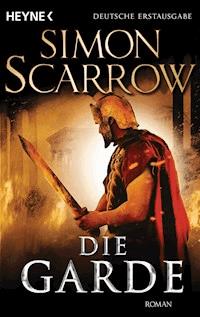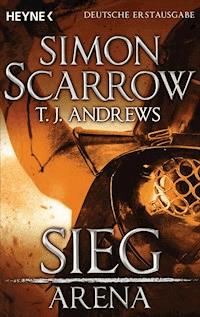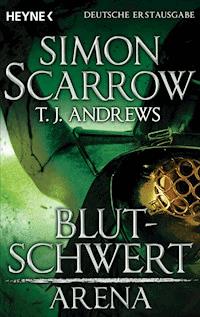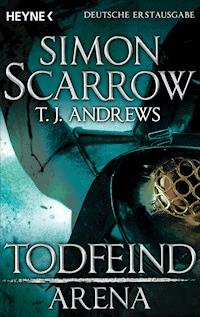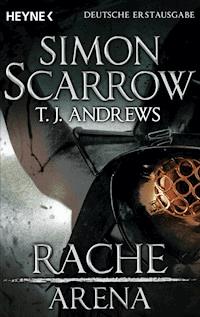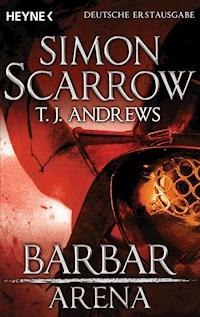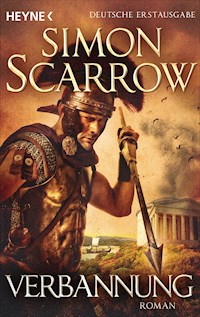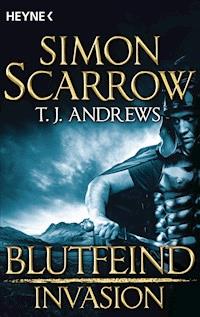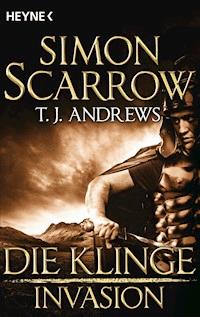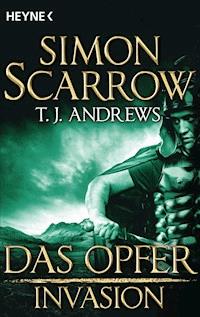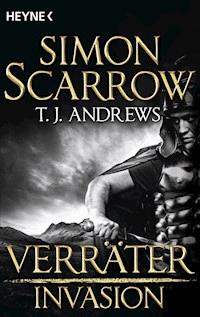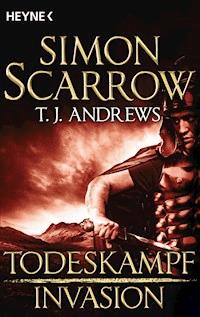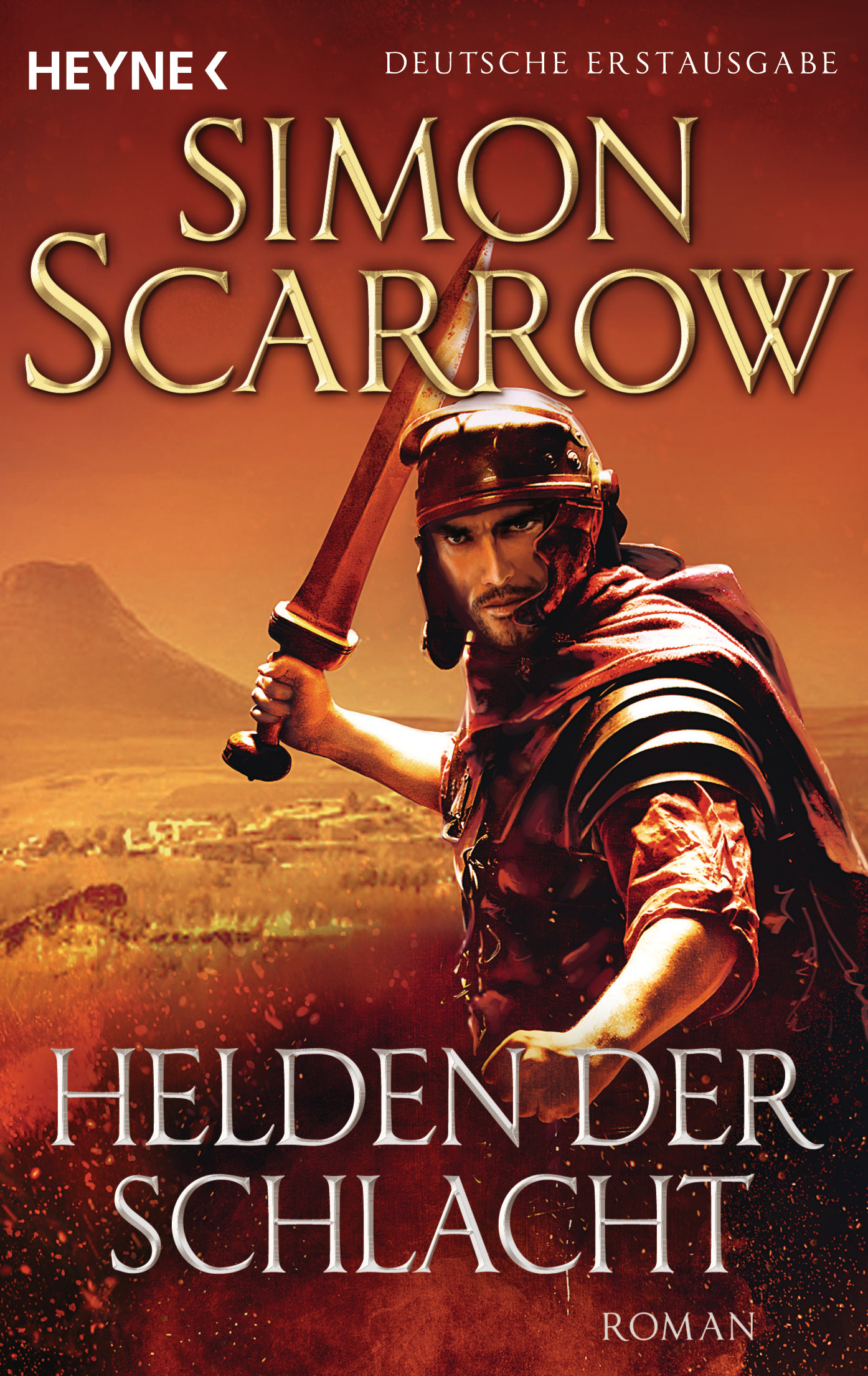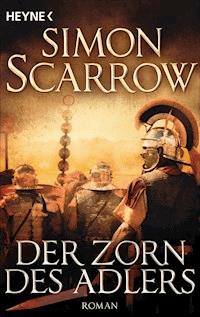
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
Britannien, A. D. 44. Eisiger Frost lähmt die römische Invasion! Seit Monaten bringen verheerende Stürme über dem Kanal den dringend benötigten Nachschub zum Erliegen. Von Hunger und Furcht geschwächt, verliert die mächtige römische Armee allmählich ihren legendären Kampfeswillen. Und dann die schreckliche Nachricht: General Plautius’ Familie wurde von den fanatischen Druiden verschleppt! Nur zwei Männer können jetzt noch ihr Leben retten: Centurio Macro und Optio Cato beginnen einen Wettlauf mit der Zeit – denn bald schon werden die grausamen Götter der Druiden ein Blutopfer verlangen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Simon Scarrow
DER ZORNDES ADLERS
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Ostrop
ZUM BUCH
Die Invasionsarmee in Britannien droht am eisigen Winter zu scheitern! Beißender Frost lähmt den Vormarsch der Soldaten, Stürme bringen seit Monaten den Nachschub zum Erliegen. Immer öfter gelingen einzelnen Barbarenbanden verheerende Siege. Die mächtige römische Armee verliert allmählich ihren Kampfeswillen. Da erreicht General Plautius eine weitere schreckliche Nachricht: Das Schiff, auf dem seine Frau und die beiden Kinder von Gallien übergesetzt sind, ist kurz vor der Küste im Unwetter gesunken, die Schiffbrüchigen sind in die Hände der Druiden gefallen, der grausamsten Barbaren, von denen Rom je gehört hat. Unverzüglich schickt der verzweifelte Plautius seine beiden besten Männer zu ihrer Rettung: Für Centurio Macro und Optio Cato beginnt eine weitere blutige Mission …
Ein ausführliches Werkverzeichnis von Simon Scarrow findet sich auf www.randomhouse.de/content/download/speziell/Simon_Scarrow.pdf
ZUM AUTOR
Simon Scarrow wurde in Nigeria geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Studium arbeitete er viele Jahre als Dozent für Geschichte an der Universität von Norfolk, eine Tätigkeit, die er aufgrund des großen Erfolgs seiner Romane nur widerwillig und aus Zeitgründen einstellen musste.
Besuchen Sie Simon Scarrow im Internet unter www.scarrow.co.uk
Inhaltsverzeichnis
Für Joseph und Nicholas –
Danke für das inspirierende Schwertfechten
Die Organisation der römischen Legion
Wie allen Legionen, so gehörten auch der Zweiten Legion rund fünfeinhalbtausend Mann an. Die Basiseinheit war die achtzig Mann starke Zenturie, die von einem Zenturio befehligt wurde, als dessen Stellvertreter der Optio fungierte. Die Zenturie war in acht Mann starke Unterabteilungen gegliedert, die sich im Lager eine Baracke beziehungsweise im Feld ein Zelt teilten. Sechs Zenturien bildeten eine Kohorte, und zehn Kohorten bildeten eine Legion; die erste Kohorte hatte jeweils doppelte Größe. Jede Legion wurde von einer hundertzwanzig Mann starken Kavallerieeinheit begleitet, unterteilt in vier Schwadronen, die als Kundschafter und Boten Verwendung fanden. Die Ränge in absteigender Folge lauteten folgendermaßen:
Der Legat war ein Mann aristokratischer Herkunft. Im Allgemeinen Mitte dreißig, befehligte der Legat die Legion bis zu fünf Jahre lang und hoffte darauf, sich einen Namen zu machen, um dergestalt seine darauf folgende Politikerkarriere voranzubringen.
Beim Lagerpräfekt handelte es sich zumeist um einen angegrauten Kriegsveteran, der zuvor eine Zenturie befehligt und die Spitze der einem Berufssoldaten offen stehenden Karriereleiter erklommen hatte. Er verfügte über große Erfahrung und Integrität und übernahm das Kommando über die Legion, wenn der Legat abwesend oder im Kampf gefallen war.
Sechs Tribunen dienten als Stabsoffiziere. Dies waren Männer Anfang zwanzig, die zum ersten Mal in der Armee dienten, um administrative Erfahrung zu erwerben, bevor sie untergeordnete Posten in der Verwaltung übernahmen. Anders verhielt es sich mit dem Obertribun. Er war für ein hohes politisches Amt vorgesehen und sollte irgendwann eine Legion befehligen.
Die sechzig Zenturionen sorgten in der Legion für Disziplin und kümmerten sich um die Ausbildung der Soldaten. Sie waren aufgrund ihrer Führungsqualitäten und ihres Todesmuts handverlesen. Demzufolge war bei ihnen die Sterblichkeitsrate weit höher als bei den anderen Rängen. Der oberste Zenturio befehligte die erste Zenturie der ersten Kohorte, war hoch dekoriert und genoss großes Ansehen.
Die vier Dekurionen der Legion befehligten die Kavallerie-Schwadronen und hofften darauf, zum Befehlshaber der Kavallerie-Hilfseinheiten befördert zu werden.
Jedem Zenturio stand ein Optio zur Seite, der die Aufgabe eines Ordonnanzoffiziers wahrnahm und geringere Kompetenzen hatte. Ein Optio wartete für gewöhnlich auf einen freien Platz im Zenturionat.
Unter dem Optio standen die Legionäre, Männer, die sich für fünfundzwanzig Jahre verpflichtet hatten. Theoretisch durften nur römische Bürger in der Armee dienen, doch wurden zunehmend auch Einwohner der römischen Provinzen angeworben, denen beim Eintritt in die Legion die römische Staatsbürgerschaft verliehen wurde.
Nach den Legionären kamen die Männer der Hilfskohorten. Diese wurden in den Provinzen rekrutiert und stellten die Reiterei sowie die leichte Infanterie des römischen Reiches und nahmen andere Spezialaufgaben wahr. Nach fünfundzwanzigjährigem Armeedienst wurde ihnen die römische Staatsbürgerschaft verliehen.
1
Einen Moment lang erstarrten die gischtenden Wogen im Licht eines Blitzes. Rund um das Schiff war das Brodeln und Schäumen wie festgebannt, und die Schlagschatten der Matrosen und der Takelage fielen auf das grell erleuchtete Deck. Dann packte die Dunkelheit das Schiff erneut. Schwarze, tief hängende Wolken ballten sich über den grauen Wellen, die von Norden herangerollt kamen. Noch war die Nacht nicht hereingebrochen, doch der von Grauen erfüllten Mannschaft und den Passagieren kam es so vor, als hätte die Sonne sich schon längst von der Welt verabschiedet; nur ein winziger Fleck helleren Graus weit im Westen deutete ihre Bahn an. Der Geleitzug war in alle Winde zerstreut, und der Präfekt, der das neu in Dienst gestellte Triremengeschwader befehligte, fluchte wütend. Die Hand fest um ein Stag geklammert, beschirmte er mit der freien Hand die Augen vor der eiskalten Gischt und spähte über die brodelnden Wellenberge hinweg.
Lediglich zwei Schiffe seines Geschwaders waren noch zu erkennen. Ihre dunklen, schwankenden Silhouetten zeichneten sich ab, als sein Flaggschiff von einer großen Woge emporgehoben wurde. Diese beiden Schiffe trieben weit im Osten, und noch weiter östlich musste der Rest des Geleitzugs auf dem wütenden Meer verstreut sein. Vielleicht würden sie es noch in die Schiffsstraße schaffen, die landeinwärts nach Rutupiae führte. Für das Flaggschiff gab es jedoch keine Hoffnung mehr, noch das große Nachschublager zu erreichen, von dem aus die römische Armee mit allem Notwendigen beliefert wurde. Weiter landeinwärts rasteten die Legionen wohl geschützt in ihren Winterquartieren bei Camulodunum und warteten auf die Fortsetzung des Eroberungsfeldzugs. Trotz aller Anstrengungen der Ruderer wurde sein Schiff aber von Rutupiae weggefegt.
Als er so über die Wellen zum dunklen Saum der britischen Küste blickte, musste der Präfekt sich verbittert eingestehen, dass der Sturm ihn geschlagen hatte, und so erteilte er den Befehl, die Ruder einzuziehen. Während er über die verbliebenen Möglichkeiten nachdachte, setzte die Mannschaft eilig ein kleines Dreieckssegel am Bug, damit das Schiff stabiler im Wasser lag. Seit dem Beginn des Britannienfeldzugs im vergangenen Sommer hatte der Präfekt diesen Meeresteil schon hundertmal überquert, doch niemals unter so schrecklichen Bedingungen. Tatsächlich hatte er noch nie einen so schnellen Wetterumschwung erlebt. Noch am Morgen – inzwischen schien das eine Ewigkeit her – war der Himmel völlig klar gewesen, und ein frischer Südwind hatte eine schnelle Überfahrt von Gesoriacum versprochen. Normalerweise mied man die Seefahrt im Winter, doch General Plautius’ Armee gingen die Vorräte aus. Die Taktik der verbrannten Erde des britischen Befehlshabers Caratacus bedeutete für die Legionen, die die für die Fortsetzung des Feldzugs im Frühjahr benötigten Vorräte nicht allzu sehr angreifen wollten, dass sie nur durch den Winter kamen, wenn sie vom Festland aus ständig mit Getreide versorgt wurden. Daher waren die Geschwader weiter über den Ärmelkanal gependelt, wann immer das Wetter es zuließ. Die heimtückische Natur hatte ihn am Morgen mit wunderschönem Wetter dazu verlockt, seinen Frachtschiffen die Überfahrt nach Rutupiae zu befehlen, ohne ein derartiges Unwetter auch nur im Geringsten vorherzuahnen.
Gerade, als die zerklüftete Küstenlinie Britanniens über dem kabbeligen Wasser in Sicht gekommen war, hatte sich ein dunkles Wolkenband am nördlichen Horizont zusammengezogen. Der Wind war rasch stärker geworden, hatte dann plötzlich gedreht, und die Männer des Geschwaders hatten immer verängstigter die dunklen Wolken beobachtet, die sich wie wutschnaubende, gierige Bestien auf sie zu stürzen schienen. Erschreckend schnell war das Unwetter über ihnen gewesen und hatte die Trireme des Präfekten, die an der Spitze des Geleitzugs fuhr, gepackt. Im heulenden Sturm krängte das Schiff so heftig, dass die Matrosen von ihren Aufgaben ablassen und sich irgendwo festklammern mussten, um nicht über Bord geschleudert zu werden. Als die Trireme sich schwerfällig wieder aufrichtete, warf der Präfekt einen Blick auf den Rest des Geleitzugs. Einige der Flachboden-Transportschiffe waren gekentert, und dicht bei den dunklen Rümpfen tanzten winzige Gestalten auf den schäumenden Wogen. Manche winkten verzweifelt, als dächten sie wirklich, ein anderes Schiff könnte sie jetzt noch retten. Der Geleitzug war inzwischen völlig aufgelöst, jedes Schiff kämpfte nur noch um sein eigenes Überleben, ohne sich um die Notlage der anderen kümmern zu können.
Mit dem Sturm kam auch der Regen. Große, eiskalte Tropfen peitschten schräg auf die Trireme nieder und stachen wie Nadeln auf der Haut. Angesichts der durchdringenden Kälte wurden die Matrosen rasch unbeholfener. In seinen wasserdichten Mantel gehüllt, erkannte der Präfekt, dass der Kapitän und seine Mannschaft mit Sicherheit die Kontrolle über das Schiff verlieren würden, wenn der Sturm nicht bald nachließ. Doch das Meer wütete weiter und trieb die Schiffe in alle Richtungen auseinander. Durch irgendeine Laune der Natur hatte der Sturm die drei Triremen an der Spitze des Geleitzugs mit besonderer Wucht getroffen, und bald waren sie weit von den anderen Schiffen abgetrieben – am weitesten die Trireme des Präfekten. So ging es den ganzen Nachmittag, und als die Nacht sich näherte, war noch immer kein Nachlassen zu spüren.
Sein Wissen über die britische Küste abwägend, ging der Präfekt die Möglichkeiten durch. Nach seiner Einschätzung waren sie schon weit von der Schifffahrtsstraße nach Rutupiae weggetragen worden. Steuerbord zeichneten sich ganz schwach die nackten Kreideklippen der Küstengegend um die Siedlung Dubris ab, und so würden sie dem Sturm ein paar Stunden widerstehen müssen, bevor sie die Landung auf einem sichereren Küstenstreifen wagen konnten.
Der Kapitän kam über das schwankende Deck auf ihn zugetaumelt und salutierte, die andere Hand fest um die Heckreling geklammert.
»Was ist denn?«, rief der Präfekt.
»Bilgewasser!«, rief der Kapitän, die Stimme heiser, nachdem er schon seit Stunden Befehle durch den heulenden Sturm gebrüllt hatte. Er stieß mit dem Zeigefinger nach unten, um seine Worte zu unterstreichen. »Wir laufen voll!«
»Können wir es ausschöpfen?«
Der Kapitän legte lauschend den Kopf schräg.
Der Präfekt holte tief Luft, legte die Hand an den Mund und schrie: »Können wir es ausschöpfen?«
Der Kapitän schüttelte den Kopf.
»Und jetzt?«
»Wir müssen vor dem Sturm herlaufen! Sonst gehen wir unter. Und dann müssen wir eine sichere Landestelle finden! «
Mit einem übertriebenen Nicken machte der Präfekt deutlich, dass er verstanden hatte. Na schön. Sie würden eine geeignete Stelle finden müssen, um das Schiff auf den Strand zu setzen. Etwa dreißig oder vierzig Meilen weiter westlich gingen die Klippen in Kiesstrände über. Wenn die Brandung nicht allzu heftig war, konnte man dort eine Landung versuchen. Zwar mochte die Trireme dadurch ernsthaft beschädigt werden, aber es wäre schlimmer, außer dem Schiff auch noch Mannschaft und Passagiere zu verlieren. Dabei dachte der Präfekt an die Frau und ihre kleinen Kinder, die sich unten im Bauch des Schiffes verkrochen hatten. Sie waren ihm anvertraut worden, deshalb hatte er alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sie zu retten.
»Erteile den Befehl, Kapitän! Ich gehe unter Deck.«
»Jawohl.« Der Kapitän salutierte und kehrte zum Mittelschiff zurück, wo die Matrosen am Fuß des Masts kauerten. Der Präfekt beobachtete noch, wie der Kapitän seine Befehle brüllte und auf das eingeholte Rahsegel oben am Mast zeigte. Keiner rührte sich. Der Kapitän brüllte den Befehl erneut und trat dann böse nach dem erstbesten Matrosen. Der Mann kauerte sich noch mehr zusammen, kassierte aber sofort den nächsten Tritt. Da sprang er in die Takelage und kletterte nach oben. Die anderen folgten ihm, kletterten, an das Stag geklammert, die schwankenden Webeleinen empor und erklommen schließlich die Rah. Barfuß suchten sie mit den eiskalten Zehen Halt und schoben sich Stückchen um Stückchen auf die Rah hinaus. Erst als jeder Mann an seinem Platz war, konnten sie die Knoten lösen und das Segel in seiner am stärksten gerefften Stellung setzen. Diese geringe Segelfläche reichte aus, um das Schiff beim Abwettern des Sturms zu steuern. Bei jedem Blitz zeichneten sich Mast, Rah und Männer einen Moment lang als scharf gezeichnete, schwarze Silhouetten vor dem blendend hellen Himmel ab. Dem Präfekten fiel auf, dass die Regentropfen bei jedem Blitzschlag einen Moment lang mitten im Fall zu erstarren schienen. Trotz seines Entsetzens empfand er angesichts dieser Ehrfurcht erregenden Demonstration von Neptuns Macht auch eine begeisterte Erregung.
Endlich waren alle Männer in Position. Der Kapitän stellte sich mit seinen kräftigen Beinen breitbeinig aufs Deck, legte beide Hände trichterförmig an den Mund und blickte zum Mast empor.
»Bänder lösen.«
Die halb erstarrten Finger machten sich verzweifelt an den Lederbändern zu schaffen. Einige Matrosen waren geschickter, und so entfaltete sich das Segel ungleichmäßig schnell. Ein plötzliches Pfeifen in der Takelage kündigte ein erneutes Anschwellen des Sturms an, und die Trireme erbebte unter dem wütenden Angriff. Ein Matrose, der noch geschwächter war als seine Kameraden, verlor den Halt und wurde so schnell in die Dunkelheit hinausgeschleudert, dass keiner seinen Sturz verfolgen konnte. Doch die Matrosen hielten nicht in ihren Bemühungen inne. Der Wind zerrte an der freiliegenden Segelfläche und hätte sie den Matrosen fast aus den Händen gerissen, ehe es ihnen gelang, die Reffleinen festzuzurren. Sobald das Segel gesetzt war, rutschten die Männer wieder von der Rah herunter und arbeiteten sich vorsichtig aufs Deck zurück, Kälte und Erschöpfung tief in die besorgten Gesichter gegraben.
Der Präfekt arbeitete sich zur Luke im Heck des Schiffs zurück und ließ sich vorsichtig in den stockdunklen Schiffsbauch hinunter. Nach dem Geheul des Sturms und dem Geprassel des Regens wirkte es in der kleinen Kajüte unnatürlich ruhig. Ein Wimmern zog ihn zum Heck, wo die Spanten zusammenliefen, und im Schein eines durch die Luken eindringenden Blitzes sah er die Frau, die sich dort hinten eingekeilt hatte, beide Arme eng um die Schultern zweier Kinder geschlungen. Zitternd hielten sie ihre Mutter umklammert, und das jüngere, ein fünfjähriger Junge, weinte unaufhörlich, das Gesicht von Gischt, Tränen und Rotz verschmiert. Seine drei Jahre ältere Schwester saß einfach nur da, schweigend, doch die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen. Plötzlich wurde der Bug der Trireme von einer riesigen Welle hochgerissen, und der Präfekt stürzte auf seine Passagiere zu. Er fing sich mit einem Arm am Schiffsrumpf ab und stürzte der Länge nach hin. Einen Moment lang rang er nach Atem, und in dieser Pause kam die Stimme der Frau ruhig aus dem Dunkeln.
»Wir kommen hier doch durch, oder?«
Ein weiterer Blitz ließ das Entsetzen in den bleichen Gesichtern der Kinder erkennen.
Der Präfekt beschloss, ihr zu verschweigen, dass er die Trireme auf den Strand setzen wollte. Besser, er ersparte den Passagieren alle zusätzlichen Aufregungen.
»Natürlich, Herrin. Wir laufen vor dem Sturm her und sobald er vorüber ist, segeln wir wieder die Küste entlang nach Rutupiae zurück.«
»Ich verstehe«, antwortete die Frau schlicht, und der Präfekt erkannte, dass sie seine Antwort durchschaut hatte. Sie war offensichtlich scharfsinnig und machte ihrer edlen Abstammung und ihrem Mann alle Ehre. Beruhigend drückte sie die Kinder an sich.
»Habt ihr das gehört, ihr beiden? Bald sind wir wieder im Trockenen und haben es warm.«
Dem Präfekten fiel ein, wie sehr die Kinder gezittert hatten, und er verfluchte seine Achtlosigkeit.
»Einen Moment, Herrin.« Mit seinen eiskalten Fingern hantierte er an der Schließe seines wasserdichten Umhangs. Er verfluchte seine Ungeschicklichkeit, doch dann bekam er die Schließe auf. Er nahm den Umhang von den Schultern und reichte ihn ihr in die Dunkelheit hinein.
»Hier, für dich und deine Kinder, Herrin.«
Er spürte, wie sie ihm den Umhang aus der Hand nahm.
»Danke, Präfekt, das ist sehr freundlich. Kommt, ihr beiden, unter diesem Mantel können wir uns zusammenkuscheln. «
Der Präfekt zog die Knie an die Brust und umschlang sie mit den Armen, um einen Rest von Wärme zu bewahren, doch da berührte ihn sanft eine Hand an der Schulter.
»Herrin?«
»Du bist Valerius Maxentius, nicht wahr?«
»Ja, Herrin.«
»Nun denn, Valerius. Schlüpfe mit uns unter diesen Umhang. Bevor die Kälte dich noch umbringt.«
Der beiläufige Gebrauch seines persönlichen Namens verwirrte den Präfekten einen Moment lang. Dann murmelte er einen Dank und nahm ihr Angebot an. Der Junge hockte zusammengekauert zwischen ihnen, heftig zitternd, und immer wieder wurde sein Körper von Schluchzern geschüttelt.
»Nur ruhig«, tröstete der Präfekt ihn leise. »Alles wird gut. Du wirst schon sehen.«
Eine Folge von Blitzen erhellte die Kajüte, und der Präfekt und die Frau sahen einander an. Ihr Blick war fragend, und er schüttelte den Kopf. Wieder schwappte ein Schwall Wasser durch die Luke in die Kajüte. Die Spanten der Trireme ächzten unter der Wucht von Kräften, an die die Erbauer des Schiffs wohl nicht einmal im Traum gedacht hatten. Der Präfekt wusste, dass der Schiffskörper einer solchen Gewalt nicht mehr lange standhalten konnte und das Schiff schließlich im Meer versinken würde. Dann würden die an die Ruder geketteten Sklaven, die Matrosen, die Passagiere und er selbst ertrinken. Bevor er sich auf die Lippen beißen konnte, war ihm ein Fluch entschlüpft. Die Frau erriet, wie er sich fühlte.
»Valerius, dich trifft keine Schuld. Diese Entwicklung war unvorhersehbar.«
»Ich weiß, Herrin, ich weiß.«
»Vielleicht werden wir ja noch gerettet.«
»Ja, Herrin. Wenn du es sagst.«
Die ganze Nacht jagte der Sturm die Trireme die Küste entlang. Der Kapitän war in die Takelage geklettert und trotzte der beißenden Kälte, um nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau zu halten. Er merkte deutlich, dass das Schiff sich immer schwerfälliger durch die Wellen bewegte. Unter Deck war ein Teil der Galeerensklaven von den Ketten befreit worden, um beim Ausschöpfen zu helfen. Sie saßen in einer Reihe da und reichten die Schöpfeimer weiter, die dann über Bord geleert wurden. Doch dadurch war das Schiff nicht mehr zu retten; es verzögerte nur den unvermeidlichen Moment, an dem eine besonders mächtige Woge über die Trireme hereinbrechen und sie versenken würde.
Der Kapitän hörte das verzweifelte Geschrei der noch immer an den Ruderbänken festgeketteten Sklaven. Das Wasser schwappte ihnen schon bis über die Knie, und für sie gab es bei einem Schiffbruch keinerlei Hoffnung auf Entrinnen. Andere mochten vielleicht an Planken geklammert eine Weile überleben, bis die Kälte ihnen den Rest gab, doch den Sklaven drohte das sichere Ertrinken, und der Kapitän verstand ihre Hysterie nur zu gut.
Der Regen ging in Schneeregen und dann in Schnee über. Dicke weiße Flocken stoben durch die Luft und sammelten sich auf der Tunika des Kapitäns. Seine Hände waren inzwischen vollkommen taub, und er sah ein, dass er zum Deck hinuntersteigen musste, solange er sich noch an der Takelage festhalten konnte. Doch gerade, als er die erste Bewegung machte, erblickte er plötzlich den drohenden Umriss einer felsigen Landzunge. Kaum eine halbe Meile voraus brach sich weiße Gischt an zerklüfteten Klippen.
Der Kapitän schwang sich hastig aufs Deck hinunter und eilte nach achtern zum Steuermann.
»Felsen voraus! Hart nach Backbord!«
Der Kapitän warf sich gegen die Ruderpinne und kämpfte gemeinsam mit dem Steuermann gegen die Wellen an, die auf das große Seitenruder drückten. Ganz langsam reagierte das Schiff, und der Bug schwenkte allmählich vom Festland weg. Im grellen Licht eines Blitzes erkannten sie die dunkel glitzernden Zähne der Felsen, die aus dem brodelnden Wasser aufstiegen. Das Tosen der Brandung übertönte sogar noch den heulenden Sturm. Einen Moment lang verweigerte das Schiff ein weiteres Abdrehen zum offenen Meer, und das Herz des Kapitäns füllte sich mit einer dunklen, kalten Verzweiflung. Dann aber trug ein günstiger Windstoß den Bug herum, weg von den Klippen, die nun kaum noch dreißig Meter vom Schiff entfernt lagen.
»Das war’s! Jetzt halt die Richtung!«, schrie er dem Steuermann zu.
Unter der Wucht des Sturms, der die winzige Segelfläche zu zerreißen drohte, schoss die Trireme über das aufgewühlte Meer hinweg. Jenseits der Landzunge öffneten sich die Klippen auf einen Kiesstrand, hinter dem das mit vereinzelten Krüppelbäumchen bewachsene Festland allmählich anstieg. Die Wogen donnerten weiße Gischt versprühend gegen den Strand.
»Dort!« Der Kapitän zeigte auf den Strand. »Dort werden wir landen.«
»Bei dieser Brandung?«, rief der Steuermann. »Das ist Wahnsinn!«
»Es ist unsere einzige Möglichkeit! Und jetzt gemeinsam, ans Steuer!«
Mit aller Macht drückten sie das Ruder in Gegenrichtung und brachten die Trireme dazu, zum Ufer zu schwenken. Zum ersten Mal in dieser Nacht gestattete der Kapitän sich die Hoffnung, dass sie dem Unwetter doch noch lebend entkommen würden. Bei dem Gedanken, dass sie dem schlimmsten Zorn widerstanden hatten, den der mächtige Neptun denen entgegenschleudern konnte, die sich in sein Reich wagten, lachte er triumphierend auf. Doch als sie fast in Reichweite des sicheren Ufers waren, bekam das Meer doch noch seinen Willen. Ein großer Brecher wogte aus den dunklen Tiefen des Meers heran und trug die Trireme hoch und immer höher, bis der Kapitän von oben auf den Strand hinunterblickte. Dann glitt die Woge unter ihnen davon, und das Schiff fiel wie ein Stein. So heftig, dass alle an Bord zu Boden stürzten, krachte das Schiff mit einem lauten Knirschen in einiger Entfernung von der Landzunge auf ein zerklüftetes Felsstück nieder, das den Bug durchbohrte. Der Kapitän sprang rasch wieder auf, doch daran, wie ruhig das Deck unter seinen Füßen lag, erkannte er, dass sie nicht mehr schwammen.
Der nächste Brecher drehte die Trireme halb herum, sodass nun das Heck zum Strand zeigte. Ein Reißen und Krachen vom Bug her ließ keinen Zweifel, welcher Schaden entstand. Von unten drang das Schreien und Kreischen der Sklaven herauf, während von allen Seiten wasserfallartige Fluten über die Trireme hereinbrachen. Der Rumpf würde tiefer absacken, und die nächsten Wogen würden das Schiff und alle an Bord gegen die Klippen schleudern und zerschmettern.
»Was ist passiert?«
Der Kapitän drehte sich um und sah den Präfekten Maxentius aus der Luke steigen. Die dunkle Landmasse in der Nähe und das schwarze Glitzern der gischtnassen Klippen waren Erklärung genug. Der Präfekt rief seiner Schutzbefohlenen durch die Luke zu, sie solle die Kinder an Deck bringen. Dann wandte er sich wieder dem Kapitän zu.
»Wir müssen sie von Bord schaffen! Sie müssen das Land erreichen!«
Während die Frau und ihre Kinder sich an der Heckreling niederkauerten, banden Valerius Maxentius und der Kapitän eiligst mehrere aufgeblasene Weinschläuche zusammen. Rundum griffen die Matrosen nach allem, was sich an Schwimmfähigem auftreiben ließ. Das Schreien unter Deck schwoll zu Grauen erregendem Gebrüll an, als die Trireme noch tiefer ins dunkle Meer sackte. Plötzlich jedoch verstummten die Schreie. Ein Matrose rief etwas und zeigte auf die Luke des Hauptdecks. Meerwasser schimmerte heraus. Nun verhinderte nur noch der Fels, auf dem der Bug festsaß, dass das Schiff unterging. Eine einzige Woge genügte, und es war um sie geschehen.
»Hierher!«, schrie Maxentius der Frau und ihren Kindern zu. »Schnell!«
Während die Brecher über dem Deck zusammenschlugen, banden der Präfekt und der Kapitän die Passagiere an den Weinschläuchen fest. Doch der Junge wollte sich das Seil nicht um die Taille binden lassen und leistete panischen Widerstand
»Schluss!« Seine Mutter gab ihm eine Ohrfeige. »Halt still.«
Der Präfekt nickte ihr dankend zu und band den Jungen auf dem improvisierten Floß fest.
»Und jetzt?«, fragte sie.
»Wartet beim Heck. Wenn ich es euch sage, springt. Danach schwimmt mit aller Kraft zum Strand.«
Die Frau stockte und sah die beiden Männer an. »Und ihr?«
»Wir folgen so bald wie möglich.« Der Präfekt lächelte. »Und jetzt, werte Herrin. Wenn du gestattest?«
Sie ließ sich zur Heckreling führen, überkletterte sie vorsichtig, hielt ihre Kinder an sich gepresst und bereitete sich auf den Sprung vor.
»Mama! Nein!«, schrie der Junge und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf das wilde Meer zu seinen Füßen. »Bitte, Mama!«
»Aelius, alles wird gut. Das schwöre ich dir!«
»Herr!«, schrie der Kapitän. »Dort! Schau dort!«
Der Präfekt drehte sich um und erblickte durch Schnee und Sturm eine riesige Woge, die, weiße Gischtfetzen versprühend, auf sie niederstürzte. Die Matrosen auf dem Hauptdeck wurden davongerissen. Als Maxentius sich rückwärts vom Heck warf, erhaschte er einen letzten Blick auf den Kapitän, der sich am Gitter der Hauptluke festklammerte, die Augen auf das Verhängnis geheftet, das ihn gleich erfassen würde. Eiskalte Dunkelheit schlug über dem Präfekten zusammen, und noch bevor er den Mund schließen konnte, drang ihm Salzwasser in Nase und Kehle. Er wurde wild herumgewirbelt, und seine Lunge brannte vor Atemnot. Gerade, als er schon den sicheren Tod erwartete, hörte er plötzlich das Getöse des Sturms. Dann war es einen Moment lang still, doch schon im nächsten Augenblick brach sein Kopf zur Oberfläche durch. Nach Luft schnappend und strampelnd bemühte der Präfekt sich, nicht erneut unterzugehen. Eine Woge trug ihn hoch, und nicht allzu weit entfernt erblickte er den Strand. Weder von der Trireme noch von der Mannschaft war etwas zu sehen. Die Frau und ihre Kinder waren ebenfalls nirgends zu entdecken. Die Wellen warfen ihn dichter an die Klippen heran, und angesichts der Gefahr, dort zerschmettert zu werden, verstärkte der Präfekt seine Bemühungen, zum Strand zu schwimmen.
Mehrmals rechnete er fest damit, dass die Klippen sein Leben einfordern würden. Doch während er mit seinen immer matteren Kräften dem Strand entgegenstrebte, beschützte die Landzunge ihn zunehmend vor den wildesten Wogen. Völlig erschöpft und verzweifelt spürte er schließlich, wie seine Füße den Kies berührten. Dann zerrte ihn jedoch die Rückströmung wieder vom Strand weg, und er schrie den Göttern seinen Zorn entgegen, dass sie ihm in diesem letzten Moment die Rettung verweigerten. Fest entschlossen, nicht zu sterben, noch nicht, biss er die Zähne zusammen und versuchte mit einer letzten, verzweifelten Anstrengung, den Strand zu erreichen. Von einer weiteren Woge wurde er schmerzhaft über den Kies geschleift, kämpfte aber mit aller Kraft gegen den Sog an, als die Welle zurückwich. Bevor der nächste Brecher auf den Strand niederkrachte, hastete Maxentius den steilen Kiesstrand hinauf und warf sich völlig erschöpft zu Boden.
Rundum wütete der Sturm, neue Schneeschauer wirbelten durch die Luft. Erst jetzt, an Land und in Sicherheit, merkte der Präfekt, dass er eiskalt war. Heftig zitternd versuchte er, genug Energie zu sammeln, um sich aufzurichten. Doch bevor ihm das gelang, hörte er plötzlich den Kies knirschen, und jemand setzte sich neben ihn.
»Valerius Maxentius! Alles in Ordnung mit dir?«
Mit erstaunlicher Kraft hob die Frau ihn an und drehte ihn auf die Seite. Er nickte.
»Dann komm«, befahl sie. »Bevor du erfrierst.«
Sie legte sich einen seiner Arme über die Schulter und stützte ihn auf dem Weg den Strand hinauf zu einem schmalen Taleinschnitt, der mit krüppligen Bäumchen bewachsen war. Dort hockten die beiden Kinder im Schutz eines umgestürzten Baumstamms unter dem völlig durchweichten Mantel des Präfekten.
»Unter den Mantel. Alle.«
Zu viert kauerten sie sich, heftig zitternd, so dicht wie nur möglich unter dem feuchten Stoff zusammen, während der Sturm weiter wütete und der Schnee sich auf ihnen sammelte. Als er die Landzunge entlangblickte, konnte Maxentius keinerlei Anzeichen der Trireme erkennen. Es war, als hätte sein Flaggschiff niemals existiert, so vollständig war es vernichtet worden. Andere Überlebende gab es anscheinend nicht. Keinen einzigen.
Plötzlich hörte er trotz des Sturmgeheuls den Kies knirschen. Einen Moment lang hielt er es nur für Einbildung. Doch dann erklang das Geräusch erneut, und diesmal hätte er schwören können, auch Stimmen zu hören.
»Es gibt doch noch Überlebende!« Er lächelte die Frau an und erhob sich auf die Knie. »Hierher! Hierher!«, rief er.
Eine dunkle Gestalt tauchte am Eingang des Taleinschnitts auf. Dann noch eine.
»Hier!« Der Präfekt winkte. »Hierher!«
Die Gestalten verharrten einen Moment lang, dann rief einer von ihnen etwas, doch seine Worte waren bei dem Sturm nicht zu verstehen. Er hob einen Speer und machte anderen, die nicht zu sehen waren, ein Zeichen.
»Valerius, sei still«, befahl die Frau.
Doch es war bereits zu spät. Man hatte sie gesehen, und noch mehr Männer traten zu den ersten beiden. Vorsichtig näherten sie sich den zitternden Römern. In dem unheimlichen Dämmerlicht, das der Schnee auf dem Boden verbreitete, wurden ihre Gesichter beim Näherkommen allmählich kenntlich.
»Mama«, flüsterte das Mädchen. »Wer ist das?«
»Still, Julia!«
Als die Männer nur noch ein paar Schritte entfernt waren, wurde der Himmel von einem fernen Blitz erhellt. In seinem bleichen Schimmer waren die Männer einen Moment lang zu erkennen. Über den grob geschnittenen Pelzmänteln schwankte zu wilden Stacheln gedrehtes Haar in der Luft. Darunter glühten grimmige Augen aus tätowierten Gesichtern. Einen Moment lang verharrten beide Seiten schweigend. Dann aber ertrug der kleine Junge es nicht länger, und ein schriller Schrei blinder Panik durchschnitt die Luft.
2
»Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo war«, murmelte Zenturio Macro und blickte in eine Gasse, die vom Hafen Camulodunums heraufführte. »Wisst ihr vielleicht, wo?«
Die anderen drei wechselten Blicke und trappelten dabei mit den kalten Füßen im Schnee. Neben Cato – Macros jungem Optio – standen zwei junge Frauen, Angehörige des Iceni-Stammes, warm in prächtige, pelzgesäumte Winterumhänge gehüllt. Beide waren von Vätern erzogen worden, die den Tag, an dem sich das römische Imperium bis nach Britannien ausdehnen würde, seit langem vorhergesehen hatten. Die Mädchen waren von klein auf in Latein unterrichtet worden, und zwar von einem gallischen Sklaven. Daher hatte ihr Latein etwas Singendes, was Cato als sehr melodisch empfand.
»Jetzt hör mal«, widersprach die Ältere. »Du sagtest, wir gehen in eine gemütliche kleine Bierschenke. Ich hab nicht vor, die ganze Nacht durch diese eiskalten Straßen zu laufen, bis du genau diese Schenke findest. Wir gehen in die nächste, die jetzt kommt, einverstanden?« Mit einem scharfen Blick suchte sie Unterstützung bei ihrer Freundin und Cato. Beide nickten sofort.
»Es geht hier entlang«, entgegnete Macro rasch. »Ja, jetzt erinnere ich mich. Dort ist es.«
»Das will ich auch hoffen. Sonst bringst du uns nämlich heim.«
»Einverstanden«, antwortete Macro und hob beschwichtigend die Hand. »Gehen wir.«
Vom Zenturio geführt, bog das kleine Grüppchen mit leise knirschenden Schritten in die schmale Gasse ein, die von beiden Seiten durch die dunklen Hütten und Häuser der Trinovantes begrenzt war. Es hatte den ganzen Tag über bis in die Abenddämmerung hinein geschneit. Camulodunum und Umgebung lagen unter einer dicken, weiß schimmernden Schneedecke, und die meisten Menschen saßen ums qualmende Feuer geschart in ihren Häusern. Von den jungen Stadtbewohnern gesellten sich nur die unempfindlicheren auf der Suche nach einer Kneipe, einem Abendtrunk, grölendem Gesang und vielleicht, mit etwas Glück, einer kleinen Schlägerei zu den römischen Soldaten. Die Soldaten kamen aus dem großen Lager, das sich direkt vor dem Haupttor Camulodunums ausdehnte, mit Geldbeuteln bewaffnet, die fast aus den Nähten platzten. Vier Legionen – mehr als zwanzigtausend Mann – saßen den ganzen Winter in primitiven Holz- und Torfhütten fest und warteten ungeduldig auf den Beginn des Frühjahrs, um den Eroberungsfeldzug wieder aufzunehmen. Der Winter war besonders rau gewesen, und die im Lager eingeschlossenen Legionäre, die sich tagein tagaus mit dem ewig gleichen Gerste-Gemüseeintopf begnügen mussten, waren rastlos. Umso mehr, seit der General ihnen einen Vorschuss auf das von Kaiser Claudius zugesagte Donativ ausbezahlt hatte. Mit dieser Prämie wurden der Sieg über den britischen Kommandanten Caratacus und der Fall seiner Hauptstadt Camulodunum belohnt. Die Einwohner der Stadt, die zum größten Teil irgendeine Art von Handel trieben, hatten sich rasch vom Schreck der Niederlage erholt und nahmen nun die Gelegenheit wahr, die direkt vor ihren Toren lagernden Legionäre auszunehmen. Eine Reihe von Schenken hatte eröffnet, um die Legionäre mit den verschiedenen lokalen Gebräuen sowie mit Wein vom Kontinent zu versorgen, denn manche Kaufleute waren für exorbitante Preise bereit, ihre Schiffe auf der winterlichen See zu riskieren.
Wer unter den Stadtbewohnern an den neuen Herren kein Geld verdiente, betrachtete voll Abscheu die betrunkenen Fremden, die unter lautem Gegröle und gelegentlich auch geräuschvoll kotzend von den Bierschenken zum Lager taumelten. Schließlich reichte es den Stadtältesten, und sie schickten eine Abordnung zu General Plautius. Im Interesse des frisch geschmiedeten Bündnisses zwischen Römern und Trinovantes baten sie ihn, den Legionären künftig keinen Ausgang mehr in die Stadt zu gewähren. Der General wollte zwar die guten Beziehungen zu den Einheimischen keineswegs gefährden, doch er wusste auch, dass er einen Aufstand riskierte, falls er seinen Soldaten die Möglichkeit verwehrte, die Spannungen, die sich in den langen Monaten im Winterquartier zwangsläufig aufbauten, in der Stadt loszuwerden. Man einigte sich also auf einen Kompromiss, und die Ausgangserlaubnis für die Legionäre wurde gekürzt. Folglich waren diese bei jedem Stadtgang nur umso mehr auf eine wilde Sauftour versessen.
»Da sind wir ja!«, meinte Macro triumphierend. »Ich sagte euch doch, dass es hier ist.«
Sie standen vor der kleinen, mit Nägeln beschlagenen Tür eines aus Stein errichteten Lagerschuppens. Ein paar Schritte weiter ging ein Fenster auf die Gasse, dessen Laden vorgelegt war. Ein warmer, rötlicher Schimmer drang aus der Ritze zwischen Fensteröffnung und Fensterladen heraus, und von drinnen hörten sie lautes, fröhliches Stimmengewirr.
»Wenigstens dürfte es warm sein«, meinte das jüngere Mädchen ruhig. »Was meinst du, Boudica?«
»Das will ich hoffen«, antwortete ihre Kusine und streckte die Hand nach dem Türriegel aus. »Also los.«
Von der Vorstellung entsetzt, dass eine Frau vor ihm in eine Kneipe trat, drängte Macro sich plump vor.
»Ähem, wenn du gestattest.« Mit einem Lächeln versuchte er, die Unhöflichkeit zu glätten. Er öffnete die Tür und bückte sich beim Eintreten unter dem niedrigen Türrahmen hindurch. Die kleine Gruppe folgte ihm. Warmer, verrauchter Mief hüllte die Neuankömmlinge ein, und nach der finsteren Gasse kam ihnen das Licht des Feuers und mehrerer Talglampen richtig hell vor. Einige der Gäste drehten sich nach den Neuankömmlingen um, und an den dicken, roten Militärtuniken und -umhängen erkannte Cato sie als Legionäre auf Stadtgang.
»Loch zu!«, brüllte jemand. »Bevor wir hier noch erfrieren, verdammt.«
»Fluch nicht rum!«, schrie Macro verärgert zurück. »Hier sind Damen anwesend.«
Von den anderen Gästen war Gejohle zu hören.
»Das wissen wir doch!« Unter Gelächter piekste ein Legionär eine Kellnerin, die gerade mit einem Arm voll leerer Krüge an ihm vorbeiging, zwischen die Pobacken. Sie schrie auf, wirbelte herum, verpasste ihm eine schallende Ohrfeige und rettete sich mit ein paar Sprüngen zur Theke auf der anderen Seite der Schenke. Der Legionär rieb sich die glühende Wange und lachte erneut.
»Diese Schenke empfiehlst du uns also?«, moserte Boudica.
»Gib ihr eine Chance. Ich hab hier kürzlich einen großartigen Abend verbracht. Sie hat doch Atmosphäre, findest du nicht?«
»Allerdings«, erwiderte Cato. »Dicke Luft. Ich frag mich, wann hier eine Schlägerei losgeht.«
Sein Zenturio warf ihm einen finsteren Blick zu und wandte sich wieder den beiden Frauen zu. »Was hättet ihr gerne, meine Damen?«
»Einen Sitzplatz«, antwortete Boudica spitz. »Im Moment wäre ein Sitzplatz schon genug.«
Macro zuckte die Schultern. »Kümmere dich drum, Cato. Such eine ruhige Ecke. Ich hole derweil was zu trinken.«
Während Macro sich durchs Gewühle zur Theke durcharbeitete, schaute Cato sich um und stellte fest, dass der einzige freie Platz ein wackliger Klapptisch mit zwei Bänken war und direkt bei der Eingangstür stand. Er rückte die eine Bank auf der Seite ein wenig ab und nickte auffordernd. »Setzt euch doch, meine Damen.«
Angesichts des primitiven Mobiliars schürzte Boudica die Lippen und hätte den Sitzplatz womöglich verweigert, hätte ihre Kusine ihr nicht schnell einen kleinen Stoß verpasst. Sie war die jüngere der beiden, hieß Nessa und war eine brünette Iceni-Frau mit blauen Augen und runden Wangen. Cato war sich durchaus bewusst, dass sein Zenturio und Boudica sie eingeladen hatten, um ihm Gesellschaft zu leisten, während das ältere Paar seine merkwürdige Beziehung vorantrieb.
Macro und Boudica hatten sich kurz nach dem Fall Camulodunums kennen gelernt. Da die Iceni im Krieg zwischen Rom und dem Stammesbündnis, das sich der Eroberung widersetzte, neutral waren, empfand Boudica gegenüber den Männern aus dem großen Imperium jenseits des Meers eher Neugierde denn Feindseligkeit. Um die Gunst der neuen Herren bemüht, hatten die Stadtältesten das römische Lager mit Einladungen zu großen Festessen überschwemmt. Selbst rangniedrige Zenturionen wie Macro waren zu ihrer Überraschung dazugebeten worden. Am ersten dieser Abende hatte er Boudica kennen gelernt. Ihre direkte Art hatte ihn zunächst entsetzt; die Kelten schienen dem sanfteren Geschlecht ein abscheuliches Maß an Gleichberechtigung zuzubilligen. Als Boudica damals plötzlich neben dem Zenturio gestanden hatte, der seinerseits neben einem Fässchen des hochprozentigsten Bieres stand, das ihm je begegnet war, hatte sie keine Zeit verloren und ihn sofort nach Informationen über Rom ausgequetscht. Angesichts dieser unverhohlenen Annäherung hatte Macro sie zunächst einfach nur als eine der weiteren reizlosen Frauen betrachtet, die in der Oberschicht der britischen Gesellschaft so häufig waren. Doch im Verlauf ihres Kreuzverhörs schwand allmählich sein Interesse am Bier. Zunächst nur widerstrebend, dann aber im Verlauf des ausgedehnten Gesprächs, in das sie ihn kunstvoll verwickelte, immer freudiger, unterhielt Macro sich mit ihr so angeregt, wie er es mit einer Frau bisher noch nie erlebt hatte.
Am Ende des Abends wusste er, dass er diese lebhafte Iceni-Frau wiedersehen wollte, und schlug ihr stotternd eine Verabredung vor. Sie war gerne dazu bereit und lud ihn zu einem Bankett ein, das am nächsten Abend bei einem ihrer Stammesbrüder stattfinden sollte. Macro war zuerst eingetroffen und hatte verlegen neben dem Mahl aus kaltem Fleisch und warmem Bier herumgestanden, bis Boudica kam. Dann hatte er entsetzt festgestellt, dass sie beim Trinken mühelos mithielt. Bevor er sich’s versah, hatte sie ihm einen Arm um die Schulter gelegt und ihn fest an sich gedrückt. Die anderen keltischen Frauen gaben sich jedoch nicht weniger direkt, und so wollte Macro sich gerade mit den sonderbaren Sitten dieser neuen Kultur abfinden, als die beschwipste Boudica ihm einen Kuss auf die Lippen drückte.
Völlig überrumpelt versuchte Macro, sich ihrer kräftigen Umarmung zu entziehen, doch das Mädchen missverstand dieses Gezappel als ein Zeichen seiner Leidenschaft und verstärkte ihren Griff nur noch. Also gab Macro nach und erwiderte ihren Kuss; vom Alkohol enthemmt und beflügelt verschwanden sie in einer dunklen Ecke unter einem Tisch und brachten den Rest des Abends mit Knutschen zu. Nur die dem Bier zu verdankende Erschlaffung hatte sie daran gehindert, alle Konsequenzen aus der Situation zu ziehen. Netterweise hatte Boudica diese kleine Panne nicht weiter aufgebauscht.
Von da an hatten sie sich fast täglich getroffen, und manchmal hatte Macro auch Cato mitgenommen, vor allem aus Mitgefühl mit dem Burschen, dessen erste Liebe vor kurzem von einem verräterischen römischen Aristokraten ermordet worden war. Cato, der zunächst still und schüchtern gewesen war, hatte sich allmählich von Boudicas geselliger Natur anstecken lassen, sodass die beiden nun stundenlang miteinander plaudern konnten. Macro hatte das Gefühl, dass er allmählich an den Rand gedrängt wurde. Auch Boudicas Erklärung, sie habe nur Beziehungen mit Erwachsenen, beruhigte ihn nicht. Daher war nun auf Macros Vorschlag hin Nessa eingeladen worden, ein Mädchen, das Cato etwas zu tun gab, während Macro selbst weiter Boudica umwarb.
»Geht dein Zenturio oft in solche Schenken?«, fragte Nessa.
»Nicht alle sind so schön wie diese.« Cato lächelte. »Ihr solltet euch geehrt fühlen.«
Nessa überhörte die Ironie und rümpfte bei der Vorstellung, ein rechtschaffener Mensch könnte sich von der Einladung in ein solches Lokal geehrt fühlen, angeekelt die Nase. Die anderen beiden verdrehten die Augen.
»Wie hast du denn die Erlaubnis gekriegt, mit uns auszugehen? «, fragte Cato Boudica. »Ich dachte, deinem Onkel ist kürzlich, als wir dich abends heimtragen mussten, fasst eine Ader geplatzt.«
»Genau. Seitdem ist der arme Bursche nicht mehr ganz er selbst und war nur bereit, uns heute Abend zu ein paar entfernten Kusinen gehen zu lassen, wenn jemand uns begleitet. «
Cato runzelte die Stirn. »Und wo ist der Begleiter?« »Keine Ahnung. Wir haben uns im Gedränge beim Stadttor verloren.«
»War das Absicht?«
»Natürlich. Für wen hältst du mich denn?«
»Da maße ich mir kein Bild an.«
»Sehr klug von dir.«
»Prasutagus macht sich wahrscheinlich vor Sorge ins Hemd!«, kicherte Nessa. »Wetten, dass er jede einzelne Trinkhalle durchsucht, die er finden kann?«
»Dann sind wir hier recht sicher, denn meinem lieben Stammesbruder – übrigens ein Vetter von mir – wird diese Schenke hier garantiert nicht in den Sinn kommen. Ich bezweifle, dass er sich jemals in die Gassen hinter dem Hafen gewagt hat. Hier haben wir unsere Ruhe.«
»Falls er uns aber findet«, meinte Nessa mit aufgerissenen Augen, »rastet er aus! Du weißt ja noch, wie er mit diesem Atrebate-Burschen umgesprungen ist, der uns damals anquatschte. Ich dachte schon, Prasutagus bringt ihn um!«
»Hätte er wahrscheinlich auch, wenn ich ihn nicht von dem Burschen runtergezerrt hätte.«
Cato rutschte nervös auf seinem Sitzplatz herum. »Ist er groß, euer Vetter?«
»Riesig!« Nessa lachte. »Sa! Riesig ist genau das richtige Wort.«
»Nur sein Gehirn ist nicht recht mitgewachsen«, fügte Boudica hinzu. »Versuch also gar nicht erst, mit ihm zu diskutieren, wenn er hier auftaucht. Nimm einfach die Beine in die Hand.«
»Verstehe.«
Macro kehrte von der Theke zurück und hielt die vier Becher und den Krug hoch über dem Kopf, damit im Gedränge keiner dagegenstieß. Er stellte alles auf der rauen Holzbank ab und füllte höflich jeden Tonbecher bis an den Rand mit Wein.
»Wein!«, rief Boudica aus. »Du weißt aber, wie man eine Dame verwöhnt, Zenturio.«
»Das Bier ist ausgegangen«, erklärte Macro. »Jetzt haben sie nur noch das da, und billig ist es auch nicht. Trinkt also und genießt.«
»Solange wir können, Herr.«
»Hm? Was ist denn los, Junge?«
»Diese beiden Damen sind nur hier, weil sie einem ziemlich kräftig gebauten Verwandten entschlüpfen konnten, der sie wahrscheinlich jetzt sucht, und zwar nicht in allerbester Stimmung.«
»Was einen in so einer Nacht auch nicht weiter überrascht. « Macro zuckte die Schultern. »Aber im Moment sitzen wir im Warmen. Wir haben Feuer, was zu trinken und angenehme Gesellschaft. Herz, was begehrst du mehr?«
»Einen Sitzplatz näher beim Feuer«, antwortete Boudica.
»Na ja, lasst uns anstoßen.« Der Zenturio hob seinen Becher. »Auf uns!« Macro führte den Becher an die Lippen, goss den Wein in einem einzigen Zug herunter und knallte den Becher auf den Tisch. »Ahhhh! Genau das, was ich brauchte! Wer ist für mehr?«
»Einen Moment.« Boudica folgte seinem Beispiel und leerte ihren Becher.
Cato wusste, wie viel Wein er vertrug, und schüttelte den Kopf.
»Wie du willst, Junge, aber Wein hilft, die Sorgen zu vergessen. «
»Wenn du es sagst, Herr.«
»Das sage ich allerdings. Insbesondere, wenn man schlechte Nachrichten hat.« Macro sah Boudica über den Tisch hinweg an.
»Was für Nachrichten denn?«, fragte sie.
»Die Legion marschiert Richtung Süden los.«
»Wann?«
»In drei Tagen.«
»Das wusste ich noch gar nicht«, bemerkte Cato. »Worum geht es denn?«
»Vermutlich will der General die Zweite Legion dazu einsetzen, Caratacus den Fluchtweg über die Tamesis nach Süden abzuschneiden. Die anderen drei Legionen können das Gebiet nördlich des Flusses aufräumen.«
»Die Tamesis?«, fragte Boudica stirnrunzelnd. »Die ist weit von hier. Wann kommt deine Legion denn wieder hierher zurück?«
Macro wollte gerade irgendetwas Beruhigendes daherplappern, da sah er den schmerzlichen Ausdruck in Boudicas Gesicht. In so einer Situation war Ehrlichkeit nötig. Besser, Boudica erfuhr die Wahrheit sofort, als dass sie ihm später grollte.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht geht der Feldzug noch ein paar Jahre, vielleicht kommen wir auch nie zurück. Alles hängt davon ab, wie lange Caratacus gegen uns kämpft. Falls wir ihn schnell vernichten, ist die Provinz bald befriedet. Im Moment überfällt der Schweinehund aber ständig unsere Nachschublinien und verhandelt außerdem mit einigen anderen Stämmen, sich seinem Widerstand gegen uns anzuschließen.«
»Dass er gut kämpft, kann man dem Mann nicht zum Vorwurf machen.«
»Doch. Wenn er dadurch unsere Trennung verlängert.« Macro ergriff ihre Hand und drückte sie zärtlich. »Hoffen wir also, dass er gescheit wird und merkt, dass er unmöglich gegen uns siegen kann. Wenn dann Ruhe in der Provinz herrscht, nehme ich Urlaub, komme hierher und suche dich auf.«
»Erwartest du etwa, dass Britannien sich so schnell unterwirft?«, brauste Boudica auf. »Bei Lud! Wie dumm seid ihr Römer eigentlich? Caratacus führt nur die Stämme an, die sich im Einflussbereich der Catuvellauni befinden. Es gibt aber noch viele andere Stämme, und wenn sie zu stolz sind, sich der Führung eines Stammesfremden zu unterstellen, sind sie mit Sicherheit ebenfalls zu stolz, sich demütig der römischen Herrschaft zu unterwerfen. Nimm doch nur unseren eigenen Stamm.« Boudica zeigte auf sich selbst und Nessa. »Die Iceni. Ich kenne keinen einzigen Krieger, der davon träumt, Untertan eures Kaisers Claudius zu werden. Gewiss habt ihr unsere Stammesfürsten mit Bündnisversprechungen umworben und ihnen für den Fall, dass Rom feindliche Stämme schlägt, Beuteanteile zugesagt. Aber ich warne euch, sobald ihr versucht, euch als unsere Herren aufzuspielen, werden die römischen Legionen einen hohen Blutzoll entrichten …«
Ihre Stimme war schrill geworden, und ihre Augen loderten herausfordernd. Die Zecher an den Nachbartischen hatten sich zu ihr umgedreht und einen Moment lang ihre Gespräche unterbrochen. Dann drehten sie die Köpfe aber zurück, und das Stimmengewirr schwoll langsam wieder an. Boudica schenkte sich noch einen Becher Wein ein, leerte ihn und fuhr dann ruhiger fort: »Das Gleiche gilt für die meisten anderen Stämme. Glaub mir.«
Macro sah sie an, nickte langsam und nahm ihre Hand zärtlich in die seine. »Tut mir Leid. Ich wollte dein Volk nicht beleidigen. Ehrlich. Ich bin nicht gerade ein Meister der Worte.«
Boudicas Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln. »Macht nichts, dafür hast du genügend andere Vorzüge.«
Macro warf Cato einen Blick zu. »Könntest du vielleicht mit dem Mädel hier ein Weilchen zur Theke gehen? Meine Herzensdame und ich müssen uns unterhalten.«
»Ja, Herr.« Cato erfasste die Lage sofort, stand eilig auf und bot Nessa den Arm. Die junge Frau schaute zu ihrer Kusine und erhielt ein leises Nicken zur Antwort.
»Na, dann los.« Nessa lächelte breit. »Pass auf dich auf, Boudica, du weißt ja, was diese Soldaten für Leute sind.«
»Sa! Ich kann schon auf mich selbst aufpassen.«
Daran hegte Cato nicht die geringsten Zweifel. Im Laufe der Wintermonate hatte er Boudica recht gut kennen gelernt, und sein Mitleid galt ganz seinem Zenturio. Er geleitete Nessa durch das Gedränge zur Theke. Der Schankwirt, nach dem Akzent zu urteilen ein alter Gallier, trug nicht die römisch-kontinentale Kleidermode, sondern einen reich gemusterten Kittel, und zwei Zöpfe hingen ihm vom Kopf auf die Schultern herab. Er spülte gerade Becher in einem Fass mit schmuddeligem Spülwasser und schaute auf, als Cato mit einer Münze auf die Theke klopfte. Er wischte sich die Hände an der Schürze ab und schlurfte heran, die Augenbrauen fragend gehoben.
»Zwei Becher Glühwein«, bestellte Cato, vergewisserte sich dann aber nochmals bei Nessa. »Einverstanden?«
Sie nickte, und der Wirt nahm zwei Becher und ging zu einem zerbeulten Kupferkessel, der auf einem rußigen Gitter über der schwach glimmenden Glut stand. Dampfschwaden stiegen aus dem Kessel auf, und selbst von dort, wo er stand, erschnüffelte Cato die duftenden Gewürze durch den Kneipenmief aus Bier und säuerlichem Menschenschweiß hindurch. Der hoch gewachsene, dünne Cato schaute auf seine Begleiterin hinunter, die begierig zusah, wie der Gallier eine Kelle in den Kessel tauchte und das Gemisch umrührte. Cato runzelte die Stirn. Er wusste, dass er eigentlich irgendeine Plauderei in Gang bringen sollte, aber das war ihm schon immer schwer gefallen, da er stets befürchtete, entweder unaufrichtig oder schlicht und ergreifend dümmlich zu wirken. Außerdem war er diesmal nicht mit dem Herzen bei der Sache. Sicher, Nessas Äußeres war durchaus reizvoll – von ihrem Charakter hatte er keine Ahnung – , nur trauerte er eben immer noch um Lavinia.
Seine einstige Leidenschaft für Lavinia brannte noch immer wie Feuer in ihm, obwohl sie ihn zum Schluss betrogen hatte, diesem Schwein von Vitellius hinterhergelaufen und mit ihm ins Bett gegangen war. Noch bevor Cato sich jedoch zur Verachtung durchringen konnte, hatte Vitellius Lavinia heimtückisch in einen Mordanschlag auf den Kaiser verwickelt und sie anschließend kaltblütig umgebracht, um die Spuren zu verwischen. Noch immer hatte Cato die dunklen Flechten von Lavinias Haar vor Augen, wie sie in der aus ihrer Halswunde strömenden Blutlache schwammen, und ihm wurde schlecht. Er sehnte sich mehr denn je nach ihr.
All seine ziellos gewordene Leidenschaft floss nun in einen glühenden Hass auf Tribun Vitellius und erfüllte ihn mit einer solchen Unversöhnlichkeit, dass keine Rache zu schrecklich schien. Doch Vitellius war mit dem Kaiser nach Rom zurückgekehrt, nachdem er als Held aus dem fehlgeschlagenen Attentat hervorgegangen war. Sobald deutlich wurde, dass die Leibwächter des Kaisers ihrem Herrn das Leben retten würden, hatte Vitellius sich auf den Attentäter gestürzt und ihn getötet. Jetzt betrachtete der Kaiser den Tribun als seinen Lebensretter, den er gar nicht genug ehren konnte, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Catos Blick wurde starr, und er presste die Lippen so verbittert zusammen, dass seine Begleiterin erschrak.
»Was um alles in der Welt ist denn mit dir los?«
»Hm? Entschuldigung. Ich habe gerade nachgedacht.«
»Ich will lieber nicht wissen worüber.«
»Es hat nichts mit dir zu tun.«
»Na, hoffentlich. Schau, da kommt der Wein.«
Der Gallier kehrte mit zwei dampfenden Bechern zur Theke zurück, bei deren würzigem Duft sogar Cato das Wasser im Mund zusammenlief. Der Gallier nahm die Münze, die Cato ihm reichte, und machte sich wieder an den Abwasch.
»He!«, rief Cato laut. »Wo bleibt das Wechselgeld?«
»Gibt’s nicht«, gab der Gallier über die Schulter zurück. »Das ist der Preis. Wein ist knapp bei diesem stürmischen Wetter.«
»Trotzdem …«
»Meine Preise gefallen dir nicht? Dann hau doch ab und such dir eine andere Schenke.«
Cato wurde bleich vor Zorn und ballte die Fäuste. Er hätte den alten Mann am liebsten in Stücke gerissen und wollte schon losbrüllen, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Sobald er sich wieder unter Kontrolle hatte, erschrak er über dieses Versagen seiner Rationalität, auf die er sonst so stolz war. Beschämt sah er sich um, ob irgendjemand bemerkt hatte, wie er sich um ein Haar zum Narren gemacht hätte. Es sah aber nur ein einziger Mann in seine Richtung, ein untersetzter Gallier, der am anderen Ende der Theke lehnte. Er beobachtete Cato genau und hatte die eine Hand schon an den Griff eines Dolches gelegt, der in einer Metallscheide von seinem Gürtel herabhing. Ganz offensichtlich der Rausschmeißer des alten Wirtes. Er begegnete dem Blick des Optios, hob drohend den Zeigefinger und mahnte den jungen Mann mit einem leisen, verächtlichen Lächeln, sich zu benehmen.
»Cato, da beim Feuer ist ein Sitzplatz. Gehen wir doch da hin.« Nessa schob ihn sanft von der Theke zum gemauerten Kamin, wo zischelnd und knisternd junges Holz verbrannte. Nach einem Moment des Widerstands gab Cato nach. Sie schlängelten sich zwischen den Gästen hindurch, sorgfältig darauf bedacht, den Wein nicht zu verschütten, und setzten sich neben einer Hand voll weiterer Gäste, die sich am Feuer wärmten, auf zwei niedrige Hocker.
»Was war denn los?«, fragte Nessa. »Man konnte ja eben richtig Angst vor dir kriegen.«
»Wirklich?« Cato zuckte die Schultern und nippte dann vorsichtig an seinem dampfenden Becher.
»Wirklich. Ich dachte schon, du stürzt dich auf ihn.«
»Ich war auch kurz davor.«
»Warum denn? Boudica hat mir erzählt, du wärst eher der ruhige Typ.«
»Das bin ich auch.«
»Und warum jetzt also?«
»Das geht dich nichts an!«, antwortete Cato ruppig. Dann tat es ihm aber sofort Leid. »Entschuldigung, ich wollte nicht so barsch sein. Ich will einfach nur nicht darüber reden.«
»Ich verstehe. Dann lass uns über etwas anderes reden.«
»Zum Beispiel?«
»Ich weiß nicht. Überleg du dir was. Das wird dir gut tun.«
»Na schön, dieser Vetter von Boudica, Prasutagus, ist der wirklich so gefährlich, wie es klingt?«
»Schlimmer. Er ist mehr als nur ein einfacher Krieger.« Cato sah die Angst in ihrem Gesicht. »Er hat noch andere Macht.«
»Was denn für Macht?«
»D … Das kann ich nicht sagen.«
»Du und Boudica, seid ihr in Gefahr, falls er euch jetzt findet?«
Nessa schüttelte den Kopf und trank dabei gleichzeitig einen Schluck. Ein paar Tropfen Wein spritzten auf ihren Umhang und schimmerten dort kurz im Feuerlicht auf, bevor sie vom Stoff aufgesaugt wurden. »Na ja, er wird hochrot anlaufen und ein bisschen rumbrüllen, aber das ist es dann auch schon. Sobald Boudica ihm schöne Augen macht, dreht er sich auf den Rücken und wartet darauf, dass sie ihm den Bauch krault.«
»Er mag sie also?«
»Du sagst es. Er ist vernarrt in sie.« Nessa reckte den Kopf, um quer durch den Raum nach ihrer Freundin zu schauen, die sich über den Tisch gebeugt hatte und Macros Wange mit der Hand umfing. Nessa wandte sich wieder Cato zu und flüsterte so vertraulich, als könnte Boudica sie hören: »Unter uns, ich habe gehört, dass Prasutagus sich richtig in sie verliebt hat. Wenn das Frühjahr anbricht, begleitet er uns nach Hause in unser Dorf. Ich würde mich nicht wundern, wenn er die Gelegenheit wahrnimmt, Boudicas Vater um ihre Hand zu bitten.«
»Und was empfindet sie ihm gegenüber?«
»Oh, sie wird den Antrag natürlich annehmen.«
»Wirklich? Warum denn?«
»Schließlich bekommt ein Mädchen nicht jeden Tag Gelegenheit, den künftigen Herrscher der Iceni zu heiraten.«
Cato nickte langsam. Er hatte auch schon andere Frauen kennen gelernt, die gesellschaftlichen Aufstieg über ihre Gefühle stellten. Cato beschloss, seinem Zenturio nichts davon zu erzählen. Wenn Boudica Macro abservieren und einen anderen heiraten wollte, konnte sie ihm das selber sagen. »Was für eine Schande. Sie hat etwas Besseres verdient. «
»Natürlich. Darum macht sie ja auch mit deinem Zenturio rum. Sie soll es ruhig genießen, solange es etwas zu genießen gibt. Ich habe meine Zweifel, ob Prasutagus ihr noch viel Freiheit lässt, wenn sie erst einmal verheiratet sind.«
Plötzlich ertönte hinter ihnen ein lautes Krachen. Cato und Nessa fuhren herum und sahen, dass die Tür zur Schenke aufgetreten worden war. Durch den niedrigen Türrahmen drängte sich jetzt einer der größten Männer, die Cato je gesehen hatte. Als dieser sich recht ungelenk aufrichtete, stieß er mit dem Kopf gegen das Strohdach. Mit einem wütenden Fluch in seiner Muttersprache zog er den Kopf ein und trat so weit in den Raum, dass er sich aufrichten und alle Gäste gründlich mustern konnte. Er war über sechs Fuß groß und entsprechend breit gebaut. Beim Anblick des Muskelspiels seiner kräftig behaarten Unterarme schluckte Cato, als ihm wie mit einem Schlag in die Magengrube klar wurde, wer der Neuankömmling sein musste.
3
»O je!«, jammerte Nessa. »Jetzt sind wir dran.«
Als Prasutagus die Zecher mit wütenden Blicken musterte, verstummten alle und bemühten sich, seinem Blick auszuweichen, ihn dabei aber genau im Auge zu behalten. Cato sah an dem Iceni-Riesen vorbei nach hinten. In ihrem Winkel bei der Tür befanden sich Boudica und Macro außerhalb des Sichtfelds des Neuankömmlings, und Boudica machte Macro rasch ein Zeichen, sich unter der Bank zu verkriechen. Er schüttelte jedoch den Kopf. Sie deutete beharrlich nach unten, doch der Zenturio ließ sich nicht umstimmen. Vielmehr schwang er die Beine über die Bank, bereit, sich dem Eingetretenen entgegenzustellen. Da leerte Boudica rasch ihren Becher, tauchte selber unter die Bank und drückte sich gegen die Wand. Dabei stieß sie jedoch gegen den Tisch; der Becher fiel herunter und zerbrach auf dem Steinboden.
Prasutagus riss einen Dolch unter seinem Mantel hervor und wirbelte herum, bereit, sich auf jeden Feind zu werfen, der sich von hinten an ihn heranschlich. Der Iceni-Krieger musterte Macros untersetzte Gestalt, als dieser aufstand, und brüllte dann vor Lachen los.
»Was gibt’s hier zu lachen?«, schnauzte Macro ihn an.
Nessa drückte heftig atmend Catos Arm. »Dein Freund ist ein Narr.«
»Nein«, widersprach Cato flüsternd. »Vielmehr ist dein Verwandter in Gefahr. Er ist nicht mehr nüchtern, und jetzt hat er Macro sauer gemacht. Dein Vetter soll mal besser gut auf sich aufpassen.«
Prasutagus klopfte dem Zenturio auf die Schulter und sagte etwas Versöhnliches in seiner Muttersprache. Das Messer verschwand wieder unter seinem Umhang.
»Finger weg!«, knurrte Macro. »Du bist vielleicht ein Riese und ein schlagkräftiger Bastard, aber ich bin schon mit Schlimmeren fertig geworden.«
Der Krieger beachtete ihn jedoch nicht mehr, sondern wandte sich wieder den anderen Gästen zu, um sich erneut nach seinen widerspenstigen Kusinen umzusehen. Nessa war aufgestanden, um die Begegnung zwischen dem Zenturio und ihrem Vetter zu verfolgen, und schaffte es jetzt nicht mehr, sich rechtzeitig außer Sicht zu bringen.
»Ahhh!«, brüllte der Riese und stampfte vorwärts, wobei er jeden, der ihm im Weg stand, grob beiseite stieß. »Nessa!«
Ziemlich unüberlegt stand Cato auf und stellte sich zwischen die beiden, um den näher kommenden Krieger mit erhobener Hand aufzuhalten.
»Lass sie in Ruhe!« Seine Stimme bebte, denn ihm wurde plötzlich klar, wie unklug er sich gerade verhielt.
Prasutagus stieß ihn zur Seite, packte Nessa bei den Schultern und brüllte sie an, genau wie sie es vorhergesagt hatte. Cato rappelte sich vom Boden hoch und stürzte sich auf den Briten. Prasutagus stand jedoch wie ein Fels. Gleich darauf verpasste er Cato einen ordentlichen Schlag gegen die Schläfe. Catos Welt versank in einem blendend weißen Blitzschlag, und er fiel wie ein Stein um, bewusstlos.
Macro hinten bei der Tür erhob sich. »Das geht zu weit, Süßer!« Er schob sich durchs Gedränge zum Kamin durch. Hinter ihm kämpfte Boudica sich unter ihrer Bank hervor.
»Macro! Lass das! Er bringt dich um.«
»Das soll der Schuft mal versuchen.«
»Lass das! Ich flehe dich an!« Sie schoss hinter ihm her und packte ihn bei den Schultern.
»Lass mich los, Weib!«
»Macro, bitte!«
Prasutagus schaute sich um. Sofort stieß er Nessa beiseite, drehte sich mit seiner massigen Gestalt herum und überschüttete Boudica in einer Mischung aus Erleichterung und Zorn mit einem wasserfallartigen Wortschwall. Fast bei dem Riesen angekommen, blieb Macro stehen und schaute sich suchend nach etwas um, was sich als Waffe verwenden ließe. Er griff nach einer Krücke, die neben einem besinnungslos besoffenen Briten auf dem Boden lag, und hielt sie wie einen Hirtenstab vor sich. Doch bevor er noch einen weiteren Schritt auf Prasutagus zu machen konnte, ging er unter einem krachenden Schlag auf den Hinterkopf zu Boden – Boudica hatte ihn mit einem Tonkrug niedergeschlagen. Schwindlig und der Ohnmacht nahe rappelte Macro sich auf alle viere hoch.
»Bleib unten!«, zischte Boudica. »Bleib unten und halt den Mund, wenn du weißt, was gut für dich ist.«
Mit lodernden Augen und wutverzerrtem Mund marschierte sie auf ihren Vetter zu. Prasutagus fuchtelte noch immer brüllend mit seinen mächtigen Armen durch die Luft. Boudica baute sich vor ihm auf und schlug ihm ins Gesicht, wieder und wieder, bis er sich beruhigt hatte und seine Arme schlaff herunterhingen.
»Naa, Boudica!«, protestierte er. »Na!«
Sie gab ihm noch eine Ohrfeige und warnte ihn mit erhobenem Zeigefinger davor, noch ein einziges Wort zu sagen. Seine Augen glühten, und er biss die Zähne zusammen, gab aber keinen Laut mehr von sich. Die anderen Zecher warteten in fasziniertem Schweigen ab, wie sich der Zusammenstoß zwischen diesem riesenhaften Krieger und der hoch gewachsenen, herrischen Frau, die sich ihm so offen widersetzte, weiter entwickeln würde. Schließlich ließ Boudica den mahnenden Finger sinken. Prasutagus nickte, redete jetzt ruhig mit ihr und machte eine Andeutung von Nicken zur Tür hin. Boudica rief Nessa und ging den beiden auf die Straße hinaus voran. Prasutagus verharrte noch einen Moment und warnte die Gäste mit einem wütenden Blick davor, über ihn zu lachen. Dann schob er den am Boden liegenden Optio mit einem Fuß zur Seite und stürmte aus der Schenke, hinter seinen Schutzbefohlenen her, bevor sie ihm erneut entkommen konnten.
Jeder einzelne Zecher in der Schenke schaute zur offenen Tür, ob der Krieger vielleicht zurückkehrte. Als die Unterhaltung langsam wieder auflebte, nickte der alte Gallier seinem Rauswerfer zu, und der ging zur Tür und machte sie zu. Dann schlenderte er beiläufig zu Macro hinüber.
»Alles klar, Kumpel?«
»Hab mich schon besser gefühlt.« Macro rieb sich schmerzlich zusammenzuckend den Kopf. »Verdammt! Das tut weh.«
»Wundert mich nicht. Die hat es in sich, die Frau.«
»Allerdings!«
»Hat dir aber den Arsch gerettet. Dir und dem Burschen da.«
»Cato!« Macro eilte zu seinem Optio, der sich auf einen Ellbogen gestützt hatte und den Kopf schüttelte. »Alles in Ordnung?«
»Ich weiß nicht recht, Herr. Fühlt sich an, als wäre mir ein Haus auf den Kopf gefallen.«
»Gut gesagt«, kicherte der Rausschmeißer. »Dieser Prasutagus hat manchmal eine ganz schön harte Hand.«
Cato schaute auf. »Ach, wirklich?«
Der Gallier zerrte Cato auf die Beine und wischte ihm das Stroh von der Tunika. »Und jetzt möchte ich die beiden Herren bitten, doch bitte sofort unser Haus zu verlassen.«
»Warum denn?«, fragte Macro.