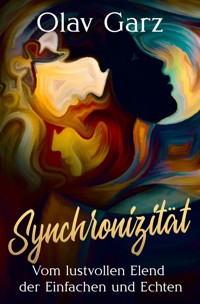Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählte Geschichten, die das Leben schreiben, berühren und beschäftigen uns. Vielleicht lassen sie den Lesenden mit einem Schmunzeln zurück. Menschen mit ihrem Schicksal, ihrem Leid oder Pech werden uns nicht nur begegnen, sondern auch in schmerzlicher Erinnerung bleiben. Leuten bei deren persönlichen Glück zuschauen zu können, stimmt uns dagegen heiter und fröhlich. Das Leben ist nicht nur immer laut und lustig, es kann auch leise und traurig sein. Steigen Sie in diesen besonderen Zug ohne Zugnummer mit ein und rollen Sie mit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Zug rollt
Erzählband
Olav Garz
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar.
© 2024 -Verlag, Altheim
Buchcover: Germencreative
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Belin.
In Erinnerung an
Dirk Koslowski,
der aus ungeklärten Gründen
leider viel zu früh verstarb.
Er war mir, während meiner Kindheit
im Tossehof, ein lieber Freund.
Ich liebte seine Räuberpistolen.
Gelsenkirchen,
Ortsteil Bulmke-Hüllen, 1973.
Inhalt
Der Trauerredner
Er war doch ihr Arzt
Die gekochte Leber
Die Blamage von Rio …………. ab Seite 15
Der Zug rollt
Im Hunde-Lotto gewonnen
Der Analphabet
Einmal Pommes ohne alles …….... ab Seite 41
Peter-Pan war ein Hund
Der Kritikbogen
Mit der Wahrheit getäuscht
Der Überweisungsbeleg ………… ab Seite 75
Herr Wasanthe isst ohne Besteck
Im Koma
Der Langarmpullover
Der Sperrmülltermin …………. ab Seite 105
Das Frauchen will verreisen
Der Schlaf- und Nerventee
Falscher Hase
Das Blut will nicht fließen ……. ab Seite 138
Ein frisch gezapftes Bier auf Hawaii
Die Urlaubsvertretung
Nürnberger Rostbratwürstchen
Die falsche Adresse …………… ab Seite 160
Gekaufte Liebe
Der abgelaufene Verbandskasten
Mit dem Taxi nach Paris
Zu wenige Kartoffelpuffer ………. ab Seite 178
Die putzende Opernsängerin
Im Kofferraum
Kaltschale
Frau Dr. Schell und ihr Unfall … ab Seite 203
Der Koloss von Rhodos
Einen Drachen steigen lassen
Frühlingsrolle oder Dim Sum in Reckling-
hausen
Dr. Rainald Koegler,
der Vorzeige-Beamte ……………. ab Seite 223
Die Annonce
Mit dem Ford Escort nach Eisenach
Nico an der Leine
Die trockene Badehose ……… ab Seite 254
Summa cum laude
Ein Einkaufszettel aus Holz
Die Kartoffelschale
Ein guter Sugar-Daddy ……… ab Seite 272
Der tödliche Briefwechsel
Die Tür
Die nasse Windel
Das Auto aus Draht …………… ab Seite 292
Was ist Sterben?
Verschwunden ……………. ab Seite 310
„Stets findet Überraschung statt/
Da, wo man es nicht erwartet hat“.
Zitat,
Heinrich Christian Wilhelm Busch,
humoristischer Dichter und Zeichner
geboren 1832, gestorben 1908
Einleitung
Vom Aufgeschnappten sei hier die Rede.
Etwas, was man zufällig hört oder mitbekommt und wenn es nur die Flasche Wasser sein sollte, die sich der Spaziergänger am Wasserhäuschen in der Stadt oder als Reisender noch schnell in der Bahnhofsvorhalle holen will und Ohrenzeuge einer unglaublichen, erzählten Szene wird. Weniger als zwei Minuten Stehzeit und trotzdem, die Wortfetzen, dass gerade Erzählte, der Ausschnitt dieses Gespräches, der hörende Einblick in ein anderes Leben, lässt uns in der Sonne frieren, vielleicht sogar Erschaudern. Dichtung und Wahrheit verschwimmen ineinander, kann das Gehörte wirklich wahr gewesen sein, habe ich mich vielleicht verhört oder spielt mir mein Geist einen Streich? Und wäre es bei einer Fahrt mit der Regional-Bahn im Groß-Abteil von Eppstein im Taunus nach Limburg an der Lahn anders als bei einer längeren Bahnfahrt mit dem ICE von München hoch nach Hamburg?
Und so finden die Fragmente einer aufgefangenen Unterhaltung, die bruchstückartigen Erzählungen, dem mitgehörten, genauso Rücksicht in unseren Erinnerungen wie selbst erfahrene Geschichten. Und doch geht von diesem unfertigen Gehörten etwas Faszinierendes aus. Sie beschäftigen uns eine Weile lang, wenn auch unbewusst. Spinnen wir sie in Gedanken weiter, was wäre, wenn …?
Läuft wirklich immer alles glatt im Leben oder sind es die ungezählten Unebenheiten, die kleinen Stolpersteine und die großen Hürden, die den Alltag übermannen? Sind es nicht die strengen Vorgaben, die gesellschaftlichen Spielregeln, die aufgezwungenen Normen, die wir so manches Mal gefühlt wie schwere Ketten an den Füßen empfinden? Der Mensch an sich kommt dabei und wie so oft zu kurz. Mehr zufällige Begegnungen, Erfahrungen anderer Menschen, Leute, die den Tod als Erlösung herbeisehnen, das Leid einer nicht erwiderten Liebe erfahren oder unerfüllte Sehnsüchte in sich tragen, die vielleicht für immer Kopfspiele bleiben müssen, schreiben ihre eigenen Geschichten. Sie sind und bleiben im wahrsten Sinne des Wortes, rollende Ausschnitte des Lebens.
Wir werden im Verlauf dieser Erzählungen Menschen begegnen, bei denen und in deren Leben nicht alles nach Plan gelaufen ist, laufen konnte. Es kommen Leute zu Wort, die auf der Suche nach ihrem eigenen Glück waren oder treffen auf Nachbarn, die etwas sein wollten, was sie aber, trotz aller Anstrengungen, nicht sein konnten. Sie alle geben uns einen großzügigen Einblick in ihre Seele, die eventuell nicht nur einmal verletzt zurückbleiben musste. So werden wir hier von Protagonisten hören wie du und ich. Glückliche Momente, glückliche Fügungen, glückliche Menschen, werden uns dafür zum Ausgleich begegnen; auch sie interessieren uns.
Stürzen Sie sich in schwere Lebensbeichten, in weitererzählte Legenden und in leichte, erheiternde Geschichten, die jemand über drei Ecken mitbekommen haben will, von denen man vielleicht irgendwann oder irgendwie unbedingt gehört haben wollte oder gelesen hatte. Konnte das Erzählte wirklich stimmen, sich real so zugetragen haben? Schicksale, die uns nicht kalt lassen, seltsames Gebaren, traurige und mitleidende Gefühle, fröhliches Hundegebell, vermeintliche Lotto-Gewinne oder lesen Sie von Glücksgefühlen, sein eigenes, verdientes Geld in fremde, dafür aber in gute Hände geben zu wollen.
Und überraschende Rezepte für die eine oder andere gute Mahlzeit liegen ohnehin bei. Zucker und Zimt, Pfeffer und Salz, Essig und Öl werden hierbei nicht fehlen; trotzdem wird Mann oder Frau davon nicht alles nach kochen wollen, aber lesen Sie am besten selbst …
Liebe Lesende, steigen Sie mit ein in diesen besonderen Zug ohne Zugnummer. Nehmen Sie Platz und machen Sie es sich im Leseabteil bequem, ohne das genaue Ziel vorher zu kennen. Übrigens, bei dieser Fahrt brauchen Sie keine gültige Fahrkarte vorzuzeigen. Die An- und Abfahrtszeiten bestimmen Sie ebenfalls allein und können jederzeit, ohne auf eine genaue Abfahrtszeit Acht geben zu müssen, aus- und einsteigen, denn jede aufgeschriebene Geschichte hat bekanntlich ihr eigenes Ziel. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und eine gute Unterhaltung.
Der Trauerredner
Er war doch ihr Arzt
Die gekochte Leber
Die Blamage von Rio
Der Trauerredner
Hans-Otto hatte heute, entgegen seiner Überzeugung, keine Zeit.
Und das am letzten Arbeitstag in seinem Leben. Er konnte sich selbst nicht verstehen. Wie er doch gerade genau diesen einen Tag herbeigesehnt hatte. Jetzt sollte es soweit sein. Uneitel wie er nun einmal war, ging er noch rasch die Abschiedsrede in Gedanken durch, die er für seinen Kollegen Hermann geschrieben hatte. Er fing damals zeitgleich mit ihm im gleichen Betrieb an und sein Arbeitsleben sollte ebenfalls heute Nachmittag enden. Von Anfang an waren sie Freunde. „Das ist nun 45 Jahre her“, dachte Hans-Otto kurz. Bescheiden wie er war, wollte er sich selbst nur am Rande, am Ende seiner Rede, erwähnen. Ohne viel Aufhebens oder Gedöns zu machen. Der Sekt war längst kaltgestellt worden und die Schnittchen lagen, mit Petersilie und mit den der Länge nach geteilten Gewürzgurken, hübsch garniert auf dem Buffet. Auf deren baldigen Verzehr hofften alle Gäste gegenseitig. Der Kaffee blieb heiß, es konnte losgehen.
„Herr Reddemann, Sie haben doch bestimmt ein paar Worte zu Ihren beiden Ausständen vorbereitet, nicht wahr?“.
Fast war es schon eine kleine Tradition geworden, stand eine kleine Betriebsfeier, ein Firmen-Jubiläum bevor, wer wurde wohl gebeten, nur ein paar Worte vorzubereiten? Natürlich, Hans-Otto. Und so ging für ihn und das nicht einmal so ungern, ein kleiner Wunsch in Erfüllung. Eine Rede über das Leben allgemein, das Arbeiten und der nun beginnenden Rentenzeit halten zu dürfen.
„Lieber Hermann, 1976 standen wir hier gemeinsam vor dem Werkstor, uns schlotterten die Knie, als Stifte wollten wir hier unsere Lehre beginnen. Weißt du noch, als allererstes wurden wir Brötchen, Bier und Bild-Zeitung holen geschickt“.
Die Zeit dieser Feierstunde verging wie im Fluge. Nach dem die Präsente verteilt und alle Abschiedstränen getrocknet waren, gingen sie gemeinsam, so wie seit 1976, zum allerletzten Mal durch dieses Firmentor, Richtung Ausgang, nur dieses Mal ohne Bier holen zu müssen.
„Sage einmal Hans-Otto, was machst du jetzt eigentlich mit deiner freien Zeit?“.
Dabei fiel dem Hermann mit Schrecken auf, das er gar nicht so recht wusste, welche Hobbys Hans-Otto eigentlich hatte und das nach 45 Jahren gemeinsamer Kollegen-Zeit.
„Ich habe da so eine Idee für dich!“, meinte Hermann ganz locker und nebenbei.
„Erzähle mal“, sagte Hans-Otto und mehr so zum Spaß.
„Du könntest Trauerredner werden!“.
„Ein was bitte?“, fragte der zurück.
„Wir waren letzte Woche bei der Beerdigung von der Schwester meiner Frau. Helga selbst war nicht mehr in der Kirche. Die Trauerrede hielt ein professioneller Trauerredner. Du, der sprach besser, schöner, trauriger und einfühlsamer als ein Pastor oder ein Pfarrer es je hätten tun können. Man hatte das Gefühl, der wäre ein Bruder von der Helga gewesen. Das kannst du genauso gut, mit deiner angeborenen Empathie!“.
Mit diesen Worten verabschiedeten sie sich, heute förmlich mit Handschlag (sonst nie) und versprachen sich gegenseitig gesund bleiben zu wollen, sich nicht aus den Augen zu verlieren und ab und zu miteinander zu telefonieren. Die abschließende und vorerst letztmalige Umarmung fiel mehr als herzlich aus.
Die Überlegung, bei Beerdigungen eine Rede halten zu können, beflügelte ihn mehr, als er es wahrhaben wollte. Nach dem großen Hallo Zuhause, nach den Glückwünschen zum Ruhestand, nachdem alle Nachbarn, Freunde und Bekannte wieder gegangen waren, eröffnete er seiner Frau abends diese Überlegung.
„Martha, ich werde Trauerredner!“.
„Du wirst was?“.
Hannah, die Enkelin, zufällig Ohrenzeugin dieser Unterhaltung geworden, sprang direkt darauf an.
„Aber Opa, das ist doch toll; ich kenne das schon. Soll ich das für dich übernehmen?“.
„Was möchtest du denn da übernehmen, Hannah?“.
„Lass mich mal machen, Opa!“
Keine drei Tage später, seine Enkelin Hannah war erneut zu Besuch bei ihren Großeltern:
„Opa, übermorgen hast du deinen ersten Termin!“.
Mehr überrumpelt als froh, fragte Hans-Otto:
„Wer ist denn gestorben? Wenn ich ihn oder sie gekannt haben sollte, ist es für mich okay, ad hoc noch etwas Schönes und mit viel Gefühl vorbereiten, besser gesagt, schreiben zu können, aber sonst …“
„Wieso gestorben, Opa? Du bereitest bitte eine Hochzeitsrede vor; meine beste Freundin heiratet übermorgen!“.
Er war doch ihr Arzt
Gerda schaute auf die Uhr.
Zwar prüfte sie wieder und wieder die Uhrzeit und das bestimmt 100-mal am Tag, aber donnerstags lieber noch einmal mehr. Heute ist wieder Bekloppten-Tag. Sie nennt diesen Tag so, weil sie alle drei Wochen einen Termin bei ihrem Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat. Die Bezeichnung Seelenklempner hätte er einfach nicht verdient. Meinte sie es verächtlich, wollte sie es damit verniedlichen? Sie war sich nicht immer im Klaren darüber, warum sie in ihren Gedanken so abfällig über diesen so wichtigen Dauertermin sprach. Die Zeit rannte und sie musste sich auf den Weg machen, denn um Punkt 15.00 Uhr wurde sie erwartet.
Der Arzt, ein ausgewiesener Facharzt, der mit den vielen Diplomen an der Wand, durfte ihr bereits seit drei Jahren in die Seele schauen. Bei ihm ließ sie es zu, ihm gestattete sie diesen Einbruch in ihre tiefste, innere Privatsphäre. Zu ihm hatte sie Vertrauen und sie mochte ihn. Nur zugeben wollte sie das nicht, eingestehen konnte sie sich es aber auch nicht.
Gerda selbst wohnte in der Stadtmitte der thüringischen Stadt Jena, genauer gesagt, direkte Innenstadtlage. Das machte ihr vieles einfacher. Sie musste einfach nur pünktlich losgehen. Daher erreichte sie ihren Herrn Doktor zu Fuß, den sie grundsätzlich nur mit einem förmlichen Sie und mit seinem Doktortitel, aber nie mit Nachnamen, ansprach. Sie verließ ihre Wohnung an der Fürstenstraße, ging die Schlossgasse hinunter, an der Friedrich-Schiller-Universität vorbei, bog in die Saalstraße ein und schon stand sie vor seiner Praxis. Das polierte Messingschild am Eingang glänzte bei Sonnenschein wie Gold und ihr Blick blieb, wie immer, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, daran hängen: „Dr. Markus Schnell, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Diplom-Psychologe und Supervisor“.
Diese besondere, langwierige und spezielle Ausbildung ihres Arztes, beeindruckte sie immer wieder von Neuem. Bei ihm fühlte sie sich gut aufgehoben. Nein, aus Kupfer hätte dieses Schild nicht sein dürfen, so ihr Resümee. Die Haustür war stets offen, so gelangte sie, ohne bereits auf der Straße klingeln zu müssen, die Treppe hinauf bis zu seiner Praxis, im sechsten Stock gelegen. Im Übrigen verbat sie sich seit jeher, den Aufzug zu benutzen und ihr Pulsschlag ging nach dieser Anstrengung wie gewöhnlich etwas schneller. Aber heute lag noch etwas Anderes in der Luft. Mit etwas Ruhezeit dazwischen, klingelte Sie pünktlich an seiner Praxistür. Sie war größtenteils mit Glas versehen; so konnte man vorab hineinschauen. Der Herr Doktor stand im Flur seiner Praxisräume und es schien so, als ob er auf etwas warten würde. Hatte Gerda da einen Anflug von leichter Nervosität in seinem Gesicht, in seiner Mimik, erkannt?
„Hallo Gerda, da sind Sie ja schon!“, begrüßte er sie, nach dem er ihr die Praxis-Tür geöffnet hatte.
„Komisch“ dachte sie sich, „ich bin doch immer pünktlich; nie zu früh, aber auch nie zu spät“.
So hatte sie es gerne. Sie war zur verabredeten Zeit da, egal, wen sie traf oder worum es auch immer gehen sollte. Und überhaupt, was sollte dieses sich beim Vornamen nennen –
es behagte Gerda nicht. Er war doch ihr Arzt!
Und schon waren wieder die Bilder der letzten Sitzungen bei ihr präsent. Fühlte sie es, spürte sie etwas? Ihre Überlegungen dahingehend blieben diffus zurück. „Aber irgendwie stimmt was nicht“, lautete ihr Urteil und leise für sich in Gedanken ausgesprochen. Gerda begrüßte ihn mit einem neutralen sowie gewohnten „Guten Tag Herr Doktor!“.
Herr Schnell half ihr, heute mehr unbeholfen als galant, aus dem Mantel. Eine Vorzimmerdame oder Assistentin gab es in dieser Praxis nicht. Still und leise war es dort. Ein kleiner Zimmer-Springbrunnen plätscherte wohl seit Jahren in der Diele vor sich hin. Man konnte erkennen, dass er nicht gepflegt wurde. Zu viele Wasserränder, zu viele Kalkablagerungen und viel zu viele Staubmäuse ringsherum liegend. Der Garderobenständer hatte ebenfalls seine beste Zeit hinter sich; „wen er wohl schon alles auf dem Haken gehabt hatte? Wie viele arme Seelen, so wie ich, haben hier wohl schon Hilfe gesucht?“, dachte sie bei sich.
„Nehmen Sie schon einmal bitte Platz, liebe Gerda, ich mache uns noch schnell einen Kaffee, dann kann es gleich losgehen. Kaffee mit etwas Kondensmilch, wie immer?“.
„Gerne Herr Doktor!“.
Eigentlich waren es nur 45 Minuten, die ihr die gesetzliche Krankenkasse pro Sitzung bewilligt hatte, die anderen, weiteren 15 Minuten, ließ der Herr Doktor und dass bei jeder Quartalsabrechnung, regelmäßig sowie großzügig hinten herunterfallen.
„Gerda“, sagte der Herr Doktor, „ich möchte Sie etwas fragen!“.
Eigentlich war sie heute mit einem genauen Plan zu ihm gekommen. Sie wollte einiges fragen, hatte sich im Vorfeld extra die Mühe gemacht und alles aufgeschrieben, was ihr für die heutige Sitzung wichtig war. Es war eine lange Liste geworden. Und jetzt, nun wurde sie befragt. Unangenehme Gefühle kamen bei ihr hoch.
„Gerda, wie lange sind sie schon meine Patientin?“.
Aber Herr Doktor, das wissen Sie doch! Fast auf den Tag drei Jahre!“.
„Gerda, ich möchte ganz offen sein, darf ich heute ehrlich zu Ihnen sein?“.
Ihr Herz begann zu rasen, ihr wurde etwas übel. Sie begann zu überlegen:
„War er denn sonst nicht ehrlich mit mir, was will dieser Kerl von mir?“. Auf einmal war er für sie der Kerl und nicht mehr der Herr Doktor. „Was meinen Sie damit, Herr Doktor?“.
Wie oft hatte Markus an diesen einen Moment schon gedacht. Ausgesuchte Gedanken verworfen, sich später dafür geschämt, dann wiederum nach den richtigen Worten gesucht, erneut am Text gefeilt. Wie sollte er nur seine Liebe zu dieser einen, seiner Patientin, gestehen? Nein, im Grunde verbat er sich selbst diese Gefühle. Sie war seine Patientin und er war doch ihr Arzt. Disziplin! rannte unentwegt durch seinen Kopf. Und trotzdem, heute Nachmittag, wagte er es. Für diesen Satz nahm er seinen ganzen Mut zusammen: „Gerda, ich kann Sie sehr gut leiden!“.
Ihr Herzschlag setzte kurz aus, nur, um dann danach umso heftiger zu schlagen, so dass ihre Halsschlagader spürbar und sichtbar pulsierte. Sie verschluckte sich und bekam einen nicht enden wollenden Hustenanfall. Sie war erschüttert. Hätte sie seine Frage erraten sollen, darauf wäre sie niemals gekommen.
Klar, gewünscht hatte sie das schon lange – natürlich schwärmte sie im Verborgenen für diesen Arzt. Aber heute, jetzt und hier, sensible Gefühle im Klartext ausgesprochen zu bekommen, hatte für sie eine andere Dimension. Was der Herr Doktor aber gerade versuchte, so locker und doch verkompliziert auszusprechen, hätte sie sich niemals getraut zu sagen.
Auch wenn sie davon träumte, das hätte sie sich in ihrem ganzen Leben nicht getraut, nur erträumt.
Nach dieser Schrecksekunde, die wohl beiden wie Stunden vorgekommen sein mussten, verstummte Gerda regelrecht. Sie versank in einem Strudel an Informationen, Szenen, Vorkommnissen, Flashbacks, die jetzt auf einmal so viel Sinn machten, die sich in letzter Zeit aufgetürmt hatten. Kurz, auf die sie sich mit ihrem früheren, ersten Blick, gar keinen Reim machen konnte. Jetzt wusste sie es plötzlich, daher also die Zuvorkommenheit in Person, deswegen mehr Sprechzeit als üblich (60 anstatt nur 45 Minuten), und ohne Extra-Vergütung. Die vertrauensvolle Ansprache, die nette Fürsorge seinerseits und so vieles andere mehr. Dann dieses ewige Ich begleite sie noch bis zur Haustür. Und immer in den Mantel helfen wollen und dieses eigenartige Nachwinken, als ob man seine eigene Frau verabschiedet, wenn sie morgens das Haus verlässt, um zur Arbeit fahren zu können. Zärtliche, eher zufällige Berührungen, sie hatte sie sich doch nicht eingebildet. Ihr stets den Hut hingehalten und die Handschuhe gereicht. Nicht nur einmal eine tröstende Umarmung am Ende einer Sitzung, wenn viele, viele Tränen ihr hübsches Gesicht benässt hatten. Ihr Kopf war völlig durcheinander. Ihre Gedanken fuhren Achterbahn mit ihr.
„Gerda, du sagst ja gar nichts?“.
„Jetzt duzt er mich auch noch“.
Gerda wurde ganz blass, zu sich selbst redend: „was soll ich bloß machen, was soll ich nur sagen?“.
Sie, mit ihren 50 Jahren, sie, mit ihrem zu früh ergrautem Haar, sie, mit ihrem ewigen Geiz, sich partout nicht chic anziehen zu wollen, niemals und zu keiner Zeit geschminkt, saß nun dort, in ihrer angeborenen Schüchternheit im Sessel und wusste nicht mehr, wie ihr geschah. Sie traute sich nicht, Markus, dem Herrn Doktor, etwas zu sagen, geschweige denn, ihn überhaupt anzusehen. Sie sagte auch nichts zum gerade erst Gehörten. Stattdessen fragte sie ihn: „Herr Doktor, ob ich wohl ein Glas Wasser haben könnte?“.
Der Arzt, völlig konsterniert, selbst neben sich stehend, von sich selbst schockiert, rannte in seine kleine Teeküche, goss das Glas hektisch ein und bot es ihr sofort an. Gerda trank es in einem Zug aus. Es war ihr peinlich, so schnell zu trinken, sich so zu benehmen. Sie erkannte sich nicht wieder.
„Ich muss jetzt gehen, Herr Doktor!“, sagte sie ganz leise und wagte es fast gar nicht, ihn dabei anzusehen.
„Gerda, was habe ich da nur angestellt?“.
Fast flehend bat er sie, zu bleiben. Ihr Entschluss zu gehen, stand aber fest. So begleitete er sie zur Tür, hielt ihr aber nicht wie sonst, den Mantel hin – er traute es sich schlichtweg nicht mehr. Sein Mut hatte ihn soeben komplett verlassen. Die Tür fiel ins Schloss. Doch Gerda blieb im Hausflur stehen; sollte sie gehen oder bleiben? Sie war völlig verstört. Wann hatte es das schon einmal in ihrem stillen, bescheidenen Leben gegeben: Ein gestandener Mann, ein Arzt mit Doktortitel, ein wahrer Gentleman, ein Mann in den besten Jahren und ja, er war geschieden (das hatte sie bereits vor langem herausgefunden), gestand ihr, dem Mauerblümchen, dieser armen Seele, seine Liebe.
Sie musste verrückt geworden sein, das auszuschlagen. Trotzdem ging sie ganz leise, fast auf Zehenspitzen, so, als ob sie unsichtbar sein wollte, durch den dunklen Hausflur.
„Ich brauche dringend frische Luft“, dachte sich der Doktor. „Ich muss hier raus“. Nein, der nächste Patient musste nicht warten, denn Termine hatte er für diesen Tag vorsorglich nicht mehr vereinbart. So nahm er den Fahrstuhl, fuhr hinunter, wollte sich gerade auf dem Bürgersteig eine Zigarette zur Beruhigung anzünden, da kam Gerda aus dem Flur. Sie sahen sich nur an, keiner sagte etwas, sie nahmen sich gegenseitig in die Arme. Er durfte sie küssen ...
Die gekochte Leber
Halb verdurstet, halb ausgehungert, freuten sich die lieben, aber auch übermüdeten Kinder (in der Sprache der Bürokratie der 1960er Jahre, gerne auch mit dem unschönen sowie sperrigen Wort Verschickungskinder belegt), nach ihrer langen Anreise zu einem vierwöchigen Aufenthalt auf der Nordsee-Insel Borkum, dem einzigen Ort in Deutschland neben Helgoland mit erholsamen Hochsee-Klima, im Kinder-Heim „Seehund“, auf ihre allererste Mahlzeit an diesen Ankunftstag.
Sie kamen teilweise aus dem Schwarzwald oder aus dem Ruhrgebiet und warteten schon ganz ungeduldig auf das von den Großen angekündigte sowie baldige Essen und Trinken. Von allen Tischen, bei dem jeweils eine erwachsene Tante mit dabeisaß, schallte es wie in einem großen Chor durch den Saal: „Liebe Kinder, wir wünschen euch allen einen guten Appetit!“.
Da saßen noch alle Kinder durcheinander. Aber das würde sich ab morgen ändern – spätestens übermorgen früh sollte allen Kindern ein Tisch zugewiesen werden. Die älteren unter sich, die mittleren und die ganz kleinen ebenfalls für sich. Nein, Namensschilder für jedes einzelne Kind waren nicht aufgestellt worden, aber dafür hatte jeder Tisch und das gut lesbar, eine eigene Nummer. „Liebe Kinder, ab morgen früh teilen wir euch alle neu auf!“.
Der kleine Olaf, gerade einmal sechs Jahre alt, konnte sich es nur schwer vorstellen, dass so viel Essen aus einer Küche kommen könnte, um alle Kinder satt zu bekommen. Was jedoch dann an Massen von frischen Brötchen herauskam, versetzte ihn ins Erstaunen. „Liebe Kinder, lasst es euch nun alle gut schmecken!“.
Und dazu der frische, gut gekühlte Kakao. Der kleine Mann genoss jeden Happen, jeden Schluck. Nach dem Essen waren alle platt. Wer nicht wollte, sollte seinen Rucksack, seinen Koffer morgen auspacken, bis auf den Waschbeutel. Denn das, was unbedingt sein musste, war das Zähneputzen. Daran ging jetzt wohl vier lange Wochen nichts vorbei. Die Aufsichtsperson achtete streng darauf, jedes einzelne Kind am Waschbecken stehen zu sehen, wie es sich die Hände wusch, das Gesicht sauber machte und sich zum Schluss die Zähne reinigte. „Liebe Kinder, ihr putzt jetzt alle eure Zähne, und zwar gründlich!“.
Kontrolle musste wohl sein. Waren es doch bestimmt so um die 50 Kinder, die ab heute diese Herberge neu bewohnen würden. Die Kinder, die die vorherigen vier Wochen an der frischen Luft genießen durften, waren höchstwahrscheinlich erst heute, gleich früh am Morgen, mit der gleichen Fähre zurück nach Emden an das Festland und von dort weiter, wieder nach Hause gefahren. „Liebe Kinder, wir wünschen Euch allen nun eine gute Nacht, schlaft alle schön!“.
„Kinder, Frühstückszeit!“ rief die nette Tante von gestern Abend, die ab heute Morgen lieber mit Schwester Elke gerufen werden wollte. Sie war es auch, die zugleich an Olafs Tisch, der mit der Nummer elf, das Essen gemeinsam mit den anderen Kindern in dieser Gruppe, seinen neuen Freunden, einnahm.
„Liebe Kinder, heute Morgen gibt es Eier bis zum satt essen!“. Jedes Kind bekam ein Spiegelei auf den Teller gelegt. Es war rund und von beiden Seiten gebacken worden. Nachschlag war möglich.
Kaum hatte Olaf das Spiegelei und vieles andere aufgegessen, seinen, dieses Mal noch warmen, aber nicht zu heißen und im Vorfeld bereits schwach gezuckerten Tee getrunken, den die Schwester Elke so fürsorglich für alle Kleinen nachgoss, überkam ihn ein kleiner Schauer. Beim gestrigen gemeinsamen Abendessen war es ihm noch gar nicht so stark aufgefallen, aber als er sich im Saal umschaute, entdeckte er einen Tisch, der ihm komisch vorkam. Gut, es war auch ein Tisch und dieser Tisch hatte ebenfalls vier Tischbeine und gleichfalls eine Nummer bekommen, aber trotz allem war etwas anders an diesem Tisch, der mit der Nummer zwölf versehen war. Dann fiel dem Olaf auf, dass dort Kinder Platz nehmen mussten, die alle, in der Summe betrachtet, übergewichtig waren. Es waren Mädchen und Jungen, die dort gemeinsam zusammensitzen mussten und wohl alle dasselbe Leid plagte.
Gebrandmarkt, abgeschottet, stigmatisiert, alle diese Wörter waren ihm natürlich noch fremd. Aber wie er diese Kinder dort so sitzen sah, spürte er eine Abneigung gegen diese Art von Tisch. Nein, sie bekamen heute Morgen keine Eierspeise zum Frühstück angeboten, schon gar nicht zum satt essen. Ja, auch kleine Kinder haben bereits ein Gespür für Gerechtigkeit. Deren Aufsichtsperson rief wiederum ihren neuen Schützlingen zu: „Liebe Kinder, ihr sitzt hier bei mir und wir essen nicht das, was die anderen Kinder bekommen!“.
Viele machten sich gleich lustig über die Tischkinder vom Tisch zwölf, die dort zwar nicht räumlich, trotzdem abgetrennt sitzen mussten. Nicht selten hörte Olaf den Satz: „Da sitzen die dicken Kinder“, wenn auch nur unter vorgehaltenen Kinderhänden.
Dann gab es gebratene Leber vom Schwein mit Röstzwiebeln, Kartoffelpüree und Bratensoße zum Mittagessen. Den Kindern aber, am Tisch Nummer zwölf, alle zusammen am Diät-Tisch sitzend, wurde eine gekochte Leber serviert, ohne sonstige Beilagen. Dazu gab es ungesüßten Tee. Trotz allem rief deren Schwester an diesem Tisch: „Liebe Kinder, lasst es euch gut schmecken!“
Da Olaf in Sichtweite und somit nah genug an deren Tisch saß, sah er nun die gekochte Leber auf deren Tellern liegen. Sie war schon fast weiß, teilweise mehr dunkelgrau als hell, dann wieder unansehnlich weiß, dann eventuell noch etwas blassrosa schimmernd, vielleicht sogar etwas gräulich. Dieses Stück Leber sah nicht nur grauenvoll von außen aus, sie muss noch schlimmer geschmeckt haben; vielleicht nach gar nichts? Sie alle bekamen das Stück Fleisch fast nicht herunter, sie muss zu zäh gewesen sein. Kaute man dabei auf Gummi? Der leckere Essen-Duft der gebratenen Leber lag auch für sie in der Luft, nur blieb dieser Geschmack leider für ihre Zungen unerreichbar und von frisch gebratenen Röstzwiebeln konnten diese Kinder nur träumen.
„Kinder, nach den vier Wochen hier werden euch Eure Eltern nicht wiedererkennen!“, hallte es vom Tisch zwölf durch den großen Saal. So richtig darüber freuen konnte sich keines von diesen Kindern.
Die Blamage von Rio
Brasilien ist ein sehr, sehr großes Land in Südamerika, dass sich vom Amazonas-Becken im Norden bis zu den Weinbergen und den mächtigen Iguaçu-Wasserfällen im Süden erstreckt. Es hat acht Millionen, fünfhundertvierzehntausend km² (8.514.000). Nur zum Vergleich: Deutschland hat gerade einmal 357.022 km².
Das Wahrzeichen Rio de Janeiros ist die 38 Meter große Christusstatue mit dem schönen Namen Christos. Hoch oben, auf dem Berg namens Corcovado, stehend. Man kann dieser Statue ganz nahekommen, wenn, ja wenn, diese große Figur, den Herrn Jesus darstellend, nicht eingerüstet ist. Übrigens breitet Christos seine Arme ganz bewusst über den Berghang aus, dort, wo das unglaublich weite und nicht überschaubare Gebiet der Favelas (Armenviertel) steht. Sie sind einfach so in den Berg hineingebaut worden. Ohne Strom und fließendem Wasser. Noch nie habe ich so hautnah, so eng, größtes Elend und sündhaften Luxus nebeneinander wohnen sehen.
Wer für sich einmal, wenn überhaupt, Arm und Reich entdecken möchte, dann hier. Nein, offizielle Führungen gab es zur Zeit unseres damaligen Besuches noch nicht. Gefährlich war es auch noch dazu, aber fröhliche Kinder und freundliche Menschen haben es uns etwas leichter gemacht. Wenn man noch genauer hinschauen wollte, waren weitere, tiefer gehende und sehr unschöne Bilder zu sehen. Wenn kein Geld mehr zum Einkaufen zum Essen da war, wurde in deren Grenzregionen, schon einmal eine komplette Schildkröte samt Panzer auf den Rost gelegt. Meine Frau Monika und ich blieben nach diesem Besuch sehr nachdenklich zurück. Der nächste Tag kam und wir hatten den Wunsch, einmal im Leben den Corcovado sehen zu wollen. Merken Sie es gerade? Genau das war mein Fehler, der schon bei der Reiseplanung in Deutschland seinen Ursprung haben sollte. Eigentlich meinte ich Christos, sagte aber Corcovado. Monika, meine Frau, wollte mir übrigens ausgerechnet bei dieser Tagesreise vertrauensvoll freie Hand lassen; ich sollte bitte alles organisieren: „Michael, heute bist du dran, bereite bitte alles vor; ich bleibe noch ein bisschen hier im Frühstücksraum sitzen und lese die Zeitung zu Ende“.
Da ich keinerlei portugiesische Sprachkenntnisse hatte, versuchte ich an der Hotel-Rezeption mit meinem Schulenglisch – Abschlussklasse, Hauptschule, meinen ADAC-Landkarten und vorher abgeschriebenen Texten –, alles generalstabsmäßig vorzubereiten; inklusive der strengen Aufforderung, mir bitte nur ein Taxi mit einer offiziellen, städtischen Zulassung und einem Fahrer mit einer echten Fahrer-Lizenz zu ordern. Wobei diese Lizenz etwa, ungefähr, mit unserem deutschen Führerschein gleichzusetzen wäre. Das hatte ich mir einmal in einem Reisebericht im Fernsehen abgeschaut. Denn wenn man zum Beispiel nach Japan fliegen wollte, immer erst schön alle möglichen Fragen in japanischer Schrift aufzeichnen und sie dann dem Verkäufer oder Taxifahrer vor die Nase halten. Das kann ich bestimmt auch für Brasilien anwenden, so meine schlaue Erkenntnis, damals in Vorbereitungen für diesen Trip stehend. „Yes Sir!“, klang es seitens des Rezeptionisten und für mich sehr überzeugend. „Es ist alles verstanden und wir organisieren das sehr gerne für Sie“.
Mächtig stolz und im Glauben, das wirklich alles klar war, ging ich zurück an unseren Frühstückstisch. „Hallo Michael, alles in Ordnung, kann es losgehen?“.
In meiner Antwort klang Überheblichkeit mit: „Was denkst du denn von mir? Alles bestens“.
„Hast du auch an die Klimaanlage im Taxi gedacht?“.
„Wofür hältst du mich eigentlich?“.
Na dann. Pünktlich, um 10.00 Uhr, sollte der Ausflug hoch zum Corcovado losgehen. Was nicht kam, war natürlich das georderte Taxi und der Fahrer mit den speziellen Ortskenntnissen. So standen wir in der heißen Sonne, nur überdacht vom Baldachin vor dem Hotel-Eingang und schwitzten schon einmal vor. Circa 20 Minuten später, kam dann der Herr Taxi-Fahrer um die Kurve angebraust. Er und sein Taxi sahen alles andere als Souverän aus. „Lieber Herr Taxifahrer, ab jetzt bitte langsamer“. Ich glaube nicht, dass er mich verstanden hatte.
Und los ging es, die ganze Copacabana entlang und dann den Corcovado hoch, so heißt der Berg in Rio de Janeiro ganz offiziell, auf der die Christos-Statue steht, wie bereits erwähnt. Hoch oben angekommen, nass geschwitzt, als erstes umgerechnet sieben D-Mark für Parkgebühren bezahlen müssen. Das Taxi hatte natürlich keine Klimaanlage, wofür hatte der Rezeptionist eigentlich das Trinkgeld von mir bekommen? Die Aussicht war getrübt und wir waren ebenfalls betrübt. Warum? Die gesamte Statue war eingerüstet. Ich dachte, ich schaue nicht recht. Nur noch Gerüste um uns herum. Das Plateau, die Abgrenzungen, einschließlich dem Herrn Christos, alles eingerüstet. Die Aussicht war auch noch versperrt. Monika bestrafte mich mit einem lauten und langanhaltenden Lachanfall. „Sehr gut organisiert, mein Lieber!“; rief sie mir zu.
Vor lauter Frust wusste ich nicht mehr wohin mit mir. Da fliegt man einmal um die halbe Welt und dann so etwas und noch einmal, wofür hatte der Rezeptionist das Trinkgeld von mir bekommen? Kühle, aber auch überteuerte Getränke an einem Kiosk besorgend, natürlich auch für den Herrn Taxifahrer, ich bin ja schließlich kein Unmensch, hatten wir trotzdem, dort oben, noch eine einigermaßen gute Zeit, auch wenn die Aus- und Fernsicht stark eingeschränkt blieb. „Na wartet, meine Freunde. Euch werde ich es noch zeigen“.
Meinen Zorn bekam als erstes der arme, nicht pünktliche, ohne ausreichende Deutsch-Sprachkenntnisse und immer noch ohne eine funktionierende Klimaanlage und vielleicht auch ohne einer offiziellen Fahrer-Lizenz ausgestattete Taxifahrer, zu spüren. Bei der Abfahrt von der Bergspitze machte ich ihm mit einer starken, ausholenden Gestik und einer noch grimmigeren Mimik klar, dass er es ja nicht wagen sollte, am Pförtner-Häuschen vorbeizufahren, wo man uns unberechtigterweise das Geld zum Parken abgeknöpft hatte.
Er wagte es kaum noch, in den Rückspiegel zu schauen und hielt tatsächlich an; heißt denn das Kassen-Häuschen auch auf Portugiesisch Kassen-Häuschen? Geschimpft hatte ich ja nur noch in deutscher Sprache. Vielleicht hatte ich auch dem portugiesischen Casa, das für das Wort Haus steht, Kasse dazwischengeschoben. Casa oder Kassa egal, ich weiß es nicht mehr. Ich ließ mir von ihm den Parkzettel übergeben. Eigentlich wollte ich dieses schöne Erinnerungsstück zuhause ins Fotoalbum geklebt haben, aber dazu hatte ich nun schon keine Lust mehr. Mit großer Brust näherte ich mich den beiden Herren. Sie waren mit einer Art Phantasie-Uniform und einer dunkelblauen Schirmmütze am Verkaufsschalter eingekleidet sowie ausgestattet und mussten, trotz der heißen Temperaturen, hinter einer nicht abgedunkelten Glasscheibe ausharren.
Ohne ein Grußwort zu äußern (was eigentlich sonst gar nicht meine Art ist), kam ich gleich zur Sache: „I want back my Money“, drohte ich Ihnen mit mahnender Stimme und verdrehtem Schulenglisch. Das war schon die erste Peinlichkeit; wenn überhaupt, hätte es heißen müssen: „I want my Money back!“ (ich hätte gerne mein Geld zurück). Die Dankes-Formel vergaß ich vor lauter Aufregung, auch beim Wiederholen).
Die Herren Aufsichtspersonen, Security und Parkplatzkarten-Verkäufer in Personal-Union wussten natürlich nicht, was ich meinte, was ich von ihnen wollte und warum ich mich so peinlichst aufführte. Ich weiß nur noch, dass ich redete und redete. „I` didn`t see the Corcovado; I want back my Money“.
Minutenlang ging das so; bestimmt eine Viertelstunde lang. Eine Wiederholung dieser beiden Sätze überholte die andere. Andere Kunden warteten geduldig in der sich aufbauenden Schlange hinter mir. Warum auch immer. Sie amüsierten sich wohl köstlich über diesen Teutonen; Futter dafür gab ich ihnen ja wohl alle Male. Nur gut, dass es damals vor 30 oder mehr Jahren noch keine Handys gab. Die Herren Kassierer und zugleich Kontrolleure bewegten sich nicht von der Stelle. Höchstwahrscheinlich fühlten sie sich auch gar nicht direkt von mir angesprochen. Heute weiß ich es auch besser; ich erzählte ihnen in deutscher Sprache, dass ich nicht den Berg gesehen hätte, sprich den Corcovado. Dabei standen wir ja alle auf diesem Berg; er war zu sehen. Was ich eigentlich sagen und beschreiben wollte, war, dass Christos nicht zu sehen war. Dazu noch mein fürchterliches Gebärden als Deutscher im Ausland; was für eine Blamage meinerseits.
Ob Sie es glauben oder nicht, auf einmal ging einem von diesen beiden Herren wohl ein Licht auf und einer zeigte mit seinem Finger auf Christos, der als Souvenir in tausenden von Variationen und in den verschiedensten Dollarnoten aus allen Herren Ländern ausgepreist am Seitenfenster stand. „Ja genau, das meine ich damit; endlich verstehen Sie mich“. Wortlos, aber nicht unfreundlich, zahlten sie mir den gesamten Betrag, die umgerechnet, vollen sieben Deutsche Mark, in ihrer landeseigenen Währung, dem brasilianischen Cruzeiro, wieder aus. Der Taxifahrer, die ganze Szene mit Abstand betrachtend und sich schadlos haltend, traute seinen Augen nicht. Stolz wie Oskar, zu diesem Zeitpunkt schämte ich mich noch nicht zu Tode, öffnete er mir sogar die Wagentür, damit ich bequem einsteigen konnte. Auf der Rückfahrt sprach meine Frau kein Wort mehr mit mir. Das Schweigen im Auto war ziemlich laut. Wegen der schlechten Stimmung im Taxi, wagte der Herr Taxifahrer noch nicht einmal mehr, ein Liedchen zu pfeifen oder von seinem schönen Land in seiner portugiesischen Muttersprache zu erzählen, wie er es noch auf der Hinfahrt getan hatte. In den Rückspiegel schaute er jedenfalls schon lange nicht mehr.
Kaum im Hotel angekommen, bin ich natürlich nicht zur Rezeption gegangen, um den Herrn Portier zur Rede zu stellen und das in meinen Augen unberechtigte Trinkgeld zurückzufordern. Peinlicher wäre es wohl nicht gegangen. Ich konnte mich schließlich beherrschen. Er war sowieso nicht mehr da, der Frühdienst war schon lange zu Ende. Darüber hinaus war der Rauch fast verzogen, meine Frau sprach mittlerweile wieder mit mir, dass der Taxifahrer mit einem breiten und zufriedenen Grinsen quittierte. Vielleicht rechnete er sich dadurch auch schon Chancen für ein höheres Trinkgeld im Voraus dafür aus. Seine eigene Verspätung Anfangs dieses Ausfluges, die von mir nicht gewollte Raserei seinerseits, die unerträgliche Hitze im Auto, das alles hatte, er wohl erst gar nicht wahrgenommen, zumindest aber vergessen. Ich nicht.