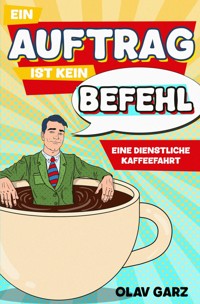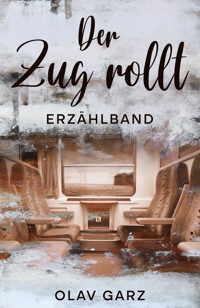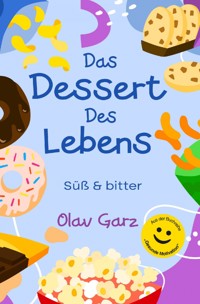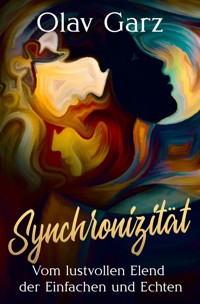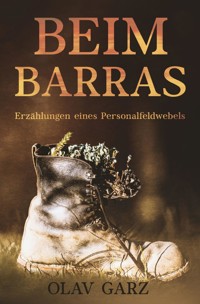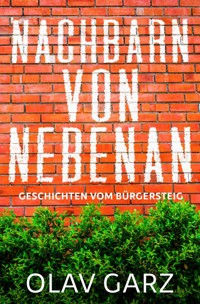
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerede, Gebrabbel, Gefasel, Gemunkel, Plapperei, Getuschel, Geschrei, Gequake, Klatsch und Tratsch, alles Umgangssprachen. Und doch erfüllen sie alle zusammen eine Beschreibung für eine besondere Neigung, die uns alle miteinander verbindet und jeden Einzelnen auf den Nägeln brennt, nämlich, die eigene Neugier befriedigen zu können. Kommen Sie mit auf einen Spaziergang des Dünkels und schauen mit dem Autor gemeinsam hinter meterhohen Hecken, die nur aus einem einzigen Grund gepflanzt wurden: Den Einblick von außen abwehren zu wollen. Oder sind sie nur zu schüchtern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachbarn von
nebenan
Geschichten vom
Bürgersteig
Olav Garz
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse
http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2024 -Verlag, Altheim
Buchcover: Germancreative
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Belin.
In Erinnerung an
Herrn Oberstudienrat a.D.
Heribert Segbers
1947-2014
HS war nicht nur mein langjähriger
Klassenlehrer und ein feiner Mensch,
sondern vor allem ein herausragender
Pädagoge.
Er hatte mich zu einem guten
Hauptschulabschluss geführt.
Danke, lieber Heribert!
Hauptschule an der Hansastraße,
Gelsenkirchen, Ortsteil Bulmke-Hüllen,
1974-1979
Inhalt
Einleitung
Blutsfehde
Ein Pott Durcheinander
Der Wintergarten
Arm sind immer nur die anderen
Der gekaufte Gottesdienst
Ein durch und durch
unpolitischer Mensch
Haben Sie die Drombuschs
gesehen?
Der Schützenkönig
Ein ehemaliger Lieblingsnachbar
von mir
Sascha
Frau Doktor aus Krefeld
Einsamkeit auf dem Treppenflur
Nachbarn von nebenan
Ihr schönster Tag
Die Wunde, die nicht
verheilen will
Viele kleine Leute,
die in vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern.
Aus Nordafrika
Einleitung
Kann eine Mülltonne einen eigenen Charakter besitzen? Darf eine Mülltonne ein politisches Statement besitzen, kann sie wirklich aussagekräftig genug sein, um etwas über das Leben des Tonnen-Besitzers aussagen zu können, ohne diesen persönlich kennenlernen zu müssen? Anders herumgefragt, darf ich von einer einzigen auf der Straße stehenden Mülltonne auf einen Menschen schließen, der sie gerade auf den Bürgersteig geschoben hat? Ganz egal, ob im Schlafrock oder in einem Frack danebenstehend.
Nun, es gibt viele Arten, die Mülltonne zu personifizieren. Inzwischen gibt es schicke Kleider, die man ihnen umhängen kann, z.B. mit Bügel und Schlaufe – sozusagen und je nach Jahreszeit, mit unterschiedlichen Mustern und Farben, neu eingekleidet. Sie können gepflegt aber auch misshandelt werden, in dem Mann oder Frau ständig gegen sie treten. Viele Beulen, viele abgebildete Fußtritte am unteren Ende der Tonnen könnten das, nachweislich, beweisen. Von einer fehlenden fach- und sachgerechten Befüllung einmal ganz abgesehen. Da aber die Zeiten der großen Demonstrationen in Bonn am Rhein, in den 1980er Jahren mit 300.000 Menschen und den noch größeren Themen wie Atomkraft – Nein Danke! oder der Aufrüstung mit Pershing II.-Waffensystemen oder Willy wählen! in den 1970er Jahren vorbei sind, sinkt auch die Motivation, die eigene Mülltonne mit ausgewählten Aufklebern als eine politische Stimme nach außen zu missbrauchen und für klare Verhältnisse zu sorgen, wer hier wohl wohnt.
Der Nachbar an sich liebt es inzwischen, seinen eigenen und ruhigen Feierabend mehr für sich alleine zu verbringen, als dass er sich um seine Nachbarn kümmern wollte, selbst dann, wenn sie direkt nebeneinander, quasi Zaun an Zaun, wohnen sollten. Und die gut riechende und bestimmt auch wohlschmeckende Grill-Bratwurst will er jedenfalls, für alle offensichtlich, nicht mehr mit seinen angrenzenden Nachbarn teilen. Dann wird eben kein Guten-Appetit-Ruf an drüben, über die hohe Hecke, adressiert.
Und wenn überhaupt Kontakt nach außen bestehen sollte, sind heutzutage eher die globalen Reise-Sticker von berühmten Hotels aus den noch berühmteren Orten, der noch größeren und weiten Welt angesagt. Kurz, wer fliegt, nimmt den kostenlosen Sticker aus der Hotelmappe vom Hotelzimmer oder großzügig an der Rezeption ausliegend, für die heimische Pflege der Prahlerei, gerne mit nach Hause. Entweder muss der teure, gerippte Hartschalenkoffer noch am Airport daran glauben oder später. Jedenfalls muss und das auf alle Fälle zeitnah, am besten direkt nach der Landung, der Platz auf der Mülltonne, gewissermaßen als Beweismittel für die Nachbarschaft herhalten und wenn es nur irgendein, für alle in dieser Straße Daheimgebliebenen, unbekanntes Grill-Restaurant an irgendeinem best-place-Strand in Florida war. Wie dem auch sei, die internationale Fernreise-Botschaft lebt.
Ob schwarz, grau, gelb, braun oder blau, eigentlich egal. Fortschrittlich: In Österreich gibt es inzwischen eine grüne Tonne für privates Glasgut, ohne Pfandanspruch. Noch zukunftsträchtiger: Im Nordseebad und Kurort Dangast, direkt am Jadebusen, stehen inzwischen weitere kleine und bunte Tonnen auf den Hofeinfahrten bzw. in den Garagen. Die kleine gelbe ist für die Verwertung von Elektrokleingeräten vorgesehen, wie zum Beispiel die defekte Kaffeemaschine, den kaputten Toaster oder dem verkalkten Wasserkocher. Die kleine rote Tonne steht für echten kleinteiligen Haushaltsschrott, wie zum Beispiel einer alten Bratpfanne, bereit.
Die Tonnen für den Restmüll, für den Bio-Abfall, der Kartonage sowie dem Altpapier sind ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens und werden ein Abziehbild dessen bleiben, was der Besitzer uns damit sagen oder eben nicht sagen möchte, indem er sie zum Beispiel unbeklebt zurücklässt. Ist das nicht auch ein klares Statement, wofür auch immer? Wobei es hier höchstwahrscheinlich auf die subjektive Wahrnehmung, hier wohnt ein Spießer, hinauslaufen könnte, den man unbedingt dahinter vermuten wollte. Aber der wiederum sieht, dass Zigarettenkippen nun einmal nicht in den Gelben Sack gehören und den netten Nachbarn von nebenan nur einmal höflich darauf aufmerksam machen möchte: „Sie wissen schon, für das nächste Mal …“. Und er wäre es auch, der uns in einem strengen Winter, natürlich in einem überaus freundlichen Ton, darauf hinweisen möchte, dass wir bitte kein Streusalz mehr für die vereisten Bürgersteige benutzen möchten.
So werden wir hier bei diesen Geschichten auf Menschen treffen, denen es gelinde geschrieben oder einfach gesprochen schnurz ist, wie ihre Tonne aussieht, solange sie turnusmäßig und termingerecht geleert wird. Wer weiß schon wirklich, was sich hinter einer frisch gestrichenen, gepflegten und mit Geranien geschmückten Hauswand oder einer schmucklosen, alten und grauen Fassade in der Münchener Straße so abspielt.
Wir sehen und hören von lieben Menschen, die am Vorabend vom Heiligen Abend eine Pralinenschachtel für das Team der Abfallentsorgung auf den Deckel der grauen Tonne legen und damit allen Entsorgern frohe Weihnachten wünschen möchten oder beobachten nette Anwohner, die die braune Tonne, gleich am ersten Werktag eines neuen Jahres, mit einem großen Bonbonbeutel und persönlichen Neujahrsgruß, „für das liebe Entsorgungsteam“, bestücken wollen. Sie alle haben Recht damit, denn die regelmäßigen Tonnenleerungen tragen nun einmal dazu bei, dass wir uns auf der Straße etwas wohler fühlen können. Und überhaupt, müsste der Trend nicht schon längst zur zweiten, blauen Tonne gehen, wenn gefühlt bereits jeder dritte Nachbar im Home-Office, sprich zuhause am Küchentisch, seiner Arbeit nachgehen möchte und trotz der fortschreitenden Digitalisierung, täglich riesige und per Express angelieferte Kartons mit dem Kartonmesser zerschnitten werden müssen. Und sollte die Tochter vom Nachbarn, schräg gegenüber, die ehemals überzeugte Pazifistin, die unbeirrte Vegetarierin, die resolute sowie aktive Umweltaktivistin und bis vorgestern noch disziplinierte Dauerbesucherin von Demonstrationen gegen die Tötung von Walen, auf einmal den Spleen bekommen und sich dafür entschieden haben, freiwillig zur Bundeswehr gehen zu wollen, um dort Karriere machen zu können, sieht die Welt in dieser Straße ohnehin anders aus. Nicht nur, dass aus dem offenen Fenster der jungen Bald-Soldatin und das den lieben langen Tag lang sowie in Dauerschleife, der Song von der Rockband Status Quo, Your in the Army Now, schrillt, nein, es kommt obendrein der ohrenbetäubende, wiederkehrende Trommelwirbel dieses Liedes noch hinzu, der uns die nächsten Abende nicht mehr zur Ruhe kommen lassen will. In der Summe können es alle Anwohner dieses Straßenabschnitts nicht mehr erwarten, bis endlich der Einberufungsbescheid bei dieser Hausnummer eingetroffen ist. Der Jubelschrei dieser jungen Dame wäre dann gewissermaßen der finale Befreiungsschlag für alle Lärmgeschädigten.
Sehr schön dagegen: Alle Hunde freuen sich, wenn die Gelben Säcke zur Entsorgung am Vorabend des Abholens auf die Bürgersteige gelegt werden. Dann kann Pfiffi bei den für alle Hunde so beliebten Vier-Wochen-Rhythmus nachriechen, was der Nachbarhund in den vorangegangen 30 Tagen so zum Fressen bekommen hat. So mancher Hund soll dadurch, nach dem Gassi gehen, sehr viel zufriedener nach Hause zurückgekommen sein, wenn er wittern konnte, dass das eigene Futter wohl doch nicht so schlecht ist, wie es ihm vorher erschien.
Blutsfehde
Diese Geschichte endete zugleich dort, wo sie begonnen hatte; in Duisburg.
Tote, Schwerstverletzte, Verletzte, großes Geknalle, ohrenbetäubendes Geschreie, ein furchtbares Szenario machte sich hier auf und hinterließ hunderte von gebrochenen Herzen.
„Was ist da los?“, schrien alle durcheinander.
Manche Menschen flüchteten sich in Hauseingänge, andere wiederum suchten Schutz hinter den zufällig dort parkenden Autos, wo gerade dieses unglaubliche Verbrechen geschah. „Ruft doch endlich einer die Polizei und einen Krankenwagen!“, hieß es von der anderen Straßenseite. Diese Straße lag heute in Trümmern – eine ganze Fassade blieb zerschossen zurück. Das große, griechische Restaurant mit dem vielleicht italienisch klingenden Namen, mit seinen 75 Tischen und den noch größeren und leuchtenden Buchstaben „PITSA“ an der Hauswand, war im ganzen Viertel bekannt. Die italienische Pizzeria vom Pedro, gleich nebenan stehend, aber auch.
„Thomas“, rief Pietro (der Italiener), früher stets im italienisch-deutschen Kauderwelsch und mit einem ruhrdeutschen Einschlag garniert, zu seinem griechischen Kollegen mit dem christlichen Namen hinüber: „Deine PITSA-Buchstaben sind zwar größer und bunter, aber meine Pizza ist die originale aus Napoli!“. So zogen sie sich jahrelang gegenseitig auf und lebten in trauter Gemeinsamkeit; jeder hatte sein gut laufendes Geschäft, trotz der Nähe auf ein paar Metern. Keiner von beiden nahm dem anderen etwas weg. Die Bambinis, die Söhne vom Pietro und vom Thomas, sie spielten, seit sie sich kannten, miteinander. Auf die große italienische Neon-Beleuchtung mit dem Begriff „Pizza“, hatten sie damals bei der Gründung dieses Restaurants ganz bewusst verzichtet – allein nur ihre Küche, Cucina Calabria, sollte den Kunden überzeugen. Das war stets ihr Credo gewesen. Thomas wiederum war stolz auf seine stark überdimensionierte, bunte sowie fast schon zu grell wirkende Banden-Werbung, über den Eingang seiner griechischen Taverne hängend.
Thomas hatte zwar schon ein, zwei Mal, hier und dort, bei einer seiner Raucherpausen, auf den Bürgersteig vor seinem Lokal stehend, zwielichtige Menschen, eher raue Typen, bei Pietros Ristorante, nebenan absteigen sehen und beobachten können, aber so richtig hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht.
Theresa, seine Frau, meinte immer nur: „Thomas, halte dich da raus. Das könnte die Mafia mit ihren Erpressungsversuchen sein. Wir sind Griechen, bei uns werden sie nicht hereinkommen wollen. Also, halt bloß die Füße still“.
Keine drei Minuten später; Polizeisirenen heulten durch das ganze Viertel – Krankenwagen kämpften sich durch die alten, engen Straßen. Kaum war die Kriminalpolizei, die „KTU“ (Kriminaltechnische Untersuchung), die Notärzte vor Ort, wurden es allen schlecht und mussten sich sofort und reihenweise übergeben. Das Blut auf den Bürgersteigen, die großen Blutlachen, in denen die Leichen lagen, sie alle waren tiefrot getränkt, verschmiert und grauenhaft anzusehen. Thomas, der Grieche, der aber trotzdem von allen nur „der Italiener“ gerufen, war sofort tot.
„Theresa, wo ist Thomas? Wo ist Antzelo? Leben sie noch...? Um Gottes willen, was ist bloß passiert?“.
Theresa konnte nur noch laut schreiend antworten: “Demestos, ich kann es dir nicht sagen. Und wo ist Antzelo, ich werde verrückt!“.
Die Polizei, die Fahrer der bestellten Leichenwagen (fünf an der Zahl), die zufällig vorbeigehenden Spaziergänger, Augenzeugen Widerwillen, sie alle standen nach wie vor unter schwerem Schock. Niemand konnte sich vorstellen können, dass so eine Bluttat jemals hier hätte passieren können. Die Straße hallte voller Hilferufe nach.
„Wo ist Antzelo? Oh, mein Gott, wo ist Antzelo?“.
Während sie Thomas (den Chef), als sechstes Opfer im Hausflur tot und blutüberströmt liegend fanden, war Antzelo, der kleine Knirps, der freche Junge, der Sohn vom „griechischen Italiener“, nirgendwo aufzufinden. Demestos, der Angestellte, der Kellner, der älteste Freund der Familie, weinte bitterlich um den Verlust seines Chefs, seines Mentors, seines Zieh-Vaters, dem lieben Thomas. Es lief ein Film bei ihm ab. Was hatten sie doch alles zusammen erlebt gehabt: Den Umzug nach Deutschland, den Aufbau des griechischen Restaurants, die vielen Überstunden, immer das wenige Geld geteilt, mit dem sie anfangs noch auskommen mussten. Und jetzt, diese Tragödie. Alle tot. Aber wo war Antzelo?
14 Minuten später. Die Polizei suchte, nach wie vor, nach Beweismitteln. Patronenhülsen wurden entdeckt, in Plastiktüten verpackt, die Leichen waren zwischenzeitlich abgedeckt worden. Die Ärztin und Pathologin vom Dienst, Frau Dr. Eckstein, war noch nicht am Tatort angekommen, bekam ein Polizist die Idee, beim Italiener im Ristorante, gleich nebenan, mit den typischen aus Kalabrien stammenden Essen und zugleich Namensgeber dieses Lokals, „Pizza“, hineinzuschauen. Von außen wirkte dieses Restaurant wiederum viel kleiner, bescheidener und nicht ganz so wuchtig. Die Polizei suchte den Lichtschalter in dem Ristorante. Pietro hatte nach Beginn der Knallerei sofort alle Lichter ausgemacht, als er den ersten Schuss hatte fallen hören. Die Tür, auf den Knien rutschend, gleich von innen abgeschlossen. Nach dem die ersten Verhöre des noch lebenden Küchenpersonals beendet waren, als der erste grobe Überblick für die ermittelnden Kriminalbeamten feststand, kamen sie nicht umhin, zu resümieren, dass hier höchstwahrscheinlich eine tragische Verwechslung stattgefunden haben musste. Denn so wie die es Lage-Übersicht hergab, so brutal wie die Menschen ermordet worden waren, mit einer nicht zu übersehenden Kaltblütigkeit hingerichtet wurden, konnte es sich nur um einen Auftragsmord einer italienischen Mafia-Organisation gehandelt haben. Sie sollten nicht die im griechischen Restaurant „PITSA“ arbeitenden Menschen ermorden, sondern die Leute im italienischen Restaurant „Pizza“ töten. Ob sie die großen, immer noch hell leuchtenden fünf Buchstaben irritiert hatten? Thomas sein Restaurant war allerdings auch nicht in den landestypischen blau-weißen Landesfarben von Griechenland getüncht worden. Man wusste es nicht sofort, es konnten bis dahin nur Mutmaßungen bleiben. Erschütterungen über diese Verwechslung en masse überall. Alle lagen sich nur weinend in den Armen. Pietro seine Angestellten heulten wie die Schlosshunde, so sehr waren sie von dem Tod ihrer Gastronomie-Kollegen von nebenan überwältigt.
„Antzelo, Antzelo“, rief auf einmal Demestos, der fast schon zur Familie gehörende Angestellte, laut über den Bürgersteig: „Da bist du ja Junge, wir haben schon das schlimmste gedacht!“. Theresa, die Griechin, konnte Antzelo, ihren kleinen Sohn, nur noch weinend und schluchzend in die Arme nehmen. Beide, der Sohn und seine Mama, weinten bitterlich. Er hatte sich, warum auch immer, zum Zeitpunkt dieses Unglücks bei seinem Spielkameraden, Francesco, dem Sohn vom Pietro, in dessen Kinderzimmer aufgehalten. Sie beide hatten von alle dem nichts mitbekommen.
Ein Pott Durcheinander
Karin und Cornelius waren kein Paar.
Sie haben kein Händchen gehalten, keine zufälligen Berührungen bei der persönlichen Übergabe eines Aktenordners provoziert bzw. zugelassen oder irgendwelche Zärtlichkeiten austauschen wollen. Sie gaben sich niemals den Anschein, gaben keinem Kollegen die Möglichkeit, darüber nachdenken zu wollen, ob da doch nicht etwas zwischen diesen beiden hätte sein können. Karin und Cornelius arbeiteten nur zusammen, in einem Büro beim Siemens in Berlin. Sie waren Kollegen, wie alle anderen auch. Vielleicht waren sie sich ihrer Liebe, ihrer ganz besonderen Verbundenheit zu einander, einfach nicht bewusst.
Sie hatten jeweils ihre eigene Familie, Kinder, Schwiegereltern und Verwandtschaft. Außerhalb der Arbeit sahen sie sich gar nicht. Sie kamen nicht zusammen, zu keiner Zeit saßen sie alle beisammen. Keine gemeinsamen Geburtstagsfeiern, keine Geschenke, keine Ausflüge, nichts dergleichen. Die beiden Familien kannten sich gegenseitig nur vom Hörensagen. Es wurde auch nicht miteinander telefoniert, nicht gesprochen, sie hatten keine Zeit für einander, wenn sie nicht zusammen am Arbeitsplatz waren. Niemand hat sich darüber Gedanken gemacht. Und in der Firma reichte es den beiden „Siemensianern“ ganz offensichtlich und dass seit Jahrzehnten, tagtäglich, beisammen sein zu können.
„Was gibt es denn heute zum Mittagessen, Karin?“.
„Ich habe uns einen Pott Durcheinander mitgebracht, aufgewärmt schmeckt er sogar noch besser als am ersten Tag. Würstchen sind drin, den Rest vom Schwarzwälder Schinken und die letzte Bulette von gestern Abend habe ich auch noch hineingeschnitten!“.
„Recht haste, Karinchen. Ick‘ freu mir“; eigentlich sprach Cornelius gar kein Dialekt, nur manchmal, aus unerklärlichen Gründen, verfiel er in seine alte Sprachverfärbung aus Berlin-Dahlem. Jeden Tag wechselten sie sich mit dem Mittagessen mitbringen ab. Sie liebten beide das Ritual, auch das Abholen vom Karinchen aus Berlin-Schmargendorf, war für den Cornelius stets mehr Vergnügen als Pflichtprogramm.
Der Kofferraum wurde aufgemacht, der Topf mit dem guten Essen für beide, gut verpackt, hineingestellt, man winkte dem Ehemann, der Ehefrau des jeweils anderen Ehepartners vor der Haustür noch einmal zu und verbrachten dann die nächsten acht, neun Stunden täglich miteinander, ohne das den beiden etwas fehlen würde, wie auch, so waren sie das ganze Jahr zusammen, außer in den Betriebs-Ferien.
„Na, dann wollen wir mal deinen juten Eintopf verschnabulieren, wa!“.
„Dir auch einen guten!“.
„Bin ich heute mit Spülen dran oder du, Karinchen?“.
„Lieber Freund, seit 30 Jahren fragst du nun jeden Tag das gleiche!“ und lachte, fast zärtlich, dabei.
So verging, Jahr für Jahr, Dekade für Dekade bis auf einmal die Rente vom Cornelius vor der Tür stand. Alle freuten sich für ihn, nur zwei Personen nicht, Cornelius und Karin. Gab es am Anfang in seinem jungem Rentnerleben noch einiges an Haus und Garten zu erledigen, spürte er mehr und mehr, die fehlende Nähe zur Karin aufkommen. Seiner eigenen Frau erzählte er davon lieber nichts. Fuhr die Karin dagegen nun alleine auf das Werksgelände zu, wurde auch ihr das Herz schwer. Ihr fehlte etwas sehr Gravierendes.
Sie traute es sich nicht, sich es selber einzugestehen; ihrem Mann wollte sie nichts davon erzählen, Cornelius gegenüber wollte sie sich nicht offenbaren. So vergingen die ersten drei Monate der Trennung des Paares, das offiziell keines war. Dann hielt es plötzlich Cornelius nicht mehr aus. Er erschien an seinem ehemaligen Arbeitsplatz mit einem Pott Wirsing-Durcheinander unter seinem Arm. Alle grüßten freundlich, viele umarmten ihn, andere wollten ihm unbedingt die Hand schütteln. Der Karin dagegen, fiel vor lauter Schreck der Bleistift aus der Hand.
„Cornelius, was machst du denn hier?“.
„Karinchen, ich wollte mir dir gemeinsam Mittagessen. Ich habe uns Wirsing-Eintopf mitgebracht!“.
So verschwanden die beiden, wie lange 30 Jahre bereits vorher, wie früher in trauter Zweisamkeit, in die Aktenkammer dieses riesigen Bürokomplexes, um auf dem kleinen, mobilen Zweiplatten-Herd, so wie in alten Zeiten, ihr Süppchen aufwärmen zu können.
„Lass es dir gut schmecken, Karinchen!“.
„Du dir aber auch Conny!“ und sie sagte es so glückselig, wie man es nur sagen kann, wenn man überglücklich ist.
Da war sie wieder, diese Anrede, diese Vertrautheit, dieses unausgesprochene Ich liebe dich doch auch. Die beiden, er nun Anfang 60 und sie bald Ende 50, der eine die Rosenhochzeit bereits hinter sich, die andere die silberne Hochzeit bald vor der Tür stehen, konnten, wollten sich ihrer Gefühle nun nicht mehr schämen, nicht mehr bei Seite schieben, sie mussten und wollten sie sich jetzt eingestehen.
„Karin-Klara“ (wenn es ernst wurde, sprach er sie mit ihrem vollständigen Vornamen an), „ich lasse mich scheiden, wenn du es willst!“.
„Conny, und ich lasse mich scheiden und wenn du willst, lasse uns zukünftig den Eintopf in unserem eigenen, gemeinsamen Zuhause essen!“.
Zum aller ersten Mal in ihrem gemeinsamen Leben nahmen sie sich gegenseitig in die Arme. Sie fühlten Vertrautheit, Sicherheit, Wärme und Geborgenheit, im besten Sinne des Lebens, Liebe.
Kurz darauf wurden beide Ehen, leise und ohne viel Aufhebens, geschieden. Es gab keine Szenen, kein Aufbegehren, kein beschimpfen, keine Ehekräche, keine seelischen Verletzungen, keine psychischen und physischen Zusammenbrüche oder finanzielle Grausamkeiten der jeweiligen Ehepartner. Es sah fast so aus, als ob es alle vier schon lange vorher gewusst, es jeder für sich alleine gespürt hätte ...
Der Wintergarten
Wenn man bei Wikipedia den Begriff der Brieffreundschaft nachlesen möchte, kommt folgendes dabei heraus: Eine Brieffreundschaft bezeichnet die persönliche und regelmäßige Korrespondenz von mindestens zwei Personen über eine größere Entfernung durch den Austausch von Briefen – mit dem Aufkommen des Internets – auch von E-Mails.