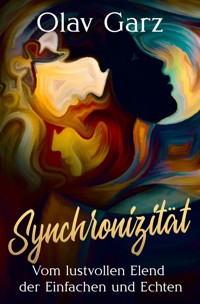Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem der Autor sein Barett an den berühmten Nagel gehängt und sein soldatisches Leben bei der Bundeswehr geendet hatte, machte er sich auf den Weg durch die bunte Welt des Verkaufens. Neben erheiternden Storys, ergreifenden Geschichten sowie aufregenden Wendungen, begleiteten ihn während seines zivilen Berufslebens Schicksale, misslungene Motivationen und kuriose Situationen, die anfänglich alle das gleich Ziel hatten: Die Jagd nach dem Geld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Auftrag ist kein Befehl
Eine dienstliche Kaffeefahrt
Olav Garz
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse
http://dnb.de abrufbar.
© 2025 -Verlag, Altheim
Buchcover: Germencreative
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Belin.
In Erinnerung an
Herrn Oberstudiendirektor a.D.
Otto Michael Buss
1939 - 2007
OMB war ein deutscher Politiker,
ehemaliger CDU-Abgeordneter des
Hessischen Landtags und zuletzt
Leiter der Wilhelm-Merton-Schule
für Erwachsenenbildung mit dem
Schwerpunkt zweiter Bildungsweg.
Darüber hinaus war er ein sehr guter
Zuhörer und mein „Ersatzkommandeur“
für die Zeit meiner Freistellung vom
aktiven Dienst bei der Bundeswehr.
Buss hatte meine Sorgen verstanden.
Frankfurt am Main, 1992-1994
„Wie andere in den Park
oder in den Wald,
lief ich immer ins Kaffeehaus,
um mich abzulenken und zu beruhigen,
mein ganzes Leben“
Thomas Bernhard,
österreichischer Schriftsteller,
1931-1989
Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser, vor Ihnen steht eine komplett ausgebildete Fachkraft, die mit allen Wassern gewaschen ist und nach der sich heutzutage angeblich alle Arbeitgeber die Finger lecken. Ich bin sozusagen ein klassisches Abziehbild dessen, was man landläufig den braven, folgsamen und fleißigen Prototypen nennt, wenn es darum geht, dem qualifizierten Fachkräftemangel etwas Positives entgegensetzen zu können. Ein Mensch, der es von Anfang an gewohnt war, sich nach seinem neunjährigen sowie regulären Schulabschluss, sämtlichen Prüfungen seitens von nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammer Düsseldorf und der kaufmännischen Berufsakademie in Hilden mündlich sowie schriftlich zu unterwerfen. Und on Top, als erwachsener Mensch, den zweiten Bildungsweg in Hessen erfolgreich abschließen zu können. Alles bestanden, alles erledigt, alles abgearbeitet. Zertifikate empfangen, Sekt ausgetrunken, Urkunden aufgehängt und es hätte mit mir und irgendeiner Firma in Deutschland, dazu noch umzugswillig und Standortunabhängig (von der Waterkant bis zum Alpenrand), so richtig losgehen können. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre ... Wie schwierig es für mich persönlich noch werden sollte, als ehemaliger, länger dienender Soldat eine zivile Arbeitsstelle „draußen“, besser gesagt, „vor dem Kasernentor,“ finden zu können, lag außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Das Problem ist nur, heute ist das alles bereits 31 Jahre her. Nun bin ich bereits Ü60, seit zwei Jahren in Rente, viel zu müde und abgekämpft, als das ich für den allgemeinen Arbeitsmarkt noch zu gebrauchen wäre. Aber damals, nach Beendigung meines Dienstes bei der Bundeswehr, nach zwölf Jahren Befehl und Gehorsam, nach meiner ordentlichen Entlassung mit verdienten Übergangsgebührnissen, einer angemessenen Abfindung und vielen Abschiedsurkunden, da sah die Welt noch ganz anders aus. Genau von diesem Übergang möchte ich gerne in Ruhe und der Reihe nach, nicht streng und unsoldatisch erzählen. Ich will kein Detail dabei vergessen, nichts verschlucken, keine wahre Begebenheit weglassen, erst recht nichts beschönigen, Klartext reden und keine Verklärung von irgendwas anstellen – vor allem nichts heroisieren. So will ich ernsthaft darüber Zeugnis ablegen, was es bedeuten konnte (heute noch kann?), wenn ein gelehriger, fertig ausgebildeter und geschulter Soldat mit guten Manieren und ordentlichen Beurteilungen sowie mit reichlich Erfahrung und hoher Verantwortung für Mensch und Material ausgestattet, freiwillig auf die raue Wirklichkeit der freien Wirtschaft stoßen sollte.
Mein persönliches Malheur fing 1994 an und hörte viele lange Jahre nicht auf zu existieren. Ich kämpfte gegen dieses Phänomen eisern an, hielt tapfer dagegen, wurde es nicht leid, davon zu berichten, wie wichtig die Bundeswehr bei der Verteidigung des Deutschen Vaterlandes sei (ohne das Wort Wehrertüchtigung gekannt zu haben), und es sicherlich keine Schande wäre, einmal in seinem Leben Soldat gewesen zu sein. Alles dort Gelernte, wie zum Beispiel, unfallfrei über den Bordstein gehen zu können, bei Eis alle Autoscheiben vom Dienst-Kraftfahrzeug rundherum frei zu kratzen, in geschlossenen Räumen selbständig die Kopfbedeckung abzunehmen, den Vorgesetzten als erstes zu grüßen, nicht zu duzen, nicht ungefragt zu reden, lernen zu warten, bis man aufgefordert wurde, konzentriert, kurz und knapp, auf den Punkt etwas sagen zu können, sich nur krank zu melden, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, sich nicht auf seine Lorbeeren ausruhen, jeden Morgen mit sauberen Schuhwerk zu erscheinen, vor jedem Wasserballtraining zu Duschen, die gesellschaftlichen Gepflogenheiten nicht nur zu kennen, sondern auch zu leben, dass zu tun, was einem befohlen wurde, nichts zu hinterfragen und sich quasi selbst verbieten, selbständig denken zu wollen.
Sich nicht bei ver.di engagieren, erst recht unwissend zurückbleiben, was eine IG-Metall so macht und später nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst höchstens das Magazin des Deutschen Bundeswehr-Verbandes weiterhin zu abonnieren, aber nur, um die Todesanzeigen von verstorbenen, ehemaligen Kameraden nachlesen zu können. Auf einen respektvollen und achtsamen Umgang mit seinen Alliierten Acht geben, den Vorschriften alles nach und nach abzuarbeiten, was es abzuarbeiten gab, nicht vom Weg abweichen, niemanden in die Pfanne zu hauen und auf die Gesundheit jedes einzelnen Stubenkameraden zu achten. Aufzupassen, dass der Kaugummi vor dem Betreten eines Hauses herauszunehmen und gemäß den Vorschriften richtig zu entsorgen ist, zu wissen, dass keiner gleicher als der andere ist und nicht über das Essen im gemeinschaftlichen Verpflegungsraum (umgangssprachlich: Kantine) zu schimpfen. Sein Barett (Verzeihung, den Hut), niemals auf einem fremden Schreibtisch abzulegen und die Oberflächen der Hände, Unterarme sowie den Halsbereich selbständig vor Tattoos zu schützen. Niemanden die Beförderung neiden, die man selbst gerne empfangen hätte, sich nicht am Tisch vom Vorgesetzten anzulehnen, im Hinterstübchen die wichtige Notiz zu hinterlegen, dass das private Telefon vor einer Zusammenkunft mit anderen Gesprächspartnern auszuschalten ist und zu allem Ja und Amen zu sagen und so weiter und so fort. Im Grunde bestens dafür prädestiniert, einen verdienten, der militärischen Ausbildungshöhe und Qualifizierungsstufe entsprechend ähnelnden sowie zivilen Angestelltenvertrag in seinen Händen halten zu dürfen – selbstverständlich mit Probezeit. Aber die muss ein einstiger Armeeangehöriger nicht fürchten, dafür hängt er sich viel zu sehr herein und das über allen Maßen. Mein Veteranen-Ehrenwort darauf.
Bis zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch hatte ich es fast immer geschafft. Die Zeugnismappe (selbstverständlich nicht in Camouflage-Farben gehalten), allesamt teure Farbkopien, stets ohne Eselsohren, kein Klecks darauf und alles schön foliert, strahlte um die Wette mit anderen zivilen Bewerberunterlagen, als sie auf den Schreibtischen der Personalentscheider lagen. Womit aber nicht bewiesen war, dass sie im Vorfeld gelesen oder wenigstens einmal hineingeschaut wurde – trotzdem, dieses Manöver hatte ich somit überlebt. Als dann jeweils der bundesweite „Ernstfall“, der persönliche Vorstellungs-Termin, mit allen seinen Himmelsrichtungen eintrat und ich mich gleich zu Beginn eines Gespräches rechtfertigen musste, wie ich es mir denn überhaupt erlauben wollte, mich ausgerechnet bei ihnen zu bewerben, sie, die großen Firmen von Rang und Namen, sie, die mit Krieg nichts am Hut hätten, sie, die sich als pazifistische Einheit präsentieren möchten, obwohl deren enttarnten Firmenhistorien inklusive der hauseigenen Verstrickungen mit den Nationalsozialisten von berühmten Geschichtsforschern nachgewiesen und längst auf den Bestseller-Sachbüchermärkten nachzulesen waren, kurz, darauf war ich einfach nicht vorbereitet.
Die wichtige Diskussion, mit guten Argumenten im Marschgepäck, Verzeihung Aktentasche, meinerseits, die ich gerne geführt hätte aber nicht für angebracht sah, enthielten wichtige Eigenschaften wie zum Beispiel, Disziplin üben oder Tugenden leben, die bei der Armee, bis zum heutigen Tag gehegt, gepflegt und eingefordert werden. Andere sagen traditionelles Denken dazu. Soll heißen, man bleibt anständig, nimmt sich nichts heraus, ohne etwas sorgfältig im Vorfeld geprüft zu haben, spielt sich nicht in den Vordergrund, beschwert sich erst nach Ablauf einer Nacht beim direkten Vorgesetzten, falls dann noch überhaupt etwas vom Zorn des Vortages übriggeblieben wäre und der Rauch nicht schon vorher verzogen sein sollte. Sozusagen fast den urbritischen, königlichen Ausspruch, „never complain, never explain“ (weder klagen, noch sich rechtfertigen), verinnerlicht zu haben. Ferner immer schön bei der Wahrheit bleiben, die strikte Termineinhaltung bleibt zu jeder Zeit, auch unter anderen Umständen eine Selbstverständlichkeit, gesetzte Fristen werden wahrgenommen und umgesetzt.
Bei einer militärischen Fahrschule für das gesamte Autofahrer-Leben gelernt, nicht bei Rot über die Ampel zu fahren, am Mittagstisch die Krawatte auf der rechten Schulter abzulegen, sauber mit Gabel und Messer zu arbeiten oder stets nur das von seinen eigenen Untergebenen einklagen, wozu man selbst in der Lage wäre. Auf den Punkt: Nur, was man selbst beherrscht, kann auch von anderen verlangt werden – von der in Breite und Tiefe angeeigneten Fachkunde einmal ganz abgesehen. Nein, die Tatsache, dass bei der Bundeswehr wirklich alle Soldaten, vom Kanonier bis zum Regimentskommandeur, das gleiche Mittagessen, wie zum Beispiel die berühmte heiße Erbsensuppe mit Speckwürfeln aus der Gulaschkanone mit einem trockenen Weißmehl-Brötchen zu essen bekommen, um die Moral zu heben, um den Gemeinschaftssinn zu fördern, schien mir dann doch als Argument zu simpel, obwohl es mir auf der Zunge gelegen hätte – und nein, andere kluge Fragen wurden mir diesbezüglich und größtenteils nicht gestellt.
Wollte ich mich aber, präzise auf diese eine unmilitärische Stelle gut vorbereitet, für eine passgenaue, ausgeschriebene Aufgabe in deren Unternehmen (branchenübergreifend) präsentieren, fragten sie mich lieber, „ob ich früher scharf schießen musste?“. Eine andere Dame, sie war dort die Personalchefin eines großen Kosmetik-Unternehmens in Süddeutschland, fragte mich weltfremd, „Was ich denn so als Söldner in Afrika verdient hätte?“. Wo anders hörte ich einmal die Frage: „Gibt es in den Kasernen auch Gefängnisse?“. Allmählich wurde ich allem überdrüssig, diesem Unsinn etwas entgegenhalten zu wollen und überhaupt, warum und wofür ständig „Rede und Antwort“ stehen zu müssen? – war ich doch gar kein Jugend- oder Presseunteroffizier in meiner Dienstzeit gewesen. Nein, ich musste nicht scharf schießen. Nein, es gibt kein Gefängnis bei der Bundeswehr. Das einzige Militärgefängnis, mit Standort in Schwedt an der Oder (Brandenburg) und dass es nur bei der NVA in der DDR gab, wurde noch vor der Wiedervereinigung aufgelöst. Und nochmals nein, ich war kein Söldner, der gegen Bezahlung für einen fremden Staat freiwillig in einem bewaffneten Konflikt stand. Und als ich dann einmal ernsthaft gefragt wurde, warum ich kein Rittergut in Ostpreußen mein Eigen nennen dürfte, da ich doch schließlich Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in Bronze sei, schmeckte mir der angebotene, frisch aufgebrühte Filterkaffee mit Kaffeesahne längst nicht mehr. Sollte ich mich wirklich darauf einlassen, eine Antwort zu geben? Geben zu wollen? Ich trug es dennoch mit Humor und stellte leise das damalige, aktuelle Datum (Tag, Monat, Jahr) vor und schob lässig hinterher, dass das Dritte Reich bereits vor 49 Jahren untergegangen war. Nein, Träger des nationalsozialistischen Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes wollte ich nicht gewesen sein, ganz bestimmt nicht. Danach war es zwar etwas stiller im Raum, aber mir tat diese drohende Ruhe vor dem Sturm nicht gut. Diese Einstellung entfiel ebenfalls.
Etwas später war ich plötzlich einmal der beste Bewerber, auf den sie solange gewartet hätten. „Das es so jemanden wie Sie noch gibt“. Als dann die exklusive Werksführung, „nur für Sie persönlich, sonst nie“, zu Ende war, knapp vor der Einstellung und bevor mein mitgebrachter und zugleich komplett aufgetankter Pelikan-Füllfederhalter dieses wichtige Anstellungs-Papier überhaupt hätte erreichen können, kam auch dort die Frage aller Fragen auf mich zu: „Nur noch eine Frage bitte, was haben Sie eigentlich von 1982 bis 1992 so getrieben?“. So erzählte ich dann stolz und dabei die Katze aus dem Sack lassend (der Job war mir schließlich sicher), dass ich nun ein ehemaliger Oberfeldwebel und Personalfeldwebel der Reserve sei. Danach war es sofort mit der gerade erst geschlossenen Firmen-Freundschaft wieder aus.
„Nein, ich müsse das begreifen, nein, das geht natürlich nicht, nein, so etwas können wir unserer Belegschaft und der Führung dieses Hauses nicht zumuten, nein, ein Befehl würde bei mir sicherlich ein Befehl bleiben und zukünftig gesprochen, keine herkömmliche, friedliche Aufgabe sein. Ein Auftrag wäre doch kein Befehl! Das alles gäbe in Summe garantiert Reibungsverluste und brächte nur Unfrieden für alle Beteiligten und dem Betriebsrat mit sich. Nein, dass alles wollten sie sich dann lieber doch ersparen. Sie müssen verstehen“.
Welche skurrilen Fragen wohl Polizisten, Feuerwehrleuten oder Notärzten oder anderen wichtigen Berufsgruppen heutzutage gestellt werden, wenn sie die Branche wechseln möchten?
So stand ich nun, im wahrsten Sinne des Wortes, fast auf der Straße. Meine Restdienstzeit betrug nur noch 30 Tage und ich hatte keinen Job, keine Aufgabe in Aussicht und dass bei vier abgeschlossenen Berufen: Verkäufer, Einzelhandelskaufmann, geprüfter Personalfachkaufmann und den staatlich geprüften Betriebswirt inklusive der dazugehörigen Fachschulreife in der Tasche. Das alles ließ mich ratlos zurück. Eine Verpflichtung für weitere drei Jahre, somit dann insgesamt fünfzehn Jahre, war keine wirkliche Option für mich – ganz ehrlich, sie wäre mir wie eine Flucht vor dem Gegner vorgekommen, hätte nichts dabei gewonnen und wäre nur drei Jahre älter geworden. Ich war und bin nun mal kein Feigling. Auch schiebt ein Soldat keine Probleme nach hinten, er bekämpft sie, direkt, jetzt, heute. Ich konnte, ich durfte diese offene Flanke nicht zulassen – der zwingende Blick am Morgen, in den eigenen Spiegel, musste zufriedener ausfallen. Als ehemaliger Soldat war ich es zwar gewohnt, in Lagen zu denken, Freund-Feind-Erkennung im Hinterkopf zu behalten, Hilfsversuche zu aktivieren und dafür ausgebildet, mich so lange nicht zu ergeben, bevor nicht der aller letzte Ausbruchsversuch gescheitert gewesen wäre. Aber das unmilitärische Melden auf dem heimischen Arbeitsamt rückte, trotz allem positiven Denken, immer näher und näher, Tag für Tag. Dem wollte ich unbedingt etwas entgegensetzen – Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Und so zog ich zum Start in mein ziviles Berufsleben, nun „als Einzelkämpfer“ auf mich allein gestellt, den aller letzten Joker aus der Tasche und ließ mich, wohl oder übel, auf das Abenteuer Zeitarbeit ein. Was sich im Nachhinein als leichte Arbeit anhört, stellte sich für mich als eine furchtbare und menschliche Katastrophe größten Ausmaßes dar, die ich zum damaligen Zeitpunkt und vor Vertragsabschluss nicht so richtig abschätzen konnte. Dafür war ich zu dieser Zeit einfach zu naiv gewesen. Auf einmal sollte ausgerechnet ich der berühmte Deckel auf dem bekannten Topf auf Zeit gewesen sein. Gerade in Anlehnung an der bisherigen, gesamten Bandbreite meiner Ausbildung und nun als frischgebackener Niederlassungsleiter und Vorgesetzter mit Weisungsbefugnis, war man sich in der Geschäftsleitung, unten an der baden-württembergischen Grenze zur Schweiz gelegen und zu einhundert Prozent sicher, dass ich ein guter Truppführer für meine vier neuen Truppenteile „Sanitär, Heizung, Lüftung und Elektrik“ sein würde und nebenbei die Fürsorge für die mir anvertrauten Arbeiter im Blick behalten könnte – Handwerkerinnen selbst habe ich damals nicht entdecken können. Dass ich mich aber im Herzen so schwer damit tun würde, damit konnte ich zu Beginn meiner Arbeitsaufnahme in diesem außergewöhnlichen Geschäftszweig, mit seinen vielen schattigen und einigen sonnigen Seiten, nicht rechnen. Gut, Frankfurt am Main war in den 1990er Jahren eine Boomtown. Überall nur Peiner Bau Kräne, sie waren quasi in der gesamten Stadt verteilt und von jeder Straßenecke aus zu sehen. Gut, Handwerker-Aufträge winkten hier somit ohne Ende; daran hatte es nicht gemangelt. Das Akquirieren von Aufträgen lief trotzdem nicht von alleine.
Fortan jonglierte ich, wie ein Sandwich agierend (man kann nicht allem gerecht werden), ständig zwischen monatlichen Umsatzvorgaben und meinem eigenen hohen Anspruch, den Menschen an sich dabei nicht vergessen zu wollen, hin und her. Schließlich gehörte jeder einzelne Arbeiter, viele Alt-Gesellen, einige Meister darunter, in dieser Frankfurter Niederlassung, zu meinem zivilen Blaumann-Regiment. Der Geschäftsführung gegenüber musste ich beweisen, dass der Handwerker, der ausgebildete Fachmann, die gelernte Fachkraft, nur ab einer gewissen Stundenlohnhöhe für meine Kunden, auf dem Leasingmarkt für Personal auf Zeit, zu bekommen war. In der Spitze 45 D-Mark pro Arbeitsstunde vom Kunden zu bekommen, war das Ziel – daran verdienten alle gut mit (ich auch). Es war die Kunst des Verkaufens gefragt. Die lernte ich, eigenartigerweise und das als Veteran, recht schnell. Das fiel mir nicht schwer. Sorgen machten mir die Schicksale dieser Menschen, die es gewiss nicht immer leicht in ihren Leben gehabt hatten – wären sie sonst, teilweise weit über ihr 40. Lebensjahr hinaus, bei einer „Leihfirma“ gelandet? Ich hielt ihren gerechten Anteil am Erfolg dieses Standortes so hoch wie möglich, wie ich es nur irgendwie vor meinem Chef vertreten konnte. Mein Gewissen war rein, aber dafür war ich nicht eingestellt worden. Schön war es dagegen, wenn ich unerwartet, bei einem laufenden sowie entfristeten Arbeitsvertrag, um ein Vorläufiges Arbeitszeugnis gebeten wurde. Da wusste ich schon Bescheid. Einen Mann weniger an der Magnettafel. Für meinen Umsatz nicht gut, für den neuen Arbeitnehmer toll, für das Renommee meiner Niederlassung sehr gut. Das ist eine Auszeichnung in dieser Branche. Darüber hinaus lernte ich mit der Zeit, dass die Arbeitgeber, die meine ehemaligen Arbeitnehmer lieber bei sich direkt in Lohn und Brot stehen haben wollten, mir stets treu blieben, wenn es darum ging, erneut Spitzenzeiten in deren Unternehmen abdecken zu müssen. Es waren gute Geschäfte.
Zum Schluss trug ich, nach harter und entbehrungsreicher Arbeit, die mich bei einer regelmäßigen „Kern-Arbeitszeit“ vom jeweiligen frühen Montagmorgen bis zum späten Sonntagabend bis an meine physischen und psychischen Grenzen führte, Verantwortung für insgesamt 78 Menschen. 78 Lohntüten, die wollten erst einmal verdient sein und 30 Tage im Monat können schnell umgehen, sehr schnell sogar. Wenn ich etwas aus dieser entbehrungsstarken, arbeitsreichen, aber finanziell betrachtet für mich sehr lohnenden Zeit etwas gelernt hatte, dann das, was es bei der Bundeswehr nicht gibt, nicht geben darf. Nämlich: Ellenbogen ausfahren müssen. Kameradschaft ade.
Der erste zivile Gehaltsstreifen nach zwölf Jahren Sold Empfang, nach dem Ausscheiden aus dem Soldatenleben, wies 7.000 D-Mark netto aus. Das war das Brutto von einem Oberstleutnant (silberfarbenes Eichenlaub mit zwei silberfarbenen Sternen). Kurz, von A7 hoch auf A15. – quasi in einem Monat acht Beförderungen übersprungen –, wofür ein sehr guter Berufssoldat normalerweise ein lebenslanges Dienstverhältnis bräuchte und das auch nur bei ausgezeichneter Führung. Trotzdem, es konnte mir nur ein schwacher Trost sein. Ich litt ganz einfach unter dieser menschlichen Kälte und diesem erbarmungslosen Miteinander. Andersherum: Keine Waffe mehr in der Pistolentasche am Gürtel liegend, mit mir herum tragen zu müssen, war das eine und gefiel mir recht gut. Sie nun gegen einen hochwertigen Marken-Kugelschreiber, im Jackett steckend, eintauschen zu können noch besser. Aber das reichte nicht, um für eine eigene und auf eine gesunde Dauer ausgerichtet, gut gefüllte Lohntüte sorgen zu können. Und so startete ich anschließend, nach zwei Jahren in diesem besonderen Bereich, mit großer Vorfreude, in ein handfesteres Arbeitsleben. Auf das, was vor mir lag, in eine neue, berufliche Zukunft. Dass ich dabei so viel erleben würde, dass mich meine Wege quer durch Deutschland und ins europäische Ausland führen sollten, unzählige, erfreuliche Überraschungen, aber auch schicksalhafte Begegnungen mit sich bringen würden, war nicht absehbar.
Alle meine Arbeitsjahre, als Vorgesetzter, als Mitarbeiter, als Chef und als Angestellter, waren insgesamt betrachtet, von großen beruflichen Sorgen begleitet, von schönen Erlebnissen eingerahmt und von schlimmen Nöten umringt. Parallel dazu hatte ich unglaubliche, glückliche Momente erleben dürfen, die mich bis heute prägen. Tränen vor lauter Freude auf den Wangen gespürt oder aus Trauer fließen lassen, interessante Menschen kennengelernt und oft genug an einem bekannten Grab stehen müssen. Leuten, die wirklich etwas zu sagen hatten, aufmerksam zugehört. Kurz, die Dramaturgie hätte dabei nicht höher hängen können.
Sicherlich, von 31 überlebten Arbeitsjahren in Schicht- und Vollzeit, kann nicht jede einzelne Seite vom Tagebuch Rücksicht finden. Trotzdem, die Auswahl an Tragödien, die man sonst nur auf einer Theaterbühne erwarten wollte, Bestimmungen, die nicht abgewendet werden konnten, Probleme, die ich auf mich zukommen sah, mich ihrer aber nicht erwehren konnte, sind alle Male eine Zeile wert. Ferner habe ich menschliches Versagen aller Orten erlebt, eine Menge an Menschen kommen, noch mehr gehen sehen und Slapsticks erfahren, weil der eigene Anspruch der erträumten, subjektiven Arbeitsqualität, sprich der eigenen Wahrheit, stets hinterhergelaufen werden musste. Sie alle möchte ich hier gerne, in einer kleinen Auswahl und in Ausschnitten, mit aufgeschrieben wissen. Dass ich viele Jahre später meinen Lebensunterhalt mit dem schönen und zugleich angenehmen Lifestyle Thema, „Kaffeegenuss“, sowie monetär betrachtet, sehr komfortabel bestreiten sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen und das alles als ehemaliger leidenschaftlicher Teebeuteltrinker.
Der Beruf des Verkäufers ist ein schöner Beruf und ich selbst habe leider viel zu spät für mich persönlich erkannt, dass es bei nationalen und internationalen Dienstfahrten, die mich in alle Windrichtungen geführt hatten, nicht richtig war, an wichtigen Orten der Erinnerung, die an die dunklen Jahre in diesem Land verweisen, vorbeizufahren – obwohl mir viele braune Unterrichtungstafeln das stumme, aber auffordernde Signal dafür gaben, jetzt herauszufahren, um den vielen unzähligen, unschuldigen Menschen, den Opfern, gedenken zu können – wie zum Beispiel die Hinweistafel für die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Fahrtrichtung Hamburg. Wenigstens einmal eine Stunde in der Woche die schmerzliche Erinnerung an diese grausame Zeit wachhalten – es wäre der Umsatzverlust wert gewesen, wenn überhaupt, denn Unpünktlichkeit kennt der Außendienst-Verkäufer einfach nicht und als ehemaliger Soldat dazu erst recht nicht. Erst viel später, zum Ende meiner nationalen Reisetätigkeit, fand ich den Mut dazu, das Navigationsgerät mit diesen besonderen, außergewöhnlichen Adressen zu füttern. Mahnstellen zu besuchen, wenigstens einmal zehn Minuten innezuhalten oder Erinnerungstafeln bis zum Ende durchzulesen, um mich damit den wahren, wichtigen und ernsthaften Lebensthemen widmen zu können.
Liebes Publikum, lassen Sie sich überraschen, begleiten Sie mich ein Stück des Weges dabei, was mir alles so passiert ist, welche Persönlichkeitstypen ich kennenlernen konnte, welch verrückte Charaktere mir über den Weg gelaufen sind und wie viele überraschende Wendungen auf mich zu kamen. Und nun, trotz aller Umstände, viel Freude beim Lesen der Lustigen, heiteren, aber auch nachdenklichen Kurzgeschichten und Erzählungen aus meinem bunten Verkaufsleben, bei dem ich viele Cafés besucht und noch mehr in Staus gestanden habe und bei dem wirklich nur das wahre Leben Regie führen konnte.
Du hast Sorgen, sei es diese oder jene …
ins Kaffeehaus
Man kreditiert dir momentan
nichts mehr …
ins Kaffeehaus
du hasst und verachtest die Menschen
und kannst sie trotzdem nicht missen …
ins Kaffeehaus
Peter Altenberg,
österreichischer Schriftsteller
und Wiener Kaffeehausliterat
1859-1919
Der Napoleon von Wiesbaden
Vor meinen Augen läuft ein Film ab.
Ich sehe gerade das Bild eines wahrhaftigen Napoleon. Es ist jetzt nicht die Kriegsführung oder die Strategien, die ihn mit seinem vermeintlichen Vorbild vergleichen sollen, nein, sondern eher die Körpergröße. Napoleon Bonaparte war nicht der aller längste, wie wir alle gelernt haben. Nun gut, mein Napoleon, Pardon, mein Kunde, mit eigenem Geschäft für Fliesen, Kacheln und Bädern und in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ansässig, auch nicht und hatte sich selbst geholfen. Und es blieb nicht nur dabei, was seine Maßschuhe für kleinere Füße mit den überhöhten Schuhabsätzen betraf.
Sein Schreibtisch stand tatsächlich auf einer kleinen Tribüne. Unter seinem Schreibtischstuhl stand eine zweite Platte. Alles maßgerecht von einem Schreiner angefertigt und mit einem feinen Stoff verkleidet worden. So thronte nun der Herr Geschäftsführer über alle seine Untertanen, die vor ihm sitzen mussten. Seine Angestellten, wenn sie zum Rapport antraten, seine Kunden, denen er etwas verkaufen mochte und die angereisten Verkäufer aus der Industrie, die wiederum ihm etwas verkaufen wollten. Es war immer ein sehr originelles Bild in zwei Kapiteln.
Die erste Szene war stets die gleiche Begrüßungszeremonie. Sie war von großer Höflichkeit geprägt. Ich, der kleine Verkäufer, der Bittsteller, „der Papierdrucker“ hatte zu warten. Dann kam seine persönliche Empfangszeremonie an der Tür zu seinem Büro.
Die zweite Szene, wenn man in sein Arbeitszimmer hineinkam, glich schon einer anderen Atmosphäre. Das Büro selbst war recht kahl bestückt und der Raum von einem kühlen Charakter erfüllt, woran die hochwertige Möblierung und teure Ausstattung keine Schuld trug. In Entfernung stand drohend sein Thron, das Alleinstellungsmerkmal schlechthin. Das war, Verzeihung, mitunter sehr lustig anzusehen. Beim Guten Tag sagen an der Bürotür schaute ich noch auf ihn herunter. Dann aber war ich dran. Vor allem das immer zu ihm hochschauen müssen, stand doch der Stuhl des Außendienstes auf dem Boden der Tatsachen, bereitete mir körperliche Sorgen. Er wiederum mochte es wohl so haben. Jedenfalls waren Nackenschmerzen bei einer längeren Verkaufsrunde nicht mehr auszuschließen.
Ich persönlich kam mit ihm sehr gut aus, er hörte mir zu, folgte meinen Ratschlägen (es ging dabei um einen möglichen, neuen Image-Auftritt seines Unternehmens mit positiven Wirkungsmöglichkeiten nach außen), war zu mir aufrichtig und fair und ich bekam seine Unterschrift für diesen oder jenen Auftrag. Ach ja, Getränke nach Wahl. „Alles fein“, sagen die Hamburger dazu. Danke, lieber Kunde. Gerne bis zum nächsten Mal, aber dann bitte mit einer Halskrause oder einer Nackenrolle meiner Wahl.
Faxe aus Buenos Aires
Erika war hin und weg.
Lebte sie gerade ihren ganz privaten, eigenen Traum oder ging die Phantasie mit ihr durch. Sie lauschte und hörte diese wunderbaren, lateinamerikanischen Melodien, sah die Tango Schritte dieses entzückenden und zugleich schönen Paares, direkt vor ihnen auf der Plaza de Mayo. Jürgen und sie saßen nun, fast täglich, an diesen herrlichen Platz, in einem kleinen Café mit Außenterrasse, genauer, im Schatten der Kathedrale Metropolitana. Nein, es war kein Traum; sie waren wirklich dort. Für das Ehepaar ging, in Deutschland beide als Vollzeit Angestellte arbeitend, ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Endlich ausruhen, sich erholen, Abstand gewinnen, lautete die Losung vor dem Abflug.
Der unverbaute Blick vom Balkon ihres Hotelzimmers auf den Rio de La Plata kostete sie zwar jeden Tag 73 US-Dollar Aufpreis, aber das war es ihnen wert gewesen. Was Erika noch mehr freute, war die Tatsache, dass es hier, 11.491 Km entfernt von ihrem Zuhause, die Deutsche Presse gab. Wie beglückt kam sie von ihrem ersten Morgenspaziergang zurück ins Hotel, mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern in der Hand.
„Jürgen, die Zeitung ist da!“, rief sie ab diesen Zeitpunkt allmorgendlich in das Badezimmer von ihrem Hotelzimmer hinein. Er war und blieb nun einmal ein leidenschaftlicher Zeitungsleser.
Jürgen rief zurück: “Das ist ja klasse; ist sie von gestern?“.
Erika überhörte diese unverschämte Frage, sie ärgerte sich sogar ein wenig darüber, aber weiteren Kummer verbat sie sich von selbst, an diesem schönen Flecken von der großen, weiten Welt. Nach dem Frühstück war es soweit. Ein schöner, ruhiger Spaziergang stand für die beiden an. Auch sollten an diesem Tag Kartengrüße an die Lieben daheim geschrieben und gleich versandt werden.
„Jürgen, was schleppst du denn da alles mit dir herum? Du bist doch nicht im Dienst!“.
Erika konnte einen Schreibblock Din A4, unliniert, nicht kariert und mit einer Trennungsleiste für mögliche, einzelne Blätter versehen, zwei Kugelschreiber, einen Textmarker in Gelb und mehrere Büroklammern erkennen.
„Das ist nur für das Tagebuch, du weißt doch, ich möchte, so genau wie nur irgendwie möglich, unsere Reise dokumentieren“.
„Vergesse darüber aber nicht die Karten zu schreiben, hörst du!“, mit etwas Nachdruck in ihrer Stimme.
Sie wollte sich einfach keine weiteren Gedanken darüber machen und ließ ihn gewähren. Stattdessen wollte sie viel lieber in das südamerikanische Leben eintauchen und den Tag genießen. Der Wetterbericht versprach heute bis zu 25° Grad Wärme. Das alles konnte Jürgen nur recht sein. Und so schrieb der Bezirksleiter einer Drogerie-Kette in sein angebliches Reise-Tagebuch:
Buenos Aires, am 12.November 1999
„Liebe Cornelia, folgende Aufgaben sind mir gerade eingefallen, die nicht aufzuschieben sind: Filiale A16. Habe der Filialleiterin beim letzten Besuch eine mündliche Rüge erteilen müssen. Die Sonnencreme war immer noch nicht weggeräumt und die neue Babykost-Linie war nicht gesondert auf dem Kopfregal aufgebaut gewesen, sondern stand mit allen anderen Gläschen versteckt im Regal. Bitte gleich dort anrufen und nachfragen, ob die beiden Mängel abgestellt wurden. Bitte im Arbeitsbuch der Filiale eintragen lassen“.
„Jürgen, schau` mal, die vielen Tauben. Es werden ja immer mehr. Weißt du noch, damals auf dem Markusplatz? Da war es genauso“.
Er gab keine Antwort, schaute nur einmal kurz hoch, nickte Alibimäßig und schrieb weiter: „Liebe Cornelia, noch ein letzter Punkt: Wie oft habe ich schon darum gebeten, endlich die Verkaufs-Schütten nicht mit Spielzeug zu füllen, wenn sie morgens herausgefahren werden; nur im Sommer! Noch einmal alle Filialen anrufen!“. Jürgen versteckte den Block wieder zwischen dem Reiseblattteil und dem Feuilleton der Frankfurt Allgemeinen Zeitung, Kurzform F.A.Z., wo er ihn gut aufgehoben wusste.
Zum Rezeptionisten vom Hotel ging er immer nur beiläufig vorbei, um die tagsüber fertig geschriebenen Faxe diskret übergeben zu können. Anschließend ließ er sich gleich den Sendebericht dazu aushändigen, um beruhigend den Sendestatus „OK“ ablesen und das Zeugnis des korrekten Versandes gleich daran heften zu können. Klammerer und Heftklammern hatte er extra dafür mit in den Koffer gelegt. Erika wusste er dabei wo anders bei seinen Kurzbesuchen in der Lobby. Sie ahnte nichts von seiner Arbeit in den Ferien.
Am nächsten Tag kam es, wie es kommen musste: Beim Servieren des Kaffees rutschte der Schreibblock aus der Zeitung; Erika direkt vor die Füße. Die nächsten geschriebenen Aufträge an seine Vertreterin, hatte sie nun in ihren Händen. Auszüge, wie: „Liebe Cornelia, wenn ich wieder da bin, muss ich mit Ihnen dringend über die Inventur der Filiale A27 sprechen, sie ist hundsmiserabel ausgefallen, die A31 hat wiederum sehr gute Ergebnisse geliefert. Analyse erforderlich“.
„Sage mal Jürgen, hast du sie noch alle!“, widerfuhr Erika wie ein Schreck. „Was machst du da, ich dachte, du erholst dich, liest Zeitung, studierst die Menschen und das Land, lässt es dir gut ergehen, so wie ich auch. Anstatt Postkarten zu schreiben, schreibst du Aufträge an deine Assistenz von Argentinien nach Hessen. Das ist also deine angebliche Chronik über unsere Reise. Was soll das?“.
Von da ließ Erika ihren Ehemann nicht mehr aus den Augen. Sie unterhielt sich mit ihm öfter, aber auch angestrengter. Jürgen wurde dadurch immer unruhiger, nervöser und fast schon ungenießbar. Er kam kaum noch ungestört zum Schreiben an seine engste Mitarbeiterin, seine Vertretung in der Heimat. „Sie wundert sich bestimmt schon, warum sie keine weiteren Anweisungen mehr von mir bekommt!“, dachte er für sich selbst. Das machte ihn erst so richtig unleidlich. So vergingen die letzten fünf Tage und Jürgen sehnte den Heimflug herbei, während Erika jeden Urlaubstag bis zum Ende auskosten wollte.
„Du musst dringend zum Arzt, Jürgen. Du überziehst dermaßen, das ist alles sehr ungesund. Du kannst doch nicht im Ernst von der anderen Seite der Weltkugel dienstliche Faxe in deine Firma schicken. Und überhaupt, wie sieht das denn alles aus. Du hast Urlaub und somit auch einen Auftrag bekommen: Dich zu erholen!“.
Wieder Zuhause angekommen, den Kopf zwar reichlich von seiner Ehefrau gewaschen bekommen, die Koffer waren noch nicht ausgepackt, der Kühlschrank noch leer, seine Frau war erstmalig die Zimmer am Lüften, griff er gleich zu seinem Dienst-Handy, um in der Firma anzurufen und nachzufragen, ob alles in Ordnung wäre. Die stellvertretende Bezirksleiterin war direkt am Telefon und berichtete ihm, dass wirklich alles prima laufen würde. Sie hatte alles im Griff während seiner Abwesenheit. Hatte sie eigentlich ihren Chef vermisst? Er konnte es nicht heraushören.
Dann die entscheidende Frage: „Haben Sie alle meine Aufgabe erfüllt, ist soweit alles abgearbeitet?“. Cornelia, die Zuverlässigkeit in Person, sagte lässig: „Ach ja, Ihre Faxe sind alle angekommen, sie sind auf Ihrem Schreibtisch liegend, ich hatte gar keine Zeit, sie zu lesen!“.
Jürgen lief rot an, wollte gerade schon loslegen, da kam ihm seine Vertretung zuvor: „Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe mit allen Filialen telefoniert, die Hausaufgaben von den letzten Besuchen vor Ihrem Urlaub haben sie alle brav erledigt; es ist wirklich alles gut“.
Erika, gerade aus dem Schlafzimmer kommend, fragte bloß: „Alles klar bei dir?“. „Ja, mein Schatz, der nächste Urlaub gehört nur noch uns ganz allein!“. Worauf Erika etwas irritiert zurückblieb.
Die Beförderung
Der Vater vom Volkmar platzte fast vor Stolz.
Sein Sohn sollte für die Firma, die ihren Mutter-Sitz in Ludwigshafen am Rhein hatte, in den Bundesstaat New York, in die Stadt New York City, präziser, in den Stadtbezirk Manhattan versetzt werden. Dort war die Position des „Ständigen Vertreters“ in der Außenstelle dieses inzwischen groß gewordenen Unternehmens frei geworden. Ein Traum wurde gerade für ihn wahr. Wobei, Volkmar war nicht fröhlich, nicht überzogen überglücklich, nein, eher überkam ihn das Gefühl der Genugtuung. Daraus zog er die Kraft, die ihn für die nächsten Aufgaben, die nun vor ihm lagen, geradezu prädestinierten.
Was hatte er sich alles in der Vergangenheit gefallen lassen müssen. Ständig zog er, der bessere Arbeitnehmer, der kluge Angestellte, den Kürzeren. Keiner war fleißiger, intensiver bei der Sache, niemand hatte so viel Sachverstand, seine Expertise zählte, seine Einschätzung war gefragt. Und trotzdem, der Patriarch, der Chef dieser Firma, zog stets seine eigenen, in jeglicher Hinsicht, unqualifizierten Söhne vor. Wenn der Alte zum wiederholten Male und offensichtlich eine personelle Fehlentscheidung zu Gunsten seiner beiden Söhne getroffen hatte, fühlten sie in der Firma alle mit Volkmar mit.
„Papa, ich schmeiß jetzt hin. Ich kündige!“.
„Und genau das tust du nicht, mein Sohn. Mache es denen nicht so einfach; eines Tages kommt deine große Chance!“.
Volkmar hörte auf seines Vaters Rat, ging zur Arbeit, tat so, als ob nichts gewesen wäre und arbeitete weiterhin konzentriert und sehr erfolgreich im Sinne dieses Unternehmens weiter. Er war die Stütze, auf die sich sein Chef, der Alte, der Mann mit der Auszeichnung und der Urkunde „Unternehmer des Jahres 2000“ an der Wand, verlassen konnte. Volkmars Firma, in der Verpackungsindustrie Zuhause und im Schatten eines riesigen und weltumspannenden Chemie-Konzerns, auf dessen Erfolgswelle mitreitend, musste diesen wichtigen Posten in Nord-Amerika erfolgreich nachbesetzen. Dieses Mal hatte der Inhaber keine andere Chance. Er musste den besten auswählen und Volkmar, an seinen eigenen Söhnen vorbei, befördern. Wer so perfekt und fließend Englisch reden, lesen und schreiben konnte, wer so tief in der Materie stand, Empathie für die Kollegen, für den Menschen an sich besaß, kurz, Führungsqualität beweisen konnte, die Produkte kannte und die Abläufe bis ins Detail hätte im Schlaf aufsagen können, war jetzt bei ihm die erste Wahl. Und so bekam Volkmar die gerechte, überfällige Beförderung ausgesprochen.
Ende August, Anfang September 2001, sollte es bereits losgehen. Postadresse: 285 Fulton Street, New York, NY 10007, USA. Die Söhne vom Chef blieben verbittert und enttäuscht zurück. Sie hätten gerne das Highlife (ein exklusives Leben), persönlich in New York City (Downtown) erleben wollen. Liebend gerne hätten sie dabei nachts mit einem Glas Whiskey und einer Zigarette in der Hand, in irgendeiner Karaoke-Bar gestanden und das schöne Lied von Frank Sinatra „New York, New York“ laut nachgesungen.
Der Aufbruch vom Volkmar stand an. Die Organisation ließ ihm kaum Luft zum Atmen. Zwischen seiner eigenen Familie und den Anforderungen seiner Firma hin- und hergerissen, arbeitete sich Volkmar in diesen schwierigen Geschäftsbereich ein. Das Fingerspitzengefühl brachte er mit. Ebenfalls, wie eh und je, ganz viel Herz und Verstand. Er wollte es gut machen. Ende August ging bereits sein Flug über den großen Teich.
Den Stadtteil Lower Manhattan in New York City kannte er recht gut und das hatte nichts mit seiner alten TV-Liebe, Einsatz in Manhattan, zu tun. Die Straßen im Financial District, um das World Trade Center herum, kannte er wie die berühmte Westentasche. Den Stadtplan hatte er bereits in- und auswendig gelernt. Gerade da, wo die kleine Schwester seiner Firma, die Dependance untergebracht war, hoch oben im Nord-Turm, im 78.Stockwerk vom WTC gab es alles, was man zu einem aufregenden Leben in dieser Stadt bräuchte. Netzwerke, auf denen er bauen konnte, Verbindungen, von denen er Zuhause in Ludwigshafen, in der Provinz, nur hätte träumen können. Jetzt sollte seine Karriere so richtig an Fahrt aufnehmen. Er freute sich riesig.
„Papa, die Familie hat gesagt, dass sie nachkommt“.
„Wie schön!“.
„Das wird eine tolle, verrückte Zeit da drüben. Ich werde mich reinhängen, wie noch nie. Arbeiten, arbeiten, arbeiten…
Der 11.September 2001 im US-Bundesstaat New York war ein strahlender Tag, mit viel Sonnenschein, blauen Himmel und guter Laune. Ein ganz normaler, aber zugleich schöner Arbeitstag hatte soeben begonnen. Zehntausende von Menschen, Angestellten, Kunden, Dienstleistern, Serviceleuten, Polizisten und Sicherheitspersonal, kurz, ein Gewusel ohne Ende, strömten in diesen Skyscraper, in dieses unglaublich lange Hochhaus. Leute mit einem Hotdog oder Coffee-to-Go-Bechern ausgestattet, mit der Tageszeitung in der einen Hand und ihren Mobil-Telefonen in der anderen Hand, drängten sie sich, bereits früh am Morgen, in die unzähligen Fahrstühle dieses riesigen Gebäude-Komplexes.
Kaum war Volkmar aus dem Fahrstuhl herausgetreten, war er den Tränen nahe. Sein neues Verkaufs-Team bereitete ihm, den neuen Chef, einen herzlichen und zugleich warmen Empfang. Luftballons an der Decke hängend, eine riesige Kreditkarte aus Pappe, als Anspielung darauf, dass ab heute, alles und überall, nur noch unbar zu bezahlen sei. Die übergroße Torte stand zum Anschneiden bereit. Die Überraschung war ihnen allen gelungen. Gerade noch wollte er dem Team ein großes Dankeschön zurückgeben, da riss er auch schon seine Augen und seinen Mund weit auf und sah das Flugzeug direkt auf sie alle zufliegen....
Knoblauch im Sauerland
Ja, das Sauerland ist schön und das zu jeder Jahreszeit.
Wobei, eine Einschränkung kann die gute Stimmung trüben. Eine Ausnahme davon könnte die Tatsache sein, dass man diesen besonderen Flecken in Deutschland als Verkäufer besucht und für diese wirklich schöne Mittelgebirgsregion, im südwestfälischen gelegen, keine Augen haben kann, weil die gesamte Aufmerksamkeit den Kunden gehören sollte. Und so fuhr unser Protagonist mit seinem polierten Dienstwagen, mit seinen sehr gut vorbereiteten Verkaufsunterlagen sowie der Gewissheit, dass er am heutigen Montag, zum Wochenbeginn, einen Zusammenarbeitstag mit seinem Chef im internen System stehen hatte, pünktlich, mit geputzten Schuhen, frischem Rasierwasser, gekämmten Haaren, kurz, als gepflegte Person zum vereinbarten Treffpunkt, von dem es gemeinsam zum ersten Kunden weitergehen sollte. Doch das im Vorfeld mit E-Mail-Verkehr und am Festnetztelefon fix vereinbarte Treffen fiel aus. Natürlich viel zu früh am vereinbarten Standort wartend, erreichte ihn, dem Verkäufer, nun der mobile Anruf seines direkten Vorgesetzten, dass es der Chef nicht pünktlich schaffen würde; „sie wollten sich doch besser gleich beim Kunden, vor dessen Firmen-Tür treffen“, so der Boss am Autotelefon, irgendwie unaufgeräumt klingend.
Für gewöhnlich war es üblich, den Chef kurz vor einen Besuchstermin zu impfen, so der interne Berufsjargon – dazu am besten in einem Café. In der Fachsprache hieß das Briefen. Dieser wichtige Termin vor dem noch wichtigeren Termin fiel somit schon einmal aus. Zur neuen verabredeten Zeit kam der Chef ebenfalls nicht. Die Uhrzeit sprach nun gegen jegliches Warten; sie verbat es quasi und drängte zu einer Handlung, so oder so. Der 10.00 Uhr-Termin rückte immer näher, nun war es bereits 9.58 Uhr und der Verkäufer stand ganz alleine vor der Tür dieses Geschäftes, dass den lilafarbenen Kopf einer Großkatze eines großen Einkaufs-Verbandes, dem er angehörte, verzierte. Um den Verkauf seiner Waren nicht zu gefährden, um den Inhaber dieses Elektronik-Fachgeschäftes für große und kleine Weiße Ware, sprich Haushaltstechnik, nicht zu verärgern, ging er nun, trotz des fest vereinbarten Termins für die Zusammenarbeit alleine hinein und wünschte dem Geschäftsführer einen schönen guten Morgen.
Keine drei Sekunden später klingelte die Schelle an der Tür erneut und der Vorgesetzte vom Verkäufer trat ebenfalls herein. Den Kunden begrüßte auch er, nur überschwänglicher, fast schon auf freundschaftliche Art und Weise, was den Einkäufer der benötigten Waren irritierte und erstaunte. Man hätte den Eindruck gewinnen können, dass es ihm unangenehm gewesen war, so überschwänglich angesprochen zu werden. Seinen Mitarbeiter dagegen würdigte er keines Blickes; es gab nur ein kurzes, kühles Guten Morgen – seine Augen sprachen Bände. Der Handschlag entfiel komplett und dann geschah etwas Unglaubliches. Der Chef rückte näher an den Angestellten heran und flüsterte ihm zu: „Sie hätten ruhig warten können“.
Dem Verkäufer wurde schlecht. Es grub sich ganz tief in seinen Magen ein. Fast so, als müsste er sich augenblicklich übergeben, blieb blass und stumm zurück. Fast schwankte er ein wenig. Hatte er sich gerade getäuscht oder konnte er sich, nach wie vor, auf seinen Geruchssinn verlassen? Es stimmte wirklich: Sein eigener Chef roch nach altem Knoblauch. „Er stinkt aus allen Poren“, so sein privates, leises Resümee. Auf dem Weg in das Kunden Büro musste er ernsthaft überlegen: „Ist mir jetzt schlecht, weil der Chef stinkt oder weil er gerade unverschämt zu mir war?“.
Der Kunde selbst, der wichtigste Mann in dieser Runde, der Herrscher aller Räume, mit den schönen Ausblicken auf die riesigen und zugleich gut riechenden Fichtenkulturen, riss zugleich alle Fenster auf und rang nach frischer Luft. Die freundliche und sonst übliche Geste, seinen Gästen einen frischen Kaffee anzubieten, hatte der nette Mann darüber schlichtweg vergessen. Er war viel zu sehr damit beschäftigt dafür zu sorgen, dass frischer Sauerstoff durch seine Räume ziehen konnte. Nach einem erfolgreichen Verkaufsbeginn sah das alles nicht mehr aus, dabei waren erst fünf Minuten der kostbaren Verkaufszeit, die der Geschäftsführer unserem Verkäufer an diesem Morgen zur Verfügung gestellt hatte, vergangen. Das Warming-up, die für den Verkauf so enorm wichtige Einstiegsphase des gemeinsamen Aufwärmens, war mindestens verdorben, wenn nicht sogar und das im wahrsten Sinne des Wortes, richtig versaut worden. Dem Verursacher selbst schien das alles nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlimmer mit ihm. Er fing an fürchterlich zu gähnen. Er hielt sich nur noch und das laufend, die Hand vor dem Mund. Dann reichte es den Kunden zum ersten Mal.
„Ich habe bereits die Fenster geöffnet, damit Sie ausreichend Sauerstoff einatmen können. Das müsste jetzt reichen. Lutschen Sie einmal dieses Pfefferminz-Bonbon, das hält Sie nicht nur wach“.
Aber der Vorgesetzte vom Verkäufer gähnte auf das Wohlste weiter. Es machte ihm ganz und gar sowie offensichtlich nichts aus. Die Socken herunterrutschend, die Absätze schiefgelaufen, alles das war dem Verkäufer böse auf den Magen geschlagen. Vom unrasierten Hals und dem dadurch zerfledderten Kragen vom Oberhemd ganz zu schweigen. Auch wollte die Anzugjacke nicht so recht zur Hose passen; irgendwie war bei und an diesem Mann, und das nicht zum ersten Mal, alles verkehrt. Trotz allem, unser tapferer Verkäufer riss sich zusammen und trug dem Herrn Geschäftsführer seine Ausarbeitungen, für die er das gesamte letzte Wochenende gebraucht hatte, in Ruhe vor. Er war nur froh darüber, dass es keine Herrenoberbekleidung war, die er hier und heute verkaufen musste. „Das wäre schiefgelaufen!“, sagte er ganz still zu sich und mehr zur Beruhigung, als alles andere.