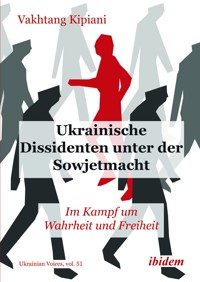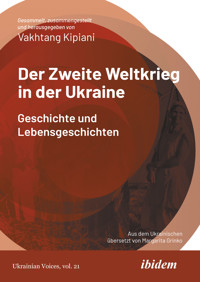
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ukrainian Voices
- Sprache: Deutsch
In diesem Band sind authentische Schicksale zusammengetragen: Vakhtang Kipiani legt eine faszinierende Sammlung von Berichten über zerstörte Träume, zerrissene Familien, Tote, Ermorderte, Folter, Grausamkeit und Deportation in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine vor – Tatsachenberichte, die so noch nie auf Deutsch zu lesen oder zu hören waren. In Augenzeugenberichten erfahren wir von Ukrainern, die nacheinander in unterschiedlichen Armeen als Soldat rekrutiert wurden, von Deportierten, von Zwangsarbeitslagern – von Schicksalen, die uns ergreifen und nicht mehr loslassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Die Wahrheit des Krieges
Der Krieg begann für meine Familie
Wie mein Urgroßvater in Charkiw das Dritte Reich ausbaute
Während der Trennung durch den Krieg haben Oma und Opa sich 250 Briefe geschrieben
„Die Infanterie lief zurück, doch wir waren schon an der Position, also traten wir nicht mehr den Rückzug an“
„Der Deutsche wollte Opa überreden, seine Tochter zu heiraten … damit die Rote Armee ihn in Ruhe lässt“
Ein Großvater marschierte 1940 in Bessarabien ein … und der andere ging zu den „Banderiwzi“
Ein mit Milch und Käse freigekauftes Leben
„Der Offizier zeigte Mama, wie Deutschland seinen Lebensraum erweitern würde“
„Die deutsche ‚Zunge‘ lockte man mithilfe von Mädchen an …“
Ein Märchen vom Krieg: „Aschenputtel, das war meine Oma …“
Meine Krim. „Wollen sie uns wirklich erneut unsere Heimat wegnehmen?“
Warum die Tochter eines NS-Offiziers die Verbrechen ihres Vaters in der Ukraine erforscht
Petro Mowtschan, der den Krieg gewonnen hat
„Das Schrecklichste war, wie wir unsere eigene Artillerie bombardierten“
Krieg, Besatzung, Evakuierung
Kartoffeln am Tannenbaum … Frohes neues Jahr 1942!
Der Krieg hat begonnen, oh, der Krieg hat begonnen …
„Als die Bolschewiki an die Macht kamen, waren sie zuerst sehr milde“
„Mama, wie schwer ist es ohne dich …“
Beim Nachrichten schauen sagte Oma: „Wie blöd ich war, dass ich nach dem Krieg keinen Nagant genommen habe!“
79 Tage in der Todeszelle
„Mein Großvater war in der SS.“ „Und meiner wurde in Auschwitz getötet.“ Die Geschichte einer Liebe zwischen den Nachfahren eines Täters und eines Opfers
Im Feuer nicht verbrannt, im Dnepr nicht ertrunken
Die zwei Leben und ein Sieg des Juchim Eisenberg
„In der Roten Armee trug Papa ein Gewehr …“ so, wie man es ihm in der Division „Galizien“ beigebracht hatte
Frieden. Krieg. Und Menschen
Mein Großvater war im Untergrund in Kyjiw … und sprengte die Brücke über den Dnepr
Mein Großvater hat sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft
„Viele Familien wurden nach Sibirien deportiert, und einige wurden von den eigenen Leuten für angebliche Kollaboration mit dem KGB bestraft“
Drei Geschichten meiner Familie: ein Offizier, ein Partisan und ein erschossener Lehrer
Wasyl Taran: „Wie ich durch den Krieg kam“
Der Angriff der Deutschen kam nicht unerwartet … „Wir wussten alle, dass der Krieg kommt. Wie konnte Stalin das nicht wissen?!“
Der Krieg meiner Familie: Unbekannte Erinnerung und Heldentaten, die bekannt wurden
Die Geschichte der Feier zum Tag des Sieges in der Sowjetunion (1947 – 1965)
Unsere Autoren
Die Wahrheit des Krieges
Als ich etwa sieben Jahre alt war, wurde mir an den Tagen des 9. Mai und 22. Juni etwas anders. Es waren um die 30 Jahre vergangen seit dem Ende des „schrecklichsten Krieges der Menschheitsgeschichte“, wie uns damals beigebracht wurde. Die Großmütter und die Großväter aller meiner Klassenkameraden hatten an der Front gekämpft. Die einen kamen noch zu den feierlichen ersten Schultagen, die anderen lagen bereits unter der Erde. Aber es gab sie – die Helden des Zweiten Weltkrieges. Meine Großeltern waren nicht darunter. Drei von ihnen waren zu jung für die Front gewesen, und einer meiner Großväter war als Elektroingenieur und Leiter eines strategischen staatlichen Objektes vom Wehrdienst befreit. Ich war sehr neidisch darauf, dass alle jemanden hatten, der im Krieg gewesen war, und ich nicht.
Erst viele Jahre später habe ich verstanden, was für ein Glück das ist, wenn eine globale Katastrophe die eigene Familie verschont. Wenn die eigenen Verwandten am Leben sind, und Oma und Opa ihre eigene Geschichte dessen erzählen können, was passiert ist und was sie selbst gesehen und erlebt haben. Diese menschliche Wahrheit des Krieges stimmte oft nicht mit dem überein, was im Fernsehen gesagt, im Kino gezeigt und in der Schule als einzig mögliche Version der Ereignisse gelehrt wurde.
Natürlich gab es Filme und Bücher, die den Lügen der Propagandisten des sowjetischen Generalstabs widersprachen. Doch das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es schien, als wüsste die Mehrheit der Leute, die in der Sowjetunion geboren wurden, nur das, was die Partei ihnen erlaubte zu wissen und woran sie sich erinnern durften. Doch zum Glück war dem nicht so. Zu Hause – oft mit der Mahnung „Sag das niemandem auf der Straße oder in der Schule!“ – erzählten Eltern und ältere Verwandte das, was nicht in den sowjetischen Kanon gepasst hatte. Und diese wahren Geschichten waren später die Saat für die Freiheit zu denken, zu sprechen und zu handeln.
Um den Zweiten Weltkrieg zu begreifen, muss man natürlich mehr lesen als eine wissenschaftliche Monografie oder die Memoiren Churchills, von Mansteins oder Schukows. Doch nicht jeder wird dafür Zeit haben. Manchmal reicht eine kleine Bemerkung, um die Lust am Nachdenken und Recherchieren zu wecken.
Meinerzeit hat mich eine Fotogeschichte unglaublich beeindruckt, die der bekannte Journalist und Fotograf Juri Rost auf den Seiten der damals sehr beliebten Moskauer „Literaturzeitung“ erzählt hatte. Er hatte in der ukrainischen Oblast1 Tscherkassy die Familie Lysenko kennengelernt: Mutter Jewdokija und zehn Söhne: Andrij, Pawlo, Mychajlo, Todos, Mykola, Petro, Oleksandr, Iwan, Stepan und Wasyl. Als der Krieg begann, zogen alle zehn – Andrij, Pawlo, Mychajlo, Todos, Mykola, Petro, Oleksandr, Iwan, Stepan und Wasyl – in den Krieg. Und als der Krieg vorbei war, kehrten alle zehn – Andrij, Pawlo, Mychajlo, Todos, Mykola, Petro, Oleksandr, Iwan, Stepan und Wasyl – zurück zu ihrem Elternhaus, denn dort wartete Mama.
Anschließend, nach dem Krieg, stellte man im Dorf Browachy im Rajon Korsun-Schewtschenko ein Denkmal für die Mutter auf. Und pflanzte zehn Pappeln zu Ehren der Söhne sowie fünf Weiden zu Ehren ihrer Töchter (insgesamt hatte diese Frau siebzehn Kinder geboren). Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, dorthin zu reisen und mich vor dem symbolischen Denkmal für alle Mütter zu verbeugen, die Kinder für die Liebe und Freude geboren hatten, aber letztendlich auch für den Krieg. Wir suchen uns die Zeiten nicht aus.
Dieses Buch wurde Mitte April 2018 gedruckt. Im Frühjahr 2010 erschien auf den Seiten einiger populärer Webseiten und Zeitungen die Ankündigung des Projektes „1939 – 1945. Ungeschriebene Geschichte. Erzählen Sie, wie Ihre Familie den Zweiten Weltkrieg erlebt hat“. Dazu ein kurzer und einfacher Text:
Der Zweite Weltkrieg hat in jeder ukrainischen Familie Spuren hinterlassen. In der Regel wollen Teilnehmer dieser Geschehnisse, egal auf welcher Seite sie gekämpft hatten, nach wie vor keine Einzelheiten erzählen. Die Wahrheit über den Krieg hat man manchmal nur den engsten Verwandten anvertraut.
Wir bieten Journalisten der ukrainischen Medien an, vor dem Jubiläum des Sieges Familiengeschichten und Erzählungen darüber zu veröffentlichen, wie alle unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern den Krieg erlebt hatten.
Ebenso laden wir unsere Leser dazu ein, sich an dem Projekt zu beteiligen.
Aus dieser Idee waren mehr als hundert Publikationen entstanden. Es sprachen sowohl die, die noch lebten, als auch die, die schon lange nicht mehr auf der Welt sind. Zeugen der Ereignisse nahmen ihre Redefreiheit wahr: Soldaten verschiedener Armeen (der Roten, der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) und der Division „Galizien“2), Bewohner der von Nationalsozialisten, ihren Verbündeten und von Bolschewiki besetzten Gebiete, Ostarbeiter, Kinder, Frauen. Und was sehr wichtig war – Kinder und Enkelkinder fanden endlich die Zeit, sich hinzusetzen, ihren Familien zuzuhören und die Erzählungen einer Zeit aufzuschreiben, die scheinbar so fern und gleichzeitig doch nah ist.
Denn Ukrainer streiten nach wie vor darüber, ob es „Zweiter Weltkrieg“ oder „Großer Vaterländischer Krieg“ heißt, und ein Viertel der ukrainischen Staatsbürger sieht Stalin als effektives Staatsoberhaupt und Drahtzieher des nationalen Sieges. Zur gleichen Zeit erinnern sich viele Menschen an andere Dimensionen dieser Tragödie – vom Heldenmut der einen bis zur Niederträchtigkeit der anderen. Manch einer schweigt nach wie vor über das Gesehene: über Tod, Angst und Tränen. Das vergisst man nicht, auch wenn man nicht darüber redet.
Die Geschichten in diesem Sammelband sind nur ein Teil der Werke von Autoren der populärwissenschaftlichen Websites „Ukrainische Wahrheit“ | „Українська правда“, „TEXTE“ | „ТЕКСТИ“ und „Historische Wahrheit“ | „Історична правда“3. Tatsächlich gibt es viel mehr davon, sodass man auch einen zweiten und dritten Band herausgeben könnte. Wenn Sie noch nicht die Geschichte Ihrer Familie erzählt haben, können Sie das immer noch tun.
E-Mail: [email protected].
Vakhtang Kipiani
Chefredakteur der Website „Historische Wahrheit“
| „Історична правда“
1 Anm. d. Übers.: Verwaltungsbezirk in der Ukraine, der sich wiederum in Rajone (Landkreise) unterteilt. Es gibt in der Ukraine 24 Oblaste, dazu die Städte Kiew und Sewastopol sowie die Autonome Republik Krim.
2 Anm. d. Übers.: Damit ist die 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) gemeint, die u.a. aus ukrainischen Freiwilligen bestand.
3 Anm. d. Übers.: https://www.pravda.com.ua/; https://texty.org.ua/; https://www.istpravda.com.ua/
Romko Malko
Der Krieg begann für meine Familie 1939 …
Die Familie meiner Oma Wira hat der Krieg in ihrem neuen Haus in Ternopil ereilt. Das war nicht im Juni 1941, sondern im September 1939. Eines Nachts hämmerte es an der Tür: „Aufmachen! Eine halbe Stunde zum Packen. Nur das Nötigste mitnehmen…“
Der Zweite Weltkrieg kam nicht erst im Juni 1941 in die Ukraine, sondern bereits im September 1939. Zumindest die Westukrainer – ihr Land gehörte damals noch zu Polen – erinnern sich genau an dieses Datum. Das polnische Heer war schwach und demoralisiert, daher hatte es keinen Sinn, gegen zwei Millionenarmeen – die deutsche und die sowjetische – zu kämpfen. „Die polnische Armee auf Fahrrädern“, scherzten die Ukrainer, und das spiegelte fast vollständig die Wahrheit wider.
Die Deutschen griffen Polen zuerst an, und da es keinen Widerstand gab, drangen sie viel weiter vor, als zuvor im Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vereinbart worden war. Doch dann erschien die Rote Armee, und die Deutschen mussten sich zurückziehen.
Zuerst marschierten die Deutschen in Polen ein, und da es keinen bedeutenden Widerstand gab, konnten sie recht weit vordringen – weiter, als zuvor mit den Sowjets im Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vereinbart worden war. Doch dann erschien schnell die „glorreiche“ Rote Armee, und die Deutschen mussten sich zurückziehen.
Dass jemand die Deutschen oder die Bolschewiki besonders freudig empfangen hatte, entspricht nicht der Wahrheit. Die Mehrheit empfand ihr Auftauchen als Besatzerwechsel, mehr nicht. Möglicherweise hat der ein oder andere ihnen Brot und Salz gebracht, doch das war eher die Ausnahme als die Regel. In der Gesellschaft herrschten Unsicherheit und Angst. Die Leute wussten genau, wer die Bolschewiki waren, erinnerten sich gut an den kürzlich überstandenen Holodomor1 in der Großen Ukraine und an Hunderte geschwollener Ukrainer von jenseits des Sbrutsch2, die es für ein Stück Brot nach Galizien geschafft hatten. Man hatte keine Illusionen. Zu den Deutschen war die Einstellung etwas besser: Schließlich war das europäische Deutschland nicht mit den lumpigen Bolschewiki gleichzusetzen. Doch insgesamt lag eine böse Vorahnung schwerer Ereignisse in der Luft, und die Menschen versuchten schlicht, zu überleben. Sehr schnell sollte das, was sie geahnt hatten, jede Erwartung übertreffen…
Die Familie meiner Oma Wira lebte in Ternopil. Der Krieg ereilte sie in ihrem neuen Haus, das ihre Eltern kurz zuvor nach vielen Jahren der Umzüge zwischen den Dörfern Galiziens gebaut hatten. Früher war mein Uropa – ein Mensch, der sieben Sprachen flüssig beherrschte – als Lehrer tätig, aber er konnte keine Arbeit in Ternopil finden, weil er nicht Polnisch sprechen und kein Pole werden wollte.
Oma ging damals in die Unterstufe des Gymnasiums und ihr Bruder Rodjo (Rodion) stand kurz vor dem Abschluss. Doch dann kamen die Bolschewiki und verwandelten das Gymnasium sogleich in eine normale zehnjährige Gesamtschule. Ehemalige Gymnasiasten, die nur 8 Klassen hatten, bekamen die Gelegenheit, ein Jahr länger zur Schule zu gehen. Vielleicht, um sich die neue Lebensweisheit besser anzueignen.
Die Ankunft der Sowjets brachte zunächst keine nennenswerten Veränderungen mit sich und Leute dachten sogar, ihre Sorgen seien unberechtigt. Es gab natürlich Verständnislosigkeit und Verwunderung, was die sowjetischen Besatzer betraf, doch man maß dem keine besondere Bedeutung zu. Nun, die Leute wunderten sich eben über zerlumpte sowjetische Soldaten, die im Vergleich zu den deutschen oder polnischen wie Bettler wirkten, die Ehefrauen der Offiziere gingen nun mal in den Nachthemden polnischer Damen ins Theater, die sie in verlassenen Anwesen gefunden hatten, und stellten Blumen in Nachttöpfe… Es gab so einiges, aber schlimm war es ja nicht…
Die Leute wunderten sich über zerlumpte sowjetische Soldaten und Offiziersgattinnen, die in Nachthemden polnischer Damen ins Theater gingen und Blumen in Nachttöpfe stellten ...
Es gab bald Gerüchte, dass Leute verschwanden und nach Sibirien deportiert wurden. Menschen wurden zum Schulleiter bestellt oder einfach auf der Straße in ein schwarzes Auto gezerrt, und waren dann einfach weg.
Doch sehr bald änderte sich die Realität. Die Schrauben wurden allmählich angezogen. Schon bald verbreiteten sich Gerüchte über das Verschwinden von Menschen und Deportationen nach Sibirien.
Eines Tages im Frühjahr 1941, nach einer Feier anlässlich des Geburtstags Taras Schewtschenkos3 in der Schule, passierten den Schülern plötzlich merkwürdige Dinge. Einer wurde zum Schulleiter bestellt und kam nicht mehr zurück, ein anderer wurde auf der Straße in ein schwarzes Auto gezerrt und war weg, wieder andere verschwanden einfach spurlos. Auf ähnliche Weise wurde ein Junge mit dem Nachnamen Hrynkiw, dessen Familie in der Umgebung meines Urgroßvaters wohnte, entführt. Die besorgten Eltern suchten nach ihren Kindern, doch weder im Gefängnis noch bei der Polizei konnte man ihnen helfen. Die Angst kroch nach und nach unter die Haut…
Eines Morgens weigerte Rodjo sich, zur Schule zu gehen: „Mir geht es irgendwie nicht gut. Ich fühle mich krank.“
Die Mutter, sprich meine Urgroßmutter, zeigte Verständnis für ihren Sohn und erlaubte ihm, zu Hause zu bleiben.
Mittags kam eine besorgte Klassenkameradin vorbei und berichtete, dass Rodjo und andere Jungs zum Direktor gerufen worden waren. Alle Aufgerufenen, die in der Schule gewesen waren, seien nicht mehr in den Unterricht zurückgekehrt. Man habe sie in ein schwarzes Auto gesetzt und irgendwo hingefahren. Es war klar, dass danach niemand mehr zur Schule geschickt wurde. Rodjo blieb noch einige Zeit zu Hause und ging eines Abends ins benachbarte Städtchen zu seinen Verwandten, um unterzutauchen. Ob Uroma Maria ahnte, dass sie ihren Sohn an diesem Abend zum letzten Mal sehen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon.
Es vergingen ein paar Wochen, und eines nachts, am 21. Mai, hämmerte es an der Tür und jemand brüllte auf Russisch: „Aufmachen! Eine halbe Stunde zum Packen. Nur das Nötigste mitnehmen…“
Uropa Prokip – der, der sieben Sprachen konnte, ein raffinierter Gelehrter, der sich hervorragend in Recht und Gesetz auskannte und alle seine Schüler ausnahmslos siezte – konnte nicht glauben, dass ihm so etwas überhaupt widerfahren könnte. Er stand wie erschlagen mit zwei Bürsten in den Händen da und wiederholte: „Das kann doch gar nicht sein… Wir haben doch nichts falsch gemacht…“
Wenn meine Uroma nicht gewesen wäre, die die Situation nüchtern einschätzte und schnell anfing zu packen, hätten sie in den Sachen nach Sibirien fahren müssen, in denen sie geschlafen hatten, und mit zwei Kleiderbürsten dazu.
Als ganze Familien in Wagen gehievt wurden, gingen die Verschonten hinaus und verabschiedeten ihre Nachbarn. Die Deportieren wurden zuerst nach Ternopil gebracht, dann zum Bahnhof. Dort sperrte man sie in Güterwaggons, die für den Viehtransport bestimmt waren, und schickte sie massenhaft ins Ungewisse ...
Oma Wira sollte bleiben. Sie schlief mit einer studentischen Untermieterin auf dem Heuboden, und man hatte gar nicht vor, nach ihr zu suchen. Uroma sprach beim Packen bewusst laut, damit Wira hörte, was im Haus vor sich ging, dass ihre Eltern weggebracht wurden, und leise war. Sie nahm nicht einmal Wiras Sachen mit – sie hoffte, dass sie bleiben würde. Doch Oma hielt es nicht aus. Im letzten Moment, als das Auto bereits rollte, sprang sie aus ihrem Versteck und stürmte zu ihren Eltern. Die Soldaten wollten sie zuerst nicht mitnehmen, denn sie dachten, sie wäre eine Fremde, doch sie gelangte trotzdem auf die Ladefläche und klammerte sich an die Hand ihrer Mutter. Die Straße war voller schrecklicher Wehklagen – es wurden gleichzeitig mehrere Familien deportiert. Die Leute weinten wie bei einer Beerdigung. Diejenigen, die zurückblieben, waren aus den Häusern getreten und verabschiedeten ihre Nachbarn ins Ungewisse.
Die Ausgesiedelten wurden zum Bahnhof Ternopil gebracht und in Güterwaggons gesperrt, die für den Viehtransport gedacht waren. Man behielt sie einige Tage dort, bis man eine ganze Truppe zusammen hatte, und fuhr los…
Die Familie Tkatschuk. Vater Prokip, Mutter Maria (geboren Korduba), Sohn Rodjo (Rodion), Tochter Wira. Ternopil, 1929 oder 1930
Am 30. Juni 1939 wurde in Lwiw der Ukrainische Nationalstaat erneut ausgerufen. Doch die Existenz der Ukraine passte nicht in Hitlers Pläne, daher wurden viele Beteiligte sehr bald verhaftet.
Es war Frühjahr 1941. Das Ziel der Reise meiner Oma, Uroma und meines Uropas war Salechard. Danach ging es mit dem Lastschiff irgendwo zur Mündung des Flusses Ob, hinter den Polarkreis. Eine hungrige und kalte Existenz, lange Jahre der Waldrodung, zwei Kubikmeter pro Tag (meine Oma war damals dreizehn), die Verhaftung meiner Uroma für den Diebstahl eines Fisches (um nicht zu verhungern) und noch viel mehr… Das alles für den heroischen Sieg des „großen“ Stalin und des nicht minder „großen“ sowjetischen Volkes über die bösen Faschisten.
Währenddessen hatte Deutschland die UdSSR angegriffen. Deutsche marschierten in Ternopil ein und öffneten das Gefängnis. Ein solches Grauen hatten weder die Einwohner noch die Deutschen selbst je zuvor gesehen. Das Gefängnis war buchstäblich voller Leichen. Das geronnene Blut stand in Pfützen. Die Toten waren hier und da mit Kalk zugeschüttet, aber die meisten hatte man einfach auf einen Haufen geworfen. Die „glorreichen“ sowjetischen Behörden, die die Gefangenen nicht deportieren wollten, hatten sie einfach massenweise direkt im Gefängnis erschossen. Genauer gesagt, nicht einfach erschossen, sondern mit einer besonderen „Behandlung“: Sie hatten sie gefoltert, gequält, Stücke vom Fleisch abgeschnitten und erst anschließend ermordet. Unter den Tausenden Körpern fanden sich auch die sterblichen Überreste von Schülern des Ternopiler Gymnasiums – Rodjos Klassenkameraden. An der Wand des Gymnasiums hängt nun eine Tafel mit ihren Nachnamen und ihrem Todesdatum: 21. – 26. Juni 1941.
Aus der ganzen Oblast Ternopil reisten Verwandte der Verschwundenen und Verhafteten in die Stadt, um ihre Leichen zu identifizieren und würdig zu beerdigen. Die Flüche und Tränen kannten kein Ende. Das Gleiche passierte in allen großen und kleinen Städten der Westukraine. Ein solches Leid hatte das Land seit dem Einmarsch der mongolischen Tataren nicht mehr erfahren…
Gleich nach der Invasion der Deutschen und der erneuten Ausrufung des ukrainischen Nationalstaats am 30. Juni in Lwiw fuhr Omas Bruder Rodjo nach Lwiw und stellte sich nun als Mitglied der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) freiwillig der ukrainischen Regierung zu Diensten. Aber ein ukrainischer Staat gehörte nicht zu Hitlers Plänen, daher fing man sehr bald an, alle Beteiligten zu verhaften.Unter anderem auch Rodjo. Möglicherweise wäre ihm das Schicksal vieler ukrainischer Patrioten zuteilgeworden und er hätte seine Kugel bereits in den ersten Tagen des Krieges erhalten, doch seine Bestimmung hielt eine andere Mission für ihn bereit. Der Junge schaffte es irgendwie, den Wärtern zu entkommen und nach Ternopil zurückzukehren. Leider liegen die Einzelheiten dieser Flucht nach wie vor im Dunkeln, denn heute ist niemand mehr da, der davon berichten kann. In Ternopil kam Rodjo semilegal im Elternhaus unter, das von sowjetischer Miliz ausgeraubt worden war, und machte sich daran, ein Organisationsnetzwerk aufzubauen. Dabei half ihm maßgeblich die Schwester seiner Mutter, Tante Stefka, die nebenan wohnte. Sie hatte keine eigenen Kinder, daher war Rodjo für sie wie ein Sohn. Ständig kamen Leute ins Haus, aßen etwas, ruhten sich aus oder übernachteten und gingen dann wieder. Die Frau kochte für sie, erfüllte nach Bedarf die Rolle der Verbindungsfrau, beschaffte Informationen, kaufte Zugfahrkarten, empfing Übergaben. Nach der Überlieferung meiner Familie war Rodjo der regionale Leiter der OUN. Das bestätigten auch Leute, die ihm während des Krieges begegnet waren. Leider konnte man keine privaten Dokumente finden: Im Untergrund griff man kaum zu Bürokratie, und bis Ende 1943, als die Ukrainische Aufständische Armee (UPA) entstand, wurde allgemein sehr wenig dokumentiert.
Rodion Tkatschuk. Ternopil, 1942
Etwa gegen Ende 1942 hängte die Gestapo in Ternopil öffentlich einige Mitglieder der OUN. Die Organisation beschloss, sich für die Gebrüder zu rächen und plante eine kühne Operation. Damals gab es im Zentrum von Ternopil das Restaurant „Polonia“, das vor allem höherrangige deutsche Beamte und Volksdeutsche besuchten. An der Tür hing das Schild „Nur für Deutsche“, deshalb war dem Normalsterblichen der Zutritt verwehrt. Eines schönen Tages betraten zwei Offiziere der Wehrmacht das Restaurant. Nachdem sie sich im Saal umgeschaut hatten, verfeuerten sie einige Magazine in die anwesenden Nationalsozialisten. Sie hinterließen eine blutige Masse aus erlesenen Speisen, Getränken und Soldaten des Führers, bevor sie genauso seelenruhig wieder auf die Straße traten. Dort hielten sie eine Kutsche an, stiegen ein und verschwanden um die Ecke, als hätten sie sich in der Luft aufgelöst. Zu sagen, dass für die Besatzer eine derart dreiste Aktion ein Schock war, wäre eine Untertreibung.
In der Stadt veranstaltete man sogleich eine wahre Menschenjagd, versperrte alle Ein- und Ausgänge, durchkämmte jede Ecke, doch man konnte die beiden Draufgänger in Offiziersuniformen nicht finden. Diese saßen derweil entspannt einige Blocks vom Tatort entfernt im Haus meiner Uroma. Einer davon war Rodjo, doch der Name des anderen bleibt leider unbekannt.
Die organisierte Aktion vor der Nase der Gestapo konnte nicht unbemerkt bleiben, und einige Zeit später fahndete man nach Rodjo.
Er war gezwungen, die Stadt zu verlassen und die Arbeit woanders in einem ihm zugeteilten Gebiet fortzusetzen. Eines Nachts, als er von einem Dorf zum anderen ging, traf er auf eine deutsche Patrouille. Auf dem Wagen, den ein ihm aus Ternopil bekannter Pole lenkte, saßen Deutsche. Als sie den nächtlichen Passanten erblickten, verlangten sie nach seinem Ausweis. Der Mann sah demjenigen ähnlich, den die Gestapo schon mehrere Monate vergeblich suchte. Rodjo griff nach seiner Tasche mit den Dokumenten, doch zog stattdessen eine Pistole heraus und streckte die Deutschen auf der Stelle nieder. Den polnischen Kutscher ließ er unangetastet.
Nachdem sie ein paar Worte gewechselt hatten, verabschiedeten sie sich und gingen ihrer Wege. Doch der Pole erwies sich als weniger freundlich und großzügig. Er zückte sein Gewehr und schoss Rodjo in den Rücken.
In Ternopil verhaftete man Tante Stefka und brachte sie zur Identifizierung. Interessant war, dass man niemandem erlaubte, den Leichnam von der Straße zu entfernen. Stattdessen stellte man eine Wache daneben. Als die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen waren, blieb Rodjos Körper an der Straße liegen, und die Tante wurde von der Gestapo eingesperrt. Irgendwie gelang es den Jungs von der OUN, sie herauszuholen, und einige Wochen später kehrte sie zurück nach Hause, wo sie damit weitermachte, dem Untergrund zu helfen.
Derweil hatten Bewohner des Nachbardorfes Rodjo in der Nacht auf ihrem Friedhof feierlich beerdigt. Auf Befehl der Organisation fanden in der ganzen Oblast, in allen Kirchen, Gedenkfeiern zu Ehren Rodjos statt und die Glocken läuteten trauernd…
Diejenigen, die das Glück hatten, aus Sibirien zurückzukehren, konnten oft nicht in ihrem eigenen Haus leben - dort wohnten bereits die Familien von Beamten der sowjetischen Regierung. Daher mussten sie ihre Verwandten oder Nachbarn um Obdach bitten.
Als Oma, Uroma und Uropa aus Sibirien zurückkamen, wohnte in ihrem Haus bereits ein sowjetischer Beamter mit seiner Familie. Darum mussten sie ihre Verwandten um ein Dach über dem Kopf bitten.
Glücklicherweise lebte Tante Stefka noch und erzählte ihnen von Rodjos Schicksal. Uroma ging lange durch die Dörfer und fragte die Leute nach dem Grab ihres Sohnes. Diese hatten Angst, darüber zu sprechen. Die Zeiten waren grausam, doch Uroma suchte trotzdem weiter. Das Schicksal führte sie mit einer Frau zusammen, deren Vater seinerzeit die Beerdigung organisiert hatte, und die Frau zeigte ihr Rodjos Grab. Uroma stellte für ihren Sohn ein Kreuz auf, doch bis zum Zerfall der Sowjetunion hatte sich doch niemand getraut, seinen Namen auf die Gedenktafel zu schreiben.
So geht die Geschichte. Vieles würde ich gern ergänzen, doch leider kann das heute niemand mehr…
1 Anm. d. Übers.: Eine 1932 – 33 vom sowjetischen Regime verursachte Hungersnot in der Ukraine, bei der fast vier Millionen Menschen ums Leben kamen.
2 Anm. d. Übers.: Der Fluss Sbrutsch im Westen der Ukraine trennte bis 1939 die Zweite Polnische Republik von der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
3 Anm. d. Übers.: Taras Schewtschenko (1814 – 1861) war ein bedeutender ukrainischer Lyriker und Maler sowie Wegbereiter der modernen ukrainischen Nationalliteratur.
Oleh Kozarew
Wie mein Urgroßvater in Charkiw das Dritte Reich ausbaute
Wie die meisten Leser habe auch ich einen Veteranen-Opa, der mit der Roten Arbeiter- und Bauernarmee von Stalingrad nach Wien marschiert ist (von ihm erzähle ich ein anderes Mal). Genauso haben wohl viele von uns einen Großvater, der sich vor der Mobilisierung versteckt hat. Nicht verwunderlich ist es auch, dass ein Teil meiner Großonkel zur Ukrainischen Hilfspolizei gehört hatte. Aber ich habe in meiner Familiengeschichte auch einen wirklich exklusiven Fall. Mein Urgroßvater war Bürgermeister von Charkiw während der deutschen Besatzung – genau der Bürgermeister Oleksij Kramarenko, dessen Befehl zum Verbot der russischen Sprache in Regierungsinstitutionen der Stadt ab und an von prorussischen Medien zitiert wird.
Oleksij Iwanowytsch Kramarenko studierte am Technischen Institut in Charkiw, arbeitete daraufhin als Chefingenieur und war ein sehr geschätzter Fachmann. Er dozierte an den Instituten in Kamjanez-Podilskyj und Charkiw und leitete die den Lehrstuhl für Glastechnologieam Charkiwer Technologischen Institut.
Oleksij Iwanowytsch Kramarenko wurde am 17. Februar 1882 in Elisabethgrad (heute Kropywnyzkyj) in die Familie eines Eisenbahners hineingeboren. Er studierte Chemie am Technologischen Institut (heute Polytechnisches Institut1) in Charkiw und arbeitete in vielen Betrieben der Ukraine als Chefingenieur, beispielsweise baute er die Produktion in der Porzellanmanufaktur in Budjan und in der Tschasiwojarsker Ziegelei auf.
Er wurde als Fachmann sehr geschätzt und bekam sogar einen Adelstitel. Selbst zu Zeiten der sowjetischen Herrschaft reiste er ständig ins Ausland. Er unterrichtete an den Instituten in Kamjanez-Podilskyj und Charkiw. Am polytechnischen Institut Charkiw war er Leiter des Lehrstuhls für Glastechnologie.
Am Kriegstreiben 1917 – 1920 nahm Oleksij Kramarenko nicht teil. Es blieben ungewisse Hinweise auf Sympathie mit der Ukrainischen Volksrepublik. Verwunderlich ist, dass er Lenin verachtete und Trotzki verehrte.
Mein Urgroßvater (Zweiter von links) mit Kameraden und Kameradinnen. 1930er Jahre
Am Kriegstreiben 1917 – 1920 nahm Oleksij Kramarenko nicht teil, und seine politischen Präferenzen waren widersprüchlich – Hinweise auf Sympathie mit der Ukrainischen Volksrepublik, eine erklärte Russophobie und eine Abneigung gegenüber Lenin vereinten sich mit einer Begeisterung für Trotzki.
Oleksij Kramarenko
Seine Nachkommen erzählen, dass zwei Armeen – eine weiße und eine rote – Oleksij Iwanowytsch und seiner Frau Maria Leonidiwna ein schönes Klavier entwenden wollten, das im Stil der Secession gestaltet war (heute spielt meine Mutter darauf), doch beide Male schaffte es Kramarenko, es zurückzuholen.
Dazu sagte er noch zur weißen Armee, er habe „kein Mitgefühl mit ihrer Bewegung“, wonach er sich nur dank einflussreicher Verwandter seiner Frau retten konnte.
Kramarenko hatte eine „anglomanische“ Einstellungund einen Geschmack, der damals für konservative Gelehrte alter Schule charakteristisch war: Hoffmann, Blok, Wynnytschenko (er schrieb selbst Gedichte und konnte bei Gelegenheit auch Wasyl Tschumak zitieren), Rezitation von Lyrik mit klassischer Musik, Theater, Kartenspiel, Alkohol und Affären.
Das letzte Hobby endete mit einer Scheidung von meiner Uroma und einer Hochzeit mit seiner Kollegin, der Chemikerin Natalia Berschadska. Möglicherweise hat das letztendlich unsere Familie gerettet.
Die Deutschen besetzten Charkiw und mussten eine lokale ukrainische Selbstverwaltung organisieren. Oleksij Kramarenko wurde zum Bürgermeister ernannt. Dabei war die wahre Macht in den Händen der Deutschen, daher hinterließ der frischgebackene Gouverneur nur im kulturellen Bereich eine merkliche Spur.
Die Deutschen besetzten Charkiw am 21. Oktober 1941. Von allen ukrainischen Großstädten hatte es Charkiw wohl am schwersten getroffen. Die Nazis schnitten den Bürgern bewusst den Zugang zur Grundversorgung ab und führten ungewöhnlich harte Repressionen ein.
Aber auch hier musste zur Unterstützung eine lokale ukrainische Selbstverwaltung organisiert werden.Wie Historiker Anatolij Skorobohatow erzählt, hatten die Deutschen sich mit den Dozenten des Technischen Instituts beraten – wo wahrscheinlich auch ihr Spionagenetz war – und ernannten Oleksij Kramarenko zum Bürgermeister.
Welche Funktionen und Möglichkeiten der damalige „Stadtleiter“ von Charkiw wohl hatte (übrigens gehörte Charkiw nicht zur Zivilverwaltung des Reichskommissariats Ukraine, sondern zum Frontgebiet)?
Eher wenige.
Oleksij Kramarenko auf Dienstreise in den USA
Theoretisch sollte er die Industrie der Stadt erneuern, die von den Bolschewiki zur Zeit des Rückzugs vernichtet worden war, die Bevölkerung mit Waren versorgen und darauf achten, dass die Befehle der deutschen Obrigkeit ausgeführt wurden. Er hatte jedoch keine Gelegenheit, diese Aufgaben wahrzunehmen, denn die wirkliche Macht war nach wie vor in den Händen der Deutschen.
Kramarenko blieb nichts anderes übrig, als seinen sperrigen und korrupten Administrationsapparat „durchzuschütteln“, die Menge der „von Juden befreiten“ Wohnfläche festzuhalten (übrigens bot er eine solche „befreite“ Wohnung seiner Exfrau, meiner Uroma, zum Einzug an – man kann sich vorstellen, was man ihr 1943 gesagt hätte, hätte sie zugestimmt), kümmerliche Kantinen „für seine Leute“ herzurichten und sich um den kulturellen Sektor zu kümmern.
Gerade die Kultur wurde die einzige Branche, in der Bürgermeister Kramarenko eine bedeutende Spur hinterlassen hat. Er trug nämlich zur Wiedergeburt der örtlichen Kirchen bei.
Vor dem Krieg war in Charkiw nur noch eine aktive Kirche übrig, und dank dem Bürgermeister wurden viele weitere den Gläubigen zurückgegeben. Darunter sowohl die autokephale als auch die autonome orthodoxe Kirche – letztere ist heute die Kirche des Moskauer Patriarchats (beide Kirchen mussten damals Gottesdienste zu Ehren des „Befreiers“ Hitler abhalten).
Oleksij Iwanowytsch war nicht gläubig, doch er freute sich, über der Stadt wieder das Läuten der Kirchenglocken zu hören.
Am besten bekannt wurde der Bürgermeister für seine Anordnung zum Verbot der russischen Sprache in staatlichen Einrichtungen der Stadt.
Zum bekanntesten „Streich“ Kramarenkos wurde der Erlass, der die Sprache betraf.
Schon fünf Monate weht über der freien Stadt nebst der siegreichen deutschen Fahne unsere gelb-blaue ukrainische Fahne als Symbol eines neuen Lebens, einer Wiedergeburt unseres geliebten Vaterlandes.
Doch zu unserem großen Bedauern und zur Schande für uns Ukrainer bleibt hier und da nach wie vor ein beschämendes bolschewikisches Erbe.
Zu unser aller Schande und zum für uns völlig verständlichen Zorn des ukrainischen Volkes kommt es vor, dass wir die russische Sprache von Seiten der Staatsbeamten hören, die sich anscheinend für ihre Muttersprache schämen.
Schande über die, die freie Bürger eines befreiten Vaterlandes werden. Schämen sollten sich die, die ihre Muttersprache scheuen, und daher keinen Platz unter uns haben. Wir lassen das nicht zu, das darf nicht sein. Deshalb befehle ich, jedem Beamten im Dienst ausnahmslos das Sprechen der russischen Sprache zu verbieten.
„Zu unser aller Schande und mit für uns völlig verständlichen Zorn des ukrainischen Volkes kommt es vor, dass wir die russische Sprache von Seiten der Regierungsbeamten hören, die sich scheinbar für ihre Muttersprache schämen.“
Genau wegen dieser Verordnung taucht der Name meines Uropas manchmal in allen möglichen aufgeregten Artikeln der „Iskonniki“2 auf.
Seine ehemalige Familie unterstützte der Bürgermeister. Manchmal kam er auch zu Besuch.
Währenddessen wurde seine neue Frau schwanger. Im August 1942 wurde Oleksij Kramarenko von der Gestapo verhaftet.
Man sagte, er ging auf der Straße neben der Gestapo, und traf einen Bekannten.
„Wo gehen Sie hin, Oleksij Iwanowytsch?“
„Ach, ich bin wie der Papagei bei Dickens.“
Eine recht einfache Anspielung für die damaligen literarische Mode: „Dann muss ich wohl mit, sagte der Papagei, als die Katze ihn am Schwanz zog.“
Eine Version besagt, man hätte meinen Uropa wegen irgendwelcher Manipulationen bei der Lebensmittelversorgung verhaftet. In einer anderen hatte er aktiv dabei geholfen, Gefangene eines Konzentrationslagers im Stadtteil Cholodna Hora zu befreien, darunter Partisanen und Juden.
Außerdem habe eine Freundin der Familie, Iwanzowa, vom sowjetischen Geheimdienst Angebote zur Zusammenarbeit übermittelt, doch Kramarenko habe abgelehnt, und aus Rache dafür hätten die Roten ihn bei den Nazi-Kollegen „verpfiffen“. Vielleicht war es aber auch umgekehrt, und er kollaborierte mit dem sowjetischen Geheimdienst oder dem Widerstand. Wie die Gestapo meiner Oma Valeria gesagt hat: „Ihr Vater ist bis Kriegsende inhaftiert.“
Als er im Gefängnis war, gebar seine Frau Sohn Oleksij, der nur einige Jahre lebte und an einer Hirnhautentzündung starb. Das weitere Schicksal Kramarenkos bleibt im Dunkeln.
Jemand sagte, die Deutschen hätten ihn erschossen, ein anderer, man habe ihn während des Rückzugs nach Polen gebracht. Ein anderer Bekannter unserer Familie hat Oleksij Kramarenko angeblich nach dem Krieg in London gesehen, wo er unter einem anderen Namen gelebt habe. Doch vielleicht sind das alles nur romantische Legenden…
Nachdem die sowjetische Regierung wieder an die Macht kam, hat man meine Oma, Kramarenkos Tochter, einige Male vernommen und dann in Ruhe gelassen. Natalia Berschadksa blieb allem Anschein nach ebenfalls von schlimmer Verfolgung verschont. Doch seine Exfrau, Maria Leonidiwna, starb.
Eine ganze Zeit lang hatte man in meiner Familie vermieden, viel über diese Geschichte zu sprechen, sie jedoch auch nicht vertuscht. Schließlich war sie ziemlich symbolisch: Kollaboration war in Zeiten des schrecklichsten Krieges des 20. Jahrhunderts in Europa kein Privileg großer Staaten.
Dem einen fiel zu, die Tschechoslowakei aufzuteilen, der andere sollte das Dritte Reich bewaffnen und lehren, wieder ein anderer durfte die „nationale Unabhängigkeit“ oder „Volksdemokratie“ ausrufen, und die einfachen Leute bekamen von der Weltpolitik ihre „Hausaufgaben“, vor denen sich selten drücken konnten.
1 Hier geht es um die Nationale Technische Universität „Polytechnisches Institut Charkiw“.
2 Anm. d. Übers.: So nennt man eher abwertend die Befürworter der einheitlichen urtümlichen Rus, bestehend aus Russland, Ukraine und Belarus.
Pawlo Solodko
Während der Trennung durch den Krieg haben Oma und Opa sich 250 Briefe geschrieben
Meine Oma väterlicherseits, Nadija Oleksijiwna Nejischschala, lernte meinen Opa, Pawlo Andrijowytsch Solodko, während der Besatzung kennen. Ich habe sie gebeten, mir mehr über diese romantische Geschichte vor der Kulisse des blutigen Weltkrieges zu erzählen. Von meinem verstorbenen Großvater gibt es Erinnerungen an die Front – ich habe sie an die Erzählungen meiner Oma angepasst.
Die Schlacht bei Charkiw war nicht so gut organisiert. Am 12. Mai 1942, als die sowjetischen Streitkräfte in die Offensive übergingen, hatte niemand vor der Gefahr einer Einkesselung gewarnt.
Oma Nadja hat ihren Schulabschluss in Bachmatsch (Oblast Tschernihiw) im Juni 1941 gemacht. Genau zur gleichen Zeit wie mein Opa Pawlo, aber dieser war in Kurin (ein Dorf bei Bachmatsch) zur Schule gegangen und hatte seine Abschlussfeier am 22. Juni. Sie lernten sich da noch nicht kennen, denn im August wurde Opa in die Armee einberufen. Er war neunzehn Jahre alt.
***
Im November 1941 begann unser Rückzug von der Oblast Luhansk in Richtung Stalingrad1.
Wir waren vor allem nachts unterwegs, zu Fuß. Manchmal legten wir 60 Kilometer pro Nacht zurück, geschlafen wurde im Gehen. Bei uns trugen wir Rucksäcke. Es regnete, der Zeltmantel half kaum. Wenn es im Morgengrauen fror, wurde der Mantel zum Panzer.
Unsere Kanonen wurden von Pferden gezogen. Wir konnten schon kaum gehen, und da blieb zu allem Überfluss noch eine Kanone stecken. Wir griffen sie von allen Seiten – einige zogen an den Rädern, andere am Pferdegeschirr.
1941 und 1943 sind aus Kurin etwa 1,5 Tausend Personen an die Front gegangen. 867 sind nicht zurückgekommen.
Als wir am Dorf ankamen, waren die Offiziere mit den Wagen und Lebensmitteln nicht da.Man hatte da noch nicht überall in den Kolchosen die Kartoffeln geerntet – und das hat uns gerettet.
Während des Rückzugs 1941 hatten die hungrigen sowjetischen Soldaten Glück, dass die Kartoffeln noch nicht überall geerntet worden waren.
So waren wir etwa 750 Kilometer gegangen. Dafür ging es mit dem Zug zurück. Am 12. Mai 1942 gingen wir in die Offensive – das war die Schlacht bei Charkiw. Soweit ich das mit meinem Soldatenverstand beurteilen konnte, haben unsere Oberkommandeure sie nicht auf die beste Art und Weise organisiert.
Niemand sprach darüber, dass uns eine Einkesselung drohte. Als man uns am 22. Mai eine trockene Ration für vier Tage gab und uns ermahnte, sie auf acht Tage aufzuteilen, begannen wir zu ahnen, dass wir im „Kessel“ waren.
Eines Mittags Ende Mai sah ich, wie auf unserer Position ein Schwarm „Junkers“-Flieger landete. Ich fiel in den Graben. Die Deutschen schalteten sogar die Sirenen an, um uns psychisch fertigzumachen. Plötzlich gab es eine schreckliche Explosion, die Luft wich mir aus den Lungen. Ich dachte: wahrscheinlich bin ich jetzt tot.
Was dann geschah und wie lange, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein Bewusstsein erlangte ich immer nur für kurze Zeit: ich lag auf der Ladefläche eines Wagens, Nacht, Brand, Schießerei. Die Schüsse hörte ich nicht – ich hatte mein Gehör und Sprachvermögen verloren.
Das war wahrscheinlich ein Krankenwagen. Wie viele Nächte ich darauf gefahren bin, weiß ich bis heute nicht. Endlich wurde ich wach. Ich öffnete meine Augen – ein klarer, sonniger Tag. Im Kopf und in den Ohren herrschte ein furchtbarer Schmerz und Lärm. Ich drehte meinen Kopf: neben mir auf irgendwelchen Lumpen lagen Verletzte und stöhnten. Um mich herum waren Schubkarren, Autos, viele Verwundete, blutige Verbände. Deutsche liefen mit Maschinengewehren herum.
Ich zog meinen Sack hinter dem Rücken vor – er war komplett durchlöchert. Auch im Feldmantel entdeckte ich Löcher von den Bombensplittern. Aber meinen Körper hat keiner davon berührt.
Anfang Juni fand ich mich in Uman wieder, in einem Lager für Kriegsgefangene – der bekannten Umaner Grube. Danach siedelte man uns um ins Lager im Dorf Iwanhorod, bei Chrystyniwka. Dort traf ich Iwan Zybulka, mit dem ich gemeinsam gekämpft habe.
Iwan und ich lernten zwei Gleichaltrige kennen – zwei Männer aus Sibirien, die bei Kertsch gefangen genommen wurden. Zu viert fingen wir an, unsere Flucht vorzubereiten.
Um das Lager im Dorf Iwanhorod bei Chrystynywka waren zwei Reihen Stacheldraht gespannt, und über der Erde war auch so ein Draht. An den Ecken waren Türme. Wenn einer der Gefangenen erschossen wurde, wurde dieser auf Befehl der Deutschen hinter dem Zaun beerdigt und ein Birkenkreuz wurde aufgestellt. Von solchen Kreuzen gab es um das Lager herum bereits etliche.
Um uns herum waren zwei Reihen Stacheldraht, über der Erde ebenfalls Draht. An den Ecken standen Türme. Manch einer versuchte, bei der Arbeit zu fliehen, doch die Schneisen im Feld fielen auf – die Wache schwang sich dann aufs Pferd und holte den Flüchtigen ein. Am Abend erschoss man den Unglücklichen beim Lager. Man beerdigte ihn hinter dem Stacheldraht und stellte unbedingt ein Kreuz aus Birkenholz auf (darauf bestanden die Deutschen). Von solchen Kreuzen gab es um das Lager herum bereits etliche.
Unsere Wohnhöhle befand sich in der äußersten Reihe. In der Nacht gruben wir eine Öffnung bis zum Draht. Die Schuhe und Feldmäntel zogen wir aus. Ich kletterte als Letzter durch über den Zaun.
Als ich die erste Reihe überwunden hatte, hörte ich Schritte. Zwischen den Drahtreihen waren drei Meter. Der Wächter kam näher und mein Herz klopfte, bereit, aus der Brust zu springen. Die Haare standen mir zu Berge und ich dachte: verabschiede dich, Pawlo, mit neunzehn Jahren vom Leben. Ich presste mich an den Boden, und die Schritte des Wächters kamen immer näher. Gleich ist er da, feuert eine Salve aus seinem Gewehr… Diese Minute schien ewig.
Und da war der Wächter neben mir… und ging weiter. Vielleicht bemerkte er mich nicht, oder vielleicht war er ein guter Mensch (uns bewachten Letten) und verschonte mich.
***
Als die Deutschen die Station Bachmatsch-Kyjiwska bombardierten, flogen Metallstücke, verbrannte Holzsplitter und Stofffetzen einige Kilometer. Es brannte fürchterlich: auf der Straße, die zur Station Bachmatsch-Homelskyj führt, standen gleich zehn Häuser in Flammen.
Der Krieg begann mit einem schrecklichen Bombardement. An der Station Bachmatsch-Kyjiwskyj versammelten sich Unmengen von Militärzügen (später sagte man, es sei die Folge einer Sabotage gewesen) und am 14. Juli hat man sie so beschossen, dass Metallstücke, verbrannte Holzsplitter und Stofffetzen sogar bis zu uns gelangten, dabei waren wir mehrere Kilometer entfernt. Es brannte fürchterlich – auf der Straße, die zur Station Bachmatsch-Homelskyj führt, standen gleich zehn Häuser in Flammen.
Die Deutschen hatten seltsame Bomben: zwei zusammengesetzte Tröge, und darin war ein Haufen kleiner Brandbomben. Diese Tröge haben die Leute später als Viehtränken benutzt. Und nach dem Krieg war es beliebt, Hunde aus deutschen Helmen zu füttern.
1941 haben die Deutschen statt einer Kolchose eine Gemeinde geschaffen. Sie zahlten nichts für die Arbeit und nahmen sich das Korn und das Vieh. Eine Schule gab es nicht.
1942 begannen sie, einen Wendekreis für Dampflokomotiven zu bauen, und schickten die Jugend dorthin. Angeleitet wurden sie von alten Deutschen, die nicht mehr für die Front taugten. Eines Tages trieben die Deutschen alle Mädels und Jungs, die zur Arbeit gekommen waren, in einem Laden zusammen, um sie nach Deutschland zu bringen. Aber unsere Jungs, die in der Eisenbahnwehr gedient hatten – in so einer schwarzen Uniform – öffneten diesen Laden. Und sie sagten: „Lauft!“
Die Deutschen suchten nicht nach uns – sie wussten nicht, wer uns freigelassen hatte, und hatten selbst Angst, von unseren Jungs bestraft zu werden.
***
Wohin sollten wir gehen? Mit Geographie kannte ich mich aus. Wir brachen nach Nordosten auf und orientierten uns am Polarstern. Wir beschlossen, uns aufzuteilen – Waskow und ich liefen geradeaus, Zybulko und Wasyl bogen links ab.
Die Deutschen erteilten Befehle, die Kriegsgefangenen, Partisanen und „Agenten der Bolschowiki“ betreffend: den Bewohnern war es untersagt, ihnen Essen und Obdach zu geben. Zuwiderhandlung wurde mit Erschießen bestraft. Denjenigen, der sie verriet, winkte ein Grundstück.
Überall hingen Erlasse der deutschen Regierung aus, die untersagte, Kriegsgefangenen Essen und Zuflucht zu gewähren, den „Agenten der Bolschewiki“. Zuwiderhandlung wurde mit Erschießen bestraft, für eine Auslieferung bekam man ein Grundstück zugeteilt. Es gab wenig hinterhältige Menschen, während der ganzen Reise hat uns niemand verraten.
Einige Male liefen wir der Hilfspolizei in die Hände. Ich gebot Waskow mit seiner russischen Aussprache zu schweigen und redete selbst. Ich zeigte den Hilfspolizisten ein Foto meiner Familie und schilderte unsere Geschichte. Sie ließen uns laufen und gaben uns manchmal sogar Ratschläge, wie man am besten durchkommt.
Ende August 1942 kamen Waskow und ich bis nach Kurin. Der Dorfälteste weigerte sich, ihn anzumelden und schickte uns zum Kommandanten für eine Erlaubnis. Doch Waskow war ein waghalsiger Junge: wenn sie mich einsperren, sagte er, laufe ich wieder weg. Den Krieg überlebte er – 1946 schickte er mir einen Brief aus dem Donbass.
Während der Besatzung betrieb man vor allem Selbstversorgungs- und Tauschwirtschaft. Läden und Poststellen waren geschlossen. Man erzählte sich, dass auf unserem Territorium zuerst die ungarische Armee gewesen war. Sie waren noch grausamer als die Deutschen. So kam es vor, dass eine Person, die aus dem Dorf auf den Markt ging, angehalten und erschossen wurde, ohne jegliche Erklärung.
Ende Februar 1943 führte man in der Region eine Strafexpedition durch. Tausende Menschen wurden erschossen und verbrannt. In Kurin waren es 34, unter ihnen der Rektor unserer Schule, Iwan Schyhyl, Lehrer Anatolij Iwanenko und Lehrerin Lukija Suchodolska, meine Freunde Pawlo Makarenko und Andrij Netschyporenko.
In den besetzten Städten hatten die Läden und Poststellen geschlossen. Die Leute überlebten dank der Selbstversorgungs- und Tauschwirtschaft. Man ging grausam mit ihnen um, wobei die Magyaren und Asiaten, die den Deutschen dienten, am schlimmsten waren - sie setzten Häuser samt ihrer Bewohner in Brand und ermordeten sie.
Der Polizist Wasyl Zyban sagte, dass er den Auftrag habe, auch mich mitzunehmen, aber er redete sich heraus und sagte, er habe mich nicht gefunden.
Die Deutschen gingen grausam vor. Nicht einmal die Deutschen, sondern die Magyaren und Asiaten, die bei den Deutschen dienten – sie waren es, die Häuser niederbrannten und Menschen töteten. Sie mordeten überall – in Bachmatsch und Kurin.
***
Letztendlich wurden doch Kinder nach Deutschland geschickt, diesmal gemäß Listen. Diese erstellte der Gemeindevorstand. Ich stand nicht drauf: mein Vater hatte das irgendwie geregelt. Er ging nicht an die Front, denn er war als Eisenbahner von der Wehrpflicht befreit (wie die meisten Leute aus Bachmatsch, die ihr ganzes Leben bei der Eisenbahn gearbeitet hatten – sowohl unter sowjetischer Herrschaft als auch unter den Deutschen, unter der Weißen Armee von Denikin und der Ukrainischen Volksarmee von Petljura).
Im Oktober 1942 wurde verkündet, dass ein neues landwirtschaftliches Technikum öffne, und wer dort studiert, der komme nicht nach Deutschland. Aus den umliegenden Dörfern ging alle Jugend mit mittlerer Reife in dieses Technikum. Auch Pawlo.
Er wurde auf mich aufmerksam und schicke seinen Kameraden vor, um mich kennenzulernen – der setzte sich zu mir und sagte:
„Nadja, ein Junge möchte mit dir befreundet sein.“
Ich sagte: „Wie heißt er?“
„Solodko.“
Und dein Opa saß ein paar Reihen weiter und beobachtete meinen Gesichtsausdruck.
Wir begannen, uns abends beim Wohnheim zu treffen. Er gefiel mir, weil man mit ihm interessante Gespräche führen konnte. Wir haben uns natürlich nicht sofort geküsst (lacht). Wir waren eben wie Klassenkameraden. Wir sprachen über unsere Bekannten, über Literatur…Alle, die die Mittelschule abgeschlossen hatten, lasen viel, denn es gab ja nichts anderes zu tun.
Beliebt waren unter den Jugendlichen damals russische Klassiker und moderne ukrainische Literatur. Man las die Werke von Iwan Le, Oleksa Desnjak, Oleksandr Kopylenko, Juri Janowski, Juri Smolytsch und Sinajida Tulub.
Die Deutschen zerbombten die örtliche Bibliothek, und meine Freundin und ich nahmen einen Sack voll Bücher mit – nicht einmal die besten. Als „beste“ Literatur bezeichnete die Jugend damals ukrainische Klassikerund moderne ukrainische Literatur.
Iwan Le, Oleksa Desnjak, Kopylenko, die Abenteuerromane von Janowskyj und Smolytsch, „Die Menschenfänger“ von Sinajida Tulub. „Krieg und Frieden“ hatte ich gefunden und Gogols „Tote Seelen“, sogar illustriert.
Als Pawlo erfahren hat, dass ich die zerbombte Bibliothek besucht hatte, freute er sich: „Lass uns Bücher tauschen!“
Ich brachte ihm Bücher aus Bachmatsch, und er mir aus Kurin.
Das Technikum gab es noch bis Dezember, dann eröffnete man dort ein Spital.
Im Mai 1943 rief man alle Studenten angeblich für ein Praktikum zusammen, aber tatsächlich für irgendwelche landwirtschaftlichen Arbeiten. Wir waren auch dort zusammen, und es lief richtig gut. Aber im Juni haben wir uns gestritten.
Pawlo kam mit einem Kumpel zu uns ins Wohnheim, und wir mussten einen Eimer Wasser bringen. Er hat uns nicht geholfen. Ich trug den Eimer selbst und kam danach nicht mehr zu unseren Verabredungen. Nicht, dass er es nicht gemerkt hätte, aber er kam gar nicht auf die Idee, zu helfen. Er war es gewohnt, dass in Kurin die Mädels selbst das Wasser schleppten.
Kurin hieß so, weil dorthin die Disziplinararrestanten des Bachmatscher Kosakischen Regiments geschickt wurden, und diese Halunken wohnten dort in Hütten, die man „Kurin“ nennt.
Die Leute aus Kurin nennt man auch heute noch „Brandstifter“, denn dort gab es für alltägliche Vergehen eine grausame Vergeltung: das Haus wurde angezündet. Natürlich gibt es auch dort, wie überall sonst, gute Leute und welche, die anders sind.
Bei uns in Bachmatsch war es nicht üblich, es war ja eine Stadt (lacht).
Also verabredeten er und ich uns nicht mehr. Pawlo versuchte es, doch ich zeigte ihm meinen weiblichen Trotz, und er zeigte mir wiederum den seinen. Ich gab ihm sein Foto zurück und bat ihn, mir meins wiederzugeben. Aber er tat es nicht.
Die Mädels, deren Jungs an die Front gingen, schenkten ihnen Fotos von sich. Auf die Rückseite schrieben sie - auf Russisch, denn das war gehobener Stil!: „Möge dir meine junge Liebe helfen und dich beschützen“.
Meine Oma Nadja in der 10. Klasse – dieses Foto wollte Opa ihr nicht zurückgeben, als er zum zweiten Mal an die Front ging. 1941
Auf der Rückseite meines Fotos hatte ich auf Russisch geschrieben: „Meine junge Liebe soll dir helfen, dich vor Kugeln bewahren.“ Später hat mir dein Opa geschrieben: „Die Worte, die du mir auf das Foto geschrieben hast, beschützen mich anscheinend wirklich.“
Naja, damals schrieben alle so etwas. Auch noch auf Russisch, denn Ukrainisch erschien uns nicht so gehoben, auch wenn alle überall – von der Familie bis zur Schule – unsere Sprache gesprochen haben. Übrigens wurde in der Division deines Opas eine Zeitung auf Ukrainisch herausgegeben. Sie hieß „Für das Vaterland!“ und sein Kommandeur Kolossow, ein Russe, hat ihn ständig gebeten, zu übersetzen, mit so einem russischen Akzent: „Was schreiben sie dort über das Vaterland?“
Oma hat Opa in die Armee 130 Briefe geschrieben ...
Das Foto habe ich ihm noch im Mai geschenkt, und im Juli gab es die ersten Gerüchte, dass die Front näherkomme. Und die Deutschen machten nicht mehr so viel Ärger, wurden ruhig.
Ich habe so etwas gechrieben, denn Pawlo sagte mir mehr als einmal: „Die Front kommt noch zurück, ich gehe noch in den Krieg…“ Aber ich dachte eigentlich nicht darüber nach – ich war achtzehn, und Pawlo zwanzig, und er war bereits Soldat.
Wir trennten uns und sahen uns bis 1946 nicht wieder. „Schreib mir wie einem Kumpel, und Amor hat hier nichts zu suchen“ – ich erinnere mich noch genau an seinen ersten Brief von der Front. Er tat mir so leid, hatte er doch so viel durchgemacht…
Wir schrieben einander viel, doch sehr formell: wir hatten uns ja gestritten, und es gab keine gegenseitigen Liebeserklärungen, alles war sehr ernst.
Aus irgendeinem Grund war ich überzeugt, dass Pawlo zurückkommen würde. Ich schrieb ihm davon, und er antwortete couragiert:
„Wenn deine Worte wahr werden, dann hast du dafür einen Kuss verdient, und sogar mehr.“
Ich glaube nicht an das Schicksal – doch manchmal würde ich es so gerne.
* * *
Als man uns nach dem Ende der deutschen Okkupation zum Wehrdienst musterte, sagte der Offizier: „Wer in der Artillerie gedient hat, geht zwei Schritte vor.“
Diejenigen, die in der Artillerie dienten, hatten höhere Überlebenschancen. Schließlich ist die Artillerie keine Infanterie.
Ich trat vor. Von denen, die zurückblieben, starben viele zwei Monate später – während der Schlacht am Dnepr. Gerüchte verbreiteten sich, dass man ihnen nicht einmal eine Uniform gegeben hatte.
Im November 1943 schickte der Kommandeur des Bataillons den Spähtruppführer und mich an die Frontlinie, um den Feind zu beobachten. Ljutischer Aufmarschgebiet, bei Jasnohorodka. Wir sprangen in den Graben, holten Luft. Der Graben gefiel mir nicht. Ich schlug dem Feldwebel vor, einen neuen zu graben.
Der Boden war sandig, wir waren im Nu fertig – und genau in dem Moment fiel eine Mine in den alten Graben.
Ein kleiner Splitter bohrte sich in meinen Kopf, doch verschonte den Schädel.
... und Opa schrieb 120. Oma bewahrt sie heute noch auf.
Oder der Fall am 7. Dezember 1943 bei der Siedlung Rosa Luxemburgs bei Korosten. Unsere Batterie unterstützte das Bataillon, und die deutsche Infanterie wies zwanzig Panzer auf. Die Kanonen schossen zielgerichtet. Der Bataillonskommandeur, Oberleutnant Rosumowskyj, gab Befehle, ich gab sie weiter an die Batterie.
Wir bemerkten den Panzer, ich lief zur ersten Kanone und zeigte dem Zielführer, woher er kam. Ich lief zurück – gleichzeitig schlug auf dem Gebäude, auf dem der Bataillonskommandeur stand, ein Geschoss ein. Rosumowskyj und der Verbindungsmann Schewtschenko kamen ums Leben.
Ein Ausschnitt aus Omas Brief: „Ich bin aus irgendeinem Grund überzeugt, dass du am Leben bleibst ... Die Zeit mit dir zusammen war die beste meines Lebens.“
Am 28. Dezember 1943 schickte der neue Bataillonskommandeur uns an die Frontlinie, um eine deutsche Kanone und Geschosse als Trophäen zu holen.Zu fünft setzten wir uns auf einen Pferdewagen, mit dem normalerweise Kanonen transportiert werden. Wir waren fast am Ziel, als eine Mörser-Batterie auf ihrem Pferdewagen auftauchte. Dmytro Tkatschenko, der unseren Wagen führte, bat einen Teil von uns, sich auf den Wagen der Mörser zu setzen, denn die Deichsel hob sich bereits unter uns. Alle hatten es sich gemütlich gemacht, niemand wollte absteigen.
Aus irgendeinem Grund beschloss ich, aufzuspringen und lief zu den Mörsern, hinter mir Oleksij Schyla. Und da ertönte eine Explosion – unser Wagen war auf eine Panzerabwehrmine gekommen, und drei Soldaten darauf wurden getötet, die anderen schwer verwundet…
* * *
Ich glaube, dein Opa blieb auch deshalb am Leben, da er die Bildung liebte. Als sie nach der Besatzung erneut gemustert wurden, sagte der Offizier: „Wer in der Artillerie gedient hat, geht zwei Schritte vor“.
Pawlo trat vor, und das rettete ihn. Denn die Artillerie ist ja schließlich keine Infanterie.
Er schrieb mir in seinem Brief: „Ich erinnere mich manchmal an das, was wir in der 10. Klasse in Algebra gelernt hatten. Aber ich weiß nichts mehr: mir schweben irgendwelche Zahlenfolgen vor, Ungleichungen, Wurzeln mit negativen Potenzen usw. Aber mir scheint, als müsste ich da nur ein paar Mal draufschauen und schon könnte ich mich erinnern.“
Er schrieb so etwas und nutze im Krieg selbst eine Tabelle von Logarithmen und irgendwelche technischen Geräte.
Opa beschreibt die Kriegserfolge in Polen und spielt auf die Schönheit der heimischen Mädchen an: „Damals haben wir diese Nazi-Hunde in Galizien plattgemacht, und jetzt tun wir es in Polen hinter der Weichsel ... Es gibt viel Interessantes, aber keine Zeit, es kennenzulernen. Und die meisten polnischen Mädels sind hübsch.“