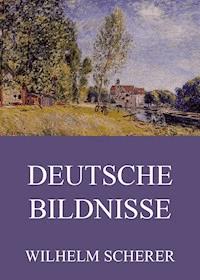
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Scherer war ein österreichischer Germanist. Auf ihn geht die bis heute gängige Einteilung der deutschen Sprachgeschichte in 300-Jahre-Abschnitte zurück, namentlich Althochdeutsch (750-1050), Mittelhochdeutsch (1050-1350), Frühneuhochdeutsch (1350-1650) und Neuhochdeutsch (1650 bis dato). Dieser Band enthält seine besten Dichter- und Gelehrtenporträts. Inhalt: Einleitung Wolfram von Eschenbach Walther von der Vogelweide Lessing Friedrich Hölderlin Emanuel Geibel Zu Bauernfelds siebzigstem Geburtstag (1872) Friedrich Schleiermacher Rede auf Jacob Grimm Karl Lachmann Moriz Haupt Karl Müllenhoff Josef Diemer Caroline Michaelis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deutsche Bildnisse
Wilhelm Scherer
Inhalt:
Wilhelm Scherer – Biografie und Bibliografie
Deutsche Bildnisse
Einleitung
Wolfram von Eschenbach
Walther von der Vogelweide
Lessing
Friedrich Hölderlin
Emanuel Geibel
Zu Bauernfelds siebzigstem Geburtstag (1872)
Friedrich Schleiermacher
Rede auf Jacob Grimm
Karl Lachmann
Moriz Haupt
Karl Müllenhoff
Josef Diemer
Caroline Michaelis
Deutsche Bildnisse, Wilhelm Scherer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634858
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Scherer – Biografie und Bibliografie
Namhafter Germanist, geb. 26. April 1841 zu Schönborn in Niederösterreich, gest. 6. Aug. 1886 in Berlin, begann 1858 auf der Universität zu Wien seine sprachwissenschaftlichen Studien, die er seit 1860 in Berlin fortsetzte, habilitierte sich 1864 an der Wiener Hochschule und wurde hier 1868 nach Fr. Pfeiffers Tode zum ordentlichen Professor für deutsche Sprache und Literatur ernannt. 1872 in gleicher Eigenschaft nach Straßburg berufen, entfaltete er hier eine äußerst fruchtbare Lehrtätigkeit, bis er im Herbst 1877 einem Ruf als Professor der neuern deutschen Literaturgeschichte an der Universität Berlin folgte, wo er 1884 auch zum Mitglied der Akademie ernannt wurde. Von Scherers literarischen Publikationen, die im wesentlichen deutsche Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte (letztere von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart) behandeln, sind hervorzuheben: »Denkmäler deutscher Poesie und Prosa« (mit Müllenhoff, Berl. 1864; 3. Aufl. 1892); seine Untersuchungen über die Literatur des 11. und 12. Jahrh.: »Deutsche Studien« (Wien 1870–78, 3 Tle.; 2. Aufl., Prag 1891), »Geistliche Poeten der deutschen Kaiserzeit« (Straßb. 1874–75,2 Hefte), »Geschichte der deutschen Dichtung im 11. und 12. Jahrhundert« (das. 1875); ferner die Monographie »Jakob Grimm« (Berl. 1865, 2. erweiterte Aufl. 1885); »Zur Geschichte der deutschen Sprache« (das. 1868, 3. Ausg. 1890); »Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich« (das. 1874); »Die Anfänge des deutschen Prosaromans« (Straßb. 1877); »Aus Goethes Frühzeit, Bruchstücke eines Kommentars zum jungen Goethe« (das. 1879) und seine »Geschichte der deutschen Literatur« (Berl. 1883, 10. Aufl. 1905), die sich als ein hochbedeutender Versuch zeigt, unter Berücksichtigung aller gewonnenen wissenschaftlichen Resultate, gleichsam aus der Mitte der Forschung heraus, eine allen Kreisen zugängliche, durch anmutig lebendige Darstellung ausgezeichnete Geschichte der Entwickelung der deutschen Nationalliteratur zu geben. Für O. Lorenz' »Geschichte des Elsasses« (3. Aufl., Berl. 1884) behandelte er die Literatur des Elsaß, mitten Brink begründete er 1874 in Straßburg die »Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker«. Aus seinem Nachlass erschienen die »Aufsätze über Goethe« (Berl. 1886, 2. Aufl. 1900), die »Poetik« (das. 1888), die »Kleinen Schriften« (hrsg. von Burdach und Erich Schmidt, das. 1893, 2 Bde.) und »Karl Müllenhoff, ein Lebensbild« (das. 1896). Als akademischer Lehrer entwickelte S. eine überaus anregende Tätigkeit und begründete eine lange Zeit vorherrschende literarhistorische Schule von ausgeprägter Eigenart.
Deutsche Bildnisse
Dichter- und Gelehrtenporträts
Einleitung
Wilhelm Scherer (geb. 1841 zu Schönborn in Niederösterreich, gest. 1886 in Berlin) vereinigt in seiner menschlichen und wissenschaftlichen Persönlichkeit die besten Seiten des norddeutschen und österreichischen Wesens. Schon früh für germanistische Studien begeistert, fand er als Student der Wiener Universität bei dem Hauptvertreter seines Lieblingsfaches, Franz Pfeiffer, einem trocknen, eigensinnig verbohrten Buchgelehrten, nicht die erwünschte Anregung und setzte seine Studien in Berlin fort, wo er durch Jacob Grimm und Karl Müllenhoff in die fruchtbare Methode wissenschaftlichen Forschens eingeweiht und von letzterem schon als titelloser Student zu verantwortungsvoller Mitarbeit berufen wurde. Der tiefgründige Ernst, mit dem er alle Probleme an der Wurzel faßte und sich durch umfassende Quellenstudien schon in jungen Jahren eine staunenswerte Gelehrsamkeit erwarb, verbunden mit temperamentvoller geistiger Beweglichkeit und künstlerisch-schriftstellerischer Begabung, sicherten ihm eine außergewöhnlich rasch aufsteigende wissenschaftliche Laufbahn.
Nach Wien zurückgekehrt, habilitierte er sich als Privatdozent an der dortigen Universität. Schon sehr bald (1868) wurde er, nach Pfeiffers Tode, erst 27jährig, zum ordentlichen Professor der germanischen Philologie ernannt. Ein begeisterter Zuhörerkreis scharte sich um den jungen geistsprühenden Universitätslehrer, und die gediegenen wissenschaftlichen Werke, die er gleichzeitig veröffentlichte, zeugten von seinem rastlosen Weiterstreben. Allem österreichischen Partikularismus abhold, sah Scherer in der kräftigen Entwicklung Deutschlands unter Preußens Führung die sicherste Gewähr für die gedeihliche Zukunft des Deutschtums. Dieser Überzeugung gab er vom Katheder herab und im geselligen akademischen Verkehr freimütigen Ausdruck, unbekümmert um die preußenfeindliche Stimmung, die seit den Ereignissen von 1866 in den österreichischen Regierungskreisen herrschte. Dadurch erwarb er sich die Mißgunst seiner Vorgesetzten, und als er in der 1871 geschriebenen Vorrede zu seiner Neuausgabe von J. Grimms "Deutscher Grammatik" die Gründung des neuen deutschen Kaiserreichs begeistert pries, sollte sogar ein Disziplinarverfahren gegen ihn anhängig gemacht werden.
Diesen peinlichen Verhältnissen entriß ihn ein Ruf an die Universität Straßburg, wo er fünf Jahre lang (1872 – 77) zu den Zierden der neugegründeten Hochschule gehörte. Dort auf dem Boden, der durch die Erinnerung an den jungen Goethe geweiht ist, wandte er sich besonders dem Studium der deutschen Klassiker zu, und die Herrschergestalt Goethes rückte immer mehr in den Mittelpunkt seiner Universitätsvorträge und der Forschungen des von ihm geleiteten Seminars. Die ganze Vielseitigkeit seines Wirkens entfaltete er aber erst als Professor in Berlin (1877 – 86), wo der Nimmermüde, Schaffensfreudige den breitesten Boden für seine Tätigkeit als Forscher, Schriftsteller und Jugendlehrer fand. 1884 wurde er zum Mitglieds der "Akademie der Wissenschaften" gewählt und in feierlicher Sitzung, am Leibniztage (30. Juni), als "der Gelehrte und Schriftsteller reicher Frucht und reicherer Hoffnung" begrüßt. Diese Hoffnung sollte nicht in Erfüllung gehen. Schon nach zwei Jahren starb er, erst 45jährig, zusammengebrochen unter der gewaltigen Arbeitslast, die er sich mit seinem leidenschaftlichen Schaffenseifer aufgebürdet hatte.
Scherer ist der letzte Germanist gewesen, der mit dem Gedanken der Zusammenfassung aller Disziplinen der Deutschkunde Ernst gemacht hat und diesem Ziel durch sein universales Wissen wenigstens nahe gekommen ist. Die in kleinlicher Einzelforschung immer weiter auseinanderstrebenden Wissenschaften der deutschen Sprachforschung, Philologie und Literaturgeschichte wollte er in einer Gesamtwissenschaft des deutschen Geisteslebens zusammenfassen. Schon in einer Jugendarbeit, der Biographie Jacob Grimms, weist er auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und des Zusammenschlusses von Philologie und Geschichte hin: "Wenn es aber in jener älteren Periode erlaubt und, wollen wir hinter Jacob Grimm nicht zurückbleiben, notwendig ist, die verschiedenen Richtungen der Geistestätigkeit in eins zu zwingen: muß nicht die Zeit der ausgebildeten Kultur in ihrer allmählichen Vollendung derselben Behandlung unterliegen? Muß nicht auch hier das gesamte Geistesleben in Betracht gezogen weiden und die Aufgabe der Philologie sich gestalten als die Erforschung des Ganges, in welchem die menschlichen Gedanken sich aufsteigend entwickeln? Nichts anderes aber ist die Aufgabe der Geschichte. Und in der Tat, der menschliche Geist ist nur einer, wie könnte es zwei menschliche Wissenschaften vom Geiste geben? So erkennen wir in Jacob Grimm ein Vorbild, in welchem sich erfüllt hat, was wir anstreben müssen: die möglichste Aufhebung der Arbeitsteilung zwischen Philologie und Geschichte." Von diesem Geiste durchweht ist auch seine Mitarbeit an den von ihm und Müllenhoff herausgegebenen "Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrhundert". Scherer war darin die Aufgabe zugefallen, die kleineren deutschen Prosadenkmäler von den ältesten Zeiten bis zum 11. Jahrhundert herauszugeben und zu erläutern – eine mühevolle und scheinbar undankbare Sammlerarbeit, handelte es sich doch meist um Aufzeichnungen rein praktischen Charakters: Beichtspiegel, Glaubensformeln, Gebete, Markbeschreibungen, Gesetze, Kapitularien, Eides- und Verlöbnisformeln, selbst Rezepte. Aber unter des geistvollen Sammlers Hand kommt Leben in diese toten Bruchstücke ferner Vergangenheit, seine umfassende Kenntnis der altdeutschen Gesamtwelt, verbunden mit einer genialen Kombinationsgabe, deutet und wertet sie alle als Ausstrahlungen des Geisteslebens unserer Vorfahren. Wie der jugendliche Germanist dabei nicht nur die Spezialgebiete des Historikers, sondern auch des Juristen und Theologen beherrschte, erregte Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt. Dabei wurde wohl bemerkt und bald lobend, bald tadelnd hervorgehoben, daß auch der wissenschaftlich geschulten Phantasie ein nicht geringer Anteil am Gelingen des Werkes gebühre. Scherer ließ diese ihm von der Natur verliehene Gabe ganz bewußt auch in seiner Forscherarbeit walten, getreu den Forderungen seines Lehrers Müllenhoff, von dem er in seiner Gedächtnisrede sagt: "Phantasie verlangte Müllenhoff ausdrücklich von dem Forscher, der die Zustände verschwundener Völker in einem einheitlichen Gemälde darstellen will. Phantasie, d. h. nicht Phantasterei, sondern die Kraft der inneren Vergegenwärtigung, durch welche wir die überlieferte Tatsache nicht als etwas Totes anschauen, sondern sie ins Leben zurückversetzen und sie nach unserer allgemeinen Kenntnis menschlicher Dinge zu dem seelischen Grund alles Lebens und zu der Gesamtheit der sonst überlieferten und lebendig aufgefaßten Tatsachen in Beziehung setzen."
Denselben Grundsätzen folgte Scherer auch in der sprachwissenschaftlichen Forschung, besonders in seiner vielumstrittenen " Geschichte der deutschen Sprache", einem Erzeugnis seiner Wiener Lehrtätigkeit (erschienen 1867). In der Grimm-Biographie hatte er die Forderung aufgestellt: "Die Grammatik soll eine Geschichte des geistigen Lebens sein, insoweit dieses in die Sprache sich hineinschlägt. Sie muß die letzten geistigen Gründe für alle sprachlichen Erscheinungen aufsuchen." Jetzt will er selbst den feinsten geistigen Extrakt aus der Arbeit seiner Vorgänger ziehen. Mit jugendlichem Ungestüm ruft er aus: "Wir sind es endlich müde, in der bloßen gedankenlosen Anhäufung wohlgesichteten Materials den höchsten Triumph der Forschung zu erblicken ... Die Entstehung unserer Nation, von einer besonderen Seite angesehen, macht den Hauptvorwurf des gegenwärtigen Buches aus." Diesem Programm entsprechend macht er besonders im ersten Drittel des Buches, "Zur Lautlehre" betitelt, den großartigen Versuch, die charakteristischsten Erscheinungen in der lautlichen Entwicklung der deutschen Sprache (z. B. die Zurückziehung des Hochtons auf die Wurzelsilbe, die gesetzmäßige Verkürzung des Wortauslauts, die sog. Lautverschiebung u. a. m.) aus dem deutschen Nationalcharakter und der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Volkes zu erklären. Viele, ja die meisten dieser geistvollen Deutungen hat er in reifen Jahren als allzu kühne Hypothesen selbst verworfen. Dennoch ist die Bedeutung des Werkes sehr groß, denn es wies über die unfruchtbare Kärrnerarbeit des Sammelns und Sichtens hinaus auf die höchsten königlichen Ziele echter Wissenschaft und hat besonders unter Scherers Schüler reiche Keime der Anregung gestreut.
Scherers Hauptarbeitsgebiet wurde aber mit den Jahren immer mehr die deutsche Literaturgeschichte. Eingehende Einzeluntersuchungen gingen der späteren Gesamtdarstellung voraus. Hatte er für Müllenhoffs "Denkmäler" die ältesten Erzeugnisse des deutschen Schrifttums analysiert, so durchforschte er mit gleicher Gründlichkeit, unmittelbar aus den Quellen, auch die folgenden Epochen deutschen Geisteslebens. Zeugnisse dafür sind seine "Geschichte der deutschen Dichtung im 11. und 12. Jahrhundert", seine Abhandlungen über die Anfänge des Minnesanges, die geistlichen Poeten der deutschen Kaiserzeit, das geistige Leben Österreichs im Mittelalter u. v. a., nicht zum wenigsten aber seine zahlreichen Rezensionen, in denen er die innigste Vertrautheit mit den behandelten Gegenständen beweist und oft zu ganz neuen, überraschenden Ergebnissen gelangt. Aber Scherer lag alle romantische Schwärmerei für das Mittelalter fern, das Studium dieser vergangenen Epochen war ihm nur eine Vorstufe für die Erkenntnis der Gegenwart. So sehen wir denn seit der Straßburger Zeit das 18. und 19. Jahrhundert, vor allem Goethe als den Kulminationspunkt deutschen Geisteslebens und deutscher Dichtung, immer mehr in den Mittelpunkt seiner Forscherarbeit rücken. Auch auf diesem Gebiet wendet er die historischphilologische Methode an, die sich bei seinen mittelalterlichen Forschungen als so fruchtbar erwiesen hatte. Unter Benutzung der gesamten zeitgenössischen Literatur und des gewaltigen (teilweise noch ungedruckten) Materials von Briefen, Tagebüchern und sonstigen Aufzeichnungen gewinnt er Klarheit über das, was die einzelnen Dichter an Typen und Motiven ihrer Umwelt verdanken, was sie aus Eigenem hinzugetan und wie alle diese mannigfaltigen Strömungen sich kreuzen und gegenseitig befruchten. Er tritt in die Werkstatt des Dichters und belauscht ihn bei seiner Arbeit; aus den Textänderungen der verschiedenen Auflagen zieht er Schlüsse auf seine innere Entwicklung, aus dem Stilwechsel oder manchen Rissen und Sprüngen im Aufbau der Dichtungen gewinnt er Einblick in ihre Entstehungsgeschichte und eine sichere Unterlage zu ihrer Erklärung. Unendlich viel Kleinarbeit wird so von ihm und seinen Schülern in den Seminarien von Straßburg und Berlin geleistet, nie aber wird diese Kleinarbeit zum Selbstzweck, das hohe Endziel wird unverrückt im Auge behalten.
Die Quintessenz aller dieser mühseligen Einzelforschungen ist Scherers " Geschichte der deutschen Literatur", zuerst 1880 – 83 in Lieferungen erschienen, dann in zahlreichen Neuauflagen verbreitet, auch jetzt, nach fast vier Jahrzehnten, immer noch die anerkannt beste Gesamtdarstellung der deutschen Dichtung. Die Grundlinien der Entwicklung klar herauszuarbeiten, die führenden Geister zu charakterisieren und ihre reifsten Werke nicht durch bequeme Nacherzählung des Inhalts, sondern durch Erfassung ihres Gedankengehalts zu analysieren, betrachtet Scherer als seine Hauptaufgabe. Er setzt gebildete Leser voraus, die über die Haupttatsachen bereits unterrichtet sind; daher kann das Werk auch nicht in landläufigem Sinne populär genannt werden. Aber auch alles gelehrte Rüstzeug ist entschlossen über Bord geworfen oder in die kurzen Schlußanmerkungen verwiesen worden, wobei eine bei Gelehrten nicht eben häufige Selbstentäußerung geübt wird. Man wird an Moriz Haupts bekanntes Wort erinnert: "Das Nötigste für den Philologen ist der Papierkorb", wenn man erfährt, daß Scherer ganze Berge von Exzerpten bei dem Studium einzelner Epochen aufgehäuft hatte, um später doch nur wenige Seiten oder gar Zeilen seiner Literaturgeschichte daran zu wenden. Er wollte eben überall mit eigenen Augen sehen und unmittelbar aus den Quellen schöpfen; aber was er als unbedeutend oder belanglos für die Gesamtentwicklung erkannt hatte, wurde erbarmungslos ausgeschaltet, wobei er nicht selten von dem Urteil seiner Vorgänger abwich, wie er anderseits Erscheinungen oder Persönlichkeiten, die früher unbeachtet geblieben, stärker in den Vordergrund rückte. Großen Wert legte er auf die künstlerische Gruppierung des Stoffes und besonders auf die Sprache. In einer Akademierede (1884) sagte er u. a. über die Aufgaben der deutschen Philologie: "Es geziemt ihren Vertretern, daß sie die Sprache, die sie forschend ergründen sollen, auch kunstmäßig zu handhaben und sich einen Platz unter den deutschen Schriftstellern zu verdienen wissen." Dieser "kunstmäßigen Handhabung" der Sprache hat Scherer selbst stets liebevolle Pflege gewidmet. Sein Stil hat mit den Jahren manche Wandlungen erfahren. In der letzten Periode seines Schaffens, so besonders in der "Literaturgeschichte", strebt er nach möglichster Knappheit des Ausdrucks; durch ein treffendes Beiwort, einen glücklichen Vergleich ersetzt er oft langatmige Auseinandersetzungen. Freilich geht er in der Häufung kurzer "mörtelloser" Sätze manchmal wohl etwas zu weit.
Scherers "Geschichte der deutschen Literatur" reicht nur bis zu Goethes Tode. An der Ausarbeitung eines geplanten zweiten Bandes, der die Dichtung der Gegenwart behandeln sollte, ist er durch den Tod verhindert worden. Unvollendet blieben auch seine Studien für den Aufbau eines neuen Systems der Poetik. In einem vielbesuchten Universitätskolleg der letzten Zeit seines akademischen Wirkens legte er die Hauptmomente seiner Anschauungen nieder; diese Vorträge sind auch nach seinem Tode veröffentlicht worden, doch fehlt ihnen natürlich, inhaltlich und sprachlich, die letzte Feile. Statt der deduktiven Konstruktionen über Wesen und Formen der Dichtung, wie sie bisher allgemein üblich gewesen, will Scherer auf empirischer Grundlage eine neue Ästhetik, gleichsam eine "Naturgeschichte der Dichtung", aufbauen. Er untersucht den Ursprung der Poesie in den primitiven Zuständen der Naturvölker, wo sie noch eng mit anderen Äußerungen der Lebensfreude (Singen, Tanzen, Springen usw.) verbunden waren, und den Reflex dieser Entstehungsweise bis in die späteren Zeiten verfeinerter Lebensformen; er verfolgt die Entstehung des dichterischen Prozesses und die Vererbung und Wandlung dichterischer Motive, schildert das Verhältnis von Dichter und Publikum u. v. a. – überall neue Gesichtspunkte weisend und Altbekanntes oft in ganz neuer Beleuchtung zeigend. Seine Auffassung hat neben begeisterter Zustimmung auch viel abweisende Kritik erfahren, man muß aber berücksichtigen, daß er selbst nicht mehr die letzte Hand an sein Werk legen konnte und in der Schlußredaktion vielleicht manche Gedankenreihe gestrichen oder anders begründet hätte.
Zum Schluß sei noch zwei Freunden Scherers das Wort gegeben zur Schilderung seiner menschlichen und wissenschaftlichen Persönlichkeit.
Erich Schmidt, sein Meisterschüler und Nachfolger in der Berliner Professur, schreibt im 9. Bande des Goethe-Jahrbuchs: "Für seine Schüler war das unmittelbare Hervortreten der Persönlichkeit, die man immer zugänglich und mitteilsam fand, ein unvergeßlicher Segen. Es lag etwas Anglühendes und Fortreißendes in Scherer. Sein Vortrag und sein Gespräch verzichteten auf alle rhetorischen Mittel, aber der rasche, manchmal allzu hastige Fluß hielt den Zuhörer stark in Atem und machte ihn zum Teilnehmer einer ununterbrochenen Produktion. Sein behender Geist verschloß sich nirgends, brachte überall das Lieblingswort ›Gesichtspunkt‹ zur praktischen Geltung und drang, auch wo der Wechsel jeweiliger Beschäftigung an nervöse Unruhe streifte, in den Kern der Probleme. Diese künstlerische und gesellige, jeder Pedanterie abholde Natur haßte die ängstliche Küstenschiffahrt und pries ein Wachsen und Freiwerden des auf hoher See segelnden Menschen mit weiter Umschau und tiefem Einblick in allgemeinere Erfahrungen, denen sich die einzelne Erscheinung als besonderer Fall einordnen läßt, aber sie vertrat auch die vielberufene ›Andacht zum Unbedeutenden‹, kannte keine Nachsicht gegen Trägheit und Schlendrian, hochmütiges Geistreicheln und tiefsinniges Orakeln, das der treuen Arbeit enthoben zu sein wähnt, und schied höhere journalistische Fähigkeiten von dem landläufigen dreisten Zusammenraffen arrangierter Tatsachen und Einfälle. Auch den redlichen Arbeiter kleinen Schlages wußte er aufrichtig zu schätzen, während er den Rhetor, der Trivialitäten aufdonnert und unter dem Beifall der Menge auskramt, gründlich verachtete ... Scherer war sehr selbstbewußt, aber gar nicht eitel, denn die Eitelkeit ist kleinlich, und sein Tun und Fühlen hatte kein kleinliches Fäserchen. Auch weiß, wer ihm einmal näher trat, daß der Mann, der hier und da kühl und hochfahrend erscheinen mochte, viel lieber lobte als tadelte, liebte als haßte und Familienpietät wie Freundschaft warmherzig, zart und weich gehegt hat."
Der Wiener Professor R. Heinzel, sein österreichischer Landsmann und Studiengenosse, urteilt über Scherers Einfluß auf seine Schüler: "Er war ein pädagogisches Genie, von einer erweckenden Kraft, wie sie begeisterten Predigern oder Missionaren oft eigen ist. Mit dem sichersten Blick entdeckte er jedes Talent und wußte es auf das geeignete Arbeitsfeld zu führen. Er fand, was in den Leuten steckte, mochten sie auch noch so unreif und unwissend sein, auch selbst noch nicht ahnen, daß in ihnen der Keim zu etwas lag, was über das Durchschnittsmaß der akademischen Leistungen hinausging. Er hatte die Gabe, das Beste aus dem Menschen herauszuziehen, das ihm selbst unbewußt in der Seele schlummerte. Und alle Güte und Liebe, welche seiner Natur eigen war, seine menschlichen Eigenschaften traten im Verkehr mit seinen Schülern ans Licht."
U. E.
Wolfram von Eschenbach
Wolfram war unbedingt der größte Dichter des deutschen Mittelalters und galt auch dafür. "Laienmund nie besser sprach", sagte ein Poet, der Wolframs Gestirn bewundernd aufgehen sah, und die folgenden Jahrhunderte sagten es nach. Wolfram mußte nach der Ansicht seiner Landsleute nur hinter der Heiligen Schrift und den großen geistlichen Lehrern zurückstehen: alle weltlichen Schriftsteller übertraf er. Er scheint sich auch von allen zu unterscheiden. Jedes Wort, das aus seinem Munde kommt, hat einen persönlichen Stempel. Und doch lassen sich für die einzelnen Züge dieser Eigenart ältere verwandte sehr wohl aufzeigen.
Wolfram stammte aus Bayern, und getreu der literarischen Tradition dieses Landes vereinigte er ritterliche und volkstümliche, weltliche und geistliche Elemente. Während Hartmann sich von dem Tone des Nationalepos soviel als möglich zu entfernen suchte, immer vorsichtiger in der Wahl der Worte, immer gelassener in seiner Rede wurde, blieb Wolfram der älteren und populären Manier näher. Er mag ungefähr so alt wie Hartmann gewesen ein, wenn er auch etwa zehn Jahre später als Hartmann sich im Epos versuchte. Er mochte seinen Geschmack schon an Eilhard, Veldeke und ausgezeichneten Franzosen, wie Chrestien von Troyes, gebildet haben, als er Hartmanns "Ereck" kennenlernte. Er ist humoristisch, spielt auf Tatsachen der Heldensage an, setzt sich mit seinem Publikum in lebhaften Kontakt und verschmäht nicht die pathetische Weise der alten Lieder, welche die Herrlichkeit der Heroen unermüdlich hervorheben. Er ist seiner Sprache in einem Grade mächtig, den keiner seiner Zeitgenossen auch nur entfernt erreicht hat. Aber er macht davon auch rücksichtslos Gebrauch. Der Sprachgewaltige mag sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Er ist ein wildes Wasser, das sich nicht ein enges Bett anweisen und sanftes Strömen vorschreiben läßt. Er verleugnet jede Schulbildung. Er gibt an, weder lesen noch schreiben zu können, und will nicht zu den zünftigen Poeten gerechnet werden. "Zum Schildesamt bin ich geboren", sagt er stolz. So spottet er der Schranken. Seine Reime sind zuweilen unrein. Sein Stil verrät keine kunstmäßige Rhetorik. Seine Syntax ist die natürliche der freien Rede. Sein Vers wird ihm zu kurz, die Überfülle der Gedanken drängt ihn; er hat nicht gelernt, sie auseinander zu nehmen und glatt vor den Leser hinzulegen. Was ist das Streben nach Bildung und Feinheit oft für ein Popanz! Wie unterdrückt es warm ursprüngliche Natur! Wolfram hat den Mut, überall seinem eigenen Gefühle zu folgen. Er ist nicht schüchtern, bezeichnende Worte geradeheraus zu sagen, wo es nötig. Er ist nicht ängstlich besorgt, alles zu vermeiden, was ein zartes Ohr beleidigen könnte. Wie er die Damen auch mit ihren Schwächen neckt, wo andere nur verehren, so mutet er ihnen die Wahrheit des Lebens zu, wo andere zart verhüllen. Die Bayern waren nach dem Urteile der Alemannen im Ritterwesen zurück; das hatte für sie den Vorteil, daß sie die Allmacht der Etikette noch weniger empfanden. Bei den Alemannen Hartmann und Gottfried sehen wir die Welt nur aus den Fenstern eines eleganten Salons; bei dem Bayer Wolfram sind wir in der frischen Luft, im Wald und auf den Bergen. Dort dürfen wir nur aus der Ferne bewundern; hier können wir herantreten und den Marmor befühlen.
Während Hartmann dem Chrestien von Troyes gegenüber alle humoristischen Wendungen und Vergleiche, welche zuweilen aus dem Tone fallen, aber stets anregend wirken, ängstlich wegließ, scheint Wolfram gerade von Dichtern wie Chrestien die humoristische Kühnheit gelernt und, einem tiefgewurzelten Bedürfnisse seiner eigenen Natur gemäß, voll ausgenutzt zu haben. Gutmütiger Scherz steht ihm überall zur Seite und gestattet seinem Triebe, die Dinge anschaulich zu machen, oft die seltsamsten Sprünge. Er kennt, wie Chrestien, keine Würde des Gegenstandes. Er ist imstande, den schlanken Wuchs einer schönen Dame mit einem ausgestreckten Hasen am Bratspieß und mit einer Ameise zu vergleichen oder zu anderem Zwecke gar ein junges Gänselein herbeizuziehen. Den Zopf einer häßlichen, übrigens gelehrten Frau nennt er weich wie eines Schweines Rückenhaar. Von einem Ritter, der vor Freude weint, sagt er: seine Augen taugten nicht zu einer Zisterne, denn sie hielten das Wasser nicht. Die Grenze der Geschmacklosigkeit, die er hier streift, hat er zuweilen auch wirklich überschritten. Er will, wie Chrestien, um jeden Preis darstellen. Und er tut es mit einer unvergleichlichen Frische. Wolfram scheut sich nicht, gleich Gottfried, mit seinen Vorgängern zu wetteifern in der Beschreibung von Turnieren, Kämpfen und Festen. Besitzt er doch die dichterische Kraft, dem hundertmal Gehörten einen neuen Reiz zu geben. Er ist leidenschaftlich, lebt in den Ereignissen, die er schildert, und möchte sie uns immer gewaltig unter die Augen rücken. Alles bei ihm atmet, handelt, bewegt sich; und zwar wörtlich: denn die Kräfte des Gemütes und die Erde, das Unsichtbare und das Leblose wird bei ihm Person, steigt zu Pferde, ergreift die Lanze, siegt und unterliegt. Aus dem Ritterleben nimmt er mit Vorliebe Vergleich und bildlichen Ausdruck. Aber er nimmt ihn nicht bloß daher: ihm steht alles zu Gebote, was je in seinen Gesichtskreis trat. Sein Reichtum ist unübersehbar, und er kommt dem Bilde wie der Sache zugute. Wolfram gibt mehr Detail als Hartmann und Gottfried, und auch insofern mehr Wahrheit, mehr das greifbare Leben. Wieder steht er hierin zu Chrestien und unterscheidet sich von dessen Übersetzer. Chrestien hatte z. B. Erecks Heilung mit medizinischen Einzelheiten beschrieben. Hartmann ließ diese Einzelheiten weg. Wolfram aber schildert ganz ausführlich die vergeblichen Versuche, um die Wunde des Königs Amfortas zu heilen; und er muß dafür einen mißbilligenden Seitenblick von Gottfried hinnehmen, der, wie er sagt, um Tristans Heilung zu schildern, seine Worte nicht aus der Apothekerbüchse langen mag.
Wolfram ist kein objektiver Epiker; wir sehen in seinen Werken nicht bloß die Puppen, sondern auch den, der sie lenkt und ihnen Sprache leiht, um uns zu rühren oder zu erheitern; aber er tritt doch nur selten vor, um uns die Dekoration und die Kostüme zu erläutern. Wir schauen, was seine Helden schauen; wir beobachten, wir staunen, wir verwundern uns mit ihnen; wir erraten die Beschaffenheit der Orte aus ihren Reden und Handlungen; und aus Reden und Handlungen zumeist wird uns ihr inneres Wesen bekannt. Indessen merkt man bald, daß der Dichter sich an keine Regel der Darstellung unbedingt bindet, daß er aber mit natürlichem Takte seinen Zweck überall erreicht, daß er – wenigstens in den Jahren seiner vollen Kraft – nie breit und langweilig wird, unsere Aufmerksamkeit immer wach hält und uns alles deutlich macht, was er deutlich machen will.
Wolfram von Eschenbach ist der letzte große Dichter der Weltliteratur, der nicht die Anfangsgründe der literarischen Bildung besaß. Und er ist wohl der einzige, bei welchem dieser Mangel nicht auf dem allgemeinen Bildungsstande seiner Nation beruhte. Aber wie in schriftlosen Zeiten die Volkssänger ihr Gedächtnis auf eine hohe Stufe bringen, so daß sie viele Tausende von Versen mühelos behalten, so nahm Wolfram die vielverzweigten Stoffe, die er behandeln wollte, und alles, was einem Laien, der nur Deutsch und etwas Französisch konnte, aus dem Wissensschatze jener Zeit, aus Poesie, Theologie, Astronomie, Geographie, Naturkunde zugänglich war, – er nahm alles, was ihm liebevolle Beobachtung aus der Breite des Lebens zuführte, was der Ritter in Schlacht und Turnier, der Jäger in Wald und Feld, der Mensch in Haus und Gesellschaft ersah und erlebte, – er nahm alles dies in treuem Gedächtnis auf und bot es seiner regen Phantasie und seinem raschen Witz als reiches, stets bereites und zu überraschenden Kombinationen williges Material des Erfindens und Gestaltens. Anstatt zu lesen und zu schreiben, mußte sich Wolfram vorlesen lassen und diktieren. Daß er keinen Buchstaben kannte, gab ihm eine Kraft, Freiheit, Unabhängigkeit ohnegleichen. Im Lesenlernen liegt stets eine zähmende Gewalt, und der mittelalterliche Mensch pflegte diese Kunst überdies nur aus geistlicher Hand zu empfangen. Wolfram ist nicht dadurch geknickt worden; er hat seine natürliche Wildheit, wenn man es so nennen darf, ungeschmälert behalten; nirgends hängt ihm die Klosterschule an, und seine Seele ward nie durch eine Schnürbrust beengt.
Da Wolfram nach allem greift, was ihm naheliegt, und auf alles anspielt, was ihm gerade bezeichnend vorkommt, so erfahren wir aus seinen Epen mehr von seinen Lebensverhältnissen als etwa von Hartmanns Leben aus dessen Liedern. Seine spezielle Heimat war der bayerische Nordgau. Eschenbach liegt südöstlich von Ansbach. Abenberg, Wassertrüdingen, Nördlingen, Dollnstein, lauter noch heute wohlbekannte Orte, die Wolfram kennt und nennt, liegen in der näheren oder ferneren Umgebung. Auf der Burg Heilstein im Bayerischen Walde hat er Gastfreundschaft genossen und verkündet den Preis der Markgräfin von Vohburg, der Schwester des Herzogs Ludwig von Bayern, welche bis 1204 dort residierte. Wiederholt und lang verweilte er beim Landgrafen Hermann von Thüringen, dessen er in seinen Werken mehrfach gedenkt. Ein Wildenberg aber erwähnt er in einer Weise, daß man dort sein Haus suchen möchte. Da lebte er mit Frau und Kind, nicht in glänzenden Verhältnissen; aber er scherzt ohne Bitterkeit über seine Armut.
In seinen Liedern, deren wir nicht viele besitzen, drückt er einmal Hoffnung, einmal Ungeduld aus. In anderen, verlorenen, hatte er gescholten und seinem Zorn gegen eine Ungetreue Luft gemacht; er bekennt später, daß er zu weit gegangen, obgleich er seine Erbitterung nicht fahren lassen will. Viermal schildert er balladenartig in sogenannten Tageliedern oder Tageweisen den Abschied zweier Liebenden: warnende Treue, auflodernde Leidenschaft in drohender Gefahr, Tränen und Klagen, ergreifende Bilder selbstvergessener Zärtlichkeit, welche durch die Situation zu stärkster Wirkung gebracht wird. Solche Tagelieder waren mit Anlehnung an den Morgengesang des Turmwächters in der Provence erfunden und in Deutschland schon früher nachgeahmt, aber in die etwas konventionelle Form von Scheideduetten gebracht worden. Wolfram schloß sich näher an die provenzalische Form an, behielt die Gestalt des Wächters bei und stattete die Lieder mit einer Glut und Wahrhaftigkeit aus und brachte einen künstlerischen Ernst und Geradsinn hinzu, der ihn als den größten Meister dieser Dichtungsgattung erscheinen läßt. Doch nahm er in einem besonderen Liede Abschied von der Tageweise. Er nahm Abschied von dem Liebesabenteuer, um das Glück der Ehe zu preisen. Leicht vermutet man, daß diese Wendung seines Dichtens mit einer Wendung seines Lebens zusammenhing. Damals mag er sich sein Haus gegründet haben.
Wolfram hat das Weltleben gekannt und geliebt wie Gottfried von Straßburg, aber er ging nicht darin auf, das Weltleben erschien ihm nicht wie der Gipfel aller Seligkeit. Er hatte auch nicht, gleich Hartmann von Aue, eine weltliche und eine geistliche Provinz in seiner Seele, welche miteinander in selten getrübtem Frieden lebten. Er war von der Unzulänglichkeit der weltlichen Bildung überzeugt. Er suchte über dem Irdischen das Ewige. Er war dabei kein Aszet nach dem Herzen der Kirche. Er war ein selbständiger Mensch mit eigenen Überzeugungen, aber eine religiöse Natur. Seine großen Epopöen "Parzival" und "Willehalm" haben beide einen religiösen Hintergrund. Der "Parzival" schöpft aus französischen Gedichten keltischen Ursprunges; der "Willehalm" beruht auf französischer Nationalpoesie. Der "Parzival" bietet märchenhafte Züge, wie sie uns im Artusroman und im "Tristan" begegnet sind; der "Willehalm" trägt den historischen Charakter an der Stirn. Aber beide Gedichte beschäftigen sich mit dem Verhältnisse der Christen zu den Heiden, und der "Parzival" enthält außerdem noch tiefere religiöse Motive von einer ganz eigenen Art.
Der "Parzival" zeigt uns einen Christen und einen Heiden als Brüder. Die Lebensgeschichte von Parzivals Vater führt uns in Zustände ein, wo, wie in Spanien, die Christen und Heiden sich gegenseitig hatten ertragen, ja schätzen und achten gelernt: hervorragende Heiden sprechen Französisch; Rittertum und Frauendienst herrschen im Orient wie im Okzident, und der ritterliche Herrendienst verbindet die Religionen. Gahmuret, ein christlicher Prinz von Anjou, dient dem Kalifen von Bagdad, dem Papste der Heiden, wie Wolfram erläutert. Er wird unter den Sarazenen berühmt. Er verschmäht es nicht, sich mit einer Mohrin namens Belakane zu vermählen, deren edler, reiner Sinn ihm das Christentum zu ersetzen scheint. Doch nimmt er, sehnsüchtig nach Ritterwerk, bald den Unterschied der Religion zum Vorwande der Untreue. Er verläßt sie, erstreitet sich auf einem Turnier in dem Lande Valois die Königin Herzeloide und wird, nicht ohne ein Gefühl des Unrechtes gegen die Heidin, ihr Mann. Aber der Dienst des Kalifen ruft ihn in den Orient, und er fällt im Kampfe. Der Kalif läßt ihm ein prächtiges Grabmal errichten, wobei das Kreuz nicht fehlt. Herzeloidens Sohn ist Parzival; Belakane aber hat einen Sohn von weiß und schwarzer Farbe geboren, der Feirefiß heißt und von welchem Parzival später in einem sehr verhängnisvollen Augenblicke seines Lebens zum ersten Male hört. Mit diesem Bruder trifft er gegen Ende des Gedichts unerkannt in dem schwersten Kampf zusammen, den er je gekämpft. Sein Schwert, das er einst in jugendlicher Unerfahrenheit durch Leichenraub gewonnen, zerspringt wie durch Gottes strafende Fügung gerade jetzt, bei einem Hiebe, den er gegen seinen Bruder führt; und ohne die edelmütige Schonung des Heiden wäre er verloren. Aber da tritt die Erkennung ein, und Feirefiß bewährt eine Treue wie irgendein Christ, obgleich durch Christus die Treue in die Welt gekommen, wie der Dichter sagt. Bloß aus Liebe zu einer Christin läßt Feirefiß sich schließlich taufen und trägt das Christentum nach Indien, das er jedoch nur durch friedliche Mittel verbreitet. Von den Berührungen mit dem Heidentume wird die Geschichte Parzivals gleichsam umrahmt. In ihrem Mittelpunkte aber steht der Gral, um den sich das ganze Schicksal des Helden dreht. Der Gral! Es klingt geheimnisvoll und ist es auch. Ein altes Märchending hat sich in ein geistliches Symbol verwandelt und bleibt doch abseits von allem offiziellen Christentum. "Gral" an sich bedeutet eine weite, sich stufenweise vertiefende Schüssel, in welcher verschiedene Speisen zugleich vorgesetzt werden. Der Gral der Sage ist ursprünglich ein Gefäß, das jederzeit eine volle Mahlzeit spendet, eine Art Tischleindeckdich. Nach einer geistlichen Auffassung soll der Gral beim Abendmahl Christi als Gefäß gedient und dann in ihm Joseph von Arimathäa das Blut des Heilandes aufgefangen haben. Bei Wolfram besteht der Gral aus einem kostbaren Edelstein, der, wie es scheint, gleich dem schwarzen Stein in der Kaaba zu Mekka, vom Himmel gefallen ist. Ihn haben zuerst die Engel bewacht und behütet; dann ward er geistlichen Rittern, den Templeisen, übergeben. Er ist ein Symbol der Erlösung und des ewigen Lebens. In ihm verjüngt sich der Phönix. Wer ihn sieht, kann nicht sterben und bleibt jung. Der Ort, an dem er aufbewahrt wird, heißt der wilde Berg "Munsalväsche" bei Wolfram, ursprünglich vielleicht Mons Salvationis "Berg der Erlösung". In das Gebiet, das ihn umgibt, kann niemand aus eigener Macht eindringen. Niemand kann den Gral suchen und finden. Eine Schrift, die an ihm selbst erscheint, beruft die Menschen, die ihm dienen dürfen. Die Erwählten müssen der weltlichen Minne entsagen, und nur der König darf vermählt sein. Dessen Reich erstreckt sich über die ganze Erde. Die Brüderschaft, der Orden der Erwählten, besteht aus Männern und Frauen, Rittern und Knappen, Priestern und Laien. Sie brauchen nicht für ihren Unterhalt zu sorgen, der Gral spendet Speise und Trank.
So versammelt der Gral eine Gemeinde, unbeschadet der Kirche, aber auch unabhängig von der Kirche. Offenbar schwebt ein Ritterorden vor, und mit dem Namen der Templeisen sind geradezu die Tempelherren bezeichnet. Aber diese waren nicht von solchem Geheimnis umgeben, und ihr Oberhaupt war kein König der Welt. Der Orden des Grales, in die wirkliche Welt hineingedacht, könnte nur als ein Geheimbund existieren, dessen Einfluß die ganze Erde umfaßt und der durch ein wundertätiges Symbol unmittelbare Gesetze vom Himmel selbst empfängt. In diesen Bund der Auserwählten und Begnadigten aufgenommen zu werden, wäre dann freilich das Höchste, was einem Menschen auf Erden zuteil werden könnte; und das Königtum des Grales wäre die Spitze des Höchsten, eine überirdische, paradiesische Seligkeit auf Erden; eine Macht und eine Würde neben dem Papsttum und höher als das Papsttum, zugleich um das Papsttum unbekümmert.
Parzival ist zu dieser Würde bestimmt. Und Parzival wird der Gnade teilhaftig, obgleich er schwere Sündenschuld auf sich geladen hat. Das ist unwissentlich wie beim heiligen Gregorius geschehen. Aber während Gregorius seine Schuld durch ein hartes Büßerleben sühnt und geistliche Mittel dafür in Bewegung gesetzt werden, vollzieht sich die Reinigung Parzivals bloß durch einen Wechsel seiner Gesinnung, ganz innerhalb der weltlichen Sphäre. Ja noch mehr: Hartmann von Aue sagt in der Vorrede seines "Gregorius", es gebe keine Sünde, deren man nicht durch Reue ledig werden könnte; nur der Unglaube, der "Zweifel" sei mit nichts gutzumachen, der führe unbedingt zur Verdammnis. Wolframs Epos dagegen beginnt mit der Behauptung, daß Zweifel allerdings der Seele schade, daß jedoch, wo er einem unverzagten Manne nahe trete, dieser dennoch selig werden könne; Himmel und Hölle hätten an ihm teil, und es liege nur an ihm, den Himmel zu ergreifen. Bloß die Unbeständigkeit, die Charakterlosigkeit führe notwendig zur Verdammnis, wie die Stetigkeit zum Heil. Und Wolfram spricht damit den Grundgedanken seines Gedichtes aus. Er gibt wie Goethe im "Faust" eine weltliche Antwort auf die Frage: wer kann Erlösung finden? Goethe sagt: wer immer strebend sich bemüht. Wolfram sagt: der Stete und der Treue. Es klingt anders und ist doch verwandt: der stete Gedanke an seine Frau und an den Gral, das ausschließliche Streben nach den Idealen des Hauses und der Welt, verbunden mit dem wiedergewonnenen Vertrauen auf Gott, das ist Parzivals "Treue", die ihn zum Heile führt. Parzivals Geschichte erzählt uns die Schuld und Läuterung des Helden. Wir sehen ihn aus Dunkel und Verworrenheit zur höchsten Vollendung vordringen. Seine Mutter will ihn seinem natürlichen Beruf entziehen. Sie läßt ihn im Wald, in der Einsamkeit ohne Kenntnis von ritterlichem Wesen aufwachsen. Aber eine zufällige Begegnung mit Rittern und deren Hinweis auf Artus genügt, um die adelige Natur zum Durchbruch zu bringen. Indem er fortstürmt, bricht er seiner Mutter das Herz, die ihm nachblickend stirbt, sowie er ihren Augen entschwindet. Mit dieser Schuld beladen, aber keck und selbstgewiß, mit Narrenkleidern angetan, die Lehren seiner Mutter allzu wörtlich befolgend, der Welt ein Spott, aber schon gefährlich, so kommt er an König Artus' Hof. Unbekannt mit seiner Familie, unbekannt mit den Gesetzen der ritterlichen Ehre, erschlägt er einen Verwandten und begeht an ihm Leichenraub. Ritter Gurnemanz lehrt ihn erst, was für einen höfischen Mann sich schickt im Frieden und im Streit, und warnt ihn unter anderem vor unnützen Fragen. Er leiht der bedrängten Königin Condwiramurs zu Pelrapeire seinen Schutz und wird ihr Mann. Er zieht von ihr auf Abenteuer fort und will





























