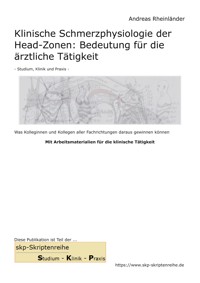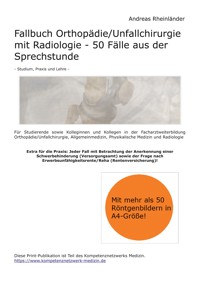Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Prinzipien, Indikationen, Vor- und Nachteile, Grenzen und Möglichkeiten. Wann welche Verfahren anzuwenden sind und wann sie nichts nützen. Für einen effektiven Alltag in Klinik und Praxis. Im klinischen Alltag tauchen zahlreiche Fragestellungen auf, die einer Abklärung bedürfen. Doch manchmal besteht Unsicherheit, welche Diagnostik nun die richtige ist. Ist es die CT oder doch eher die MRT? Szintigraphie oder PET? Was ist wirklich gut in der Sonographie sichtbar? Diese und ganz viele weitere Fragen werden beantwortet. Damit diagnostische Unklarheiten gezielt bearbeitet werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Konventionelles Röntgen
Mammopraphie
Computertomographie (CT)
Magnetresonanztomographie (MRT)
Szintigraphie, SPECT
Positronenemissionstomographie (PET)
Dopamin-Szintigraphien
Endoskopien (Übersicht)
○ Gastroskopie
○ ERCP und MRCP
○ Koloskopie und Rektoskopie
Kardiologische Diagnostik
○ Elektrokardiogramm (EKG)
○ Echokardiographie
○ Koronarangiographie
○ Myokard-Szintigraphie
Elektrophysiologische Untersuchung (EPU)
Angiographie
Arthroskopie
Sonographie
Anhang:
○ Kardiologische Infarktdiagnostik im Diagramm
○ Neurologische Diagnostik im Diagramm
Quellen (Auszug)
Kontaktdaten:
Andreas Rheinländer
Kontakt über:
skp-Skriptenreihe
https://www.skp-skriptenreihe.de
Quelle des Titelbildes: Eigens erstellte Grafik.
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage 01/2025
Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie jedwede Form von Speicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme aller Art.
Haftung
Die medizinische Wissenschaft unterliegt ständigen Veränderungen. Diese werden aus Studien und Grundlagenforschung gewonnen. Dadurch können Informationen schnell an Aktualität verlieren. Für zahlreiche Sachverhalte liegen auch Untersuchungsdaten mit widersprüchlichen Ergebnissen vor. Der Inhalt dieses Buches wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Jede Leserin und jeder Leser ist angehalten alle hier dargebotenen Inhalte selbstständig nachzuprüfen und insbesondere in jedwedem klinischen oder wissenschaftlichen Kontext durch das Hinzuziehen weiterer Quellen zu prüfen. Eine Haftung für die Verwendung der hier dargebotenen Inhalte kann nicht übernommen werden. Aus wissenschaftlicher und berufsrechtlicher Sicht wäre der Verlass auf eine Einzelquelle ohnehin fahrlässig.
Vorwort
Bildgebung bzw. Diagnostik gehört zum Arbeitsalltag so gut wie aller Fachrichtungen. Doch nicht immer ist zweifelsfrei klar, welche Bildgebung bzw. Diagnostik nun für die gewählte Fragestellung die richtige ist.
Soll es eher eine CT oder MRT sein? Was leisten PET und Szintigraphie? Was bringt eine Myokardszintigraphie im Vergleich zu anderer kardialer Bildgebung?
Diese und viele weitere Fragen setzen voraus, dass die darstellbaren anatomischen Strukturen bekannt und damit Grenzen und Möglichkeiten einer Diagnostikmethode bekannt sind. Aus jener Gesamtheit ergibt sich dann die mögliche Indikation für eine Methode.
Die vorliegende Arbeit beantwortet zahlreiche Fragen für die gängigen Bildgebungsund Diagnostikverfahren und soll so Studierenden sowie Ärztinnen und Ärzten aller Fachrichtungen eine Übersicht an die Hand geben, um besser durch den diagnostischen Alltag manövrieren zu können.
Röntgen (konventionelle Radiographie)
Die konventionelle Radiographie - klinisch als "Röntgen" bezeichnet - ist das älteste technische Bildgebungsverfahren, abgesehen von der direkten Endoskopie. Es gehört zu den am häufigsten im klinischen Alltag eingesetzten Verfahren und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.
Es wird unterschieden zwischen konventioneller und digitaler Radiographie.
Die im folgenden gemachten Aussagen zu Indikationen bezieht sich weitestgehend auf Erwachsene im deutschsprachigen Raum. Röntgenaufnahmen bei Kindern stellen eine Besonderheit dar und werden hier nicht weiter behandelt.
Vorteile, Nachteile
Der größte Vorteil der Röntgenaufnahme (jedoch nicht der „Durchleuchtung“, siehe unten) ist die schnelle Durchführbarkeit. Sie benötigt unter einer Sekunde, bei moderater Strahlenexposition.
Der größte Nachteil ist jedoch die Notwendigkeit einer korrekten Interpretation. Im klinischen Alltag sind die Arbeitskapazitäten der Radiologie begrenzt, sodass die in immer schnellerer Folge durchgeführten Röntgenaufnahmen oft einen "Befundstau" aufweisen: Die durchschnittliche Befunddauer inklusive Diktat, durch erfahrene Radiolog(inn)en, liegt bei unter 2 Minuten. Bei schwierigen Befunden kann diese allerdings auch deutlich länger dauern.
Da die Durchführung der Aufnahme an sich allerdings kaum mehr als einige Sekunden dauert, können meist deutlich mehr Aufnahmen angefertigt werden, als Befunder(innen) zur Verfügung stehen.
Gegenüber der Sonographie und der Magnetresonanztomographie liegt der Nachteil in der Strahlenexposition.
Die Indikation sollte daher - trotz Niedrigdosisröntgengeräten, die Standard sind - mit Bedacht gestellt werden.
Grenzen und Möglichkeiten
Die Aussagekraft eines Röntgenbildes hängt zunächst maßgeblich von seiner korrekten Befundung ab. Das Befunden von Röntgenbildern benötigt Erfahrung. Je älter ein diagnostisches Verfahren ist, desto unspezifischer ist es und desto mehr Daten werden durch die Bilder erhoben, die in der Befundung dann eine Rolle spielen.
So erlaubt beispielsweise die Thorax-Röntgenaufnahme eine Vielzahl von Aussagen über den Zustand der Lunge und indirekt des Herzens, des Zwerchfells, der Aorta, der Schilddrüse und der angrenzenden Strukturen. Allerdings sind diese nur in Verbindung mit dem klinischen Erscheinungsbild verwertbar.
Die Befundung von Thorax-Röntgenaufnahmen gehört zu den schwierigsten Disziplinen in der Radiologie, was mehrerlei Gründe hat:
○ ein komplexes dreidimensionales Bild wird auf zwei Dimensionen reduziert
○ Strukturen sind nicht maßstabsgetreu (!) überlagert
○ eine Vielzahl anatomischer Variationen und Normabweichungen ohne pathologischen Wert können fälschlicherweise als pathologisch gewertet werden
Typische Indikationen
Es gibt eine Reihe von typischen Indikationen für die Anfertigung von Röntgenaufnahmen. Dabei ist hervorzuheben, dass die sogenannte rechtfertigende Indikation durch die Radiologie wird und nicht durch die Person, welche die Untersuchung veranlasst hat!
Zu den typischen Indikationen zählen:
○ Lungenerkrankungen
○ Fremdkörperverdacht bzw. Lagebeurteilung vorhandener Fremdkörper
○ Frakturen bzw. V.a. Fraktur
○ Arthrosen
Prinzip
Die zu untersuchenden Bereiche werden mit Röntgenstrahlung bestrahlt, die den Körper durchdringen. Auf der Rückseite wird die nicht absorbierte Strahlung registriert und in ein Bild umgewandelt. Dieses zeigt die im Strahlengang liegenden Gewebe in der Projektion. Als Sensor stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. Bei der herkömmlichen Radiographie (konventionelles Röntgen) wird Filmmaterial verwendet, das sich bei Strahleneinfall schwarz färbt und anschließend chemisch bearbeitet werden muss. Die halbtransparenten Abzüge werden dann auf einem Leuchtkasten betrachtet ("Röntgenbild aufhängen").
Erweiterte Anwendung
Bereits in den 60er Jahren kam die Idee auf, die Aussagekraft von Röntgenbildern zu verbessern. Die Röntgentomographie (konventionelle Schichtaufnahme) wurde entwickelt. Dabei werden während der Belichtung Röntgenfilm und Strahlenquelle gegenläufig bewegt und es entsteht eine scharfe Abbildung der Strukturen in der Fokusebene. Strukturen außerhalb des Fokus verwischen allerdings. Die Bewegung des Apparates, der die Aufnahmen anfertigte, war programmierbar.
Die konventionelle Schichtaufnahme ist der Vorläufer der Computertomographie und schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Gebrauch.
Bei der Computertomographie berechnet ein Computersystem die Schnittbilder hingegen aus digitalen Daten, die mit Hilfe von Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Richtungen erzeugt werden.
Fluoroskopie
Die Fluoroskopie, klinisch als "Durchleuchtung" bezeichnet, ist ein Verfahren der Bewegtbilddarstellung mit Hilfe von Röntgenaufnahmen. Das ermöglicht die dynamische Darstellung in Form von Röntgenbildern auf einem Monitor - entweder mittels Röntgenbildverstärkertechnik oder bei neueren Geräten mittels digitalem Flachdetektor. Zur Darstellung der zu untersuchenden Strukturen wird Kontrastmittel verwendet.
Die Bestrahlung ist dabei jedoch nicht kontinuierlich. Es werden jeweils in kurzer Folge mit Hilfe von gepulster Abgabe von Röntgenstrahlen kurze Sequenzen erstellt, die für das Therapieverfahren bereits ausreichend sind, um die zu untersuchenden Strukturen beurteilen zu können. Auf Grund der Anwendung von Röntgenbildverstärkern und der kurzen Pulse ist die Strahlenexposition bei kurzen Untersuchungen meist nur unerheblich erhöht gegenüber einer regulären Röntgenaufnahme oder gar einem Computertomogramm (CT-Aufnahme).
Die Durchleuchtung findet in den verschiedensten Gebieten der Medizin Anwendung, zu denen die folgenden zählen:
○ intraoperativ zur Beurteilung von Knochenstrukturen bei Einsatz von Platten, Schrauben und Nägeln
○ Darstellung von Gefäßen, Gallengängen und Abschnitten des Magen-Darm-Traktes
○ Platzierung von Sonden
○ Herzbewegung (Ventrikulographie) und Zustand der Herzkranzgefäße (Koronarangiographie)
○ Schluckbewegung (Ösophagusdarstellung)
○ Beurteilung von Fisteln
Weiterentwicklung
Das klassische Röntgen mit Folien hat ausgedient und ist vom digitalen Röntgen ersetzt worden. Dabei wird der Detektor digital ausgelesen. Im einfachsten Falle wird die Leuchtstoffplatte nach der Aufnahme eingescannt.
In modernen Geräten werden CCD-Bauteile (charge-coupled device, empfindliche Photodioden), die auch in Digitalkameras und anderen Geräten Verwendung finden, eingesetzt.
Die digital eingelesenen Bilder können anschließend in ein DICOM-System übertragen werden, um Bilder und Befunde in einem Netzwerk speichern und verarbeiten zu können.
Kontrastmittel
Der Einsatz von Kontrastmitteln kann die Darstellbarkeit von Strukturen erheblich verbessern. Als solche eignen sich unlösliche Bariumsalze als Aufschwemmung, Jodverbindungen, Luft oder Kohlendioxid. Bariumverbindungen werden vor allem für den Verdauungstrakt verwendet. Lösliche Jodverbindungen und Kohlendioxid eignen sich für die Injektion in Gefäße, Luft kann rektal zur Dickdarmdarstellung appliziert werden.
Beteiligte Strukturen
In der nativen Röntgenaufnahme sind vor allem mineralreiche Strukturen gut zu erkennen, während Weichgewebe nahezu nicht abgebildet werden.
Zu den mineralreichen Strukturen zählen:
○ Knochen
○ Steinbildungen (z.B. Gallenblasensteine, Nierensteine)
○ Kalzifizierungen (z.B. Nephrokalzinose, Porzellangallenblase)
Weichgewebe aller Art werden hingegen nur angedeutet, Luft sticht als Aussparung im Röntgenbild hervor.
Terminologie
Im klinischen Sprachgebrauch werden auf Röntgenbildern (nicht in der Durchleuchtung) helle Stellen als Verschattung und dunkle Stellen als Aufhellung bezeichnet. Das mag zunächst paradox erscheinen, ist aber historisch begründet:
Ursprünglich wurden Fluoreszenzschirme eingesetzt und erst später Röntgenschirme. Auf ersteren werden strahlentransparente Bereiche (z.B. Lungengewebe) hell, strahlendichte (z.B. Knochen) dunkel abgebildet.
Das bedeutet: Knochen nimmt mehr Strahlung auf, sodass weniger ausgesandte Strahlung vom Detektor aufgenommen wird. Der Knochen erscheint daher dunkler. Röntgenbilder stellen dementsprechend ein Negativ einer Fluoreszenzschirm-Aufnahme dar. In der Fluoroskopie sind diese Farbverhältnisse normalerweise noch erhalten. Deshalb sind dort Knochen dunkel und Weichgewebe hell.
Die ursprünglichen Begriffe hatten sich in der klinischen Umgangssprache bereits so eingebürgert, dass sie bis heute beibehalten wurden.
Verschattung und Aufhellung werden für pathologische Veränderungen verwendet bzw. für Areale, die den Verdacht auf eine solche Veränderung begründen. Es handelt sich um relative Angaben, da sie eine Veränderung gegenüber dem Normalbefund bzw. einem Vorbefund darstellen.
Sie sind deshalb in deskriptiven Normalbefunden nicht zu verwenden.
Typische Aufnahmen
Im klinischen Alltag werden eine Reihe von Röntgenaufnahme sehr häufig angefertigt. Über die genauen Zahlen gibt es keine Statistik, jedoch zeigt die klinische Erfahrung, welche Art von Bildern regelmäßig und in großer Zahl angefordert werden. Alle Aufnahmen sind standardisiert und müssen bestimmten Anforderungen entsprechen. Dazu zählen neben grundsätzlichen technischen Aspekten (Beschriftung, Ausrichtung des Bildes, Beleuchtung) auch eine korrekte Fokussierung und Einstellung auf die Zielstruktur.
Historisch bedingt gibt es über 100 verschiedene Arten von Röntgenaufnahmen, von denen allerdings nur noch etwas die Hälfte klinische Bedeutung hat.
In einigen Bereichen wurden Röntgenaufnahmen vollständig durch
Computertomographie und Magnetresonanztomographie ersetzt.
Neben typischen Aufnahmen bzw. Aufnahmemodalitäten existieren eine Vielzahl an Spezialaufnahmen in den einzelnen Fachrichtungen – vor allem in der Orthopädie.
Thorax-Übersichtsaufnahme
Sie gehört zu den am häufigsten angefertigten Aufnahmen überhaupt. Dabei wird der Thorax in 2 Ebenen betrachtet: von ventral und seitlich. Dabei sind alle Strukturen überlagert, sodass Größenverhältnisse nicht real abgebildet werden.
Abhängig vom Strahlengang (anterior-posterior oder posterior-anterior) werden die entsprechenden Strukturen mehr oder weniger in den Vordergrund gerückt.
In der Thorax-Übersichtsaufnahme sind Herz, Lungen, Rippen und Zwerchfell beurteilbar. Zudem können im begrenzten Ausmaß die Wirbelkörper, der Ösophagus und die Aorta eingesehen werden. Das Schultergelenk ist ebenfalls erkennbar, allerdings nur von ventral. Das gilt jedoch nur für Aufnahmen im Stand.
Aufnahmen im Liegen, auch als "Bettaufnahme" bezeichnet, müssen vorsichtiger beurteilt werden, da Veränderungen hier rein durch die Lage bedingt sein können - abhängig davon, ob und inwieweit die Patientin/der Patient überhaupt noch mobilisierbar ist. Bettaufnahmen werden häufig zur Verlaufskontrolle bei schwer erkrankten Patienten angefertigt, wobei hier signifikante Veränderungen im Vordergrund stehen. Kleinere Bildveränderungen müssen ggf. ignoriert werden, da zumeist die Aufnahmen immer in einer anderen Position angefertigt wurden - je nachdem, wie das Personal in der Lage war, den Detektor unter der Person zu positionieren.
Abdomen-Übersichtsaufnahme, Beckenübersichtsaufnahme
Die Übersichtsaufnahme des Abdomens erlaubt die Darstellung der Darmstrukturen. Da diese nicht röntgendicht sind, ist ihre Darstellung immer etwas unscharf und nur sehr undeutlich erkennbar. In der Beckenübersichtsaufnahme steht zumeist das Einsehen des knöchernen Beckenrings im Vordergrund.
Im Falle eines Polytrauma wird allerdings eher eine CT durchgeführt.
Gelenkaufnahmen
Sie sind das Mittel der Wahl in der Orthopädie und Unfallchirurgie und erlauben eine sehr gute Darstellung der Knochen.
Trotz Computertomographie und Magnetresonanztomographie ist die Röntgenaufnahme der Gelenke und Knochen in keiner Weise obsolet geworden. In der Röntgendarstellung lassen sich feinste Veränderungen erkennen, die Lage von Operationsmaterial kann vor, während und nach dem Eingriff kontrolliert und der Heilungsprozess in seinem Verlauf beurteilt werden.
Im Bereich der Gelenkaufnahmen gibt es den Begriff "Übersichtsaufnahme" nicht. Eine jede Gelenkaufnahme stellt das Gelenk üblicherweise in 2 Ebenen (manchmal 3) dar und erlaubt es vollständig zu beurteilen. Es gibt allerdings eine Reihe von Gelenkaufnahmen, bei denen das Gelenk in einer bestimmten Position verharrt, die meist Druck oder Zug auf Bandstrukturen ausüben (soegannte Stressaufnahmen).
"Knochenaufnahmen", auf denen nur Knochen ohne Gelenk zu sehen sind, gibt es nicht. Eine jede Knochenaufnahme beinhaltet immer mindestens den Anschnitt eines Gelenkes, da das Verhältnis des Knochens zum Gelenk praktisch immer von Bedeutung ist.
Die Beurteilung orthopädischer Röntgenbilder und ihre klinische Einordnung bedarf der Übung.
Eine Möglichkeit, Übung zu erlangen, ist die Verwendung eines Fallbuches, wie beispielsweise dem Fallbuch Orthopädie/Unfallchirurgie mit 50 Fällen aus der Praxis und zahlreichen Röntgenbildern.
Informationen und Bezugsquellen unter https://www.fallbuch-orthopädie.de.
Mammographie
Die Darstellung der weiblichen Brust wurde ursprünglich mit dem konventionellen Röntgen vorgenommen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich jedoch eine eigenständige, leicht abgeänderte Aufnahmetechnik.
Die Mammographie dient nahezu ausschließlich der Beurteilung von (möglichen) malignen Erkrankungen der weiblichen Brustdrüse. Wenngleich Brustkrebs auch bei Männern vorkommt (etwa 1000-fach seltener) gibt es keine spezielle
Aufnahmetechnik für Männer. Das Gewebe ist bei den meisten Männern wesentlich dichter und Veränderungen heben sich schlechter von der gesunden Umgebung ab. Daher ist die Mammographie beim Mann oft wenig aussagekräftig.
Für die Durchführung der Mammographie sind spezielle Röntgen-Apparate erforderlich. Zudem werden speziell für die Mammographie zertifizierte Monitore verlangt. Bei besonders dichtem Drüsengewebe, was z.T. nicht mehr hinreichend beurteilbar ist, steht als Ausweichmöglichkeit die Mamma-MRT zur Verfügung.
Mehr zur Mammographie im nächsten Kapitel.
Schädel und Nasennebenhöhlen
Die Röntgendarstellung von Schädel und Nasennebenhöhlen ist obsolet. Sie wird allerdings gehäuft noch immer durchgeführt, obwohl sie explizit aus den entsprechenden Leitlinien gestrichen worden sind. Die Durchführung einer Röntgenaufnahme des Schädels oder der Nasennebenhöhlen stellt daher - bis auf einzelne wenige Spezialfragestellungen - einen ärztlichen Kunstfehler dar. Schädel und Nasennebenhöhlen werden in der CT oder ersatzweise der MRT dargestellt.
Mammographie
Die Mammographie ist ein radiographisches Verfahren zur Untersuchung der Brustdrüse bei Verdacht auf maligne Raumforderungen. Dabei werden sowohl die weibliche, als auch die männliche Brust untersucht.
Weil das Mammakarzinom zu den drei häufigsten Krebserkrankungen der Frau gehört, wird die Mammographie als Screeninguntersuchung bei Frauen zwischen 50 und 69 durchgeführt (Gesetzeslage in Deutschland). Der Nutzen im Vergleich mit den möglichen Risiken bzw. Kosten unterliegt einer konstanten kritischen Debatte.
Vorteile, Nachteile
Vorteile:
○ sehr breite Verfügbarkeit
○ einfache und schnelle Durchführung
○ geringe Strahlenexposition