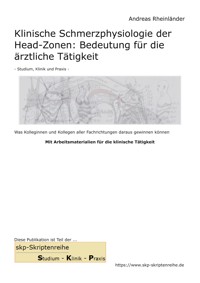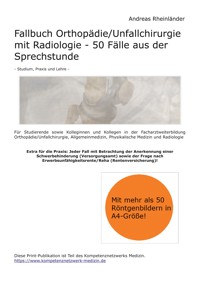
Fallbuch Orthopädie/Unfallchirurgie mit Radiologie - 50 Fälle aus der Sprechstunde E-Book
Andreas Rheinländer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Fallbuch vermittelt die Praxis der Orthopädie/Unfallchirurgie anhand realer Fälle, statt frisierter "Lehrbuchfälle". Dabei werden Anamnese und konkreter Befund sowie das Prozedere beschrieben, ergänzt um Differentialdiagnostik sowie Differentialtherapie. Einmalig für ein Fallbuch ist dabei die Beurteilung jedes Falles in Bezug auf den Befundbericht bei Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung (Versorgungsamt) bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente/Reha (Rentenversicherung). Probekapitel unter https://www.fallbuch-orthopädie.de.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wie dieses Buch zu verwenden ist und wem es nützt
Fälle
Liste der Falldiagnosen
Abkürzungen, Hinweis zur Geschlechtsangabe
Kontaktdaten:
Andreas Rheinländer Kontakt über https://www.fallbuch-orthopädie.de
Kompetenznetzwerk Medizin https://www.kompetenznetzwerk-medizin.de
Quelle des Titelbildes: Eigens erstellte Grafik.
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage 01/2025
Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie jedwede Form von Speicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme aller Art.
Haftung
Die medizinische Wissenschaft unterliegt ständigen Veränderungen. Diese werden aus Studien und Grundlagenforschung gewonnen. Dadurch können Informationen schnell an Aktualität verlieren. Für zahlreiche Sachverhalte liegen auch Untersuchungsdaten mit widersprüchlichen Ergebnissen vor. Der Inhalt dieses Buches wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Jede Leserin und jeder Leser ist angehalten alle hier dargebotenen Inhalte selbstständig nachzuprüfen und insbesondere in jedwedem klinischen oder wissenschaftlichen Kontext durch das Hinzuziehen weiterer Quellen zu prüfen. Eine Haftung für die Verwendung der hier dargebotenen Inhalte kann nicht übernommen werden. Aus wissenschaftlicher und berufsrechtlicher Sicht wäre der Verlass auf eine Einzelquelle ohnehin fahrlässig.
Vorwort
Orthopädisch-unfallchirurgische Fälle sind Alltag in mehreren medizinischen Fachrichtungen.
Im Studium sowie in der Facharztweiterbildung besteht manchmal kaum die Möglichkeit solche Fälle zu üben und diese kommentiert zu bekommen.
Diesem Zweck dienen Fallbücher.
Von diesen gibt es mittlerweile einige, die jedoch alle eines gemeinsam haben: Zwar gibt es einen (meist sehr künstlich konstruierten) konkreten Fall, als Besprechung folgen jedoch lehrbuchartige Ausführungen zur Erkrankung.
Dies hat in bestimmten Lernsituationen seine Berechtigung. Für die Praxis ist es jedoch nicht geeignet.
Dieses Übungsbuch geht daher einen anderen Weg:
Dargestellt werden reale Fälle aus der Sprechstunde, für die es genau ein Prozedere gab. Denn das ist letztlich die Realität: Der Arzt oder Ärztin in der Sprechstunde muss eine konkrete Entscheidung treffen, wie es nun genau weitergeht.
In der Fallbesprechung wird daher das konkret gewählte Prozedere diskutiert – warum so, aber auch, warum nicht anders und welche anderen Möglichkeiten es gegeben hätte.
Bei orthopädisch-unfallchirurgischen Fällen gibt es oft mehrere Pfade, die zum gleichen Ergebnis (dem Behandlungserfolg) führen, aber am Ende muss der Arzt oder die Ärztin sich für einen Weg entscheiden.
Besprochen wird also, was passierte und nicht, was passieren könnte.
Eben so, wie es in der klinischen Realität der Fall ist.
Um der Realität gerecht zu werden sind die Fälle nicht „vorsortiert“, in dem Sinne, dass jedes Krankheitsbild einmal vorhanden ist oder die Krankheitsbilder so oft vorkommen, wie es ihrer Prävalenz entspricht. Denn auch das entspricht nicht der Realität.
Des Weiteren sind es gerade keine „perfekten“ Lehrbuchfälle: Es sind reale Fälle – mit Problemen, problematischen Anamnesen oder auch offenen Fragen, die erst später geklärt werden können oder müssen oder manchmal nicht geklärt werden.
Anders als in Lehrbuchfällen gibt es viele Faktoren, die in der Realität das weitere Prozedere bestimmen: Ablehnung bestimmter Therapien, soziale Faktoren, finanzielle Einschränkungen und so weiter.
Zudem sind die Fälle nicht „perfekt abgeschlossen“. Manchmal kommen Patient(inn)en gar nicht zur Wiedervorstellung oder es ergeben sich andere Gründe, aus denen eine Diagnostik oder Therapie nicht fortgeführt wird.
Die Fallschilderungen stellen also eine Momentaufnahme dar und keinen unbedingt „fertigen“ Fall wie aus einer abgeschlossenen Akte. Manche Fälle sind auch eben nie „fertig.“
All das ist die Realität und dieses Fallbuch bildet sie ab, um Kolleginnen und Kollegen auf den Alltag vorzubereiten bzw. sie in diesem fachlich zu begleiten.
Berlin, Winter 2024
Andreas Rheinländer
Wie dieses Buch zu verwenden ist und wem es nützt
Zielgruppe sind praxisorientierte Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen in der Facharztweiterbildung Orthopädie/Unfallchirurgie, Allgemeinmedizin, Physikalische und Rehabilitative Medizin (ehemals Facharzt/ärztin für Physiotherapie) und Radiologie.
Die ersten drei Fachrichtungen kommen mit Fragestellungen wie hier im Buch immer wieder in Kontakt. Manchmal gehen die Patient(inn)en selbst in die entsprechenden Praxen oder sie werden überwiesen.
Ob das fachlich immer sinnvoll ist, sei dahingestellt.
Konfrontiert werden die drei Fachgebiete mit solchen Krankheitsbildern jedenfalls immer wieder.
Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung Radiologie können dieses Buch nutzen um mehr darüber zu erfahren, welche Konsequenz ihre Diagnosen haben.
Ein sehr hoher Anteil der Fälle wurde röntgenologisch geklärt bzw. es wurde Ausschlussdiagnostik betrieben – denn das Röntgen ist schnell und breit verfügbar.
Dieses Buch liegt im Großformat vor, sodass die Bilder gut erkennbar sind. Mitunter sind besonders relevante Stellen noch einmal hervorgehoben auf einer Extra-Seite.
Jeder Fall folgt einem einheitlichen Schema.
Anamnese, dann Untersuchung, dann ggf. Bildgebung mit Befund. Außerdem die verschlüsselte Diagnose, d.h. jene, die in der Akte eingetragen und für die Abrechnung relevant ist.
Anschließend folgt das weitere Prozedere.
Zudem werden differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen besprochen – alle am ganz konkreten Einzelfall und nicht „allgemein“ am Krankheitsbild orientiert.
Des Weiteren bietet dieses Buch eine Besonderheit: Die Einordnung des Falles in den sozialversicherungsrechtlichen Kontext - insbesondere bezüglich der Anerkennung einer Schwerbehinderung sowie im Rahmen eines Reha- oder Rentenbegehrens. Daher ist dieser Betrachtung ein eigener Abschnitt bei jedem einzelnen Fall gewidmet.
Sofern bekannt, werden auch Informationen zum weiteren Fallverlauf am Ende dargeboten.
Fall 1
Anamnese:
61-jährige Patientin. Terminsprechstunde. Erstvorstellung.
Seit fast 10 Jahren immer wieder Probleme mit den Fingern: Hin und wieder Schmerzen, vor allem bei Belastung, selten in Ruhe.
Nun verstärken sich diese Probleme jedoch seit rund einem Jahr.
Die Patientin erzählt von sich aus, dass die Mutter bereits in relativ „jungen Jahren“ (laut Patientin um Ende 40 herum) eine ausgeprägte Polyarthrose mit deutlichen Verformungen der Finger hatte.
Auch die Füße bereiten der Patientin seit einigen Jahren Schmerzen.
Zudem berichtet sie, dass sie sich sicher sei, es handele sich nicht um eine Psoriasis-Arthritis. Sie hätte über das Thema in einer Zeitschrift gelesen und ließ es von einem Dermatologen und einem Rheumatologen abklären. Es liegen mehrere serologische Befunde vor, die einen solchen Ausschluss untermauern.
Die Patientin ist kardiovaskulär deutlich vorbelastet (periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), koronare Herzerkrankung (KHK)).
Untersuchung:
Bei vollständiger Entkleidung keine Hautläsionen.
Hände beidseits:
Die Finger sind deutlich deformiert, aufgrund der Deformation ist die Kraft der Hände eingeschränkt. Ein muskuläres Problem lässt sich nicht feststellen.
Wegen der Defomierung und der damit einhergehenden gestörten Beweglichkeit ist die Feinmotorik eingeschränkt.
Anzeichen für eine zerebelläre Ursache liegen nicht vor.
Röntgen beider Hände in einer Ebene:
Röntgenbefund:
Schwere Rhizarthrose bds., Polyarthrose DIP/PIP mit Destruktionen, insbesondere am 2. Strahl
Verschlüsselte Diagnose:
Rhizarthrose bds., Fingerpolyarthrose
Prozedere:
Röntgenschmerzbestrahlung für die Hände, Novamin bei Bedarf (bei Kontraindikation für NSAR und Coxibe), Wiedervorstellung nach RTT.
Anmerkungen:
Für das Alter von 61 Jahren liegt eine ungewöhnlich stark ausgeprägte Arthrose vor.
Derartige Befunde wie hier sind zwar nicht selten, aber zumeist in höherem Alter zu finden.
Warum bei manchen Menschen bereits im frühen Alter starke Arthrosen auftreten und bei anderen nicht – bei vergleichbaren Lebensläufen – ist bis heute nicht abschließend geklärt.
Differentialdiagnostik:
Das Röntgenbild ist eindeutig.
Differentialtherapie:
Physiotherapie und Osteopathie sind eher wenig erfolgversprechend. Sie werden recht schmerzhaft sein, da die Gelenke mechanisch bedingt praktisch keine Beweglichkeit mehr aufweisen.
Mögliche Ausnahme bilden Physiotherapeut(inn)en, die einen klaren Fokus bzw. eine Spezialisierung auf Handarthrosen haben – von diesen gibt es aber nicht allzu viele. Das mögliche Ausmaß an Verbesserung der Beschwerden ist dennoch überschaubar.
Wärmeanwendung mit Ultraschall oder Reizstrom in der Physiotherapie kann flankierend angewendet werden.
Die kontinuierliche Bewegung und Benutzung der Finger mit bedarfsweiser Analgesie, zum Erhalt der Restbeweglichkeit, steht im Vordergrund.
Bei Versagen der konservativen Maßnahmen ist, zumindest für die Rhizarthrose, eine TEP (totale Endoprothese) denkbar. Diese werden von wenigen spezialisierten Orthopäd(inn)en oder Handchirurg(inn)en implantiert – geben aber einen erheblichen Gewinn an Beweglichkeit zurück.
Insbesondere unter Berücksichtigung des orthopädisch jungen Alters der Patientin ist hier ein großer Zugewinn an Lebensqualität möglich.
Dazu wird postoperativ allerdings eine intensive ergotherapeutische Beübung erforderlich sein, da sich aufgrund der Fehlstellung in allen Gelenken bereits eine gestörte neuronale Ansteuerung der Fingermotorik begonnen hat zu etablieren. Ein TEP-Einsatz ohne entsprechende Ergotherapie ist nicht allzu sinnvoll.
Funktionsbetrachtung:
Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung:
Im Rahmen eines Antrags auf Anerkennung eines Schwerbehinderungsgrades muss auf die deutliche feinmotorische Funktionseinschränkung gesondert hingewiesen werden, da sich diese nicht aus der Diagnose oder den Bildern unmittelbar ergibt!
Hier muss im Rahmen des Antrages frei formuliert werden, wie groß die Alltags- und Lebenseinschränkung ist.
Da unsere Hände Bindeglied zum sozialen und zum Arbeitsleben sind, ist diese Beeinträchtigung hochgradig antragsrelevant.
Die Patientin kann die Finger nur noch mit eingeschränkter Kraft nutzen und die Feinmotorik ist gestört.
Die Einordnung in einen relevanten Grad der Behinderung ist hier wahrscheinlich.
Reha/Rente:
Der vorliegende Befund macht die Indikation für eine Reha-Maßnahme wahrscheinlich.
Die Erfolgsaussicht für eine Verbesserung ist jedoch fraglich, da die Deformationen beträchtlich ist.
Nach dem Grundsatz Reha vor Rente wäre hier der Versuch jedoch in jedem Falle gerechtfertigt.
Denkbar ist eine Ablehnung bei bisher fehlendem Nachweis bisheriger ambulanter Maßnahmen. Hier wäre zu begründen, dass für den weiteren Erfolg und die Verhinderung der Erwerbsunfähigkeit die Frequenz der Behandlungen ambulant nicht gewährleistet werden kann.
Bei ausbleibendem Erfolg wäre eine Erwerbsminderungsrente denkbar, ist jedoch weder grundsätzlich, noch in diesem konkreten Fall, im Sinne der Patientin. Sie würde zu noch weniger Bewegung und Benutzung der Hände führen und die Beschwerden langfristig nur verstärken.
Entscheidend ist der Erhalt der Funktionsfähigkeit durch konsequente Aktivierung und (mäßige) Beanspruchung.
Hinweis:
Im Falle einer erfolgreichen TEP-Einlage mit Wiederherstellung und deutlicher Verbesserung der Handbeweglichkeit würde der Gewährungsgrund für einen Grad der Behinderung wegfallen.
Eine Reha-Maßnahme indessen würde postoperativ in Frage kommen (Anschlussheilbehandlung), läuft dann aber über die operierende Klinik.
Verlauf:
Über den weiteren Verlauf liegen zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Maniskriptes keine weiteren Angaben vor, da der Wiedervorstellungstermin weiter in der Zukunft liegt und aus organisatorischen Gründen verschoben wurde.
Fall 2
Anamnese:
81-jährige Patientin. Akutsprechstunde. Erstvorstellung.
Schmerzen und Schwellung am linken „Knöchel“ seit circa 1 Monat. Die Patientin erzählt, dass solche Schwellungen jedoch auch vorher immer mal wieder auftraten. Nun sei aber diese „neue“ Schwellung noch dazugekommen.
Ein Trauma ist nicht erinnerlich.
Außerdem Schmerzen lateral des OSG, in Richtung Achillessehne.
Bekannte Osteoporose, die von einem anderen Orthopäden (Name fällt der Patientin nicht ein), überwacht wird.
Auf gezielte Nachfrage gibt die Patientin an, dass die Schwellungen sich zum Abend hin häufen und morgens zurückgehen, außerdem Dyspnoe (Luftnot) nach 2 Etagen.
Es liegen keine bekannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, jedoch ist die Patientin vom Hausarzt, trotz der bekannten Probleme seit Jahren, bisher nie (!) zum Kardiologen oder Angiologen geschickt worden.
Untersuchung:
Unterschenkel bds.: Bds. geschwollene Unterschenkel, links deutlicher als rechts. Unterschenkel und Sprunggelenk bds. ödematös.
Linksseitig ausgeprägte Corona phlebectatica1. Bds. ausgeprägte Stammvarikosis.
Druckschmerz am OSG lateral, Vor- und Mittelfußbereich frei. ROM (range of motion) frei, aber schmerzhaft.
Röntgen vom OSG links in 2 Ebenen:
Röntgenbefund:
Nicht dislozierte Abrissfraktur der Fibulaspitze, Weber A-Fraktur; nebenbefundlich prominenter Fersensporn
Verschlüsselte Diagnose:
Weber A-Fraktur; V.a. Herzinsuffizienz; Phlebektasie; Varikosis; Osteoporose; Fersensporn
Prozedere:
Die nicht dislozierte Weber A-Fraktur wird wie eine OSG-Distorsion behandelt.
Die Patientin erhält:
- Sprunggelenk-Orthese zur Stabilisierung in einer Ebene für 4 Wochen
- Schonung ohne Ruhigstellung
- Wiedervorstellungs-Termin mit Röntgen-Kontrolle, bei Veränderung der Beschwerden früher
- keine Analgesie, da nicht gewünscht
- eine Überweisung zum Hausarzt mit Bitte um Überweisung zur Kardiologie mit Basisdiagnostik (Echokardiographie, Langzeit-EKG, Stress-Echokardiographie) sowie zur Angiologie mit Bitte um farbkodierte Duplex-Sonographie der Venen der unteren Extremität bds.
Anmerkungen:
a)
Die Patientin hat mehrere „Baustellen“. Aufgrund der kardiovaskulären Anamnese könnte die Versuchung bestehen, von einer Exazerbation eines solchen Problems auszugehen.
Dass ein Trauma nicht erinnerlich ist, verstärkt diesen Eindruck – ist aber unerheblich. Oft erinnern sich die Leute an solche kleinen Ereignisse Wochen zuvor nicht.
Patient(inn)en mit Schwellungen im OSG-Bereich und gleichzeitig, manchmal bisher undiagnostizierter, Herz- und/oder Venenerkrankung sind gar nicht so selten.
Letztlich sollten die internistischen Fragestellungen in so einem Moment zunächst ignoriert werden, damit der Frakturverdacht nicht allein aus diesem Grunde verworfen wird.
Kann der Verdacht auf eine Fraktur erhärtet oder verworfen werden, ist das weitere Internistische separat zu klären.
b)
Dass die Patientin mit ihrer Dyspnoe nach 2 Etagen und ständigen Schwellungen im Unterschenkel-Bereich nie kardiologisch oder angiologisch abgeklärt wurde ist medizinisch nicht nachvollziehbar, kommt aber vor.